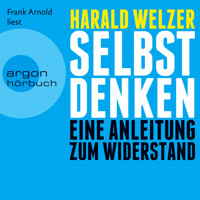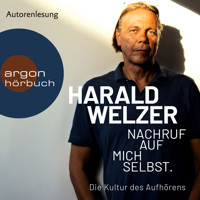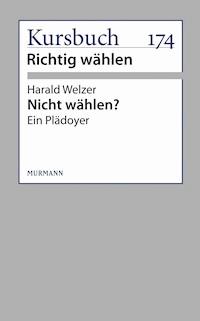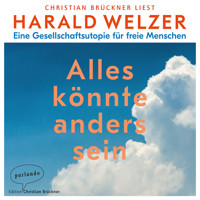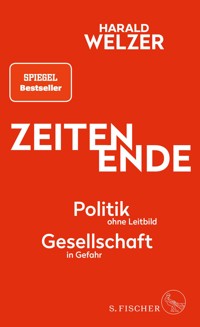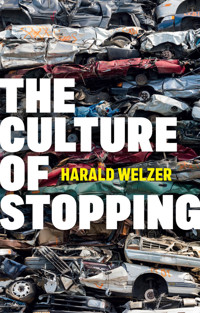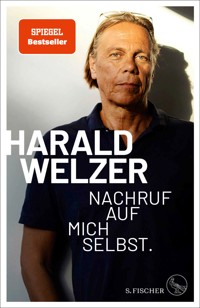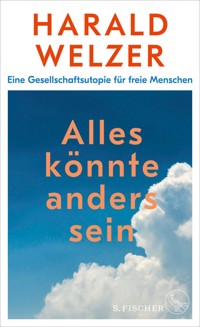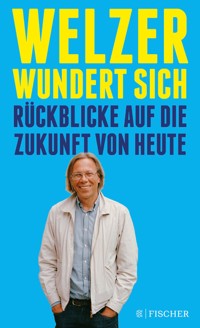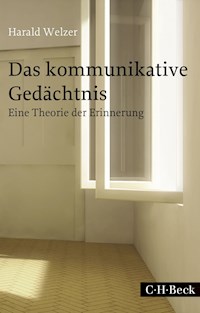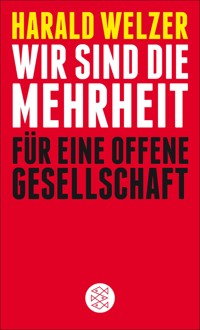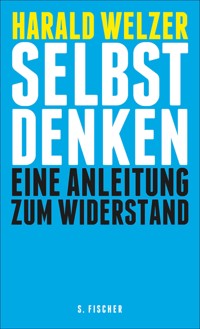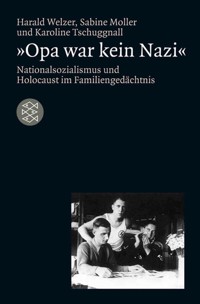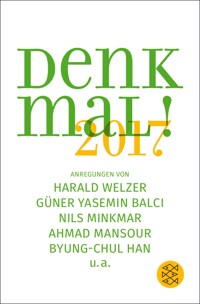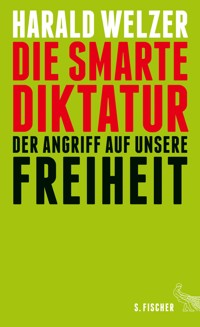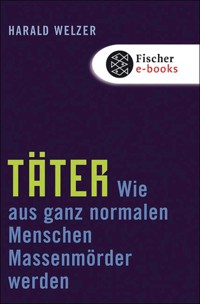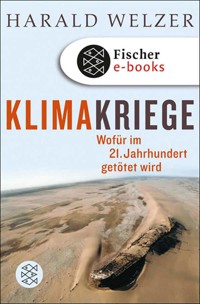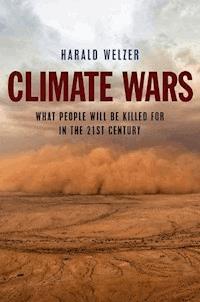22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wir wohnen in unseren Gefühlen wie in Häusern. Bestseller-Autor Harald Welzer zeigt: Gefühle spielen die entscheidende Rolle bei all unseren Entscheidungen, die eben nicht nur mit Informationen und Wissen zu tun haben, sondern vor allem mit dem Zusammenspiel aller Faktoren, die von der Geburt bis zum Erwachsensein unser Ich herausbilden. Diese bestehen aus Orten, aber genauso aus Tönen, Gerüchen, Worten, Träumen, Erlebnissen, Geschichten, Gemeinschaft und anderem mehr: all dies bildet die innere Landschaft, von der aus wir in die Welt gehen und sie gestalten. Das Haus der Gefühle hat eine Statik, die kann stabil sein oder fragil. Aber es ist nicht weniger real als ein Haus aus Stein oder Beton. Seine Bausteine sind Resonanz, Heimat und das Gefühlsverlangen nach anderen Menschen. Es braucht, wie Harald Welzer in einer faszinierenden Zusammenschau psychologischer, neurowissenschaftlicher und soziologischer Befunde (und angereichert mit vielen Geschichten) zeigt, eine stabile Architektur der Gefühle. Heute mehr denn je. Im Augenblick ist Angst in unserer Gesellschaft vorherrschend. Und das ist leider ein sehr dominantes Gefühl, das sich leicht anheizen und politisch ausbeuten lässt. Als Gegenpol können Liebe, Freundschaft, Sorge und Zugewandtheit fungieren, die wir ebenso als starke politische Kräfte verstehen lernen sollten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Harald Welzer
Das Haus der Gefühle
Warum Zukunft Herkunft braucht
Über dieses Buch
Wir wohnen in unseren Gefühlen wie in Häusern. Es sind unsere inneren Landschaften, die unsere Entscheidungen prägen und die wiederum sind ein Zusammenspiel aller Faktoren, die von der Geburt bis zum Erwachsensein unser Ich heranbilden. Das Haus der Gefühle kann stabil sein oder fragil, seine Bausteine sind Resonanz, Heimat und das Gefühlsverlangen nach anderen Menschen. Es braucht, wie Harald Welzer in einer faszinierenden Zusammenschau psychologischer, neurowissenschaftlicher und soziologischer Befunde zeigt, eine stabile Architektur der Gefühle, damit Gemeinschaft gelingt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Harald Welzer, geboren 1958, ist Sozialpsychologe, Direktor von FUTURZWEI. Stiftung Zukunftsfähigkeit und Herausgeber von tazFUTURZWEI. In den Fischer Verlagen sind von ihm u. a. erschienen: »Täter. Wie aus ganz normalen Menschen Massenmörder werden«, »Selbst denken. Eine Anleitung zum Widerstand«, »Alles könnte anders sein. Eine Gesellschaftsutopie für freie Menschen« und »Nachruf auf mich selbst. Die Kultur des Aufhörens«. Seine Bücher sind in 21 Ländern erschienen.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2025 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Deborah Mittelstaedt
Coverabbildung: Deborah Mittelstaedt
ISBN 978-3-10-492191-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Motto]
Das erste All
Das Haus der Gefühle
Gegenwärtigkeit
Die Kätzchen von John Maynard Keynes
Sich aufhalten
Ein Reiseführer
Vertrauen
Kein Aufbruch ohne Bindung
»NEO Familie«, ein Haus für Kinder
Der Lebensraum des Großstadtkindes
Peter
Ephra
Heimat
Gefühle teilen
Soziales Verstehen. Meine Gefühle für die Gefühle der anderen
Freiheit ist ein emanzipiertes Gefühl
Eichmann, Fleischmann, Neckermann
Opaforschung
Zeitschichten
Meine Vorstellungen von den Vorstellungen der anderen
Schauspielern auch die Dinge?
Weltbeziehungen
Insel ohne Resonanz
Insel mit Resonanz
Glück und Pech
Zukunft braucht Herkunft
Gastfreundschaft
Wie viel Freundschaft braucht der Mensch?
Eva-Maria
Die neuen Menschen
Smalltalk
Geschichten sind Häuser der Gefühle
Karsten
In Bewegung (Die Eisenbahn)
Existiert ein Ort unabhängig von mir?
Kriegslandschaft
Überrascht über sich selbst sein
Lebendigkeit. Verzauberte Welt
Dasein
Die Palme
Das Feld, der Raum und die Stadt
Das Klassenzimmer
Where are we now? Politische Gefühle unter der Oberfläche
Wo man sich begegnet – Wohnzimmer der Gesellschaft
Kneipen und Bars
Angst ist die Oberbefehlshaberin der Gefühle
Einen Unterschied machen
Worauf man nicht kommt
Noch ein paar kurze Geschichten zum Unterschied-Machen
3,6 Millionen Jahre
Danksagung
Abbildungsnachweis
Register
»If you find this world bad, you should see some of the others.«
Philip K. Dick
Das erste All
Es ist wirklich erstaunlich, wie wenig Philosophie, Psychologie und auch die Sozialwissenschaften sich für die Orte interessieren, in denen jeder Mensch zum ersten Mal mit der Welt bekannt gemacht wird. Egal, ob das eine Wohnung ist, eine Höhle, ein Haus, ein Palast oder ein Stall – die erste Erfahrung der Welt wird in einer Behausung gemacht. Und die hat Höhen, Breiten und Tiefen, Fußböden unterschiedlichster Art, Fenster, einen Geruch, einen Ton, eine Farbe. Da wohnen auch andere, und all dies bildet den Ausgangspunkt für alle künftigen Weltbeziehungen, die mit der weiteren Entdeckung der Welt entstehen.
Kein Wunder, dass in Kinderzeichnungen das Haus eine wichtige Rolle spielt, und fast immer hat das gezeichnete Haus Fenster. Und eine Tür mit einer Klinke. Es gibt ein Drinnen und ein Draußen. Daher die Wichtigkeit der Tür, durch die kann man hinein oder hinaus. Der Philosoph Gaston Bachelard sagt in einem ganz erstaunlichen Buch zur »Poetik des Raumes«: »Wir müssen zeigen, daß das Haus für die Gedanken, Erinnerungen und Träume des Menschen eine der großen Integrationsmächte ist. […] Es hält den Menschen aufrecht, durch alle Gewitter des Himmels und des Lebens hindurch. Es ist Körper und Seele. Es ist die erste Welt des menschlichen Seins. Bevor er ›in die Welt geworfen‹ wird, wie die eiligen Metaphysiker lehren, wird der Mensch in die Wiege des Hauses gelegt.«[1]
Der Soziologe Norbert Elias, der sich selbst als »Menschenwissenschaftler« bezeichnete, hat den Philosophen Iring Fetscher in einem Fernsehgespräch mal völlig verblüfft, als er sagte: »Philosophen stellen sich Menschen als Erwachsene vor, die niemals Kinder waren.« Da hat er recht: Natürlich wird niemand »in die Welt gestellt« oder gar »geworfen«; wir lernen die Welt langsam kennen, indem wir sie uns, ausgehend von einem festen Ort, peu à peu erschließen. Dieser Ort, sagt Bachelard, ist unser erster Winkel der Welt, unser erstes All. Erinnerungen daran haben eine andere Tonalität als die späteren Erinnerungen, die aus der Entdeckung der Außenwelt stammen.
Wenn man das »Haus der Gefühle« als Ausgangspunkt verstehen will, von dem aus man »sich aufmachen« kann, darf man sich nicht nur auf die geographischen Orte und ihre physikalischen Gegebenheiten beschränken, sondern muss vor allem die inneren Landschaften sehen, die in Menschen auf ihrer Entdeckungsreise in die Welt entstehen – in einer eigentümlichen Verbindung aus wirklichen und geträumten Orten. Bachelard spricht von einer Topo-Analyse: »das systematische psychologische Studium der Örtlichkeiten unseres inneren Lebens.«[2] Die setzt an der Schnittstelle zwischen den wirklichen und den vorgestellten Orten an.
Das Haus der Gefühle
»Wir wohnen in unseren Gefühlen wie in Häusern. Sie haben eine Architektur, in der leben wir.« Sagt Alexander Kluge,[1] dessen ganzes Lebenswerk sich mit der geschichtlichen Produktivkraft »Gefühl« beschäftigt, mit der »Macht der Gefühle«. Revolutionen, Kriege oder das Ende von Terrorherrschaft lösen, man denke nur an den Mauerfall, kollektive Gefühlsexplosionen aus. Faschismus und Populismus können sich unter Krisenbedingungen auf breiter Front durchsetzen, weil sie Herrschaftsformen des Gefühls sind.
Obwohl das offensichtlich ist und das Konzept vom vernunftgeleiteten Handeln eigentlich erst seit der europäischen Aufklärung in das Zentrum des politischen Denkens gerückt ist und dort, wie man gerade überall auf der Welt sieht, ein offenbar vergleichsweise kurzes Gastspiel gegeben hat, spielt die mächtige Produktivkraft der Gefühle in den Geschichts- und Politikwissenschaften nur eine Nebenrolle.[2] Man überweist das Themenspektrum Affekt, Emotion, Gefühl an die Psychologie und versucht ansonsten immer noch, die Menschen als vor allem rational handelnde Wesen zu verstehen. Was natürlich schiefgeht, denn das sind sie einfach nicht. Sie haben Gefühle, ohne die sie, wie wir von der Neurowissenschaft gelernt haben, weder entscheidungs- noch handlungsfähig wären. Und Gefühle haben Macht über sie. Der Versuch, Geschichte und Gesellschaft ohne Berücksichtigung der Gefühle zu verstehen, ist ungefähr so schlau, als würde man sagen, dass Raupen in der Schmetterlingsforschung nichts verloren haben.
Politisch wird die Macht der Gefühle seit je von denen verstanden, denen freiheitliche Ordnungen zuwider sind, weil sie buchstäblich spüren, dass der Wunsch nach Freiheit ein Gefühl ist, das ihrem Wunsch nach Macht entgegensteht. Deshalb betreiben sie eine Politik der Affekte, erzeugen Angst, versprechen Erlösung. Aber auf der anderen Seite, wo man Freiheit und Demokratie bewahren möchte, werden bloß Sachargumente aufgefahren, und über die kann man nachdenken, die kann man diskutieren, aber sie wecken keine Leidenschaften. Damit funktioniert Politik in komfortablen Zeiten, aber wenn die Verhältnisse turbulent werden und Angst ins Spiel kommt, ist die Vernunft immer unterlegen.
Man hat die Macht der Gefühle auch da ignoriert, wo man sich wünschte, die Gesellschaft möge sich in Richtung Nachhaltigkeit bewegen, es brauche eine »sozialökologische Transformation«. Dort argumentiert man seit Jahr und Tag mit Diagrammen und Zahlen, ohne ein einziges Mal den Gedanken zu fassen, dass Menschen nicht Diagramme und Zahlen im Sinn haben, wenn sie ihr Leben zu gestalten versuchen. Dabei nämlich geht es ihnen vor allem um gute Beziehungen, die sie zu den Menschen haben möchten, die sie mögen und auf die sie angewiesen sind. Und da sind Resonanz und Vertrauen die entscheidenden Kategorien – kurz: Es geht um die Architektur der Gefühle. Und in der kann man sich im glücklichen Fall gut aufgehoben fühlen, beheimatet. Oder unwohl im schlechteren Fall, mit einem unklaren Gefühl, unbehaust zu sein. Fehl am Platz.
Die Bereitschaft von Menschen, etwas in ihrem Leben zu verändern, loszulassen, sich auf den Weg zu machen, setzt Zutrauen, Vertrauen, Sicherheit und Zuversicht voraus. Aber das sind Gefühlsdimensionen, das ist nichts, was man als Wissen erlernt oder erklärt bekommen hat. Das muss gelebt sein, vital erworben worden sein in der Wirklichkeit. Erst solche Dimensionen geben ein Gefühl von Beheimatung und ermöglichen Zukunftsvertrauen. Und bilden die Zuversicht, Probleme, Krisen, Schwierigkeiten bewältigen zu können, und nicht an ihnen zu zerbrechen. Wenn Menschen aber in Unsicherheit leben und wenig Orientierung haben, halten sie krampfhaft an dem fest, was ihnen Halt zu geben scheint, und das führt in Zeiten zunehmender Krisen dazu, dass sie sich nicht nach vorne, sondern rückwärts bewegen. Daraus resultieren Retropolitik, Wut und Misstrauen.
Deshalb braucht es ein solides Haus der Gefühle, in dem man Resonanz, Beheimatung und Freundschaft erfährt. Dieses Haus hat eine Statik, und es ist nicht weniger real als ein Haus aus Stein oder Beton. Es braucht, heute mehr denn je, eine stabile Architektur der Gefühle.
Gegenwärtigkeit
Auch ein Haus der Gefühle kann einstürzen. Als ich die Nachricht von Laras Tod bekam, machte ich – zum wievielten Mal? – die Erfahrung, dass jetzt etwas geschehen war, was nicht mehr korrigierbar, nicht mehr heilbar, was unwiderruflich war. »Den Tod«, sagt ein verzweifelter Mann, der gerade seine Frau bei einem Autounfall verloren hat, »den Tod gibt es doch gar nicht.« Das sagt der Schauspieler Marquard Bohm in einem frühen Film von Wim Wenders, »Im Lauf der Zeit« von 1976. Wenders drehte damals im Originalton; die Schauspieler sprachen ohne Skript. Den Tod gibt es doch gar nicht, sagt also Bohm, und dieser Satz ist so etwas wie der Schutzanstrich unseres sorgsam geführten und abgesicherten Lebens.
Gerade deshalb sind wir so unvorbereitet, wenn sich zeigt, dass es ihn allerdings doch gibt. Dann fällt die Nachricht vom Tod eines lieben, eines nahen, nächsten Menschen wie ein Axthieb in das Leben. Unwiderruflich wie jede Wahrheit steht die Nachricht mitten im Leben der Zurückgebliebenen, und die Buchstäblichkeit des Fortseins, die der Tod eines Menschen immer für die anderen ist, die noch da sind, wird meist mit dem Verb »reißen« benannt – da ist jemand aus dem Leben, aus unserer Mitte »gerissen« worden, es ist »herzzerreißend«, oder es »reißt ein Stück aus einem raus«, wenn ein Freund, eine Freundin gestorben ist. Von diesem Riss weiß man nicht, wie er sich nähen oder kitten lassen soll. In einer E-Mail beschrieb mir Laras Lebensgefährte Johannes den Riss so, dass ihm »die rechte Körperhälfte« fehle. »Ich fange in weiten Teilen wieder bei null an.«
So ist das. Und ich habe sehr geheult und weine sogar ein wenig, während ich dies hier schreibe. Dabei war Lara im Sinn gemeinsam verbrachter Zeit gar keine enge Freundin, aber sie war sehr wichtig für mich, und ich wohl auch für sie. Das merkt man ja gerade in einem solchen Augenblick und in den Stunden und Tagen danach – oder besser: Das macht der Riss im Schutzanstrich offenbar, da plötzlich Licht durch ihn fällt. Unwiderruflichkeit. Das ist das Wissen, wie wichtig einem jemand war, den es nun nicht mehr gibt. Das zu wissen scheint irgendwie verspätet, es holt ja nichts mehr ein, aber es ist doch … Wissen in einer kristallinen Geistesgegenwärtigkeit, dass nun nichts mehr in der Beziehung zu diesem Menschen eine Zukunft hat.
So geschah es am 28. April 2023. An diesem Tag starb Lara. Sie wurde nur 49 Jahre alt. Sie hat sich an diesem Tag im Frühling das Leben genommen, ist von einem Baum in eine Schlinge gesprungen, an einem versteckten, verwilderten Ort, an dem sie häufig mit Kindern war. Sie musste mit Tricks arbeiten, um sich für einen Moment der Aufmerksamkeit von Johannes zu entziehen, der schon fürchtete, dass Lara drauf und dran war, über die Grenze zu gehen. Warum? Weil sie seit Monaten extrem unter einer Krankheit litt, für die es bis heute nur ein unaussprechliches Akronym gibt: ME/CFS-PEM. Diese Krankheit, die je nach Schweregrad zu völliger Entkräftung führt und in ihrem Fall von unendlichen Schmerzen begleitet war, kann nach überstandenen Virusinfektionen auftreten. Vor allem Frauen zählen zu den Betroffenen. Besonders seit der Coronapandemie gibt es viele Fälle, aber die Krankheit ist bis heute nicht ausreichend erforscht, es gibt keine Therapie, und gerade für einen so tatkräftigen, anpackenden Menschen wie Lara muss die erzwungene, endlose und mit nicht zu dämpfenden Schmerzen einhergehende Ohnmacht ein aussichtslos scheinendes Grauen gewesen sein. »Am Ende hatte sie keine Hoffnung mehr, dass ihre Kräfte ausreichen würden, auch nur noch einen weiteren Tag unter unerträglichem körperlichen und seelischen Leid nach einem wunderwirkenden Heilungsweg zu suchen«, schrieben ihre engsten Verwandten und Freunde in einem Nachruf.
Sie selbst hatte in ihrem Abschiedsbrief formuliert: »So unendlicher Schrecken, so unendlich. Lasst ihn nie in euer Leben, lasst es heil. Heil und heilig. All das ist in mir in Millionen Scherben zerborsten. Dass ich nun noch mehr Schrecken schaffe, ist unverzeihlich. Ich bitte um Gnade, bitte um Vergebung. So kann ich für niemand da sein und selbst kann ich nicht sein. So unendlich unendlich schrecklich.«
Ich weiß nichts, wo jemand eine durch nichts mehr mit Hoffnung auszupolsternde Aussichtslosigkeit so krass und eindrücklich formuliert hat. Dieser Abschied richtet sich an alle. So war sie.
Am 15. Juli fand dann eine Trauerfeier für Lara statt, im Klanghaus von Klein Jasedow, einem kleinen Ort in der Nähe der Ostsee, Laras Heimatort. Umweltbewegte kennen Klein Jasedow; landläufig würde man sagen: ein Ökodorf, wie es im Buche steht. Dort lebt eine etwa 30-köpfige generationenübergreifende Gemeinschaft, die Landbau betreibt, Musikinstrumente, insbesondere Gongs, herstellt, Ferienfreizeiten für Stadtkinder anbietet, eine Schule hat, sich in der lokalen Politik engagiert und vieles mehr. Eine Zeitschrift namens »Oya« herausgeben zum Beispiel, deren Chefredakteurin Lara war.
Die Trauerfeier fand an einem strahlenden Sommertag statt. Hunderte Menschen kamen, um sich von Lara zu verabschieden, sie zu ehren und den Hinterbliebenen ihre Verbundenheit zu zeigen. Die Gruppe, die da zusammenkam, würde man »divers« nennen; so ziemlich alles war vertreten, was eine Gesellschaft an jungen und alten und mittelalten Menschen zu bieten hat, von Ökofundamentalisten, Aktivistinnen, Leuten aus der Wissenschaft, der Musik und dem Handwerk bis hin zu ganz normalen Menschen aus der Gegend. Johannes hielt eine Rede, und da war auch der Bürgermeister, der als Mitglied der örtlichen Feuerwehr Lara vom Baum geschnitten hatte. Viele traten auf die Bühne, erzählten von ihren Begegnungen mit Lara und wer sie für sie war, traten wieder ab. Das Ende: Musik. Das alles war sehr schön. Auf der Bühne stand ein gerahmtes Foto von Lara, und man hatte das klare Gefühl, dies alles strahlte von ihr aus.
Abb. 1: Das Leben am 15. Juli 2023.
Ich saß mittig hinten, die Tür rechts von mir war offen. Dort blühte ein Strauch Rosen in voller Pracht, Vögel zwitscherten.
Unmittelbar in diesem Moment, der mich wegen seiner Schönheit irritierte, obwohl er doch so traurig war, kam mir ein Gedanke, der mich seither beschäftigt: Viele, und ich gehöre dazu, suchen und verfolgen die Utopie eines gelingenden Lebens, eines geglückten Zusammenseins, eines Friedensschlusses mit sich selbst, den anderen und der Natur.
Deshalb engagieren wir uns politisch, praktisch, sozial, wissenschaftlich, publizistisch, künstlerisch, liebend, wie auch immer. Wir suchen eine nächste Gesellschaft, die den Krieg gegen die Natur beendet, nennen den Weg dahin »Transformation« und machen große Entwürfe dafür, beschreiben die Bedingungen der Möglichkeit solchen Gelingens, skizzieren wirtschaftliche, kulturelle, technische Wege dahin, veranstalten Kongresse, gründen Organisationen, schreiben Bücher, drehen Filme – und sind auf genau diese merkwürdige Weise immer im Modus eines »davor«. Nämlich gefangen in dem sicheren Gefühl, dass dies alles erst dann und dann unter diesen und jenen Voraussetzungen zu erreichen sei – aber bis dahin müsse erst noch zum Beispiel der Kapitalismus überwunden und der Globale Süden befreit und die weltweite Ungerechtigkeit beseitigt und der Hunger besiegt werden, und überhaupt sei es auf jeden Fall noch ein weiter Weg.
Und auf einmal sieht man: Dieses stetige Streben nach der Verwirklichung einer wahrlich beglückenden Idee erzeugt auf bizarre Weise eine Haltung und ein Gefühl des permanenten Noch-nicht-da-Seins. Wilhelm Busch hat das in die Figur des britischen Mister Pief gefasst, der immer mit einem Fernrohr vor Augen durch die Natur schreitet, weil er sich sagt: »Schön ist es auch anderswo/und hier bin ich sowieso.«
Und hier, im Moment der Trauer, dachte ich plötzlich: Was für ein Unsinn! Denn hier war sie ja: die gelingende Gemeinschaft. Kein Vorstadium, sondern Gegenwart. Völlig unterschiedliche Menschen, die sich an einem Ort versammelt hatten. Um zusammen zu trauern, zu sprechen und zu gedenken, und zwar nicht eines Menschen im Singular, sondern dieses Menschen, Lara, im Zusammenhang all derer, die hier zusammengekommen waren. Erzählten, zuhörten, sangen, weinten, lachten. Hier, staunte ich, ist es ja, das Leben, von dem man – es irrigerweise für eine Utopie haltend – meint, es irgendwann später einmal erreichen zu sollen. Statt im Modus des ewigen Vorspiels zu verharren, war hier etwas plötzlich ganz handfeste, spürbare Gegenwart. Gegenwärtigkeit. Aus der größten Trauer entspross der glückliche Augenblick. Laras Vermächtnis.
Das eingestürzte Haus der Gefühle baute sich wieder auf. Den Rest des Tages ging ich spazieren mit Menschen, die ich zuvor noch nie gesehen hatte, traf alte Bekannte, lernte neue kennen, es gab sehr viele Umarmungen und schließlich, im Sonnenschein, einen gemeinsamen Spaziergang zum Ort ihres Selbstmords – kurz: Der Tag bestand aus einem im Wortsinn merkwürdigen Einverstandensein mit dem Leben. Weil wir aus Gründen des Schreckens und der Endlichkeit zusammengekommen waren. Über der Einladung zu Laras Trauerfeier stand das Motto »Lebe!«.
Die Kätzchen von John Maynard Keynes
Weil diese sehr einfache Erkenntnis »Wir sind ja alle schon da!« so auf der Hand liegt, fällt einem plötzlich auf, wie sehr wir im Modus des »Noch-nicht« und »Kommt-erst-noch« gefangen sind und deshalb den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Ich habe seit dieser Erkenntnis angefangen zu sammeln, was als Gutes schon da ist, wenn man es großzügigerweise zur Kenntnis nimmt. Ein kleines Beispiel: Ich kaufe im Sommer immer Obst und Gemüse an einem kleinen Stand kurz vor dem Ortseingang von Potsdam-Babelsberg, weil er auf meiner morgendlichen Fahrradstrecke liegt und weil es dort sehr gute Sachen aus eigenem Anbau gibt, Erdbeeren zum Beispiel, die wie Erdbeeren schmecken. An einem Morgen war der Obststand aus der Richtung, aus der ich kam, gar nicht zu sehen, weil ein riesiger 24-Tonner vor ihm stand, rechts von ihm ein Polizist, der mit dem Lkw-Fahrer sprach, noch weiter rechts eine umgeknickte Straßenlaterne.
Offensichtlich hatte sie der Fahrer beim Rangieren übersehen, und nun stand er da, der Laster, und die Laterne lag da, geknickt. Als ich ankam, hörte ich, wie Polizist und Fahrer in einer mir unbekannten Sprache redeten, ich vermutete Polnisch. Vor den Obst- und Gemüsekisten stand eine Polizistin, die gerade etwas Obst gekauft hatte. Ich fragte sie: »Sag mal, wie viele Sprachen könnt ihr eigentlich?« Die Polizistin sah mich freundlich an und antwortete: »Na, wir können eben das, was wir mitbringen.« Und ich dachte: Ja! Das ist genau die Gesellschaft, in der ich leben will. Ohne Angst verschieden sein, und jeder bringt mit, was er mitbringen kann. Und ich dachte: Wie schön für den armen Lkw-Fahrer, der kein Deutsch konnte, hier den Fall mit jemandem klären zu können, der seine Sprache sprach. Großartig. Der prozentuale Anteil der Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter mit migrantischem Hintergrund lag 2021 in Deutschland bei über 24 Prozent. Zehn Jahre zuvor waren es weniger als die Hälfte. Das ist was.
Für mich war diese Szene eine – nennen wir es – Gegenwartsutopie; ein idealer Zustand, der nicht in der Zukunft liegt, sondern schon da ist, handfest, real, vorhanden. Es werden in diesem Buch noch eine Menge Gegenwartsutopien vorkommen. Wenn man erst mal darauf gestoßen ist, dass vieles von dem, was man erst noch herstellen zu müssen meint, bereits da ist, gehen einem eine Menge Lichter auf: Gegenwärtigkeit.
Martin Werlen, der Propst der Propstei St. Gerold im Großen Walsertal in Vorarlberg, hat – in Bezug auf die Kirche – einen verwandten Gedanken: »Statt die Kirche zu lieben, lieben wir oft das Idealbild, das wir von ihr haben. Statt die Gemeinschaft zu lieben, lieben wir das Idealbild, das wir von der Gemeinschaft haben. Statt den Bruder oder die Schwester zu lieben, lieben wir das Idealbild, das wir von einem Menschen haben.«[1]
Es könnte übrigens auch sein, dass wir, statt uns selbst zu lieben, das Idealbild unserer selbst lieben, was natürlich ein unmöglicher Liebesversuch ist, weil wir ja statt dieses Idealbilds immer nur eine Schwundvariante davon sehen, wenn wir in den Spiegel schauen. Nennen wir es: das Überstreben dessen, was da ist. John Maynard Keynes, der vielleicht wichtigste Ökonom des 20. Jahrhunderts, beschreibt dasselbe Phänomen sehr witzig: Er spricht von einer »Zielstrebigkeit«, die bedeute, »dass wir uns mehr mit den entfernten künftigen Ergebnissen unserer Handlungen als mit ihren eigentümlichen Qualitäten oder ihren unmittelbaren Auswirkungen auf unser eigenes Umfeld beschäftigen. Der ›zielstrebige‹ Mensch versucht immer, seinen Handlungen eine flüchtige und trügerische Unsterblichkeit zu verleihen, indem er sein Interesse an ihnen weiter in die Zukunft verschiebt. Er liebt nicht seine Katze, sondern die Kinder seiner Katze; eigentlich auch nicht die Kätzchen, sondern nur die Kätzchen der Kätzchen und so weiter bis zum Ende aller Katzen. Für ihn ist Marmelade keine Marmelade, wenn sie kein Fall von Marmelade für morgen ist, und niemals Marmelade für heute. Indem er also seine Marmelade immer weiter in die Zukunft verschiebt, versucht er seinem Akt des Marmeladekochens eine Art Unsterblichkeit zu sichern.«[2]
Das vorgeschobene Idealbild wirkt auch politisch, wenn man etwa sieht, dass besonders »progressive« Organisationen, Parteien oder Gruppen regelmäßig zu Spaltungsprozessen oder, wie im Stalinismus oder in den K-Gruppen der 1968er-Bewegung, gar zu »Säuberungen« neigen – denn es geht ja um einen idealen Zustand in der Zukunft, und leider weichen regelmäßig manche von den idealen Vorstellungen ab, die man von sich selbst als Vorkämpfer für die große Sache hat. Und die »Abweichler« müssen dann intensiver bekämpft werden als die eigentlichen Gegner. Monty Python hat das im »Leben des Brian« wunderbar am Beispiel der »Volksfront für Judäa« gezeigt, die verbissen gegen ihren Todfeind kämpft, die »Judäische Volksfront«.
Peter Unfried schreibt: »Entscheidend ist, dass es weniger um das reale Ich geht und mehr um das ideale Ich. Wenn man das versteht, dann wird unsere ganze Zögerlichkeit verständlich, jemand zu ›sein‹, etwa Teil einer Regierung. Denn wer jemand ist, der ist dafür verantwortlich zu machen, etwa als Wirtschaftsminister, als Waffenlieferant, aber auch als Waffen-Nichtlieferant. Wer dagegen jemand sein will, der ist auf der sicheren Seite.«[3]
Wir sehen also gewissermaßen eine mentale Zeitmaschine, die zwischen dem Gegenwartsmoment und einer idealerweise zu erreichenden Zukunft steht und die sofort angeworfen wird, sobald man sich aufgerufen fühlt, mal etwas zu tun. Wir treffen auf dieses mächtige Zeitmaschinenbetriebssystem zu den unterschiedlichsten Gelegenheiten – besonders dort, wo scheinbar kleinen Handlungen ihre Bedeutungslosigkeit angesichts des großen Ganzen nachgewiesen wird, dort, wo schon nach der »Skalierung« gefragt wird, bevor man überhaupt über die kleinste Wirkung nachgedacht hat, dort, wo in Interviews nie an der Weiterentwicklung eines Gedankens mitgedacht wird, sondern wo die Moderatorin jeden ihrer Sätze mit »Ja, aber …« beginnt.
Eigentlich begegnet man diesem System überall, was kein Wunder ist, denn in der Konsummoderne sind wir ja alle trainiert darauf, dass die Befriedigung des nächsten Bedürfnisses gleich ansteht. Und in der linken Theorie darauf, dass »das befreite Subjekt«, gar »der neue Mensch« erst noch kommt. Und in der Liebesbeziehung darauf, dass das perfekte Glück irgendwann schon noch eintreten wird. Und während der Arbeit darauf, dass der Urlaub kommt, und im Urlaub darauf, dass man endlich wieder zum Job gehen kann. Und dann ist da noch der größte Bullshit der Gegenwart: der Fetisch der »Innovation«. Als sei es ein Wert an sich, dass etwas neuer ist als etwas anderes. So leben wir im dauerhaften Vorstadium, nur zwei sind nie da: der ideale Zustand und man selbst. Deshalb kommt man, militärisch gesprochen, nie vor die Lage. Man bleibt systematisch hinter sich selbst zurück.
Das aber ist hochgradig destruktiv, weil der gegebene Zustand auf diese Weise nie der sein kann, der gut ist. Er muss logisch gegenüber dem anzustrebenden Zustand immer defizitär sein, kann nie genügen. Das genau ist destruktiv, weil ich so das Gegebene nicht als Ressource für meine Stärke und Resilienz nutzen kann. Ich lasse eine Ressource in der Gegenwart liegen, weil ich die Zukunft für ergiebiger halte. Eine verhängnisvolle Wette, scheint mir.
Noch ein Beispiel aus dem theologischen Bereich: »Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft«, sagt Dietrich Bonhoeffer, »mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft, und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meinte […] Er steht hart und wie ein lebendiger Vorwurf für alle anderen im Kreis der Brüder. Er tut, als habe er die christliche Gemeinschaft erst zu schaffen, als solle sein Traumbild die Menschen verbinden. Was nicht nach seinem Willen geht, nennt er Versagen. Wo sein Bild zunichte wird, sieht er die Gemeinschaft zerbrechen.«[4]
Es spielt gar keine Rolle, ob es hier um eine »christliche« oder eine »marxistische« oder irgendeine andere Gemeinschaft geht – immer lassen die Bilder der idealen Variante welcher Gemeinschaft auch immer die, die schon da ist, als unzureichend und demgemäß als eine erscheinen, die überwunden werden muss. Daraus, so scheint mir, entsteht ein merkwürdiges Enteilen des Gelingens von sich selbst.
»Wir waren wie die Landschaft, im Rückzug«, schrieb Roger Willemsen in seinem letzten Text. »Wir hatten unserem Verschwinden nichts entgegenzusetzen, rieben uns aber auf im engen Horizont einer Arbeit, die ein Unternehmen stärken, erfolgreicher, effektiver machen sollte, aber nicht Lebensfragen beantworten, das Überleben sichern helfen würde. Kaum blickten wir in die Vergangenheit, sahen wir nichts als Fortschritt. Kaum blickten wir in die Zukunft, nichts als Niedergang. Wir waren jene, die wussten, aber nicht verstanden, die begriffen, aber sich nicht vergegenwärtigen konnten, voller Information, aber ohne Erkenntnis, randvoll mit Wissen, aber mager an Erfahrung. So gingen wir, nicht aufgehalten von uns selbst.«[5]
Dieses ewige »noch nicht« ist eines der missratenen Kinder der Aufklärung, suggeriert es doch, dass das Bessere erst kommt und der gegebene Zustand keinesfalls der sein darf, der bleiben kann. Roger Willemsen sprach deshalb von einem neuen Imperativ: uns zu vergegenwärtigen! »[…] hier zu sein, in dieser Zeit anzukommen – nicht in der Ferne der Displays, nicht auf den Modulen unserer ausgelagerten Intelligenz, nicht in den virtuellen Universen, nicht in der digitalen Parallelwelt des Sozialen, die sich vor die Realität dieses sozialen Asozialen schiebt, sondern in jener praktischen Welt, in der die Frage nach dem Überleben aller neu gestellt wird.«[6] Wir können Aufklärung, so Willemsen, nur retten, indem wir die Geistesgegenwart retten. Betonung auf Gegenwart. Hier ist der Ort zu handeln, Jetzt ist die Zeit zum Handeln. Das ist Gegenwärtigkeit.
Sich aufhalten
Doch wir sind nicht aufgehalten von uns selbst, sagt Roger Willemsen. Ja, wir müssen uns aufhalten, und genau darin steckt der entscheidende Doppelsinn: aufhören, innehalten einerseits – aber um das zu können, braucht es den Aufenthalt, den Ort, an dem man sein kann, atmen kann, anderen begegnen kann. Womit wir wieder beim Haus wären, beim Zuhause, beim Behaustsein. Wir brauchen einen sicheren Ort, um innehalten und uns orientieren zu können. Zukunft braucht Herkunft. Ohne Herkunft ist Zukunft ortlos, referenz- und resonanzlos – wie das haltlose Gesabbel von »Innovation« und »Disruption«.
Von Theodor W. Adorno stammt der zu Tode zitierte Satz: »Es gibt kein richtiges Leben im falschen«, und das ist natürlich Blödsinn (obwohl der Philosoph das gar nicht so apodiktisch gemeint hat; ich denke, er wollte darauf hinweisen, dass das individuell richtige Leben sich immer Rechenschaft darüber abzulegen hat, was der Rahmen ist, in dem das Richtige möglich sein kann). Selbstverständlich gibt es richtiges Leben im falschen, sonst hätte Georg Elser nicht sein Attentat auf Hitler geplant, sonst hätte der unlängst verstorbene Michael Sladek nicht als »Stromrebell« zusammen mit Ursula Sladek ein fossil- und atomstromfreies Energieunternehmen aufgebaut, die Elektrizitätswerke Schönau. Und sonst gäbe es auch nicht all die großartigen Menschen, die sich in Ehrenämtern vom Roten Kreuz bis zu KZ-Gedenkstätten, von der freiwilligen Feuerwehr bis zu Fridays For Future engagieren. Die sind alle da und tun richtige Dinge. Im falschen Leben? Man kann ja nur das leben, das man hat.
Allerdings bietet der Satz vom Leben im Falschen die perfekte Ausflucht, nichts zu tun, weil erst mal – ja was? Eine unendliche Kette von großen, sehr großen, übergroßen Weltproblemen abgearbeitet werden muss. Erst dann kann das »richtige Leben« losgehen. Das ist nicht nur der perfekte Wegweiser zur immerwährenden Ausflucht; ich fürchte auch, dass dieses total richtige Leben eine unendlich langweilige Angelegenheit wäre, nämlich der Himmel auf Erden, und der Himmel ist ja, wie man hört, ein sterbenslangweiliger Ort. Gott würfelt ja noch nicht mal, wie wir von Albert Einstein wissen, wahrscheinlich kann man im Himmel auch nicht Skat spielen.
Gegenwärtigkeit bedeutet etwas ganz anderes: Nämlich die Welt, in der man ist und von der man ein Teil ist, in jedem Augenblick daraufhin anzuschauen, was an ihr gut ist und was man gegebenenfalls selbst in ihr besser machen kann. Gegenwärtigkeit bedeutet: jederzeit urteilsfähig zu sein. Gegen die permanente Anspannung des Optimierens, des Vorantreibens setzt man dann die Entspannung: Lass gut sein, was gut ist. Sich also dem Gegebenen zuwenden, passiv sein können, Dinge geschehen lassen, auf Manipulation, auf die ewige Fummelei am Bestehenden verzichten: Das wäre schon ein Schritt. Und erst wenn man diesen Modus proaktiver Passivität erreicht, kann man das Gegebene betrachten, entspannt, und sich die Frage stellen, was denn etwas zu etwas Gutem gemacht hat, wenn es gut ist. Denn das ist ja die Grundierung einer entspannten Existenz: dass etwas gut ist, wie es ist. Weil es jemand erdacht, gebaut, bereitgestellt hat. Und es da war.
Als der schon erwähnte Martin Werlen die Propstei St. Gerold als neuer Propst übernahm, ging er zunächst einfach davon aus, dass ein Ort, der schon 1000 Jahre existiert und immer noch Aufenthalt bietet, dass man also dort übernachten, arbeiten, beten, essen, trinken und atmen kann, ein guter Ort sein muss. Daraufhin untersuchte er diesen Ort auf das hin, was vielleicht nicht gut war – etwa ein in den 1980er Jahren angefügter Anbau. Oder der Sachverhalt, dass es unterschiedliche Kategorien von Zimmern gab oder dass eine Außenmauer zu hoch war, als dass jemand im Rollstuhl einen Blick in die schöne Landschaft werfen konnte. Das alles, beschloss Pater Martin, müsse zurückgebaut werden, damit der gute Ort ein noch besserer Ort sein könne, vielleicht für noch mal 1000 Jahre, wer weiß. Das ist »die praktische Welt«, von der Roger Willemsen sprach, und zu der müssen wir uns wie Pater Martin praktisch verhalten. Die Mauer muss niedriger gemacht werden. Ganz einfach.
Aber das muss man erst mal wieder lernen. Unsere Kultur des Vorstadiums in Permanenz trainiert uns ja von Anbeginn darauf, die Gegenwart zu überspringen, weil der anzustrebende Zustand doch vor einem liegt, weshalb man dauernd auf etwas hin lernen, trainieren, sich optimieren muss, lebenslang. Wir haben, wie ich schon in meinem »Nachruf auf mich selbst« geschrieben habe, kein Training im Aufhören, wohl aber ein komplettes Fitnessprogramm im unablässigen Weitermachen, das uns so in Atem hält, dass wir auf das Innehalten gar nicht mehr kommen.
Der weitgereiste und weise Claude Lévi-Strauss schrieb schon vor vielen Jahrzehnten: »Wenn der Regenbogen der menschlichen Kulturen endlich im Abgrund unserer Wut versunken sein wird, dann wird – solange wir bestehen und solange es eine Welt gibt –, jener feine Bogen bleiben, der uns mit dem Unzugänglichen verbindet, und uns den Weg zeigen, der aus der Sklaverei herausführt und dessen Betrachtung dem Menschen die einzige Gnade verschafft, der er würdig zu werden vermag: nämlich den Marsch zu unterbrechen, den Impuls zu zügeln […], jene Gnade, nach der jede Gesellschaft begehrt, wie immer ihre religiösen Vorstellungen, ihr politisches System und ihr kulturelles Niveau beschaffen sein mögen; jene Gnade, in die sie ihre Muße, ihr Vergnügen, ihre Ruhe und ihre Freiheit setzt; jene lebenswichtige Chance, sich zu entspannen, loszulösen, das heißt die Chance, die darin besteht […], in den kurzen Augenblicken, in denen es die menschliche Gattung erträgt, ihr bienenfleißiges Treiben zu unterbrechen, das Wesen dessen zu erfahren, was sie war und immer noch ist, diesseits des Denkens und jenseits der Gesellschaft: zum Beispiel bei der Betrachtung eines Minerals, das schöner ist als alle unsere Werke; im Duft einer Lilie, der weiser ist als unsere Bücher, oder in dem Blick – schwer von Geduld, Heiterkeit und gegenseitigem Verzeihen –, den ein unwillkürliches Einverständnis zuweilen auszutauschen gestattet mit einer Katze.«[1]
Nein, wir sind nicht trainiert im Vergegenwärtigen, wir lassen uns trainieren im Enteilen, im Nicht-sich-Aufhalten, im Abwesend-Sein. Man könnte sich Leistungssportlerinnen zum Vorbild nehmen, die nach dem Ende ihrer Karriere erst mal eine Weile »abtrainieren« müssen, um ihren Körper auf weniger Leistung umzustellen. Wir müssen alle erst mal abtrainieren, aus dem Überstreben kommen. Oder, wie Odo Marquard gesagt hat, lernen, »sich unterbieten zu dürfen.«[2]
Vielleicht sollte man, statt wie Mister Pief immer schon anderswo sein zu wollen, diese Welt betrachten wie bei einer Reiseführung, auf der man staunenswerte Dinge dort entdeckt, wo man vorher gar nichts sah. Gegenwartsutopien.
Ein Reiseführer
In der Erzählung »Stadtführer Berlin« beschreibt der 1899 in Sankt Petersburg geborene und in den 1920er Jahren als Exilant in Berlin lebende Vladimir Nabokov sehr alltägliche Dinge, also solche, die nie in Stadtführern Erwähnung finden. Denn diese sollen ja auf das Außergewöhnliche aufmerksam machen, die besonderen Gebäude, die spektakulären Türme oder Kirchen, die sensationellen Brückenbauwerke oder Museen. Auf das, was man »gesehen haben muss«.
Nabokov dagegen schreibt über die Straßenbahn, über Bauarbeiten, Schnee auf herumliegenden Röhren und andere gewöhnliche Dinge, also über die Grundierung des Lebens in der Stadt, die so alltäglich ist, dass sie niemand registriert. Das Selbstverständliche scheint der Aufmerksamkeit nicht wert. Aber gerade das schreibt der Erzähler auf, weil, wie er meint, gerade in der Beschreibung des Alltäglichen dessen zukünftige Bedeutung »in hundert Jahren« sichtbar wird – »jede Einzelheit«, schreibt er, »wird dann Wert und Bedeutung haben: die Schaffnertasche, die Reklame über dem Fenster, die besondere Schüttelbewegung, die sich unsere Urenkel vielleicht vorstellen werden – alles wird geadelt und gerechtfertigt sein durch sein Alter.«
Also schreibt Nabokov über die Trambahn und den Schaffner: »Der Schaffner, der die Fahrscheine ausgibt, hat sehr eigenartige Hände. Sie arbeiten so flink wie die eines Pianisten, aber sie sind nicht schlaff und schweißig und haben auch keine weichen Nägel, sondern sind so grob, dass einen eine Art moralisches Unbehagen überkommt, wenn man ihm Kleingeld in die Hand schüttet und dabei die Haut berührt, der ein derber Chitinpanzer gewachsen zu sein scheint. Trotz ihrer Derbheit und der dicken Finger sind es überaus rührige und tüchtige Hände. Neugierig verfolge ich, wie er mit dem breiten schwarzen Fingernagel den Fahrschein festklemmt und ihn an zwei Stellen knipst, in der Ledertasche wühlt, Wechselgeld herausfischt […]. Und die ganze Zeit über schaukelt der Wagen, die Fahrgäste im Gang greifen hoch nach den Halteriemen und schwanken hin und her – doch er lässt kein einziges Geldstück fallen, keinen einzigen vom Block abgerissenen Fahrschein.«[1]
Abb. 2: Sinfonisch sehen. Sich vergegenwärtigen.
So geht das in der gleichen Genauigkeit weiter, etwa wenn der Erzähler bemerkt, jemand habe »mit dem Finger ›Otto‹ in den Streifen jungfräulichen Schnees geschrieben, und mir schien, dieser Name mit seinen beiden weichen Os, die das sanfte Konsonantenpaar flankieren, passe wunderbar zu der stillen Schneeschicht […]«. Oder einen Transporter, der Fleisch anliefert: »[…] die chromgelben Tierkörper mit rosa Flecken und Arabesken, die auf einem Lastwagen gestapelt sind, und der Mann mit der Schürze und der Lederkapuze mit ihrem langen Nackenschutz, der Körper für Körper auf den Rücken wuchtet und ihn vornübergebeugt über den Bürgersteig in den roten Laden des Fleischers schleppt.«
Abends dann sitzt der Erzähler in einer Kneipe, die er ebenfalls sehr eingehend beschreibt. Er trinkt dort zusammen mit einem Begleiter, der murrt, dass all dies doch keinen Menschen interessiere und dass der Erzähler ein mieser Stadtführer sei. Der aber macht ungerührt weiter: »Die Kneipe, in der wir sitzen, besteht aus zwei Räumen, einem großen und einem etwas kleineren. Ein Billardtisch befindet sich in der Mitte des größeren; in den Ecken stehen ein paar Tische; gegenüber vom Eingang ist die Theke, und hinter ihr sind Regale mit Flaschen. Zwischen den Fenstern hängen Zeitungen und Illustrierte, in kurze Holzstäbe geklemmt, wie Papierfahnen an der Wand. Ganz hinten ist ein breiter Durchgang, durch den man ein vollgestelltes kleines Zimmer mit einer grünen Couch unter einem Spiegel sieht, aus dem ein ovaler Tisch mit karierter Wachstuchdecke herausfällt und seine feste Position vor der Couch einnimmt. Jenes Zimmer gehört zu der bescheidenen kleinen Wohnung des Gastwirts. Dort sitzt seine Frau mit welken Zügen und großem Busen und füttert ein blondes Kind mit Suppe.«
Die Beschreibungen des Erzählers werden immer wieder unterbrochen von dem mürrischen Begleiter, der sich umschaut, dies alles aber in seiner Bedeutung nicht sieht und verständnislos fragt: »Was gibt’s denn da zu sehen?« Unbeeindruckt fährt der Erzähler fort: »Dort unter dem Spiegel sitzt immer noch das Kind […]. Doch jetzt blickt es zu uns herüber. Von seinem Platz aus kann es die Kneipe sehen – das grüne Eiland des Billardtisches, den Elfenbeinball, den es nicht berühren darf, den metallischen Glanz der Theke, zwei dicke Lastwagenfahrer an dem einen Tisch und uns beide an dem anderen. Es hat sich längst an diese Szene gewöhnt, ihre Nähe macht ihm nichts aus. Eines jedoch weiß ich. Was immer ihm im Leben auch zustoßen wird, immer wird es sich an das Bild erinnern, das es aus dem kleinen Zimmer, in dem es seine Suppe bekam, in seiner Kindheit Tag für Tag sah. Immer wird es sich an den Billardtisch erinnern und an den abendlichen Gast, der seine Jacke abgelegt hatte und den spitzen weißen Ellenbogen nach hinten streckte, wenn er mit seiner Queue auf die Kugel zielte, und an den blaugrauen Zigarrenqualm, den Lärm der Stimmen, meinen leeren rechten Ärmel und mein narbenbedecktes Gesicht und den Vater hinter der Theke, der mir ein Bier zapft.«
Unglaublich: Der Erzähler beobachtet und beschreibt, was in dem Blick des Kindes wie im Spiegel seiner eigenen Perspektive erscheint – eine höchst kunstvolle Schilderung, präzise angesiedelt zwischen Beschreibung und Imagination. Die das Innenleben des Kindes betrifft, dessen Außenleben durch die beiden Räume der Kneipe und das, was sich darin abspielt, definiert ist. »Die Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt« heißt ein frühes Buch von Peter Handke, und dieser Titel scheint aufzurufen, was Nabokov hier erzeugt – ein eigentlich unmögliches Bild, eines, das es nur erzählerisch gibt: das unendlich reflektierende Spiegelkabinett unseres Bewusstseins. »›Ich begreife nicht, was du da siehst‹«, sagt nun der Begleiter wieder, und der Erzähler schließt: »Ja was auch! Wie kann ich ihm begreiflich machen, dass ich jemandes künftige Erinnerung geschaut habe?«[2]
Diese Erzählung über die Gründung einer Erinnerung hat mich elektrisiert, als ich sie zum ersten Mal gelesen habe, und sie hat mich nie wieder losgelassen. Denn man kann sofort nachvollziehen, dass hier für das Kind ein Erinnerungsraum entstanden ist, den es rückblickend immer wieder betreten kann und wird. Und dass es andererseits eben möglich ist, sich in die Perspektive eines anderen, ganz und gar unbekannten Menschen hineinzuversetzen, nur weil man sehen kann, was er sieht.
Das ist doch sehr erstaunlich, und dass man auf diese Weise tatsächlich sehr konkret in die Zukunft schauen kann, obwohl das dem menschlichen Wahrnehmungsvermögen glasklar und eindeutig unmöglich ist, ist noch erstaunlicher. Nabokov legt hier auf wenigen Seiten eine Erkenntnistheorie zu Raum, Zeit und Zukunft vor, die keine Wissenschaft je beweisen könnte. Die aber trotzdem stimmt, das ist ja klar. Dieser zugleich wirkliche und unmögliche Traumpfad zwischen Raum und Zeit sollte uns auf die Bedeutung von unterschiedlichen Räumen im Haus der Gefühle einstimmen, wobei es relativ egal ist, ob es diese Räume tatsächlich gibt. Denn niemand von uns könnte prüfen, was an der 100 Jahre alten Erzählung von Nabokov stimmt und was nicht, ob es diese Kneipe, dieses Kind je gab. Oder nicht. Wahr ist sie auf jeden Fall, diese Erzählung, und das wissen wir, weil wir sie kennen.
Vertrauen
Die moderne Entwicklungspsychologie hat in enormer Weise von der sogenannten Bindungsforschung profitiert. Sie entstand in der Zeit des Zweiten Weltkriegs, ausgehend von den Pionierarbeiten des ursprünglich von der freudschen Psychoanalyse herkommenden britischen Kinderpsychiaters John Bowlby, der sich mit der Frage beschäftigte, wie wichtig die Bindungen zwischen Kindern und ihren Bezugspersonen für das spätere Leben und die psychische Gesundheit der Kinder sind. Dieses Thema ist für die Frage von ganz entscheidender Bedeutung, ob man sich von seinem Haus der Gefühle aus aufmachen kann, um etwas Neues anzupacken, etwas Falsches richtig zu machen oder etwas zu entdecken, was zuvor unentdeckt war.
Kurz gesagt geht es bei Bindung um die emotionale Beziehung zwischen einem Kind und seiner wichtigsten Bezugsperson. Die Forschung dazu wurde ursprünglich von der sehr handfesten Beobachtung in den 1940er Jahren geleitet, dass kleine Kinder, die wegen der Kriegsfolgen von ihren Eltern getrennt wurden, ganz erheblichem Stress ausgesetzt waren und sehr schwer damit zu kämpfen hatten. Das ist nichts Überraschendes. Wir alle wissen, wie belastend Trennungserfahrungen für ein Kind sein können, etwa durch einen Krankenhausaufenthalt oder den Verlust eines Elternteils. Eine solche Trennung stellt das sichere Hintergrundgefühl, dass die Welt in Ordnung und man in ihr gut aufgehoben ist, stark auf die Probe. Tatsächlich bildet eine sichere Bindung das notwendige Fundament für das, was man »Urvertrauen« oder auch »Weltvertrauen« nennt. »Sicher« gebunden zu sein, bedeutet, dass etwa ein einjähriges Kind »weiß«, dass die Mutter zurückkommen wird, wenn sie das Zimmer verlassen hat. Und dass es sich genau deshalb auch auf andere Personen einlassen kann, die auf es aufpassen oder sich mit ihm beschäftigen, ohne in extremen Stress oder in Panik zu geraten.