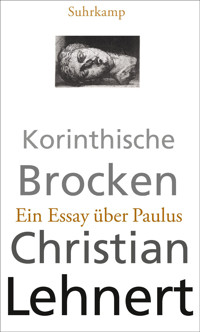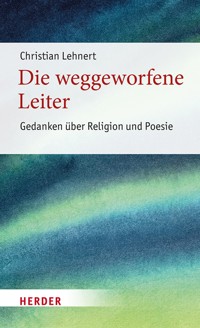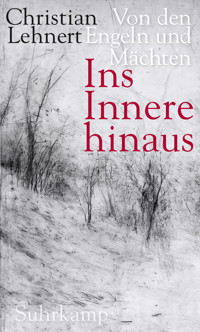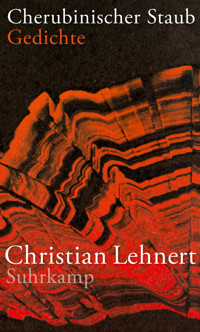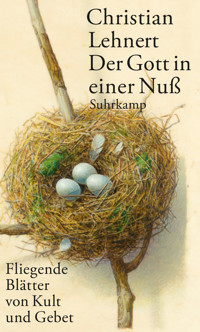21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
In einer Lebenskrise zieht sich der Erzähler in ein altes, halbzerfallenes Gehöft im Osterzgebirge zurück. Es wird ihm zum Ausgangspunkt für Gänge in eine Natur, die ebenso menschengemacht wie versehrt ist und ihm doch in kleinen Details wie eine Wildnis gegenübertritt. In der spirituellen Bewegung dieses Rückzugs sucht der Erzähler Orte radikaler Fremde auf. Er vermutet sie in einer religiösen Erfahrung, die alle Ordnungen und ideologische Sicherheiten durchschlägt; er fastet, er meditiert. Zur begleitenden Lektüre wird ihm die „Apokalypse des Johannes“, ein Grundtext der europäischen Kultur, der alle Beheimatung in der Welt ausschließt und religiöse Endzeiterwartungen genauso prägte wie die geschichtsphilosophischen Utopien der vergangenen Jahrhunderte mit ihren gefährlichen Denkfiguren der Zerstörung des Alten zugunsten des Neuen.
Das Haus und das Lamm ist erkundende, fragende Prosa im Grenzgebiet zwischen Erzählung, Essay und poetischer Bildlichkeit. In Narration und Reflexion, Realität und Imagination ringt sie um ein Verständnis des Bösen und des Leids und konfrontiert uns mit den oftmals beklemmenden Erscheinungen eschatologischen Denkens. Es zeigt sich: Diese sind bis heute wirksam – in den realen wie forcierten Weltuntergangsängsten unserer postreligiösen Gegenwart.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cover
Titel
Christian Lehnert
Das Haus und das Lamm
Fliegende Blätter zur Apokalypse des Johannes
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2023
Der vorliegende Text folgt der Originalausgabe, 2023.
© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2023
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner
Umschlagabbildung: Madeleine Heublein, SPUREN, 2018, Monotypie auf Bütten, © Madeleine Heublein, Reproduktion: Fabian Heublein
eISBN 978-3-518-77752-7
www.suhrkamp.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
DAS HAUS I
DAS LAMM I
DAS HAUS II
DAS LAMM II
DAS HAUS III
DAS LAMM III
DAS HAUS IV
DAS LAMM IV
DAS HAUS V
DAS LAMM V
DAS HAUS VI
DAS LAMM VI
DAS HAUS VII
DAS LAMM VII
DAS HAUS VIII
DAS LAMM VIII
DAS HAUS IX
DAS LAMM IX
DAS HAUS X
DAS LAMM X
DAS HAUS XI
DAS LAMM XI
DAS HAUS XII
LAMM XII
DAS HAUS XIII
DAS LAMM XIII
DAS HAUS XIV
Anmerkungen
Informationen zum Buch
Das Haus und das Lamm
DAS HAUS I
Am zwanzigsten Mai des zweiten Jahres, das ich hier oben im Gebirge verbrachte, früh bei Sonnenaufgang, als ich um den Hügel ging, sah ich am Bachufer an einer der Salweiden ein Blatt, das sich schnell hin und her drehte. Es hing an einem ungewöhnlich langen Stiel und flimmerte weiß und graugrün. Wechselnd wurden seine Ober- und die pelzige Unterseite sichtbar. Ich sah Helle und Verdunklung, sah die grüne Offenheit des Blattes für das Licht und seine Blässe im Schatten, erkannte das Ein- und Ausatmen des Baums darin wieder, sah das Blatt als Gestalt und als ein Verströmen. Ich spürte, wie wohl alles in einer doppelten Bewegung stand: Aufgestört und ruhend, in sich werdend und ins Andere getaucht, sich behauptend und sich fremd. Ich betrachtete die wächserne Haut des Blatts, seine dichte Behaarung, und ich sah darin eine Verwandlung – des Sonnenlichts und Taus und der Atmosphäre in einen lebendigen Leib. Ein Ganzes war die Welt in dem Blatt, nicht als Zustand, aber als ein Näherkommen. Da entdeckte ich auch Adern und die kleinen Punkte der Spaltöffnungen. Ich war gerettet für einen Tag.
Anfang Juni begann ich am Dach zu arbeiten. Die alten Balken mussten auf ihre Haltbarkeit überprüft werden. Sie waren mehr als zweihundert Jahre alt. Man hatte die schweren Fichtenstämme einst frisch verarbeitet, weil sie im Saft weicher und leichter zu schneiden waren, und Schädlinge müssen eingedrungen sein, welche die feuchten Rindenreste und die oberen Holzschichten zerfressen hatten. Andere Insekten waren ihnen gefolgt. Nun galt es zu schauen, ob die tragenden Kerne stark genug waren für das Dachgebälk, auch wenn heftigere Stürme kämen.
Unter dem Schlag der Axt rieselte aus den Sparren und Balken braunes Mehl. Ich beilte morsche Schuppen ab, bis im Inneren festes Holz stehen blieb, Skelettteile im Mürben, mal dicker, mal dünner. In manchen Winkeln des Dachstuhls krümmten sich am Ende unter den Latten nur einzelne Rippen wie schwebende Gewölbeelemente, gotische Muster im Zerfall. Die längst verlassenen Fraßgänge der Käferlarven durchzogen oftmals auch die noch beständig erscheinenden Teile. Selbst tiefer in den Stämmen befand sich dann nur noch weicher Mulm. Unter der Oberfläche fest erscheinender Hölzer wirkten unaufhörlich Kräfte der Auflösung, ein nagendes Nein in den Konstruktionen, das sich lautlos fortsprach, und es war mir, als würde das ganze bergende Haus als ein Staubwirbel davonwehen.
Wenn der Holzstaub in der Luft zu dicht wurde und im Hals brannte, öffnete ich die Dachluke, kletterte hinaus und blickte über die Gegend – über den Hügel nach Osten hin, der einen Tümpel und den Fahrweg verdeckte, über den kleinen eingefassten Teich im Westen und die Wiesen nach allen Seiten, wie ausgebreitete Schwingen, den Bachlauf dazwischen, wo die Weiden standen mit ihren krausen, zersägten Köpfen. Ich stieg höher auf die Trittbretter unter dem First, die für die Schornsteinfeger eingehängt waren. Der Stand in luftiger Höhe veränderte schlagartig die Wahrnehmung: Unter mir stand das Haus, fest und schwer wie ein künstlicher Berg aus Felsgestein und Stämmen, und ich spürte seine Beständigkeit trotz des Zerrinnens. Der alte Bau mit seinen kühlen Kellern über der Gründung, mit seinen Treppen und kleinen Fenstern, mit seinen Bruchsteinmauern und breiten Dielen erschien nun wie ein Bollwerk, ein mitfühlendes, seelenstarkes Gehäuse. Ich aber als sein Bewohner hatte mich tätig gegen den materiellen Verfall zu stemmen, hatte zu arbeiten bis zur Erschöpfung, war gerufen, dem hohlen Holz- und Steinleib zu dienen, und ich fragte mich am Abend über den Büchern: Warum werden auch Gedanken alt und Haltungen porös? Warum siedeln sich auch in geistigen Gestalten, in Weltbildern und Göttern und grundlegenden Überzeugungen, Zweifel und Unglaubwürdigkeit ein wie schmarotzende Pilze und Insekten in altem Gebälk? War nichts beständig außer der Notwendigkeit für Menschen, irgendwo zu wohnen?
Wenn ich mehrere Stunden mit dem Gebälk beschäftigt war, verschob sich etwas in mir. Das Beilen, die ungewohnte schwere Arbeit ließ mich die Grenzen meines Körpers anders empfinden. Die dicken Sparren, die unter das Dach griffen, wurden dann allmählich zu starren Fortsätzen meiner selbst. Während meine Hände emsig wirbelten, gab ihr Holz Befehle. Auch die Balkenansätze schienen bald in mich eingewachsen zu sein. Sie steuerten mich und die Richtung jedes meiner Hiebe. Ich war ihr atmendes Anhängsel, nicht mehr als ein Glied, ihr Organ. Tätig war das Dach – mittels meiner Körperkraft und meiner Gedanken.
Die Verwirrung setzte sich fort, wenn ich dann taumelig und erschöpft in der Küche saß und einen Kaffee schlürfte. Ich hatte die sicheren Bezugspunkte verloren: Was war außen, was war innen? Ich spürte eine absurde Umpolung: Der sich eben für einen Bewohner hielt, war plötzlich bewohnt vom Haus. Das Gebäude war in mir – mit seiner Konstruktion und seinen vielen Erinnerungen, seinen Geheimnissen, den Gängen und Kammern, den Schlafstätten und Nischen, den Regalen und den Truhen und den Kellern. So wurden wir beide miteinander still und spürten uns als Fremde, einer des andern Haus, einer des andern Vorstellung, gar dessen Traum.
Jemand macht die Tür auf für die letzten Dinge.
Im ersten Sommer hier oben hatte ich Pappen ausgelegt, die ich mit altem Kompost und Steinen beschwerte. Die zerlegten Kartons fand ich in der Scheune auf dem Heuboden zu einem riesigen Stapel geschichtet. Die alte Bäuerin, die hier bis zu ihrem Tod vor sieben Jahren gelebt hatte, musste Pappen von Postsendungen aller Nachbarn gesammelt haben, vermutlich, um sie im Winter zu verfeuern. Sie waren klamm und stockfleckig. Ich trug sie in die Sonne und breitete sie auf der blühenden Wiese aus.
Ich fühlte mich dabei wie ein Totengräber. Denn über die Sommerwochen würden im Dunkel darunter das Gras und der Löwenzahn und die Schafgarbe sterben. In der feuchten Wärme würden die Würmer und Nacktschnecken die Reste der Pflanzen zernagen und Pilzfäden die festen Halme und Wurzeln erweichen. Irgendwann brächen die Regenwürmer, Larven und Käfer durch die Papplagen, und der Humus quölle auf. Selbst die harten Stängel der Disteln würden gilben, würden blass werden wie Menschenfinger und sich schließlich verwandeln in ein makroskopisch körperloses Kriechen und Gären.
Die Erde hier vertrug kein Umgraben. Nur eine dünne Humusschicht, durchsetzt mit vielen Steinen, deckte eine feste Lehmplatte, durch die kaum die Spitzhacke drang, darunter war Geröll. So musste ich Beete anlegen, ohne die Pflanzennarbe zu entfernen. Das Töten war ein Anfang, ein Raumschaffen, schonende Öffnung für anderes. Ein Jahr später schon hatte ich mehrere fruchtbare Beete, wo Bohnen, Kartoffeln und Kürbisse wuchsen.
Wurzeln – die alte Metapher für etwas, was ich hier suchte? Bevor ich die in Töpfen gezogenen kleinen Kohlpflanzen eingrub, wog ich ihre weiße, erdige Haarpracht in der Hand. Die hängenden Fasern würden im Beet ausgreifen und Totes, die Moderreste des vergangenen Pflanzenjahres, und den tieferen Lehmgrund durchlässig für das Kommende machen, sie würden die Zeiten vermengen, ihr Wuchs wäre ein Tausch. Doch die Wurzeln vermischten nicht nur Beginn und Verlöschen, sondern auch Licht- und Erdraum. Über Wochen verströmend an ihrem Ort sollten sie emsige Schmuggler sein von oben nach unten und umgekehrt. Ein feines System von Gängen und Schächten würden sie durch den Bergboden ziehen. Dann saugten sie Nässe aus der Tiefe herauf ins Blattwerk. Sie trügen im Gegenzug das verwandelte, Pflanzenleib gewordene Tageslicht ins Erdreich und ins Geröll hinunter. Wuchernd sollten die zarten Grünkohl- und spirrligen Kohlrabiwurzeln die Sonne im Finstern abbilden. Denn wie ihr Geflecht sich nach dem Erdmittelpunkt orientierte, so die Blätter und Stängel nach dem Himmel. Paariges Wachsen: des Feuers in die Erde, der Erde ins Licht. Ist die Lebensachse der Pflanzen die Vertikale? Und ich, als ein Mensch, als ein immer Fluchtbereiter, fließe vor allem aus, weiß wenig vom Dunkel und wenig vom Hellen und viel von den vorübergehenden Zuständen, den Passagen mit offenem Ausgang, dem Dämmern, dem flächigen Treiben der Erscheinungen?
»Alles Reden ist so voll Mühe, dass niemand damit zu Ende kommt. Das Auge sieht sich niemals satt, und das Ohr hört sich niemals satt. Was geschehen ist, eben das wird hernach sein. Was man getan hat, eben das tut man hernach wieder, und es geschieht nichts Neues unter der Sonne.«1
Der biblische Weisheitsprediger Kohelet meinte, dass die Zukunft kein schwarzes Loch sei, von dem wir nichts wüssten, weil nichts daraus zu uns, die wir uns auf einem Zeitstrahl vorwärtsbewegten, herüberdränge, sondern sie sei die Wiederkehr dessen, was immer schon da gewesen ist.
Wer aber kann wissen, was schon da gewesen ist?
Derjenige nur, der mit dem Unerwarteten rechnet, mit dem plötzlichen Ereignis, das alles verändert. Das Kommende springt uns von hinten an.
Der Wald ist beseelt (ein Hilfswort); von allen Seiten wurde ich beim morgendlichen Spaziergang angeschaut. Die Amseln musterten mich unverhohlen. Zweige tasteten nach mir. Auch die Birken, die sich in zugiger Kühle wiegten, waren zumindest am Rande mit mir beschäftigt, während sie ihre ersten grünen Blätter ausfalteten. Selbst der Dunst aus den Niederungen hatte es auf mich abgesehen. Ein beharrliches Nachstarren, das mir folgte bis zum Bachlauf – grauschwebende Lider, moosgrüne Iris, weiße Glaskörper der Kiesel, Wolkenbrauen.
Wurde ich beargwöhnt? Wurde ich empfangen?
»Wenn du reinen und gerechten Sinns über die Felder gehst, dann kommen von allen Steinen und allen wachsenden Wesen und allen Tieren die Funken ihrer Seelen zu dir und heften sich an dich, und dann werden sie gereinigt und werden zu einem heiligen Feuer in dir«, so wird ein Ausruf des Chassiden und Sehers Jaakow Jizchak von Lublin überliefert.
Reinheit des Sinns, damit war es bei mir nicht weit her. Denn meine Offenheit für das, was um mich geschah, war zu schnell erloschen, verkümmerte im Dusel der alltäglichen Pläne und Sorgen. Kein heiliges Feuer – nur ein halbbewusster Schwelbrand. Denn ich musste schon wieder an die kleinen schwarzen Borkenkäfer im Wald denken, die Buchdrucker, die in den Fichten fraßen, und ich berechnete die Stunden, die ich brauchen würde, um die frisch befallenen und gefällten Stämme wenigstens teilweise zu zersägen und zu entrinden und damit den beinlosen wimmelnden Larven die Nahrungsgrundlage zu nehmen. Ich plante den Tag – da war ich schon wieder verschlossen in der Zeit. Wie sehr ich mich auch erneut mühte, meine Blicke trafen nur noch auf Gegenstände und Lebewesen, deren Namen ich kannte und deren Farben und Oberflächen im morgendlichen Licht flimmerten und die doch so undurchdringlich waren wie ich mir selbst.
DAS LAMM I
Da Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus heraus und setzte sich auf den Richterstuhl an der Stätte, die da heißt Steinpflaster, auf Hebräisch Gabbata. / Es war aber der Rüsttag für das Passafest, um die sechste Stunde.
(Johannesevangelium 19,13-14)
AUF DEM RICHTERSTUHL. – Der Augenblick, in dem Geschichte und Ewigkeit ineinanderfallen, hat nach christlichem Verständnis die Gestalt einer krisis. Das griechische Wort steht für einen Gerichtsprozess. Darin wird für und wider gesprochen, angeklagt, verteidigt und verurteilt.
Rascheln; trockenes Blattwerk bewegte sich am Boden zwischen Dornenstauden und Steinen in dem Areal, wo sich einst die römischen Wehranlagen in Jerusalem und das Prätorium, der Sitz des Statthalters Pontius Pilatus, erhoben. Ein Windstoß hatte mir, einem Passanten am Rand der Altstadt zum Kidrontal, das Laub in die Passionsgeschichte geweht. Ich sah es vor Jahren bei einem Stadtgang, und das Bild ist mir aus Gründen, die ich nicht kenne, unvergesslich: Ein Wühler, ein erdgrauer Vogel, vergrub seinen Kopf in den Blattresten, pickte und schlug mit den Flügeln, sprang über die ausgewehten Wurzeln eines Ginsters. Flaum fand er, eine Flocke, ein paar Fasern für ein Nest, und er flog auf.
Auf der Richtstätte, dem Steinpflaster, »auf Hebräisch Gabbata«, traten das Gewebe der geschichtlichen Ereignisse und der Umraum ihrer Bedeutungen, das Irdische und das Geistige, das Politische und die Transzendenz, die Jahre und das Zeitlose, die Ordnung der Wirklichkeit und das unvordenkliche Wunder einander gegenüber: »Pilatus setzte sich [griechisch: ekathisen] auf den Richterstuhl.«
Die frühsten Erzählungen von Jesus aus Nazareth, Leidensgeschichten als Kerne und Keime der Evangelien, stellen Bilder auf vor einem Abbruch ins Unsichtbare. Machtgewichtig hatte sich der Prokurator auf dem Stuhl niedergelassen, gesäumt von Wachen wie von einem metallenen Rahmen. Er ruhte im anbrandenden Geschrei der Menge, schrillen Rufen: »Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht.« Und wenig später: »Weg, weg mit dem! Kreuzige ihn!«2 Nach welchem Gesetz? Einem irdischen, das eine Rechtsordnung abbildete und eine bestimmte politische Stabilität, Normen und Machtbalancen beschrieb? Einem göttlichen, das den Menschen zu einem irrationalen Gehorsam rief vor einer Instanz, die nicht begründet und nicht ableitbar und keinem Zweck unterworfen war, sondern gesetzt, weil eine Gottheit sich zeigte? Aber wie stand es um die Gültigkeit des einen wie des anderen Gesetzes für jenen elenden »König« im blutgetränkten Purpurmantel, der augenscheinlich aus allen Zusammenhängen gefallen war?
Kreuzigungen waren im römischen Recht vorgesehen für politisch motivierte Straftaten. Aber handelte es sich hier um ein solches Delikt? Ja, überhaupt um eine Straftat? Ging es nicht allein um innere religiöse Angelegenheiten, Auslegungsfragen von Texten, Streitigkeiten zwischen Lehrern eines jener vielen östlichen Kulte, die sich im Reich begegneten? Um einen »König der Juden«, dessen Königtum aber gar nicht politisch gemeint, dessen »Reich nicht von dieser Welt« sei? Oder doch – nur in einem verwickelteren Sinne?
Pilatus saß und kalkulierte. Der Stuhl Roms stand hier auf dem Jerusalemer Steinpflaster, auf Gabbata, nicht wirklich fest. Er kippelte. Das wusste Pilatus, und deshalb hielt er vorsorglich still. Er hatte, das galt es festzuhalten, die kaiserliche Macht durchzusetzen, sein Leib war ein provinzieller Wurmfortsatz des Kaisers und seine Würde auf diesem kleinen Thron geliehen. Das unruhige Grenzland Judäa mit seinem rauen Klima stand, so hatte es der bedächtige Diplomat mehrfach erfahren, in einer theokratischen politischen Tradition, die eine Übereinkunft mit dem Kaiser als göttlicher Sonne über der menschenbewohnten Welt schwer machte. Eine fragile Balance zwischen den religiösen Juristen, den Lokalpolitikern um den Hohepriester in Jerusalem und den römischen Behörden war gefunden und doch ständig gefährdet durch die mangelnde Akzeptanz beider Instanzen im verelendeten, von skurrilen Jenseitshoffnungen durchseuchten Volk. Dort träumte man von einem neuen Äon und einem endzeitlichen Herrscher, dem neuen »Daviden«, einem Priester und König, vor dem alle Nationen, auch die übermächtigen Römer, sich bald verneigen würden. Dort brodelten religiöse Energien (die noch nicht weltanschaulich segmentiert und privatisiert werden konnten, wie es neuzeitliche Herrschaftsdiskurse in derselben Lage täten): Sie gärten diffus, verwandelten sich ständig, bildeten kochende Schäume und Blasen, schlugen in Wellen gegen die Klippen und Türme der Macht, drohten jederzeit außer Kontrolle zu geraten.
Neben Pilatus auf der steinernen Bühne, still im Erscheinen und doch ikonisch übergroß, stand der Christus. Er war kein Akteur, war taumelnder Leib, blutblind: »Sehet, der Mensch!« Gegeißelt, dass ihm die Haut in nässenden Fetzen von Rücken und Gliedmaßen hing, geschlagen, nackt, doch notdürftig mit dem Purpurgewand eines Thronanwärters angetan und mit einem Dornengeflecht gekrönt. Er blutete an Stirn und Schläfen.
Der »König von Israel« – neben dem sinnenden römischen Kaisermedium. Kreise der Machtdeutung verfingen sich: Da waren das römische Recht und Reich und das jüdische Gesetz, da war die messianische Hoffnung auf einen wahren endzeitlichen Herrscher, da war die lokale Obrigkeit rund um den Hohepriester, die einerseits Souveränität, anderseits polizeiliche Unterstützung von Rom verlangte, da war der angeklagte Rabbi, dessen Herrschaft »aus der Wahrheit« sei … Doch was sollte hier in diesem Durcheinander der Ebenen Wahrheit sein? Jedenfalls behauptete der vermeintliche Delinquent hartnäckig und in naiver Selbstgefährdung, dass die kaiserliche Macht, die Pilatus auf dem Richterstuhl verkörperte, nicht absolut, nicht göttlich, sondern abgeleitet sei: »Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre.«
Man könnte das griechische Verb ekathisen mit etwas Phantasie auch transitiv verstehen. Die Grammatik gäbe die Möglichkeit her, und vielleicht schillerte der Satz gar in den Ohren seiner griechischsprachigen Hörer. Dann veränderten sich schlagartig die handelnden Subjekte3: Pilatus »setzte ihn auf den Richterstuhl …«. Und er, bleich und benommen, mit einem Rohr wie einem Zepter in der Hand, der Rabbi und König, hockte da – als der Richter in der Verspottung? Als der eigentliche Richter? Als die Verkörperung einer unfasslichen, einer unzeitlichen, aber doch höheren Instanz? Oder doch nur als die Karikatur eines Sektenführers mit haltlosem Anspruch?
Das Johannesevangelium baut in seiner Erzählung von der Verurteilung Jesu eine Szenerie auf, die schrill und absurd ist – eine doppelte Gerichtsverhandlung, eine Spiegelkammer von Urteilen ohne verbindende Rechtsgrundlage, ein juristisches Enigma.
Dabei betrifft der Akt beide – die weltliche Macht und den Gott in seinem Heilsplan, seinem Erscheinen in der Zeit. Beide richten und werden gerichtet. Die römische Rechtsordnung wird in ihrer Gültigkeit angefragt. Der Gott aber liefert sich aus, wie seine Häscher Jesus »auslieferten«, griechisch: paredokan, und die lateinische Vulgata schreibt dafür bezeichnenderweise: tradiderunt, der todgeweihte Gefangene wird so zur »Tradition«.
KRISE. – Krisis, das Gerichtsverfahren: Zwischen Schuld und Unschuld fällt im Moment eine Entscheidung, die das, was war, und das, was folgt, in seiner Bedeutung festlegt. Spruch des Richters: Das ist es. So endet die Krise.
Krisis, das griechische Wort steht auch für eine Phase in einem Krankheitsverlauf. Dann ist es ernst geworden, und es entscheidet sich, ob ein Mensch stirbt oder zurückfindet in sein Gleichgewicht. Krisis, ein Grat in der Zeit, an dem sich das eine vom anderen scheidet, messerscharf ist er durch den chronos gezogen.
In den Prophetenbüchern und im Neuen Testament steht die ganze Menschheitsgeschichte immer wieder und fortwährend gefährlich auf der Kippe. Von einem Urteilsspruch her soll sich zeigen, was das Gewesene bedeutet und welche Zukunft ihm eigen ist, en hemera kriseos, am Tag des Gerichts. Was aber ist das für ein Tag, an dem sich die Zeit wendet und sich als Ganze zeigt, wenn sich das Kommende wie die Vergangenheit in einer unzeitigen Gegenwart, einem Augenblick, verwirklichen? Hat dieser Tag ein Datum? Kann er jenem Zeitlauf angehören, den er aufhebt?
Krinein, das altgriechische Verb im Wortinnern der krisis, konnte »sondern«, »scheiden«, »sichten«, auch »auswählen« bedeuten. Die Verwendung in der Rechtssprache lag nahe, wurde hier doch »gesichtet« und »gesondert« in der Unterscheidung von Rechtmäßigkeit und Unrecht anhand von einem kriterion, einem Richtmaß. Der Akt der Urteilssprechung setzt Recht – und er verwirklicht Recht. So kommen dem Verb auch früh semantische Beiklänge zu, Obertöne, die man mit »streiten«, »urteilen«, »bestimmen« ins Deutsche übertragen kann. Die Krise der Welt, wie sie die Bibel immer wieder beschwört, besteht in einer Anklage und einer Verteidigung und einer Entscheidung durch einen Rechtsspruch. Dabei ist eine Instanz mitgedacht, die den beiden streitenden Parteien äußerlich ist, sie bildet eine andere Sphäre, einen Ort, von dem her sich das eine vom anderen erst unterscheidet. Lawinenartig stürzt das Wort krisis hier in mythische Tiefen: Wer klagt die Schöpfung und das Leben an? Fordert den Tod? Wer verteidigt sie? Und wer ist der Dritte, äußerlich den beiden?
Bezeichnend ist, wie das Hebräische (die grobe lexikalische Entsprechung für krisis lautet mischpāt) die Semantik etwas anders einfärbt. Herrschen und Richten werden im alten Israel kaum unterschieden – eine Erbschaft der nomadischen Stammeshierarchie. Der politische Machthaber war auch Herr des Rechts, als vollkommener Souverän, im Ideal getragen von der Zustimmung des Volkes und legitimiert durch göttliche Berufung. Mose, das Urbild, war Offenbarungsmittler, politischer Führer und höchster Richter in einer Person. Selbst die Priester, welche die überlebenswichtigen Opferrituale vollzogen, waren von ihm abhängig, besaß er doch allein das Wissen um die von Gott anerkannten kultischen Ordnungen. Nach diesem mosaischen Vorbild traten die »Richter«, charismatische Heldengestalten, in Israels Frühzeit auf. Ein reichliches Jahrtausend später nahm im alten Arabien Muhammad dieselbe Rolle für sich in Anspruch – als Stammesoberhaupt der Umma, als Sprachrohr Gottes und letztinstanzlicher Jurist. Sein Tod und das Auseinanderfallen der Gewalten waren das Geburtstrauma des institutionalisierten Islam.
Solcherart mehrdimensionale Souveränität war stets abgeleitet – der nomadische Richterfürst stand nicht für sich selbst. Er war als Mensch ein Fremder und sich in seiner Existenz entzogen. Denn das Attribut des Richters war letztlich mit dem des Göttlichen verbunden, im Alten Testament wie im Koran – und entsprechend erschien der Gott selbst als ursprüngliche juristische Person in doppelter Hinsicht: Er setzte Recht, und er vollzog es, er gab es und hütete es. Mose oder Muhammad waren seine Schatten. Ihr Richten war ein Auslegen und Umsetzen göttlicher Urteile. Wie Mazzeben, rohe Steinstelen in der Wüste, waren solche Menschenherrscher stets zuerst Zeichen, standen für etwas anderes als sie selbst. Sie thronten als Stellvertreter auf dem unzweifelhaften, aber unverfügbaren Grund offenbarten Rechts. Sie bezogen ihre Autorität aus ihrer Durchlässigkeit für das Andere. Wo immer sich Mose in seiner Eigenheit zeigte, die mehr war als Vertrauen ins Offene, mehr als transzendenter Feinsinn und Gehorsam, war etwas schiefgegangen, und es drohte Unheil.
Mit dieser Eigenheit verschiebt sich auch, kaum merklich doch bedeutsam, der mythische Tiefengrund der Rede von der krisis: Ihre Pole, Anklage und Verteidigung, verlieren an Eigenständigkeit, werden wie Teilchen hineingezogen in ein starkes Massefeld, in den Spruch des richtenden Herrschers, werden zu Aspekten des einen Wesens, der thronenden Allmacht. So offenbart sich – angesichts einer Schöpfung auf der Anklagebank – eine krisis im Innern der Gottheit selbst. Gegensätzliche Kräfte werden im Ungrund wach. Denn der Gott sucht heim in tödlicher Konsequenz: »Ich habe dies Volk gesehen. Und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und ich sie verzehre …«4 Derselbe Gott erbarmt sich und hat Mitleid bis zur Selbstaufgabe: »HERR, HERR, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue …«5 Beide, der Vernichtungswille und die schützende Gnade, sind Ausdruck des einen göttlichen Rechtswillens, mischpāt. In der unerträglichen Spannung liegt eine Grundkraft biblischer Mythologie und Denkbewegungen.
Vordergründig aber ist in der Bibel das eigentliche Krisengeschöpf der Mensch. Wird er leben? Wird er sterben? Wird er gerettet? Wird er vernichtet? In jedem Augenblick seiner Existenz stehen diese Fragen. Krisis, der Mensch ist krank zum Tode, und es ist doch noch nicht alles aus; er sitzt auf der Anklagebank, die Verbrechen sind unzweifelhaft und wiegen schwer, aber das Plädoyer der Verteidigung soll noch gehört werden.
Die krisis und ihre Verbseele krinein sind Lupenworte, ihr semantisches Brennglas bestimmte die Geschichtsschau im jüdisch-christlichen Europa und in der islamischen Welt. Sie trugen eine tiefsitzende Unsicherheit in die menschlichen Verhältnisse ein, ließen immer das Ende nahe sein, riefen zur entscheidenden Umkehr. Nur wohin? In dieser Frage verlor der neuzeitliche Mensch, indem er die christlich-antiken Symbolordnungen verließ, die Orientierung. So ist die Krise wohl nicht zufällig eine der häufigsten Metaphern in der politischen Sprache unserer Tage. Wohin man auch schaut, die Umstände kippeln wie der Richterstuhl des Pilatus. Dauernd ist es der letzte Moment der Entscheidung, krisis, und die Angst ist allgegenwärtig, mal geschürt, mal instrumentalisiert, mal versteckt gehalten, gärend. Aber was folgt? Der Weg zurück? Nach links? Nach rechts? Nach vorn?
Weltimmanent ist die Krise geworden, und weil dabei der Richterstuhl unweigerlich zum Schleudersitz wurde, trat das Ungewisse, das nie zu Fassende, die »Zukunft«, an seine Stelle. Sie ist eine windige, unstete säkulare Gottheit, doch heute von unbestrittener Popularität. Die ihr ergebene Moderne hielt sich immer nur auf einem Bein, hatte das andere gestreckt zum Schritt, und das gesellschaftliche Selbstverständnis war auf Erwartung aufgebaut, auf das Kommende, das ausstehende Andere. Strauchelnd, stolpernd, vor dem hohen Tribunal des unsicheren, mit starken Hoffnungen und Ängsten aufgeladenen Futurs wurde die Gegenwart zur hektischen Zwischenzeit. Immer dann floss Blut, wenn es jemand unternahm, sich als Stellvertreter des Kommenden auf den Richterstuhl zu setzen. Dann hallten die fernen Rufe: »Kreuzige! Kreuzige!« in unmittelbarer Nähe, dann schimmerte der Purpurmantel am Grund der Massengräber.
SEKUNDENSCHLAF. – Plötzlich sah ich in aller Deutlichkeit draußen vor dem Fenster ein Herz liegen. Zuckender Muskel, von dicken Adern umgeben und durchdrungen, pulste es auf einem flachen Stein, dampfte, und es wurde anscheinend schwer und schwerer, denn der Stein neigte sich, kippte, und das Herz rutschte in eine Ritze weichen Erdreichs. Sofort drückte es sich tiefer ein. Ich war müde, folgte dem Erdpuls. Das Herz verschwand allmählich, lag nun in einer Kuhle wie in einem Nest und schlug und schlug schneller, beruhigte sich aber wieder, sank tiefer. Es musste, so klein, wie es war, Tonnen wiegen. Die Mulde wurde zu einem Trichter. Der Boden gab nach. Ich war so müde, dass ich mich nicht mehr bewegen mochte. Die Schwerkraft hatte das Herz da draußen warm und fest gegriffen, und es barg sich nun ganz in der Erde. Aber es schlug noch immer laut, laut auch in meiner Brust, hoch zum Hals, in die Stirn. Dort entstand eine Strahlung. Ich verstand das nicht, aber die Schwere leuchtete wie das Nordlicht. Ich erwachte:
NACHTRAG AUS DER HERZTIEFE. – Über uns hängt das Gericht, krisis. Wir sind die Angeklagten vor dem Tribunal unserer eigenen Wünsche, die uns das Fürchten lehren.
HALLRAUM MÜNTZER: AUF! – Sind alle Heimat und Behausung ein Schlaf? Ein flüchtiges Träumen in der Kälte? Ich grub mit Spitzhacke und Spaten an einer Hausecke ein Loch in die Tiefe, um die Gründung zu erkunden. Sie ragte tief, doch wo immer ich auf einen Felsen zu stoßen meinte, erwies er sich bald als loser Bruchstein. Das Haus stand auf Geröll. In den Ritzen fand ich Käfer und deren Larven, verkrochen vor der Winterkälte, und ich stellte sie mir vor, wie sie sich im Herbst hinabgewühlt hatten, müde und unterkühlt, bis hinein in die weiche Höhlung unter einem Gneissplitter, und ein Dämmern war durch ihr Empfinden gezogen, womöglich wie ich es fühlte, wenn ich unter dem Federbett im Halbschlaf nach innen fiel, mich verlor, und es blieb der atmende Stoff, ein Körper in seiner Verletzlichkeit zurück. Die Käfer reagierten jetzt auf keine Berührung, nicht auf den wärmenden Hauch meines Mundes, nicht auf die Erschütterungen durch die Hacke.
Ist alles Bleiben Müdigkeit?
Da hallt’s plötzlich in mir, Worthiebe, hämmernde Sätze, ein widerstreitendes Triebwerk. Denn das Haus der Sprache zumindest scheint zum immer schnelleren Geschoss in die Zeit geworden zu sein. Kein Schlaf, das pure Gegenteil: Betriebslärm, Unruhe. Merke: Die Zukunft ist schon entborgen, ist verkündet, und sie wird groß, sonnengroß und strahlt. Das Alte verglüht als ein Schlackeflug – Brand des Gewesenen, Anbruch des Morgens. Die Vorstellung eines Fortschreitens im Rhythmus notwendiger Zerstörung und Erneuerung formte die Zeitläufte Europas seit dem Mittelalter. Das Ziel in den Blick zu nehmen, es zu identifizieren, war das Handwerk der Reformer und Revolutionäre. Heute ist es, nur ohne so viel Nachdenkens und nervöser, vielfach ein Job von Technikvisionären und Programmdesignern. Das Pathos ist schaler geworden, gedämpft, aber die Tonart ist doch noch immer die gleiche: Intensivierung des Vorfindlichen bis zum nächsten Qualitätssprung – Entgrenzung – Überwindung des Leides und des Todes. So klingt der Dreiklang des Menschen, der sein eigener Herr zu sein unternimmt und findig Optimierung sucht, wo sich das alte Mangelwesen noch breitmacht. Aber es gilt, nach vorn zu schauen.
»Wie lange slafft ir, wie lang seit ir Gott seins Willens nit gestendigk […] Ach, wie viel hab ich euch das gesagt, wie es muß sein, Gott kann sich anderst nit offenbaren, ir must gelassen stehen. […] Darumb huett euch, seid nit also vorzagt, nachlessig, schmeichelt nit lenger den vorkarten Fantasten, den gottloßen Boßwichtern, fanget an und streitet den Streit des Herrn!«6 Die neuzeitlichen Mystagogen, Seelenführer in die Zukunft, waren lange Zeit Schriftausleger, sie lasen aus dem Vergangenen einen tieferen Sinn und entzifferten die Chiffren des Ungeschehenen. Sie lauschten Prophetensprüchen und den Klangteppichen apokalyptischer Texte, suchten die Zeichen der Zeit, und sie schrieben ihre eigenen Visionen entlang der gefundenen Linien fort. Sie standen in Europa auf biblischem Grund und hatten eine messianische Mythologie verinnerlicht, welche Endzeit und die Geschichtsläufe punktverschweißt in einer krisis, im Kommen eines Erlösers zu Gericht und Rettung. So konnten sie munter über den Graben springen zwischen ewiger Wahrheit und geschichtlichem Ort, um anzukommen als Gläubige in der Zeit, genau an ihrem Tag, im Augenblick des Sprechens. Dort schrieb Thomas Müntzer am 26. April 1525 an die Allstedter und rief sie auf zu einem überzeitlichen Krieg, der als Zwitter aus politischen Forderungen und eschatologischer Erwartung anhob, und die Haufen der Bauern zogen los mit Spießen und Äxten und Heugabeln gegen die Fürstenheere. »O ho, wie reiff seynt die faulen opffel! O ho, wie morbe synd die außerwelten worden! Dye zceyt der ernde ist do!«7 – »Sehet nit an den Jhammer der Gottloßen. Sie werden euch also freuntlich bitten, greinen, flehen wie die Kinder. Laßt euch nicht erbarmen! […] Ir solt eich nit forchten. Ir solt diese große Menge nit scheuen, es ist nit euer, sondern des Herrn Streit. Ir seit nit, die da streiten, stellet euch vor mennlich. Ir werdet sehen die Hulfe des Herren uber euch.«8
Wie rückwärtsgewandt, noch tief im Mittelalter verwurzelt, erscheint Martin Luthers Widerspruch gegen Müntzer in den Bauernkriegswirren, sein Konzept einer klaren Trennung zweier Reiche, einer Sphäre göttlicher Sinngebung und einer politischen Welt, die sich Letzthorizonten pragmatisch enthalten muss. Müntzer ist längst woanders: »Nuhn dran, dran, dran, es ist Zeit, die Boßwichter seint frei vorzagt wie die Hund. […] Dran, dran, dieweil das Feuer haiß ist! Lasset euer Schwert nit kalt werden. Schmidet pinkepanke auf den Ambossen Nymroths, werfet ihne den Torm zu Bodem! Es ist nit mugelich, weil sie leben, das ir der menschlichen Forcht soltet lehr werden. Man kan euch von Gotte nit sagen, dieweil sie uber euch regiren. Dran, dran, weil ihr Tag habt, Gott gehet euch vor, volget, volget!«9
Wer kann sich diesem Rhythmus entziehen? Wer dem energetischen Sog solcher Sätze, die ohne Zweifel mehr als nur Worte sind, mehr als kalkuliert – hier weht ein anderer Wind, der einen Ursprung hat, der sich dem Sprechenden entzieht. Aber wohin treibt er?
Dahin, wo der Mensch sich, jenseits seiner selbst, erst selbst findet? Denn er steht aus? »Tausend Ziele gab es bisher, denn Tausend Völker gab es. Nur die Fessel der Tausend Nacken fehlt noch, es fehlt das eine Ziel. Noch hat die Menschheit kein Ziel. Aber sagt mir doch, meine Brüder: wenn der Menschheit das Ziel noch fehlt, fehlt da nicht auch – sie selber noch?«10 So einer, der wie Müntzer »mit dem Hammer« dachte, Friedrich Nietzsche.
Worum geht es in Müntzers Predigten? Um einen neuen Menschen? Um Politik oder um Gebet, um betendes Kriegshandeln, das Kommen Christi zu erflehen? Zu erzwingen? Thomas Müntzer spricht von einem Ende her, das er nicht kennt und doch kennt, denn es ist offenbart im Geheimnis, und im Geheimnis findet der aktivistische Mystiker seinen eigenen absoluten Ort.
Dieser frühneuzeitliche Gedankenembryo, Keimling einer theologischen Mutter und eines innerweltlichen Vaters, wuchs sich aus, seine Zellen teilten sich und teilten sich in einem tausendfachen Stimmengewirr über Jahrhunderte. Irgendwo höre ich, zufällig eher, einen einzelnen Sopran, erkenne ihn wieder in der Erinnerung an lange Schulstunden auf der letzten Bank in der Fensterreihe, Geschichte oder Staatsbürgerkunde, ich weiß es nicht mehr. Kaum merklich sticht er hervor, und ich lausche: »Es ist der letzte große Kampf, in dem es sich um Sein oder Nichtsein der Ausbeutung, um eine Wende der Menschheitsgeschichte handelt, ein Kampf, in dem es keine Ausflucht, keinen Kompromiß, keine Gnade geben kann.« Das rief Rosa Luxemburg ihren Anhängern zu, als sie im Dezember 1918 über »Nationalversammlung oder Räteregierung« sprach. Echos von Echos, und: »Die Revolution hat keine Zeit zu verlieren, sie stürmt weiter – über noch offene Gräber, über ›Siege‹ und ›Niederlagen‹ hinweg – ihren großen Zielen entgegen. Wir fußen heute, wo wir unmittelbar bis vor die Endschlacht des proletarischen Klassenkampfes herausgetreten sind, geradezu auf jenen Niederlagen, deren keine wir missen dürfen, deren jede ein Teil unserer Kraft und Zielklarheit ist«, so noch einmal Rosa Luxemburg in der »Roten Fahne« vom 14. Januar 1919.
»Zielklarheit« – das ist das Schlüsselwort. Aber das Ziel ist doch auch hier metaphorisch, ist ein Wink und eine Andeutung in der Gegenwart, und so ist diese »Klarheit« eine Verborgenheit, und genau daher hat sie ihre bestimmende Kraft.
Solcherart politisch eschatologischer Gestimmtheit fand und findet sich bis heute in den unterschiedlichsten und scheinbar gegensätzlichsten Tonfällen, rechts und links und religiös und atheistisch und liberal und grün und wissenschaftlich und esoterisch. Auch heutige Hirndesigner, die sich von technischen Manipulationen neuronal verstandener geistiger Möglichkeiten eine glänzende Zukunft erhoffen, Genforscher, welche die Substanz des Menschen zu optimieren versuchen und dem Altern und Sterben den Kampf angesagt haben, auch die Visionäre unterirdischer Vakuumröhren für den schnellsten und klimaneutralen Warenverkehr fast ohne Raumzeit-Widerstand, eines zum Augenblicksgeschehen intensivierten Welthandels, auch die Pioniere einer Besiedlung des Alls oder einer Entkörperlichung der Subjekte in künstlichen Speichermedien stimmen heute mit ihren – schwerer singbaren – rationalistischen Reihenkompositionen ein. »Wissenschaft« ist vielerorts zu einer eschatologischen Glaubensgestalt geworden.
Der »Zielklarheit« kommt das reale politische Geschehen niemals bei. Es ist kleinlich, dem ewigen Gedanken, dem »kommenden Reich« die kleine irdische Münze entgegenzusetzen – aber gezahlt muss sie sein. Ein Zeuge der Schlacht von Frankenhausen, wo sich die Bauernhaufen und die Söldner der Fürsten gegenüberstanden, schreibt: »Aber gestern, Montags zu Morgen, seint wir fruhe ufgewest. Haben sich die Paurn jensit die Stat […] in iere Ordnong geton, ein Wagenburg umb sich gemacht. Seint wir uf dier ander Seiten ins frei Felt gezogen. […] unser Geschutz mit gutem Rait den Berg hienauf bracht, das in sie gheen lassen. Do haben sie keinen Stant mehr gestanden, sondern gelaufen … Haben wir gefolgt und den merer Teil zwischen dem Berge und der Stat erstochen, aber etlich viel seint hienein komen. Haben wir zu Stond den Storm an die Statt auch angelauffen, dieselbe also in der Ile erobert und alles, was ergriffen, erstochen. […] Und seint uf dißmals uber 5000 Pauern erstochen und toidt plieben.«11
Ist damit das Ende benannt?
»Und als der Myntzer den Pauren drei tage nachainander gepredigt, were allwegen ein Regenbogen am Himmel umb die Sonen gesehen worden. Denselben Regenbogen der Myntzer den Pauren gezaigt und sie getrost und gesagt, sie sehen jetzto den Regenpogen, den Bund und das Zaichen, das es Got mit inen haben wolt. Si solten nur herzlich streiten und keck sein.«12
DAS HAUS II
Der Bachlauf vom Gebirge, der sich noch in heißesten Sommern gespeist hatte aus dem Hochmoor, war seit Tagen versiegt. Die Alten hatten das noch nie gesehen. Sie liefen morgens schon in der Frühe herbei, standen am Ufer und schauten. Stumm waren sie, gingen auseinander und kamen doch rasch wieder. Dann redeten sie wirr und aufgeregt vom Blutmond, der im Frühsommer aufgezogen war mit dem Mars in seiner unmittelbaren Nähe – ein Warnsignal, ein Bußruf? Und nun kam das Waldfieber? Vorbote von noch Schlimmerem? Sie waren mit den Wörtern nicht vertraut, aber sie hatten ein Grundwasserempfinden und eine Baumfühlung; die Lärchen und Fichten schrien nach Nässe.
Ich folgte auf meinem Gang mit dem Hund dem Tal bis an den Oberlauf des Baches, wo er sich in einen kaum merklichen sumpfigen Graben verwandelte, dann in ein Band dichteren Pflanzenwuchses von Schilfgras und Ampfer. Der Wald, dachte ich wieder, die Bergrücken und die Täler sind beseelt (und ich wiederhole: Das war ein Behelfswort). Indem ich dem Gedanken nachging, entlang der nun wasserlosen Quellen auf den Gebirgswiesen, franste er aus in wirre Fragen. Wer oder was käme im braunen Fichtendickicht sterbend zu sich selbst? Was oder wer atmete im Ostwind und spürte sich womöglich selbst im Verwehen? War die plötzliche Stille eben, so dicht, als wäre da etwas gewesen über dem Geröll im Grund zwischen den Wurzeln der Kriechweiden, doch nur Einbildung? Oder reagierte ich, unbewusst, worauf?