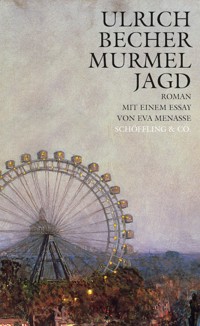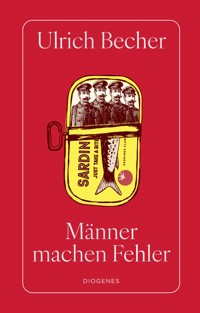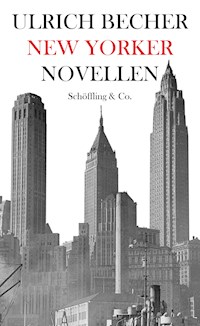14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling & Co.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Der Kampf der schönen Malerin Lulubé - die für wilde Fasnachtsbräuche, Stierkampf und vulkanische Inseln schwärmt - mit ihrem sanften, allzu vernünftigen Gatten Kerubin ist eine tragikomische Liebes- und Ehegeschichte, wie wir in der deutschsprachigen Literatur wenige haben. Hier wird von Lulubé erzählt, die während ihres Urlaubs auf einer südlichen Insel einem ›Wilden Mann‹ und auch einem Menschenhai begegnet, mit deren Hilfe ein frühes Trauma überwindet und schließlich ihren Weg findet und geht und dem Gatten schreibt: "Wenn einmal die Bogensehne meiner Leidenschaftlichkeit schlaffer hängen sollte, bin ich bereits gestorben. Ich ziehe aus, den wilden Mann zu suchen, der Deine Herzensgüte im Kopf hat und dazu das Herz eines Hais.""Das Herz des Hais" ist eine der großartigsten Liebesgeschichten, allemal gültig bleibt Peter Härtlings Votum: "Eine Erzählung wie die vom Haiherzen ist ein Geschenk." Der eigens für diese Ausgabe geschriebene Essay von Eva Menasse zeigt den aktuellen Blick auf einen Klassiker der deutschsprachigen Literatur."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
[Cover]
Titel
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
Eva Menasse: Ode an die unerschrockene Frau
Autorenporträt
Übersetzerporträt
Kurzbeschreibung
Impressum
Meinem Sohn Martin
1
In der deutschen Schweiz sind die Frauen sächlich. Nicht deshalb, weil sie zumeist im Diminutiv erwähnt werden (etwa das Fini statt die Josefine). Auch Männer werden im Diminutiv erwähnt (etwa der Heiri statt der Heinrich), doch bleibt ihr Pronomen dabei männlich. Von einer jungen oder jüngeren Frau spricht man als von einem ›Es‹ (während anderwärts im deutschen Sprachraum ›Das Weib‹ veraltet ist, nur noch bei Priestern und Schimpfern im Kurs steht). Von einer Matrone oder Greisin aber sagt man ›sie‹; erst das Altern oder das Alter beehrt man mit dem Attribut der Weiblichkeit. Redet man etwa, selbst ohne den Diminutiv anzuwenden, von einer Madeleine, so ist sie Das Madeleine. In der patriarchalisch-demokratischen neutralen Schweiz ist die blühende Frau ein Neutrum.
Das Lulubé hatte seinen Ruf- und Künstlernamen einer bekannten Kose-Abwandlung von Luise zu danken: Lulu, der es, als es in den Ehestand trat, das Initial ›B‹ seines Familiennamens Brugger anhängte. Es war eine der besten Trommlerinnen von Basel; ja, das war’s. Die Stadt am Oberrhein, wo Erasmus von Rotterdam, Hans Holbein d.J., Friedrich Nietzsche und andere merkwürdige Leute als Professoren angestellt waren, ist die Wiege europäischer Trommelkunst. Zweifellos wird auch am Kongo vortrefflich getrommelt. Aber in Basel ist das marschgerechte Trommeln, das alte Landsknechtstrommeln, nach dem zahllose Söldnerheere in getragenem Schritt und Tritt in zahllose abendländische Kriege zogen, vermöge eines aus dem Mittelalter überkommenen Fastnachtsbrauchs sublimiert worden zu einem verrückt-militant tuenden, gleichermaßen ausgelassenen und disziplinierten, großen und großartigen Volksfest, wie es so echt Europa sonst nirgends mehr kennt, einem fabelhaften in des Wortes Sinn, mit archaischen Visionen, optischen wie akustischen, und vielen traumhaften gespenstischen Momenten: der einzige protestantische Karneval auf Erden.
Das Lulubé war die Tochter eines Kleinbasler Fuhrunternehmers, der selber ein großer Trommler vor dem Herrn gewesen war. Gelegentlich einer Fas’-nacht (das ›t‹ wird hier verschluckt) Jahre nach dem Ersten Weltkrieg hatte er, im Suff, Lulus Mutter mit dem Trommelschlegel ein Auge ausgeschlagen. Hätt’ er’s unterlassen, hätte sich seine Tochter – sie sah als Vierjährige diese an ihrer Mutter ›bei verminderter Zurechnungsfähigkeit verübte schwere Körperverletzung‹ mit an – das kurze Begebnis, das fast dreißig Jahre später auf der abgewrackten Sträflingsinsel Lipari an ihren faszinierten Blicken vorbeispielen sollte, die Geschichte mit dem Herz des Hais nicht so zu Herzen genommen. Nicht so zu Herzen, das Haienherz, nicht so zu Herzen.
Denn Klein Lulus Seele erlitt einen Defekt beim Beobachten der betrunken-fahrlässigen Tat und der Folgen, die sich als seltsam geringfügig offenbarten. Das Vorkommnis wurde als Unfall vertuscht, die Mutter, personifizierte Geduld und Vergebung, ließ sich ein künstliches Auge einsetzen und klemmte eine Brille darüber. Eine sehr zerstreute Frau, seufzte sie gelegentlich: »Ich habe mein Auge verlegt, Lulu, hast du mein Auge gesehn?« So wuchs das Lulu in der kaum bewußten Vorstellung auf, daß Grausamkeiten zur Tagesordnung der Zivilisation gehörten. Der Zweite Weltkrieg – wenngleich Basel einen Grenzpfosten der neutralen Friedensoase vorstellte –, der Hitlerkrieg mit seinen technisierten Ausrottungen wehrloser Menschenmassen, nährte das Trauma des jungen Mädchens. Gleich seiner Umgebung fand es den Faschismus verabscheuungswürdig. Dennoch unternahm es nach Kriegsende, nachdem es an der Kunstgewerbeschule studiert hatte und eine Studentenehe eingegangen, Lulu B. Turian geworden war, mehrere Studienreisen nach Franco-Spanien und wurde eine Aficionada. Und dann, dann fuhr es eines Septembers mit Angelus Turian, seinem Gatten, zur Abwechslung nach Lipari hinab – steiniges Eiland, auf dem zur Zeit des neuen Imperium Romanum Benito Mussolinis dessen politische Gegner neben gewöhnlichen Verbrechern festgesetzt waren – und sah, ja, sah es schlagen, das Herz …
Angelus Turian war in jedem Betracht ein Gegenstück zu dem Lulubé, mehr: ein wandelnder Gegensatz. In Basler Kunstmalerkreisen wurde er, ungeachtet daß Cherubim den Plural von Cherub darstellt, Der Kerubin genannt. (Ehrenwerte Kreise, die bis zu einem gewissen Grad von der Theorie abhingen, daß das Café des Deux Magots neben der Kirche Saint-Germain-des-Prés im Sechsten Bezirk von Paris binnen fünfeinhalb Stunden per Leichtschnellzug und Taxi erreichbar sei, während das Exempel verhältnismäßig selten statuiert wurde.) Der Kerubin war kaum so groß wie ›Es‹, womit seine Frau gemeint war. Er hatte einen rosigen Teint und weißlich-rotblondes, ins Rosafarbene spielendes Haar, das ihm in Simpelfransen in die Stirn fiel und als Vollbart sein wie aus Marzipan geformtes Gesicht umrahmte. Zudem trug er stets weiße, lichtblaue oder rosafarbene Rollkragen-Pullover, winters wollene, sommers solche aus Zwirn. Der ganze Malersmann strahlte etwas possierlich Engelhaftes aus oder erinnerte an ein abendliches Zirruswölkchen.
Zirrus, was vermagst du gegen einen Riesenhai? Du segelst in Höhen über ihn hin, Zirrocumulus, aber niemand wird ein Herz in dir vermuten. Haben Engel Herzen? Aber ein Hai hat ein Herz, wie sich am Ende vom Lied herausstellen sollte, welch ein Herz …
Angelus Turian hatte ein Herz, ein empfindsames, leicht betroffenes, weshalb er von den bewußten Kreisen ein wenig über die Schulter angesehn wurde, eher mitleidig als geringschätzig. In der ›Höhle‹ (der Spitzname von Basels Künstlertreffpunkt, einem stockbürgerlichen Lokal) pflegte man zu munkeln: »Der Kerubin ist ein Armer.« Was nicht auf seine Finanzlage gemünzt war, sondern auf seine Artigkeit. Und: »Wenn er nicht pariert, hängt Es ihn am ausgestreckten Arm zum Fenster hinaus.«
Wenn das Paar an einem Schönwettersonntag über die Mittlere Rheinbrücke flanierte, wirkte es in seiner einfältigen Diskrepanz wie gemalt von einem der französischen ›Primitiven‹, etwa von Bombois – Er: so rosa in rosa – Es: so dunkel in dunkel. Das Lulubé hatte große dunkelblaue Augen, die, wenn sie in Trommel- oder Stierkampf-Verzückung geriet, kohlschwarz zu funkeln begannen; ein attraktives schlankes Gesicht mit niedlicher Nase, eine ins Ockergelbliche spielende Hautfarbe und glänzendes pechschwarzes Haar, das im Genick zu einem bombastischen Spanierinnenknoten gewickelt war und gehalten wurde von einem aus Sevilla importierten Flitterkamm. Auch hatte es den Spanierinnen abgeguckt, fast immer in Schwarz zu gehn mit bloßen alabastrigen, einen Deut vollschlanken Armen, die es bei kleinen Festivitäten mit einer ebenfalls importierten Mantilla umhüllte. Des fulminanten Busens wegen, den Es mit Italiens Nationalfilmdiva Nummer 1 gemein hatte, wurde Es von Basels musischen Witzbolden gelegentlich ›Das Lollobri‹ genannt.
In der Tat malte Angelus Turian licht und hübsch und nett und zuweilen rührend einfältig im Stil ›der Primitiven plus etwas Surrealismus‹. Periodenweise versuchte er sich als ›Abstrakter‹ und schuf Gebilde, die wie aus Mehl und zart gefärbtem Badesalz auf die grundierte Leinwand gepappt schienen. Man nannte ihn einen ›anständigen epigonalen Maler, der nicht den großen Schnauf hat‹. Das Lulubé hatte den großen Schnauf. Ein homosexueller Psychopath und snobistischer Hochstapler, der mit Pomp zum Katholizismus übergetreten war, hatte Frau Turian den Floh mit der ›Gnade der Tiere‹ ins Ohr gesetzt. Hatte ihr zugesäuselt, daß es fürs ›seelenlose Tier‹ einzige Gnade bedeute, von Gottes Ebenbild, dem mit der unsterblichen Seele ausgestatteten Menschen, getötet zu werden: zum Behuf einer Mahlzeit oder auch nur zum Vergnügen wie Taubenschießen, Fuchsjagd, Stierkampf. Und Es, das Lulubé, malte mit unheimlich anmutendem ›Schnauf‹ die Tiere im Zustand dieser Todesgnade – eine teils meisterhaft bewältigte Marotte, die den Kerubin, wiewohl er die Frau aufrichtig liebte, im Herzen ekelte. Tiermenschliche Zwitterwesen, stets mit dem gottmenschlichen Töter konfrontiert. Taubenkinder mit Puttenköpfchen, die im Flug die Sonntagsschützen anflehen, gut zu zielen (gelegentlich waren gesprochene Sätze ins Ölgemälde geschrieben wie auf alten ›Marterln‹). Auf Pflastersteine geworfene Fische, die, nach Wasser ringend, die Flossen wie Hände gefaltet, die Fischweiber bitten, auf dem Marktbrett zerstückelt zu werden. Ein gottvoller junger schwarzer Stier, der dem Torero – dieser seinerseits anzusehn wie ein Mammutpapagei – einen treuherzig-dankbaren Augenaufschlag gewährt, weil dieser ihm den Degen in den Nackenwulst jagt, daß das Blut emporspritzt wie eine Fontäne.
Einmal, in der zweiten Hälfte der Fünfzigerjahre – man führte bereits ein Dezennium eine ›harmonische Künstlerehe‹, – hockte man bei unerträglicher Junihitze in der Arena von Pamplona, wo das Lulubé hinbegehrt hatte, nachdem es die Taschenbuchausgabe von Hemingways ›Fiesta‹ gelesen (sechs- bis siebenmal hintereinander; als sie das Buch partienweise auswendig kannte, übergab sie’s den von den Abwässern der chemischen Industrie verschmutzten Fluten des Rheins, ließ sich hinfort nicht ausreden, daß Hemingway den Vornamen Ernesto trage). – Während Turian sich umtobt sah von Massenhysterie, gedachte er einiger kürzlich gelesener Sätze aus der Feder des berühmten französischen Schauspielers Barrault:
»Ich sah einen jungen Stier in Barcelona sterben. Das war keine ›mise à mort‹ – er wurde buchstäblich ermordet. Der Degen ragte ihm zum Halse heraus. Man ließ einfach sein Blut auslaufen. Plötzlich steht er unbeweglich. Er blickt alle diese als Papageien verkleideten Männer an und kehrt ihnen den Rücken zu. Nun geht er artig, mit letzter Kraft, langsam der Tür seines Geheges entgegen. Dort stürzt er. Aus. Ich gedenke immer wieder dieser Arena, die vor Zorn schäumte wie ein Heer von tobsüchtigen Irren, vor Zorn über diesen sympathischen Stier, der starb, indem er ihnen den Hintern zukehrte …«
Angelus Turians sanftes Herz erschrak. Jäh hineinverstrickt sah er sich in das Duplikat der unlängst von Jean-Louis Barrault geschilderten Situation. Der haargleiche, schwarzhaargleiche junge Stier stand dort unten im blutmatschigen Sand, stand noch auf seinen kurzen, knabenhaft-stämmigen Beinen, und die Degenklinge ragte, ein rosiges Blitzen in der glühenden Nachmittagssonne, aus seinem Blutströme blubbernden Hals, und er sah die ihn umstehenden Papageienmänner – den Matadoren mit seiner blutroten Muleta-Fahne, die silbern-orange gekleideten Peónes der Cuadrilla – an, offensichtlich der Reihe nach an. Und Angelus, den Feldstecher in den klebrigen, etwas zitternden Fäusten, erkannte: Es war kein Blick der Dankbarkeit, den das Wesen der bunten Überzahl seiner Folterer und Mörder schenkte, weiß der Teufel nein, sondern der eines sehr jungenhaften maßlosen fürchterlichen Staunens, Staunens darüber, daß man ihm all dies (so kunstvoll ertüftelte) mörderische Leid zugefügt hatte. Und dann ging er fort. Der Gemordete. Dem Gehege zu, das den tunnelartigen Durchlaß des Toril verschloß, durch den er sich kurze Weile zuvor hereingetummelt hatte, kaum Böses ahnend, allein etwas beunruhigt ob all des Volks (er war auf einer menschenarmen Weide zu Hause). Ging fort, einen Blutsturz nach sich ziehend, mit manierlichen, wenn auch schon sterbensmatt wankenden Schrittchen; und die sechs Banderillas, die die Papageienmänner zuvor unterm Getänzel von Balletteusen in seinen Rücken gerammt hatten, kurze Spieße, die sechs tiefe Wunden gestochen, aus denen Blut gequollen war, das seine Flanken schwarzrot lackierte, die sechs Banderillas wippten auf seinem Rücken – so sah es sich schauerlich trügerischerweise an: – beinahe kokett.
»Toro! Toro! Hijo de la gran puta!«
Da brach der sommerlich, teils hochelegant gekleidete Pöbel aus in seinen Wutorkan. Flaschen, Hüte, Brot, Papierbälle wurden in die Arena geschmissen, Kavaliere – auch solche in Offiziersuniform – brüllten, hüpften, fuchtelten, aufgetakelte Damen kreischten wie die Furien. Ungläubig erkannte Turian, daß sich der ›Volkszorn‹ keineswegs gegen den Torero richtete, sondern gegen den Toro, den Stier. Der’s gewagt hatte, nicht auf dem Fleck zu verrecken, wie es sich nach all der Marter und nachdem er so stilgerecht vom Degen durchbohrt worden war, schickte. Gegen den Stier, der sich unterfing, noch im Martertod an den Heimtrott zu seiner menschenarmen Weide zu denken.
»Toro, ladrón! Hijo de la gran puta!«
Den gottvollen jungen Stier, Prachtexemplar, in das einst Zeus sich zu verwandeln nicht gezögert hätte, um die Europa hinwegzutragen, den sterbenden Stier schimpften sie, ein unisono-Massengebrüll, das selbst die feinsten Herrschaften ansteckte, schimpften sie ›Schuft‹ und ›Sohn der großen Hure‹. Total unsinnigerweise, dachte Turian verwirrt und erschüttert bei der Vorstellung der kreuzbraven und gewißlich sittenstrengen Kuh, die den Martertodeskandidaten geboren hatte.
»Hörst du, Lulubé? Der steinalte Massenwahnsinn triumphiert«, tuschelte er seiner Frau zu, zunächst ohne sie anzusehen. »Nie wäre die spanische Republik besiegt worden, wenn sie nicht gewagt hätte, den Stierkampf abzuschaffen. In meinen Augen – ich kann mir nicht helfen – eine grausige Metzelei, Metzgerei. Hitler.« Doch im Wut-Orkan verwehte sein Getuschel.
Da stürzte der Gottvolle vor dem rotlackierten Tor, das den Tunnel verschloß, stürzte wie ein Ausgestopftes, das umgestoßen wird, und rührte sich nicht mehr.
»Toro! Abajo! Hijo de la gran puta!«
Turian ließ den Feldstecher sinken, blickte zur Seite und sah, zurückbebend, nun fassungslos, daß Es, auch Es, das Lulubé, den nicht ganz der Etikette gemäß Verendenden gellend lästerte. Daß Ihm schaumige Blasen aus dem schreienden Munde platzten, dessen lila Lippenschminke verschmiert war. Daß sich Sein Haarknoten zu lösen begann, während Es wie im Veitstanz hüpfte und – jetzt – Seinen Florentinerhut in die Arena niederschleuderte wie einen Diskus.
»Heh, Lulubé, bist du von Sinnen?«
Da zuckte seine Frau herum und zischelte ihm mit Augen, die kohlschwarz funkelten, dabei so starr wie das Glasauge ihrer in Duldsamkeit erstarrten Mutter, ein hämisches Scheltwort zu, das in Kleinbasels bescheiden-verrufener Rheingasse beheimatet war:
»Dummes Licht! … Du weinst ja.«
Verstohlen griff er sich ins Gesicht und entdeckte, daß ein paar dicke Tränen in seinen rosa Bart gerollt waren.
2
Männer machen Fehler. Des Künstlerehemanns ersten entscheidungsvollen bedeuteten diese Tränen. Seinen zweiten beging Angelus Turian, indem er im vorgerückten Alter von 32 das Trommeln erlernte. Seinen dritten und letzten: die Reise nach Lipari. Doch diese drei Fehler waren nicht zu vermeiden. Sie vollzogen sich gewissermaßen selbständig, ohne einem göttlichen oder menschlichen Willen zu entspringen, wie die Ananke der alten Hellenen, der mit dem Begriff Zufall oder Geschick nicht beizukommen war; die unaufhaltsame Zwangsläufigkeit, die umherschleicht im Labyrinth menschlicher Beziehungen. Wäre einer der beiden Partner des Ehepaares Turian beim Schwimmen im Meer um Lipari in hilfloser Gegenwart des andern von einem Hai zerrissen worden, hätte man von sträflicher Unvorsichtigkeit sprechen können, von einem schlimmen Zufall oder einem tragischen Geschick. Daß jedoch das Herz eines Hais, das Herz allein, das Herz an und für sich – die Versuchung, die unschöne Floskel ›in Reinkultur‹ hinzuzusetzen, drängt sich auf –, das hingelieferte, das verlorene Herz eines Räubers eine solche Macht auf ein Menschenkind auszuüben vermögen würde …
Das verlorene Herz eines mit allen Salzwassern gewaschenen großen Räubers …
Die Baselstädter trommeln von klein auf. Geübt wird das ganze Jahr hindurch: nicht auf der Trommel, sondern auf dem ›Böcklein‹, einem Brett ohne Resonanzboden. Das heilige Kalbfell zu rühren gestattet ist erst von dem das Nahen der Fas’nacht kündenden, das ganze rechtsrheinische Kleinbasel elektrisierenden Augenblick an, da der Wilde Mann den Rhein herabgeflößt kommt. Eines unwinterlich milden Spätvormittags Ende Januar kam er auf einem von vier Stehrudern bewegten Floß, auf das eine Kanone montiert war, unter Böllerschüssen den Strom herabgeglitten; da kam er.
In der weiten Senke zwischen Jura, Schwarzwaldgebirg und Vogesen lagerte Hochnebel. Geklemmt in eine sich auf der Mittleren Rheinbrücke stauende, in Wintermäntel verpackte Menge, sahen die Turians ihn nahen.
Er stand in der Schiffsmitte. Sein Kopf war so groß wie der eines Bisons im falben Sonnenglanz, der durch den Hochnebel geisterte, grüngolden blinkend wie Bronze. Er trug einen ganzen Tannenbaum geschultert, als habe er ihn irgendwo gepflückt wie eine Blume. Hinter ihm stand ein Fähnrich mit der Zunftfahne, ein Trommler in der Rokoko-Uniform der Schweizergarde der Franzosenkönige; im Heck der Kanonier; über den vier Floßecken wippten die Ruderknechte.
Das Lulubé sagte: »Der gefällt mir.«
Es hatte sich, dem Kerubin eine Gasse schaffend, nicht ohne Ellbogen-Stoßkraft zum Brückengeländer durchgeschlängelt. Als das Floß nahe herangeglitten war, beugte Es sich weit über die steinerne Wehr, weiter als die übrigen Gaffer; Turian umfaßte besorgt die schlanke Taille. Der Wilde Mann, kurz bevor er zwischen den Brückenpfeilern verschwand, grüßte die Menge, indem er den Baum schwenkte und das Gesicht hob, ein gewaltiges und doch zu kleines, verglichen dem monströsen Schädel, ein embryonales, verschwommen in der Patina eines eben gehobenen Seeräuberschatzes.
»Wirklich, der gefällt mir.«
Alles drängte zum jenseitigen Brückengeländer hinüber, um zu begaffen, wie der Ankömmling an der Schiffslände des Klingentals empfangen wurde.
»Mir auch«, sagte Angelus, dem das Lulubé wieder einen aussichtsreichen Platz erkämpft hatte.
»Wieso dir auch?«
Die Frage, etwas atemlos, stoßhaft geäußert, begriff Angelus nicht recht. »Eh nun, diese unverändert aus dem Mittelalter überkommene Maske … und damals hinwieder aus vorchristlicher Zeit überkommene, pardon, aus vorgeschichtlicher, ebenso wie die Masken des Vogel Greif und des Löwen dort unten.«
»Löwen gibt’s heute auch«, sagte Frau Turian diesmal nebenhin.
»Aber keine Greifsvögel mehr, die, schätze ich, aus der Erinnerung an Dinosaurier –«
»Und wilde Männer auch nicht mehr«, wurde er unterbrochen.
»Pardon?«
»Es gibt heute keinen wilden Mann mehr – wie den.«
Dem Angelus lag auf der Zunge, zu sagen, daß sich unter dessen Maske seines Wissens der Apotheker Gigon aus der Unteren Rebgasse verberge. Er ließ es ungesagt.
Der Wilde Mann sprang auf den Kai, wo ihn der Vogel Greif und der Löwe erwarteten, jeder mit seinem Tambour und seinem Zunftfähnrich nach mittelalterlichem Zeremoniell, und die drei Fabelwesen rückten unter Getrommel auf die Rheinbrücke, wo Stadtpolizisten mit den altmodisch hohen Bobby-Helmen der Londoner Polizei den Verkehr gestoppt und die graue Menge der Gaffer in Wintermänteln hatten Spalier bilden lassen. Und die drei, vornweg die Fahnenträger, hinter sich die Trommler, umgaukelt von den ›Ulis‹, Harlekins, die für Kleinbasels Waisenhaus sammelten, rückten zur Jochkapelle, einem auf der Brückenmitte errichteten kleinen Gotteswachturm, in dessen Verlies kein ewiges Licht brannte, denn die Humanistenstadt gehörte zu den frühen Blüten der Reformation.
Und vor der Jochkapelle, aus dem gleichen rosabraunen Jura-Sandstein errichtet wie das Münster, das, verschwommen im falb durchgoldeten Dunst, vom hohen Großbasler Ufer herübergrüßte (zumal es auf einem Uferhügel thront, ist seinen Türmen die Aura des Grüßens zu eigen), tanzten die drei, jeder ein Solo zum Wirbeln seiner Trommel, zuerst der Fabelmann, dann die beiden Fabeltiere.
»Sauglatt«, preßte das Lulubé ein um das andere Mal hervor, »sauglatt, maximal!« Da tanzte er, der Wilde Mann. Die ›Verse‹, kunstvoll-rabiate Variationen eines Trommelmotivs, die sein Tambour mit dem Rokoko-Dreispitz auf den ›Kübel‹ wirbelte, seine schräg hängende lange Landsknechtstrommel, hatten nichts an sich von Rokoko. Das grollte übern Rhein wie Urwaldtamtam, das Rufen einer afrikanischen Buschtrommel, und der Wilde Mann mit dem Riesenhaupt aus versumpftem Gold, dem bewegungslosen Metallgesicht, schwang den gepflückten Tannenbaum im unheimlich retardierten, heftig akzentuierten Takt. Wälzte sich vorgeduckt um seine Achse in gewaltigen Sprüngen, die die Schwerkraft zu überlisten schienen – daß er nicht fiel, war ein Wunder –, stets geduckt, das Erzgesicht dicht überm Asphalt, fast so, als tanze er waagrecht.
Das Beifallklatschen, Bravorufen der grauen Menge dankte ihm.
»Olé, olé!« kreischte das Lulubé plötzlich, so wie’s in der Arena von Pamplona die Stierkämpfer zu bejubeln gelernt hatte. Auch dies kleine Brückenfest lebt von stark gebliebener Tradition, doch ohne daß Metzelei im Spiel wäre, dachte Turian in der Aufwallung einer mitteleuropäisch temperierten, fast lieblichen Zufriedenheit, die alsbald einen sachten Schock erleiden sollte …
Darauf tanzte der Vogel Greif, und die Verse, die sein Tambour trommelte, hielten einen noch langsameren Takt ein, und der Tänzer, maskiert mit einem hohen, schwarz schillernden Aufsatz, einem kleinen Vogelkopf auf zweimeterlangem Hals – so etwas wie ein überlebensgroßer Vogel Strauß mit einem Kropf –, Gesäß, Beine, Füße in eine Hülle aus orangenem Glanzleder geschnürt, mit langem Schweif und großen Fußkrallen, tanzte betont tapsig auf der Stelle (wobei er sich durch zwei unten in die Hals-Attrappe gebohrte Gucklöcher orientierte), und der unproportioniert kleine Vogelkopf schaukelte dabei hoch oben hin und her. Nach dem Endstreich des Trommlers verbeugte er sich plump, zugleich vorsichtig, gleichsam scheu im Beifallsklatschen, wobei sein geschwänzter Lederhintern nach Großbasel wies – scheu, wie verirrt aus einem anderen Jahrhunderttausend. Dann tanzte der Löwe.