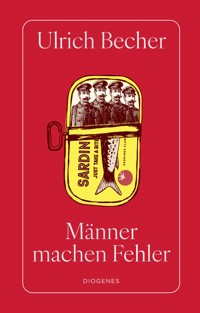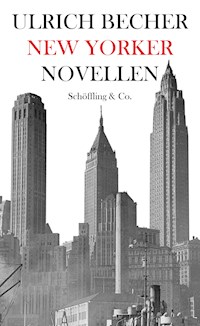Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BUCHFUNK Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Albert Trebla, Wiener Journalist und im Ersten Weltkrieg Jagdflieger, flieht im Frühjahr 1938 mit seiner Frau aus dem von deutschen Truppen besetzten Österreich auf Umwegen ins Engadin. Aber für den Verfolgten gibt es in der vermeintlich freien Schweizer Bergwelt keine Zuflucht. Trebla fühlt sich durch eine Serie rätselhafter Todesfälle bedroht und immer mehr in die Enge getrieben. Wie ein Murmeltier versucht er, in Deckung zu gehen, aber wo er auch hinkommt, wird er in äußerst merkwürdige Geschichten verstrickt.Mit »Murmeljagd« wird einer der großen Romane der deutschen Literatur wieder zugänglich: eine Tour de Force über Vertreibung und Exil, über das Leben im Ausnahmezustand, über Wahn und Bedrohung, absurde Irrtümer und eine Menschenjagd. Ulrich Bechers Lust an Sprachexperimenten, seine Vorliebe für ausgefallene Charaktere und sein politisches Engagement kulminieren in einem psychologischen Entwicklungsroman, der gleichzeitig Politthriller ist - immer vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung mit dem Faschismus.»Meine Idee war, den Antikriminalroman zu schreiben, der in einer kriminellen Epoche spielt.«Ulrich Becher
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:30 Std. 22 min
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Inhalt
[Cover]
Titel
ERSTES BUCH – Tote Zeit
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
ZWEITES BUCH – Licht im See
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
DRITTES BUCH – Geisterbahn 1
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
VIERTES BUCH – Geisterbahn 2
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
FÜNFTES BUCH – Die Straße über San Gian
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Autorenporträt
Über das Buch
Impressum
ERSTES BUCHTote Zeit
1
Wissen Sie, Gnädige Frau, es hat wirklich gar keinen Sinn, sentimental zu sein.«
Der Spruch war nicht von mir. Nur eine Floskel aus dem Puppenspiel KASPERL UND DIE BÜRGERLICHE KRAPFENBÄCKERSWITWE. Floskel, die an sich witzlos, vom Kasperl gequäkt und aus der besondren Situation heraus gebracht, stets ein Lacherfolg gewesen war im Wiener Prater-Kasperltheater des Professors Salambutschi: auf halbem Weg etabliert zwischen KOLARIK’SSCHWEIZERHAUS und der NEUEN GEISTERBAHN.
»Wissen Sie, Gnädige Frau, es hat wirklich gar keinen Sinn, sentimental zu sein«, quäkte ich an diesem verfluchten Abend Ende Mai, was für ein Mai? wieso nannte sich das Mai? Hatte mit meinem sehstarken Aug den Felsblock am Uferpfad erspäht, Klippe, deren Überhang wie ein Sprungbrett aufs fast unsichtbare Wasser hinauszackte, und die weißliche Erscheinung, das konnt ihr safrangelbes Trikotkleid sein, sie hatte noch ein hellblaues mit, aber heut abend das gelbe angehabt, als sie sich Auf Englisch von der Acla Silva verdrückt hatte. Ich war die Klippe angesprungen mit allen vieren und am kaltglitschigen Stein abgerutscht und hatte mir die rechte Handfläche leicht geschrammt und das linke Knie leicht geprellt und mich in kaltschwammiges Moos gekrallt und emporgezogen und war auf Knien zum ›Sprungbrett‹ vorgerutscht, im geprellten Knie tauben Schmerz, der nicht schmerzte, und hatte etwas Rund-Weich-Kaltes, etwas wie einen halberfrorenen Pfirsich, ertastet, die Wange der Frau, und mit beiden Armen die apathisch Kauernde umpackt und gekeucht. Und das kaltfeuchte Schauern aus dem lichtlosen Wasser und das maschinengewehrartige Tacktack fliegenden Pulses, das in meiner Stirnnarbenmulde klopfte, und der Schweiß, unter meinem Hemd niederkitzelnd, und die rauhe Quäkstimme, die mir selber fremd klang, wie verstellt, wie die des Puppenspielers Prof. Salambutschi:
»Wissen Sie wirklich, Gnädige Frau, sentimental zu sein, das hat doch gar keinen Sinn. Weil die – weil d-i-e den Maxim Grabscheidt in Dachau umgebracht haben, deswegen wollen S-i-e ins eiskalte Wasser gehn wie eine geschwängerte Dienstmagd aus einem Dreigroschenroman von anno Schnee? Denken Sie doch etwas moderner, Gnädige Frau!« (All das war bei Prof. Salambutschi nie vorgekommen.) »Ausgerechnet Sie, eine der besten Tausend-Meter-Schwimmerinnen vom Millstätter See? Im Dings, im Adria-Archipel von Hvar sind solche tausend Meter riskant wegen der Haifische, und trotzdem haben Sie es riskiert, allerdings fuhr Ihr Herr Rosenvater in Duschans Motorboot neben Ihnen her, mit einer Riesenflinte und einer Harpune bewaffnet, um Sie vor Und der Haifisch / der hat Zähne«, ja ich sang Brecht-Weill in dieser mailosen Mainacht, »zu beschützen. Und glauben Sie wirklich, Madame Xane, daßSiedaßSiedaßSie mit so einem improvisierten Kaltwasser-, Kaltwasserfrei-, Kaltwasserfreitod jemand anderm einen Gefallen getan hätten als Maxim Grabscheidts Mördern?«
Xanes Gewimmer entnahm ich etwas wie: ›Ich wollt ja hier nur ein bißchen sitzen‹, und ich sagte ihr auf den kaum sichtbaren Kopf zu:
»Nein, du hattest so halb und halb vor, ein bißchen, äh, abzuspringen von diesem Sprungbrett aus Stein«, und sie wimmerte mit dunkelverschnupfter Stimme etwas wie: man könne nicht weiterleben in einer Welt, in der sooo mit den Menschen verfahren werde, und ich quäkte: »Das alles ist Blödsinn, Gnädige Frau.« (Auch das gehörte nicht zu Prof. Salambutschis Text.) »Auf keinen, auf gar keinen, auf überhaupt keinen Fall hat es Sinn, wegen dieser Mörder sentimental zu werden. Denn bald sind sie tot. Nachdem sie so zwanzig bis dreißig bis vierzig Millionen Leben auf dem, äh, nicht vorhandenen Gewissen haben, werden sie selber tot sein, und keine Schaufel. Keine Schaufel wird sich finden lassen, um ihnen ein Grab zu schaufeln. Nicht einmal ein Holzscheit, Gnädige Frau. Kein Grabscheit.«
Mein lieber Trebla!
Wahrscheinlich wirst Du erstaunt sein, daß ein alter Regimentskamerad von den Boroëvićern Dir eine so umfangreiche Epistel in Dein frischgebackenes Exil nachjagt. Deine Züricher Adresse zu erfahren war mir ein leichtes, denn die Freunde unseres neuerstandenen Großdeutschen Reiches mehren sich in aller Welt und halten Augen und Ohren offen. Hiermit berühre ich gleich den springenden Punkt meines Schreibens. Wie Du wissen wirst, war ich nie ein Freund besonderer Umschweife, was mir in unserer Armee seligen Andenkens den Spitznamen »Preuß« eintrug, einen Spitznamen, dessen ich mich heute nicht mehr zu schämen brauche. Denn dank der genialen Entschlossenheit des Führers und Reichskanzlers ist – den internationalen Ränkeschmieden zum Trotz! – der Bruderzwist endgültig beigelegt, der Anschluß ein unumstößliches Faktum geworden, und dürfen wir uns heute, ob Preuße oder Ostmärker, mit dem guten Rechte des Starken – das uns nie wieder genommen werden wird!!! – Deutsche nennen.
Und da glaube ich, ohne meiner Maxime, die mir den Schlaraffentitel »Ritter Frisch – bereit zum Streit« verschaffte, ohne meinem Prinzipe, zur Sache zu kommen, untreu zu werden, Dir, teurer Trebla, dennoch eine Erklärung schuldig zu sein.
Du magst nämlich raisonieren, wie ein Edelmann, der jahrelang das rot-weiß-rote Band der Vaterländischen Front im Knopfloch trug, heute so bedingungslos hinter dem Führer stehen kann. Darauf darf ich Dir antworten, daß ich dieses Band stets mit gemischten Gefühlen getragen habe! Was mich in der Hauptsache dazu veranlaßte, war die kaisertreue Haltung der Bundeskanzler Dollfuß und Schuschnigg, eine Haltung, die ich als ehemaliger k. u. k. Offizier unterstützen zu müssen für angezeigt hielt, nicht zuletzt auch das autoritative Vorgehen dieser beiden Staatsmänner gegen – verzeih meine Offenheit – Deine Gesinnungsgenossen.
Wie Du, der Du einer von uns gewesen, diese gottlose Gesellschaft zu Deinen Gesinnungsgenossen machen konntest, blieb mir immer ein Rätsel; ich komme noch darauf zurück. Jedenfalls kann ich Dir en parenthese bekanntgeben, daß Du, nachdem der rote Aufruhr vom Vierunddreißiger Feber niedergeschlagen und es sehr, ich unterstreiche: sehr schlimm um Dich bestellt war, einen anonymen Mentor fandest, der sich an höchster Stelle für Dich verwendete, worauf Du mit dem Leben davonkamst. Dieser Mentor hieß Adelhart v. Stepanschitz, doch möchte ich Deinen nachträglichen Dank nicht. Was ich von Dir möchte, ist lediglich – bittschön! – Unvoreingenommenheit gegenüber dem Vorschlag, den ich Dir im Auftrage von amtlicher Seite zu unterbreiten habe.
Im Laufe der Jahre gelangte ich in der Tat zur Auffassung, daß das Habsburgerreich, für dessen Größe ich mit der Waffe in der Hand an Deiner Seite, Trebla, gestritten, unwiederbringlich der Vergangenheit angehöre – womit ich, wie Du siehst, in einem einzigen Punkte Deine ansonsten so konfusen Ansichten teile. Zudem erfüllte mich der Zulauf von Hebräern zur Vat. Front mit einem empfindlichen Schauder. Ich nahm daher, heute darf es gesagt sein, bereits Anno 36 Beziehungen zu gleichdenkenden Offizieren der alten Armee auf, u. a. zu den jetzigen Reichsministern Glaese v. Horstenau und v. Seyss-Inquart, standhaften Männern, die in einzigartig vorbildlicher Weise ihre militärische bzw. christliche Tradition und Rechtgläubigkeit – Seyss ist praktizierender Katholik – mit ihrer deutschen Ehre und den Gegebenheiten der Stunde zu vereinigen wußten. Langsam dämmerte mir die ungeheure Größe auf jenes Gedankens der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft. Und heute, zwei Monate, nachdem sich die Heimkehr der Ostmark ins Reich vollzog, darf ich mich rühmen, beizeiten »sehend« geworden zu sein.
Wenn Du an diesem heutigen herrlichen Frühlingstage in Wien weilen würdest, was würdest Du für Augen machen! Die Heere der bettelnden Arbeitslosen von der Gasse verschwunden, überall blitzsaubere Uniformen und glückliche Gesichter. Nur die Nasen des Auserwählten Volkes werden immer länger und länger, und wirst Du Dich noch wundern, mit welch penetranter Anwesenheit es Dich bald in Deinem sogenannten Exil beglücken wird!
Als ich gestern über den Graben promenierte und zum lieben alten Steffl emporsah, sagte ich plötzlich zu mir, nein, Stepanschitz, du bist deinem Kaisergedanken nicht untreu geworden! du bist ja der treue Untertan eines vorerst noch ungekrönten Herrschers, der mit eiserner Hand das neue Reich aufrichtet als ein Bollwerk der arischen Christenheit gegen das internationale Untermenschentum. Und ich gelobte mir, am Tage, da dieser Herrscher sich die Kaiserkrone im Stephansdom aufsetzen würde, dem Allmächtigen auf Knien zu danken.
Aber nun frisch bereit zum Streit und wirklich zur Sache!
Wie ich bereits oben konstatieren mußte, ist es mir, lieber alter Kamerad – Du gestattest, daß ich Dich trotz allem, was uns in den letzten Dezennien auseinanderführte, in anhänglichem Gedenken an unser gemeinsames Kriegserlebnis so anrede –, immer spanisch vorgekommen, daß Du, von der Front heimgekehrt, Dich jenem aufrührerischen Plebs in die Arme warfst, der, angeführt von zersetzenden jüdischen Geistern, mit asiatischer Zerstörungslust an den Grundfesten der Moral und des Eigentums, kurz unserer christlichen Zivilisation zu rütteln wagte. Du, der Sohn eines Generals, Du, dem ein Boroëvić die »Silberne« an die Brust heftete und ein Tülff v. Tschepe u. Weidenbach das Eiserne Kreuz 1. Kl.! Du, der mit Generalfeldmarschall v. Mackensen an einem Tisch sitzen durfte!
Daß Du den Novemberverbrechern Sympathie entgegenbrachtest, schrieb ich zunächst der Ignoranz Deiner zwanzig Lenze an. Doch als Du, dessen Ahnen zu wiederholten Malen für die Ehre u. Glorie des Kaiserreiches zum Schwerte gegriffen, ganz versankst in jener marxistischen Schandideologie, geriet ich auf den Verdacht, der Kopfschuß, den Du einer britischen Kugel zu verdanken hattest, habe Dich in Deiner Zurechnungsfähigkeit beeinträchtigt – verzeih abermals meine Offenheit, Kamerad.
Mit Erschütterung und Grausen legte ich die Büchl, Traktate, zum Aufruhr reizenden Spottverse aus der Hand, die Du in jenen Jahren pexiertest, mit Ausnahme der wirklich poetischen »Lobauschen Kormorane«, die einen Ehrenplatz in meiner Bibliothek einnehmen, was meine Vorurteilslosigkeit unter Beweis stellen dürfte.
Dann kam der Februaraufstand der Wiener Kommune!
Mit Entsetzen mußte ich in den Journalen lesen, Du habest an der Seite eines Koloman Wallisch – der sein gerechtes Ende am Galgen finden sollte – den bewaffneten Aufruhr in der Steiermark organisiert. Wenn sein Vater das erlebt hätte, imaginierte ich mit Schaudern! Mein Verdacht, Du seiest nicht im Vollbesitz Deiner Zurechnungsfähigkeit, schien mir Gewißheit geworden. Dies sowie meine im Feuer der Isonzoschlachen erhärtete Anhänglichkeit veranlaßte mich nach Deiner Verhaftung, mich für Dich zu verwenden. Dergestalt gelang es, Dich aus der Gefahrenzone des Standrechts herauszumanövrieren. Meine Bemühungen allerdings, für Dich, auf Grund Deiner früheren Verdienste als Offizier, Festungshaft herauszuschinden, schlugen fehl. Jedenfalls bliebst Du vor dem Ärgsten bewahrt.
Übrigens sehe ich heute, unter dem überwältigenden Eindrucke der weltgeschichtlichen Umwälzung, die sich in unsrem Vaterlande vollzogen hat, Deine Teilnahme an der Feberrevolte mit etwas anderen Augen an.
Hat es sich doch mittlerweile herausgestellt, daß die Politik der Dollfuß u. Schuschnigg insofern schädlich war, als sie sich blind stellte vor dem Gebot der Stunde und den Achtzigmillionenruf nach Einigung aller deutschen Stämme mitnichten berücksichtigen wollte, und kann ich mir daher denken, daß Dein Aufbegehren gegen solche volksfremde Politik nicht allein auf Deiner Verhetzung beruhte, sondern daß darin, freilich noch unbewußt, schon etwas von jenem »gesunden Volksempfinden« schlummerte, das heute die Weltgeschichte an die Hand nimmt.
Vor einigen Tagen traf ich nun mit Hauptmann Laimgruber zusammen, und kamen wir von ungefähr auf Dich zu sprechen.
L. ist ja alles andere als ein Unbekannter für Dich: in Brӑila Dein Kommandant. Der Hauptmann – er war ebenfalls Schlaraffe – erzählte viel von Dir aus alten Tagen, und wir lachten nicht wenig. So vertraute er mir die Geschichte an, wie Du im Salon der Gräfin Popescu, infolge Unauffindbarkeit des Häusls, an die Zimmerpalme hinter dem Flügel p… Ich gab darauf Dein Abenteuer auf der Schwebebahn bei Novaledo zum besten. Wir champagnisierten bei Sacher und lachten Tränen über Deine Streiche, mein lieber Trebla. Schlußendlich meinte der Hauptmann, der dicht vor seiner Beförderung steht, es sei fürwahr ein Jammer, daß solch ein Tausendsassa – Jugendsünden hin und her – dazu verdammt sei, sich dort draußen mit dem Semigrantengesindel herumzutreiben, statt an der stolzen Wiedergeburt der Heimat aktiven Teil zu haben.
Hauptmann Laimgruber gehört heute zu den Herrschern im Metropol, d. h., er bekleidet einen Vertrauensposten bei der Geheimen Staatspolizei Wien. (Ich bin befugt, Dir dies zu melden.)
Apropos, glaube ja nicht die Ammenmärchen, die im verjudeten Ausland über die Gestapo herumgeboten werden. Ich selber fiel einst auf das Geseire herein, nur um heute meine Leichtgläubigkeit zu belächeln. Denn diese Institution inkommodiert niemanden, der ein gutes Gewissen gegenüber Volk und Führer hat, und dient mit löblicher Uneigennützigkeit dem einzigen Zwecke, den »Dolchstoß von hinten« zu verunmöglichen, welcher Anno 18 die Katastrophe heraufbeschwor!
Der Hauptmann hat ungeachtet des, daß eine winterliche Begegnung zwischen euch resultatlos verlief, Deinen Fall neuerdings überprüft, u. a. setzte er sich mit nat.-soz. Kämpfern ins Benehmen, welche, heute verdientermaßen in leitenden Positionen, einst mit Dir zusammen in Wöllersdorf schmachteten und Dir, bei schärfster weltanschaulicher Gegnerschaft, persönlich kein übles Attest ausstellten. Weiter eruierte er, daß Du in der Schweiz in kümmerlichen Verhältnissen lebst, so wie daß Deine dortige Aufenthaltsbewilligung binnen kurzer Frist erlischt. Und was dann, mein lieber Trebla?
Gedenkst Du, Dich als mittelloser Ahasver von einem Land ins andre komplimentieren bzw. chassieren zu lassen?! Vielleicht wird Dir die Verzweiflung gar den selbstmörderischen Gedanken eingeben, Dich nach Spanien zu schlagen, in eine jener vaterlandslosen Banditenbrigaden einzutreten, um an der Seite von Kirchenräubern und Nonnenvergewaltigern für eine – Gott sei’s gelobt! – verlorene Sache zu kämpfen, womöglich zu fallen.
Aus dieser Deiner desperaten Notlage gibt es nur einen einzigen ehrenhaften Ausweg, den Dir Deine ehemaligen Kameraden zu ermöglichen wünschen, und zwar die Rückkehr in die Heimat!
L. läßt Dir durch mich den folgenden Vorschlag zur Güte unterbreiten:
Spätestens nach Ablauf einer Dir gewährten Bedenkzeit von 14 Tagen fährst Du nach Wien. Der Hauptmann verbürgt Dir mit seinem Ehrenwort freies Geleit. Du wirst einen zweimonatigen politischen Umschulungskursus zu absolvieren haben, der indessen mit keiner Freiheitsentziehung verbunden sein soll, wofür sich der Hauptmann ebenfalls mit seiner Offiziersehre verbürgt. Natürlich bleiben Deine bisherigen Schriften, die ja leider zu Recht auf den Scheiterhaufen gehörten, verboten, mit Ausnahme der »Kormorane«, deren Wiederzulassung auf meine Anregung hin geplant wurde. Diesem Versbande neue Dichtungen anzureihn, die von echter Schollenverbundenheit getragen und durchweht sein mögen vom neuen Geiste edelrassig-völkischer Gemeinschaft, möge Deine heilige Gegenverpflichtung darstellen. Die giftigen Früchte Deiner jugendlichen Verblendung, inclusive die grotesken Anwürfe gegen den nat.-soz. Staat und seine Führer, sollen vergeben sein, und möge Dich diese einzigartige Großherzigkeit belehren, daß der Führerstaat immer großzügig ist gegenüber Gegnern, die ihr treudeutsches Herz wiederentdecken und bereit sind, das aus Blut und Eisen geschmiedete Neue Reich zum stolzesten Bollwerk der zivilisierten Menschheit auszubauen. Treue um Treue!
Mit Deutschem Gruß und ergebungsvollen Handküssen für die werte Frau Gemahlin – das zarte Geschlecht hat ja stets den Vorzug, dem Zuge des Herzens zu folgen, und wird mich Frau Gemahlin daher sicher in meinem Wunsche, daß diese lange Epistel auf fruchtbaren Boden fallen möge, unterstützen –
Dein Adelhart Stepanschitz
Gegeben am 21. Mai 1938 zu Wien.
PS. Herr Dr. Livesius vom Großdeutschen Generalkonsulat, Hirschengraben 2, Zürich 1, wurde angewiesen, Deiner Gemahlin und Dir Reichspässe nebst zwei bezahlten Fahrkarten Zürich– Wien (Erster Klasse) auszuhändigen.
PS. PS. Wir brauchen keine Schlaraffia mehr! Unsere neue Schlaraffia ist die NSDAP!
Zwei Tage, bevor Kleinhäusler in Begleitung des Oberquartiermeisters I Franz Halder im Spezial-Mercedes nach Wien braust … Wien / Wien, nur du allein / Sollst die Stadt meiner Träume sein; aber nicht doch, ist ja von einem jüdischen Komponisten! … am Vorvortag der GEBURTSSTUNDE GROSSDEUTSCHLANDS erschein ich im Grazer Rathaus beim Hofrat Zötlotener und bitt ihn, mir meine von den ›Sicherheitsorganen des Christlichen Ständestaats‹ beschlagnahmten Dokumente zurückzugeben: Reisepaß, Doktordiplom, Führerschein. Merkwürdiger- oder typischerweise ist der Hofrat, ein Monarchist, blaß vor Erregung, jedoch zu Scherzen aufgelegt: ›Jetzt, wo Der Führer kommt, wollen Sie Ihren Führerschein? An und für sich stehn S’ ja noch unter Polizeiaufsicht.‹
›An und für sich schon. Aber ich stell mir vor, daß sich die Polizei jetzt von einem Tag zum andern sehr verändern wird –‹
›Das stell ich mir ebenfalls vor. Und darum wär ich bereit, beide Augen zuzudrücken in der Annahme, daß Sie sich ins Ausland abzusetzen wünschen.‹
›In der Annahme, Herr Hofrat, muß ich Sie bestärken.‹
›Ich begeb mich a-u-c-h hinaus‹; Zötlotener, etwas feierlich: ›Nach Belgien. Stenokerzeel. Zum Kaiser Otto. Und wenn Sie mir untertänigste Grüße an Seine Majestät auftragen, so händige ich sie Ihnen binnen einer halben Stunde aus, die beschlagnahmten Dokumente.‹
›Also gut. Ich trag Ihnen schöne Grüße auf an den Herrn Doktor Otto von Habsburg-Lothringen.‹
›Das Geschäft ist schon gemacht‹; Zötlotener lächelt. Eine halbe Stunde später hab ich in der Tat meine Dokumente wieder. So leicht hat sich dies angelassen: zwei Tage vor der Annexion Österreichs, erfolgt ausgerechnet unterm Kennwort Geheime ReichssacheUNTERNEHMEN OTTO. Herauszukommen allerdings ist für mich komplizierter gewesen:
Eine knappe Woche, nachdem Kleinhäusler auf Wiens Heldenplatz ›vor der Weltgeschichte die Heimkehr seiner Heimat ins Rrreich gemeldet‹ hat, fährt meine Xane mit dem Ehepaar Pola und Joop ten Breukaa in einem Abteil Erster des Arlberg-Expreß der Schweizer Grenze zu. Ich fahr in einem Abteil Dritter desselben Zugs, Bretter überzwerch auf den Gepäcknetzen, als Skiläufer verkleidet, eine schwarze Zipfelmütze tragend sozusagen als Tarnkappe: zur Verdeckung meines Besonderen Kennzeichens.
Die ganze Reise über bis Bludenz, Vorarlberg, schneiden mich Joop und ›seine Damen‹, so abgesprochen auf dem Wiener Westbahnhof.
Pola, die ums Jahr 1912 auf der Praterbühne Beim Leicht debütiert hatte unterm Namen Pola Polari, ist als Soubrette fast berühmt geworden; allerdings nur fast; sie wurde bereits in einem Atem mit der Massary und der Zwerenz genannt; das Apollo, das Theater an der Wien die weiteren Stufen ihres Aufstiegs. Im dritten Weltkriegsjahr unterbrach sie ihre Karriere und rückte als Krankenschwester ein. In einem Waldkarpathenbad, in das Schwerverwundete zur Rekonvaleszenz kommandiert wurden – ich hatte eine erste und zweite Kopfoperation beim Oberstabsarzt v. Rohleder und eine dritte beim Admiralstabsarzt v. Eiselsberg hinter mir –, pflegte sie mich, und ich hatte die Ehre, die zweifelhafte Ehre, von Pola entjungfert zu werden. (Zweifelhaft einzig und allein deswegen: weil ich nie, zeitlebens nicht, ganz genau wußte, ob ich, kaum 18, nicht schon vorher entjungfert worden war.) Im Nachkriegswien welkte der Ruhm der ›Populari‹, und so heiratete sie denn den betagten Grafen Orszczelski-Abendsperg, der alsbald, auf der Hochzeitsreise in Venedigs Hotel Royal Danieli, entschlief. Zur Operette zurückzukehren, war sie zu stolz. Und so heiratete denn die verwitwete Gräfin Orszczelska-Abendsperg (so nannte sie sich ungeachtet, daß die Erste Republik Österreich die Adelsprädikate abgeschafft hatte) 1927 Joop ten Breukaa, mehr oder weniger Stillen Teilhaber einer Amsterdamer Reederei. Einen Teil seiner Jugend hatte er in Niederländisch-Indien, auf den von seinem Vater als Kolonialherrensitz ausgebauten ›Kapong‹ zwischen dem Hafen Surabaja und den ›Vorstenlanden‹ Javas verbracht. Später, im väterlichen Reedereibüro, hielt es ihn nicht. Ab und zu tätigte er für die Firma Auslandsgeschäfte, studierte in Europa herum Kunstgeschichte, sammelte Bilder holländischer und französischer Meister, ostasiatische und etruskische Plastiken, machte sich in Europas Kunsthändler- und Künstlerkreisen einen gewissen Namen: als Liebhaber berühmter Gemälde und unberühmter Schauspielerinnen, die er ›förderte‹. Weil er als solcherart Mäzen nicht eben knickrig war, nahm das Lustige Künstlervölkchen die sprichwörtliche Langeweile seiner Gegenwart hin. Er hatte Pola eine Villa in Wiens Cottage-Viertel zu bieten, einen Landsitz namens Acla Silva im Oberengadin und eine winzige Stadtwohnung (9 Zimmer) in Amsterdam. Im Jahr 36 hatte er bereits einen Jacob van Ruisdael, einen Salomon van Ruisdael, einen G. B. Weenix, einen S. de Vlieger, einen J. de Momper, einen Dirk Hals aus Wien evakuiert, teils nach Amsterdam, teils nach Acla Silva; vor allem aber DEN SPAHI, den er seinen ›Leibwächter‹ nannte.
Wenn die ten Breukaas sich entschlossen, am 18. März 38 das soeben ausgebrochene Großdeutsche Reich via Buchs zu verlassen (und Xane mitzunehmen), so nicht deshalb, weil Pola ›einige Tropfen des verfemten Blutes intus‹ hatte, wie Joop gemüdet bemerken konnte; sondern weil er ›Repressalien devisengesetzlicher Natur‹ befürchtete.
Die Repressalien, die ich zu befürchten hatte, waren nicht devisengesetzlicher Natur.
In Bludenz steig ich aus dem Arlberg-Expreß und schultre meine Bretter, und der Zug fährt an, und ich luge über die geschulterten Bretter flüchtig zum Waggon Erster Klasse zurück und bekomm aus dessen Fenster nicht den geringsten Abschiedswink: auch das abredegemäß; dennoch versetzt mir das Manko einen ganz kleinen kurzen Stich ins Herz, der sich in derselben Sekunde in einem kleinen Stirnstich auswirkt.
Alles schon gehabt und zugleich neu. Die Situation ist neu.
Und so entwickelt sie sich, die Situation. Den Postbus nehmen nach Schruns (wo Ernest Hemingway einmal glücklich gewesen sein soll); ungemeldet bei einem Genossen (Arzt) übernachten; anderntags durch Montafon nach Sankt Gallenkirch hinauf. Dort beim Schmugglerkönig Toni E. nächtigen. Hab wenige Schmugglerkönige angetroffen, die organisierte Genossen waren oder gar geblieben sind; Toni einer der wenigen. In niederer Stube bei Petroleumlicht und Glühwein instruiert er mich: Die im Gebiet Montafon-Silvretta nagelneu eingesetzten SS-Grenzpatrouillen auf Skiern stammen aus Bayern. Sie kennen sich im ›arktischen‹ Grenzgebiet der Silvretta noch nicht ganz aus. Die hiesige Gendarmerie, mit der sie gemeinsam Dienst versehn, hat teils bis dato noch nicht naziwärts umgeschwenkt, und die Schneeverhältnisse über 2000 m ü. d. M. sind momentan für Skifahrer ausgezeichnet. Die Grenze zwischen dem – nun reichsdeutschen – Montafon und dem schweizerischen Prättigau ist in der Schneewüste der Silvretta mit langen Stöcken abgesteckt, aus Behältern hervorragend, in denen in wasserdichtem Umschlag der fast auf den Meter genaue Grenzverlauf schriftlich fixiert ist. – Toni wird mich um 4h früh zu dieser Grenze führen; die vier schmalen Seehundsfellstreifen für unsern Anstieg auf Skiern unterzieht er während seiner Instruktion einer Zerreißprobe, um drauf unser beider Skipaare sachkundig einzuwachsen: mithilfe eines Bügeleisens. Entweder läuft die Sache glatt – eine der Voraussetzungen bei anständigem Skifahren, haha; so Toni. Oder, falls Gefahr im Verzug sein sollte – Toni wird sich, wenn wir droben auf der Silvretta sind, hinter mir halten –, steckt er die in einem Abstand von hundert Metern verlaufenden Grenzstöcke um. Steckt sie zurück, die in der SCHUSSLINIE ragenden (was sich sowohl auf Schußfahren wie auf Schießen bezieht), zurück auf montafonisches, auf vorarlbergisches, auf österreichisches, Pardon, auf großdeutsches Gebiet, so wie man bei gewissen Meisterschaften Slalomstecken manipuliert, hahaha … Und die Brüder aus Bayern würden sich täuschen lassen, mir auf vermeintlich Schweizer Gebiet nicht folgen. Drüben, die Skipatrouillen der helvetischen Grenzpolizei sind seit einer Woche verstärkt worden. ›Liegt der Fall klar, Trebla?‹
›Der Fall liegt klar, Toni.‹ Bin eine Skikanone mittlerer Güte; der in Olmütz Geborene war vom Terrain umgeben: Hohe Tatra, Erz- und Riesengebirge; mein Vater saß zu Pferd und lachte über Skifahrer; meine Mutter liebte den ›neuen Sport‹; mit zehn brillierte ich im Telemarkschwung bei Pulverschnee; mit zwölf fuhr ich Schuß, um irgendwelchen zuschauenden Damen zu imponieren, bis ins nächste Wäldchen hinab, wo ich Kleinholz machte, d. h. meine Bretter zerbrach. Nach dem Krieg erlernte ich bei Hannes Schneider, dem Gründer der Skischule St. Anton, das Abfahren in der ›Arlberghocke‹. (Toni E. erzählt mir soeben, der Hannes wandert jetzt nach Amerika aus.) Mit dem Fliegen war’s nichts mehr: meiner Kriegsverletzung wegen, mit den Skiern ist es noch etwas, selbst bei langer Abfahrt. So rasch wie beim Fliegen verändert sich der Luftdruck nicht. – Fast hätten sie mich gefangengenommen.
Gefangengenommen? Bin ich schon im Zweiten Krieg? Gefahr im Verzug, fahr-fahr-fahr! Genauso wie der Toni es einkalkuliert hat, taucht in der Schneeferne – Schneeferner heißt ein Nordtiroler bayernwärts blickender Piz – die skifahrbare SS-Patrouille auf; tauchen die Bayern auf; steckt der Toni die ›Slalomstecken‹ um, Minuten bevor sie heranzischen im Pulverschnee, und ich entzisch ihnen, umflatscht von ein paar Karabinerschüssen. Das ist mir schon gar nichts Neues, und ich bekomm nicht einmal Stirnklopfen davon.
Hoffentlich entwischt der Toni ihnen. Ah was, er fährt ja wie ein junger Gott.
’s ist wieder Krieg und ich begehre / Nicht schuld daran zu sein. (Matthias Claudius, Wandsbek.) Vor allem aber begehr ich, auch an diesem, auch in diesem Krieg nicht zu krepieren. Nicht auf der Silvretta. – Xane in Zürich wiedersehn; das Paar ten Breukaa ist sogleich ins Engadin weitergefahren. Zwei Monate in Zürichs Seefeldquartier wohnen, im Hotel Zum Hinteren Falken, einem Haus Dritten Rangs, kurz Im Hintern genannt. Das entspricht der ›neuen Situation‹. Man soll sich da nie in Sicherheit wiegen und schon gar nicht nach siebenjähriger Ehe, doch habe ich den guten Verdacht: Xane liebt mich, und nicht nur das; sie scheint sogar nagelneu verliebt zu sein in DEN MANN, DER ÜBER DIE SILVRETTA KAM. Bis mich eine schwere Heufieberattacke-mit-Asthma zum zweitenmal verbannt: ins Oberengadin, wo wir im obersten Stock des Postgebäudes von Pontresina zwei relativ billige Zimmer mit Dusche mieten bei Madame Fausch, der Posthalterin. Kaum haben Xane und ich uns dort, nein: hier eingerichtet, erreicht uns über Franz S., Redakteur der Ostschweizerischen Arbeiterzeitung, St. Gallen, die Nachricht:
Dr. Maxim Grabscheidt, einer unsrer besten Freunde, praktischer Arzt in der Lastenstraße, Grazens Arbeiterviertel, Sozialist (und nach dem Nazi-Terminus Mischling Ersten Grades), vor drei bis vier Wochen ins Konzentrationslager Dachau bei München verschleppt; umgebracht.
Xane nimmt die so sehr verspätete Nachricht, scheint’s, mit großer Fassung auf. Nachmittags händigt mir Madame Fausch eine andre, weniger verspätete ›Nachricht‹ aus. Die meterlange handgeschriebene Epistel des Adelhart Edlen von Stepanschitz. Ein für den Connaisseur wirklich typisches Scheiß-Elaborat, das ich Xane vorzuenthalten beschließe.
Für denselben Abend haben die ten Breukaas uns nach Acla Silva eingeladen. Ich bin in solchen Fällen für etwas Zerstreuung und drum gegen Absage.
Kurz nach dem Essen ist Xane verschwunden.
Pola erzählt etwas über die letzte ›himmlische Burgtheater-Premiere vor dem Anschluß‹, was mich krank macht, und Joop himmelt seinen SPAHI an, was mich krank macht. Pola beordert Jean Bonjour, den waadtländischen Gärtner-Diener-Chauffeur (ein etwas überfüllter Beruf) auf französisch, den Mokka aufzutragen und le sucre nicht zu vergessen, was mich krank macht, und ich verlasse das überheizte Kaminzimmer mit seinem mächtigen Englischen Kamin, an den ein halber Arvenwald verfüttert wird, verlasse es wortlos wie jemand, der austreten muß, und hoff noch, daß Xane sich ebendarum Auf Englisch empfahl. Aber sie ist nirgends im Haus zu finden, und ihr dreiviertellanger Kamelhaarmantel hängt in der Garderobe des Vestibüls, und es hat keinen Sinn, der Küche, wo Bonjour in Sachen Mokka rumort, einen Besuch abzustatten, denn die Haustür, dicke Haupttür der Imitation eines schottischen Landhauses, steht halb offen. Getroffen vom Doppelschein der beiden Haustor-Kandelaber schneidet ebenso sicht- wie fühlbarer Nachtdunst, -brodem herein, Brodem ja Brodem ja Brodem, feuchtkalter.
Ich spähe über die Freitreppe des Terrassengartens hinweg. Auch die Gitterpforte steht halb offen, bei der kleinen gedeckten Holzbrücke, in deren Giebel eine grüngefensterte Laterne hängt. Die Gartentür, die, falls nicht (im besonderen Interesse des SPAHI) definitiv abgeschlossen, sich öffnen läßt mittels eines im Vestibül angebrachten Drückers. Klar: Xane hat den Drücker bedient, und ist durch die Gartentür hinaus in ihrem safrangelben Trikotkleid – oder ist es das himmelblaue? nein das safrangelbe –, ohne Mantel ohne Mantel und hat sich dann wohin gewandt? WOHIN? Ich springe wie ein hindernisspringendes Roß die langen Stufen der Freitreppe hinab, trapple über das Holzbrückchen (wie ganz kurzes Roßgetrappel), halte außerhalb der Mauer, die Acla Silva umschließt, unter der einsamen Glühbirne, die ten Breukaas Garage markiert. Halte an, wie ein jäh gezügeltes Roß, spähe das Straßenstück hinauf, das sich im Dunkel des Stazer Walds verliert; dorthin wird sie sich nicht gewandt haben; das zur Nordostecke des Moritzer Sees führende Straßenstück nieder. Gegen Maiende und welch eine Lenzlosigkeit! Wie ich ten Breukaas Garage hinter mir habe, seh ich beim Lauf durch die kalte Neumondnacht flüchtig aufblickend die Sterne. Schemenhaftes Blinzeln durch frostigen Nachtdunst: Notbeleuchtung für meine Rennstrecke.
Nicht mein Instinkt allein, der mich in diese Richtung schickt, auch Kombinationsvermögen. Vor dem Nachtmahl sind Pola, Xane, ich auf der Mauntschas-Uferpromenade, die sich zum Stahlbad hinüberzieht, spazierengegangen (während Joop es vorgezogen, bei seinem Spahi zu verweilen). Den zuvor begangenen Uferpfad dahintraben; daß der Puls in meiner Stirnnarbenmulde fliegt, nichts Ungewöhnliches. Bedräuender, nein, alarmierender, nein bedräuender die Erkenntnis: es hat keinen Sinn, sie zu rufen.
Keinen Sinn, sie beim Namen zu rufen.
Keinen Sinn. (Einer ihrer Kindheitsaussprüche: ›Je mehr du mich rufst, desto komm ich nicht.‹) Xane! – schreien wäre sinnlos. Es kommt allein an auf Instinkt und Intuition und Kombination und fit-Sein des Läufers. (So ist das schließlich bei jedem Sport. Zum Glück ist mein Heuasthma weg.)
Dann gelangt der Läufer durch die ganz und gar unfrühlingshafte Mainacht, so um 22h, an eine Art Ziel. Auf einer Uferklippe, einem von Rosatsch gebröckelten Felsblock, der ihm heute frühabends aufgefallen ist, ein – vielleicht safrangelber Schimmer, der sich matt bewegt.
Nun ist der Pulsschlag des Läufers mit der einst dreimal operierten Stirn, der Pulsschlag in seiner haselnußgroßen Narbenmulde ein Wumm-wumm-wumm-wumm. Er ist noch nicht 18 gewesen, als er den Kopfschuß abgekriegt hat, und so haben sie ihn genannt, seine Kriegskameraden und später die Genossen in einem Frieden, der kein Frieden gewesen ist:
Trebla, dem das Herz auf der Stirn schlägt.
Morgens nach der Nacht, in der ich zur Uferklippe nachgetastet war, hatte sie 38,8 und hustete. Ten Breukaas schickten ihren Hausarzt Dr. Tardüser herüber. Leichte Bronchitis, Spritzenbehandlung, ein paar Tage Bettruhe. Xane hatte während unserer langen Bekanntschaft fast niemals Husten gehabt und war eine unbegabte Husterin. Ihr Husten erinnerte mich lebhaft an das stimmlos-heisere Gebell herrenloser Hunde in türkischen Städten.
»Weißt du, wie du hustest, Liebling?«
»Na?«
»Wie die halbverhungerten herrenlosen Köter in Konstantinopel gebellt haben. Genauso. Weißt, ich hab mich oft gefragt, warum sie nicht richtig bellen konnten. Komisch, sie konnten einfach nicht.«
Xanes Lachen wurde ein Husten. Sie bezwang es und röchelte: »Selber ein herrenloser türkischer Köter.«
»Wer?«
»Du«, röchelte sie.
»Aha«, sagte ich. »Übrigens waren sie sehr rührend und liebenswert. Obschon sie eine Menge Flöhe hatten und scheußlich geschundene Stellen, mit Grind überkrustet.«
»Du auch.«
»Was?«
»Mit allen deinen Flöhen und geschundenen Stellen«, röchelte sie, »bist du sehr – öcheöche – rührend und liebenswert, Mütterchen.«
Sie lächelte aus den Kissen blaß zu mir auf. Sie hat heute weniger Temperatur und mehr Gesicht als gestern, dachte ich zufrieden. (Bei Krankheiten hatte Xane stets ihr Gesicht eingebüßt, und ich hatte mich ernstlich gefragt, ob man sie wohl mit diesem abhanden gekommenen Gesicht bei unverhoffter und flüchtiger Begegnung wiedererkannt haben würde.) Sie hat sich in diese Krankheit geflüchtet vor der Wahrheit ›Maxim Grabscheidt umgebracht‹; übermorgen wird sie aufstehn, beides überwinden. Und wie ich an die Wahrheit dachte, knisterte Stepanschitzens Brief in meiner Brusttasche, und ich ging aus unserm kleinen Schlafzimmer ins andre kleine hinüber, das ich mir als Kabinett eingerichtet hatte, schloß die Tür und tippte auf meiner alten Remington-Portable die Antwort.
Pontresina, den 24. Mai 1938
Vormals geschätzter Adelhart!
Sage Deinem Hauptmann, sag’s ihm, er kann mich im Arsche lecken.
Nicht mehr Dein Trebla
Ich schloß den Umschlag, tippte die Adresse: Schwarzspanierstraße, Wien IX.
Nach drei düstern Tagen (die Posthalterin hatte uns mit elektrischen Öfchen versorgt) schlich sich der Frühling ins Gebirg. Auf der Wiese unter unsren Fenstern weideten sehr wohlgehaltene pfefferfarbne Kühe, ihr Hüter ein Kind in rotem Wollzeug, so klein, daß unbestimmt blieb: Bub oder Mädchen. Gegen 11h energisches Türklopfen. Dr. Tardüser trat mit seinem schwarzen Köfferchen ein, durchaus städtisch gekleidet – heute fiel mir auf: aus seiner Westentasche ragte, blinkte etwas hervor, das mir kein medizinisches Instrument, sondern eine Stimmgabel zu sein schien. Er horchte Xane ab, verkündete bündig:
»Heute mittag wird aufgestanden.«
»Darf mein Mann auch aufstehn, Herr Doktor?«
»Ihr Mann? Ist er denn krank?«
Xane betrachtete in dem halbblinden Biedermeier-Handspiegel (einem Erbstück) ihr einigermaßen wiedererstandenes Gesicht:
»Nein; aber er steht nicht auf.«
Tardüser musterte mich durch sein Pincenez. Ich stand da in bosnischen Opanken, gehüllt in den von brüchigen Goldfäden durchwirkten, an chemischen Reinigungen verblichenen Burnus, den ich 1916 in Smyrna aufgetrieben hatte und seither als unverwüstlichen Schlafrock benutzte.
»Das heißt, öche-öche«, hüstelte sie, »er ist Rekonvaleszent. Er hatte einen schweren Heufieberanfall in Zürich. Mit Asthma.«
»Aschthma!« schnaufte Tardüser unvermittelt ergötzt. »Asthma! Heufieberasthma! Ein Leidensbrudrr! Bin selber Pollenallergikrr! Was meinen Sie wohl, wenn ich um die Jahreszeit ins Untrland fahren täte? Rrsticken täte ich! Präzis rrsticken!«
»Es geht mir viel besser hier oben.«
»Das möchte ich behaupten! Daß es Ihnen hier bessrr geht, jungrr Mann. Ppon-trres-sina! Das Pparadies der Heufiebrrlinge! Und nicht bis mittags in den Federn liegen, jungrr Mann! Aufstehn! Spazierengehn in Gottes herrlichrr Alpennatuuur!« Er ließ sein Köfferchen zuschnappen, stülpte, noch bevor ich ihm die Tür geöffnet, den soignierten grauen Filzhut auf den graumelierten Scheitel.
»JungerMann JungerMann – mit neununddreißig. Wie kannst du mich vor solch einem wildfremden Edelspießer sooo blamieren? Xane, ich versteh dich nicht mehr: wo du mich noch nie blamiert hast, soweit ich mich erinnere, noch nie, fragst du auf einmal diesen in Gottes Alpennatuuur praktiziiierenden Baaadearzt, fragst ihn: Darf mein Mann a-u-c-h aufstehn?! Sollte das eine Entreenummer sein à la Giaxa und Giaxa?«
»Bitte nicht«, flüsterte sie in den Biedermeierspiegel. »Bitte, sag nichts von Giaxa und Giaxa. Bitte, nicht jetzt.«
Sie hatte so eine seltsame Art, im Ganzprofil verharrend von der Seite zu schauen (die sehr weit auseinanderstehenden Augen ermöglichten das); mich mit einem Auge anzublicken, schweigend, sanftverschlossen, zugleich fremd und prüfend wie ein Mustangfüllen. – Der Badearzt hatte verlangt, daß sie ihr Nachthemd übern Kopf ziehe: er ›sei nicht gewillt, sich bei seinem stethoskopischen Befund von Nachthemdseidengeknister düpieren zu lassen, schon gar nicht bei einer Bronchitis‹. Vom elektrischen Öfchen gewärmt, saß Xane nun halbnackt in Hockstellung, die Beine unter der Bettdecke angezogen, eine Schläfe auf ein zugedecktes Knie gebettet, mit langsam ausholender und langer Gebärde eines nackten Arms dabei, das Nachthemd über den Kopf zurückzulüpfen. Ausgerechnet ein safrangelbes, von der Farbe des Kleids, mit dem sie auf der Mauntschasklippe gekauert … Immer wieder konnte mich beim Anblick dieses siebenundzwanzigjährigen Fraumädchens das Lang und Rund überraschen, das keine Disharmonie ergab, sondern einander auf eine verwunderlich anmutige, ja fast bizarre Weise ergänzte. Die Beine, jetzt unter der Bettdecke verborgen, sind formvollendet, wie man so sagt, grad und lang, doch nicht zu schlank, mit gutem Wadenschwung, ziemlich zarter Fessel, kleinem Fuß, Beine zum Cancan-Tanzen. Sie hat für die Cancan-Tänzerinnen der Belle Époque vorgeschriebne Größe 1 m 75, und wäre Xane eine Zeitgenossin des Grafen Toulouse-Lautrec gewesen, hätte sie in La Goulue’s Quadrille Naturaliste mittanzen können. In der Tat kann sie Cancan tanzen. Während sie bei einem Lieblingsschüler des Altphilologen v. Wilamowitz-Moellendorff an der Berliner Universität hörte und auf ihren Doktor hinarbeitete, nahm sie beim berühmten Gsovski Tanzunterricht: er qualifizierte sie als begabte Cancaneuse. Und späterhin tanzte Xane wirklich Cancan, eine Offenbach-Platte abspielen lassend auf ihrem Koffergrammophon (wir haben es nicht mitgenommen), stets nur einen einzigen Zuschauer duldend: ihr eignes Bild im großen Wandspiegel des kleinen Vorzimmers unsrer Wiener Schönlaterngassen-Wohnung. Der ›Rosenvater‹ (Xanes Vater) ›hat sich so viel und so wahnsinnig erfolgreich in der Welt herumproduziert, daß ich selber eine Idiosynkrasie dagegen hab, mich zu produzieren. Sogar vor dir. Zu seinem schrecklichen Leidwesen; er hätt viel lieber gehabt, daß ich Tänzerin geworden wär als Doktor phil. Und tanz ich Cancan, so tanz ich allein.‹ – Ihre Arme sind ziemlich lang, zartschlank, weshalb ich sie gelegentlich ›Lilienarmige‹ nenne (Homer). ›Im Vergleich zu ihren Haxen, mit den tollsten Haxen von Wien, etwas ernüchternd, diese Arme.‹ So unser Freund, der Wiener Bildhauer Karl Homsa (der inzwischen als ›Entarteter‹ von seinem großen Kollegen Henry Moore protegiert, nach England übersiedelte): ›Gebt mir Xanes Haxen als Modell, laßt mich die bis zum Hüftknochen aus rotem burgenländischen Sandstein heraushauen und ausstellen unterm Titel XANES BEINE UND KEIN TORSO, und ich wett, Picassos Mann Kahnweiler kauft das Stück à tout prix.‹ Langer Rücken; manchmal hab ich das Gefühl, da gibt’s keine Wirbelsäule, zu solch einem Rad kann sie sich vornüberflechten, Kautschukmädchen in der Berufssprache der Parterre-Akrobaten. Der Busen dagegen – in der Sekunde, bevor sie das Nachthemd überstreift – ist wieder anders spektakulär, ein fast-schwerer, fast-üppiger, an den man, an dem ›Mann‹ sich halten kann – wie erschaffen dazu, den Durst eines Babys zu stillen (doch hatte man keins). Um den wiederum ranken Hals ein hellrosa Wollschal und die hochangesetzten Wangen, derentwegen ich sie manchmal Reine Patapouf nannte (im Gedenken ans französische Märchen vom König Pausback, das meine Olmützer Gouvernante so unbarmherzig oft wiedergekäut), Wangen, die nach überstandner Krankheit neuerdings das Naturell gereifter Pfirsiche aufwiesen, die rechte aufs verdeckte Knie gebettet, so schaute sie mich aus den nicht sehr großen, neuerdings strahlend zwischen veilchen- und enzianblau changierenden Augen an, unter halbkreisrunden, ja sichelförmig geschwungenen Brauen. Mit beiden Augen an. Xanes Haar, das selbst bei leichteren Krankheiten zu einer Art stumpfgrünlicher Spinnweben verdorren konnte, bauschte sich wieder in einer Wolke von Haselnußbraunblond, und so kapitulierte ich denn sofort vor dieser impressionistischen Bettschönheit. (Einem ihrer Wiener Lobpreiser hatte sie erwidert: ›So schön bin ich gar nicht, ich schau nur so aus.‹) Schlurrte hinüber zu meiner Remington.
»Trebla.«
»Ja?«
»Wie alt war er eigentlich?«
»Wer?«
»Maxim Grabscheidt.«
»Zwei Jahre älter als ich. Einundvierzig.«
Drei Tage ruhte Xane auf unsrem kleinen Holzbalkon in der Mittagssonne, in Mantel und Wolldecke gehüllt. Die längere Übersetzungsarbeit, die sie übernommen, fortzuführen, hatte sie auf Dr. Tardüsers Rat hin verschoben. Auch ohne ärztlichen Rat wäre sie bereit gewesen, ganz und gar nichts und dann wieder sehr viel zu tun. Eine Mohnblume, die sich unversehens in ein Maultier verwandeln konnte. METAMORPHOSEN oder Verwandlungen durchaus im Sinn des Lucius Apulejus, geb. 125 n. Chr., dessen GOLDENEN ESEL aus von nordafrikanischem Griechisch beeinflußten Latein neu zu übertragen sie sich verpflichtet hatte. (Nicht zuletzt, weil in der Übersetzung von August Rode zu oft der Ausdruck ›traun!‹ fungierte.) La Mistinguett, ums Jahr 30 noch Herrscherin des Montmartre-Tingeltangels Moulin Rouge (bald drauf ward es, Weg allen Fleisches, ein Kino), schräg vis-à-vis dem Zirkus Médrano, in dem Giaxa – bis zu seiner Farewell-Vorstellung 36 – immer wieder aufgetreten, La Mistinguett hatte dessen Tochter, Studentin an der Sorbonne, Xane Coquelicot getauft: Klatschmohnblüte auf langem Stengel. Post Pontresina; ich tippte und fragte zwischenhinein den Holzbalkon: Wie geht es Fräulein Klatschmohn oder Fräulein Doktor Elefantophil? Xane liebt undressierte Elefanten, erwiderte, es gehe, Aviatischek oder Kometischek, beides auf meine Kriegsfliegerei gemünzte Kosenamen. Kult, den Xanes deutschrussische Mutter Elsabé eingeführt hatte. So nannten wir einander etwa auch Kukulaps, estnisch: Kuckuckskind, oder Mütterchen, das womöglich in selbstironischer Verspöttelung unsrer eigenen Kinderlosigkeit. Drei Tage ruhte Xane in der Mittagssonne, und ich wußte: der anmutige Gram, in den sie gehüllt war wie in ihre Wolldecken, galt nicht mehr Maxim Grabscheidts Ende.
Vielmehr den Lebenden: Konstantin und Elsabé Giaxa, an die sie zurück-, immerfort zurückdachte. Und einmal, wie ich ihr Halbprofil betrachtete, stand mir das Herz auf der Stirn still.
War es nicht frevelhaft unvorsichtig gewesen, ihr Stepanschitzens Brief vorzuenthalten? Diesem hinter ihrem Rücken so lapidar mit dem jungen Goethe zu antworten? Sie würde mir zweifellos geraten haben, den langen Brief aus Wien zu ignorieren; nun war die rüde Antwort abgegangen. Jählings schlug das abscheuliche Wort
SIPPENHAFT
in mich ein. Nein, beschwichtigte ich mich selber, sie würden es nicht wagen. Sein Name weckt Lachsalven der Vergangenheit; sie werden sich an ihn nicht wagen. Zudem war’s letzthin still um ihn geworden, einen zurückgezogen in seinem Radkersburger Landhaus lebenden, dem Schachspiel und dem Patience-Legen ergebenen alten Mann, Mitte Sechzig; und Giaxa Der Letzte knabbert seinen Gnadenhafer in Giaxas Stall …
»Bittschön, einen Kaffee-Grappa und einen Café nature.«
»Möcht auch einen Kaffee-Grappa.«
Ich, leicht erstaunt: »Du auch?«
Xane gelassen: »Ich auch.«
Wir hatten in der Kurierstube des Hotels Morteratsch mittaggegessen, in der Gesellschaft von Hausdienern und Fuhrleuten. (Wir haben die Kurierstube gewählt, um der Heuschnupfensekte zu entgehn.) Die ›Serviertochter‹ kredenzte uns zwei Gläser schwarzen, mit Grappa arosierten Kaffee.
»Kuckuckskind, solltest du nicht die Pola anrufen? Sie hat dir doch ihren Hausarzt und ein Kilo Alpenrosen geschickt. Müssen wir nicht anstandshalber nach Acla Silva hinüber, Servus sagen?«
Xane: «Noch nicht … Noch nicht … Mütterchen, ich –«
»Aber ganz wie du willst, Mütterchen.«
Sie pustete versonnen ins Glas. Dann leerte sie es in langen Zügen, wie man bei Durst Wasser trinkt. »Fein.«
»Abgemacht.«
»Nein, ich mein’ deinen Kaffee-Grappa. Der ist fein.«
»So? Seit wann sympathisierst du mit Schnaps?«
»Seit heut.«
Arm in Arm umherspazieren in der Bannmeile des stattlichen Pfarrdorfs. Dahin zwischen weißgetünchten sgraffitogeschmückten Engadiner Häusern, rätoromanische Segenssprüche über der Tür, bäurischen Festungen mit Fenstern, die schießschartenartig in kubischen Höhlen liegen, gewappnet mit bauchigen Schmiedeeisengittern, durch die hängende Pechnelken sprießen. Über der Schlucht- und Taispromenade oder durch Arven- und Lärchenwald hinan zum fünfeckigen Burgturm Spaniola, der wohl seit einem Millennium den Eingang zum Berninapaß bewacht, oder ein sehr kurzes Stück den Pfad zum Schafberg empor, auf dessen Höhen Segantini gestorben. Inmitten Unterpontresinas erhob sich die Confiserie Jann, ein im Gründerstil aufgeführter, das Dorfbild verschandelnder Bau, kraus und unübersichtlich beladen mit Erkern, Türmchen, Zinnenbalkons, behängt mit einem Arsenal von Schildern, die nach allen Seiten CONFISERIE und TEA-ROOM riefen. Stets wenn der Bau sich uns in neuem Aspekt bot, deutete ich blitzverblüfft hin: »Da schau her! noch eine, FixLaudon, noch eine Konfiserei. Phantastisch, wieviel Teeräume wir hier am Platze haben, wie?« Doch war es immer derselbe eine, und Xane konnte meinem unermüdlich gespielten Irrtum immer wieder ein dunkel-sachtsamtiges Kichern schenken, als läute man eine mit Samt austapezierte Glocke.
Abends saßen wir wieder im Eck der arvenholzgetäfelten Kurierstube. Ich bestellte einen Zweier Veltliner, ein Glas Tee und Spielkarten. Die Serviertochter Pina breitete einen grünen Spielteppich übern Tisch. Im Lampenschein funkelte der Veltliner fast schwarz. Xane zündete sich eine Zigarette an. (Sie raucht fünf am Tag.) Sie hatte sich zu kleinem Abendschmuck ein breites schwarzes Samtband um die Simpelfransen gewunden. Während sie ihren Tee unberührt ließ, begann sie – ganz wider ihre Gewohnheit – an meinem Weinglas zu nippen. Nachdem ich die Karten gemischt hatte, führte ich ihr meine miserablen Kartenkunststücke vor.
»Welche Karte soll ich dir zaubern?«
»Cœur Bube.«
»Cœur Bube, ein Ding der Unmöglichkeit.«
»Ach, mein Armer.« Sie bettete das Kinn auf den langen Handrücken. Ihre Augen, jetzt nicht mehr veilchenblau, sondern im Lampenlicht, das die rötlich gebeizte Holztäfelung mild widerstrahlte, dunkel irisierend wie der Veltliner, lächelten über mich hin.
»Schluß mit der elenden Zauberei.«
»Schon Schluß?« fragte sie.
»Schon Schluß.« Resignation mimend, schob ich das Kartenspiel beiseite. »Weißt du, komisch: die Haare von der Polari werden immer röter.«
»Ja?«
»Ja.« Ich wühlte ganz nebenhin im Spiel umher, bis ich den Cœur Buben sondiert hatte. »Kenn sie jetzt über zwanzig Jahr.« Ohne Hinsehn deckte ich den Cœur Buben mit den übrigen Karten zu. »Damals hatte sie einen tizianroten Chignon. Aber so rot wie heut – nein.«
»Nein?«
»Nein. Soll ich’s also d-o-c-h riskieren? Was hast du gesagt? Cœur Bube?«
»Hab ich gesagt.«
»Probieren kann man’s ja. Die wievielte soll’s sein?«
»Die, mm – erste.«
Ich nahm das verdeckte Spiel, placierte die unterste Karte zuoberst, pustete drauf, schob ihr das Spiel hin. Xane deckte den Cœur Buben auf.
»Wirklich wunderbar«, lächelte sie etwas mokant.
Keine Woche, nachdem ich meine Antwort an Stepanschitz/Laimgruber spediert hatte, stiegen im Hotel Morteratsch zwei Wiener ab. Blonde Burschen Mitte Zwanzig. Sie vermerkten ihre Namen auf der im Durchgang zur Speiseveranda ausgehängten Mitgliederliste des CHPP, Club der Heufieber-(Hayfever-)Patienten Pontresina:
J. Krainer
G. Mostny
2
Donnerstag, den 2.Juni, Radio Beromünster (von mir in der Kurierstube abgehört) hatte die Ernennung Dr.Hans Froelichers zum Schweizer Gesandten in Berlin bekanntgegeben, gegen 16h fand im Val Roseg DIE ERSTE BEGEGNUNG statt.
Auf der Russellas-Promenade; Zirrokumuluswölkchen verliehn dem Himmel etwas von einer Steppdecke; drunten, ins Veltlin mochte der erste heiße Tag des Jahrs eingezogen sein; hier im Roseg brütete die Sonne wärmend durch die Wolkenritzen, melkte Harzduft aus den Arven, Föhren, Lärchen. »Atme«, sagte ich. Niemand kam uns entgegen. Aus Süden, vom Gletscher herab, schäumte ziemlich hochgeschwollen der Rosegbach; führte der Fußweg dicht ans Ufer, traf uns eisig-frischer Hauch. Auch auf dem das andre Ufer entlangziehenden Fahrweg keinerlei Betrieb: bis auf einen vereinzelten Leiterwagen, mit zwei Maultieren bespannt, die gemächlich in Richtung Pontresina trabten. Große Milchbottiche aus Zink schaukelten offenbar leer gegeneinander, doch übertoste der Wildbach ihr Klirren. Vorbei.
Der Nadelwald wurde schütter, verkrüppelte; wir näherten uns der Baumgrenze. Da regte sich doch jemand.
Inmitten einer Geröllhalde, sich in vollendetem Mimikry kaum abhebend von ihr, hockte auf seinen Hinterbeinen ein grau-orange pelziges Murmeltier. Nein: es hockte nicht, es stand da, aufrecht, kerzengrad, die Vorderbeine: vielmehr die kurzen Arme hängen lassend. Sehr ähnlich einem kleinen, ebenso vorsichtigen wie neugierigen Menschen in einem fußfallenden Pelzmäntelchen– der wartete; auslugte; in Quivive-Manier erstarrte. Als wir uns näherten– ein sachtdurchdringender Pfiff. Verschwunden.
Xane wanderte fünf, dann zehn, dann zwanzig Schritt vor mir her auf niedern Absätzen, in ihrem blauen Sweater-Kleid, zu dem sie einen gleichfarbnen Schal als Turbanchen trug. Ihr Dreß schien abgestimmt aufs Wolkenritzenblau. Sie schlenderte, unmerklich die hohen Hüften wiegend, gletscherwärts. Wir hatten die Alp prima zur Rechten, indes, so wie die Posthalterin es uns beschrieben, die Alp seguonda vor uns zur Linken anstieg, rosagescheckt vom ersten Alpenrosenblust, und ich klemmte eins meiner beiden Monokel ein (solches nicht etwa dazu angetan, reliquienstolz meine kakanische Abkunft zu unterstreichen, vielmehr unerläßlich, seit im Gefolge des Kopfschusses rechtsseitig sporadisch Sehschwäche aufgetreten, eine besonders meine Fernschau beeinträchtigende, während ich links wie ein Sperber sehe), mein horngefaßtes (das andre mein Lesemonokel). Noch eine halbe Gehstunde zum Hôtel du Glacier, schätzte ich. Ein Haus am Fuß der schwärzlichen Gletschermoräne; vom Dach geisterte dünner Rauch auf. Unwillkürlich hielt ich Rückschau und sah…
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!