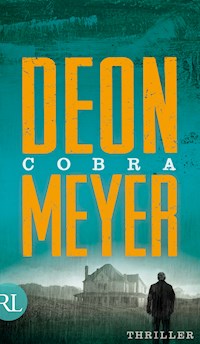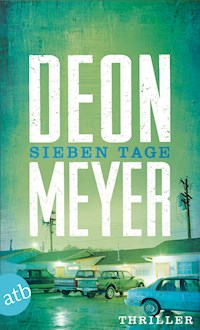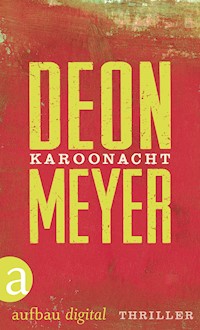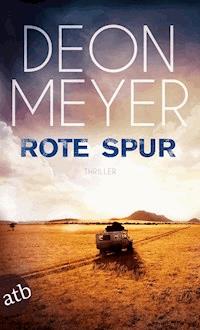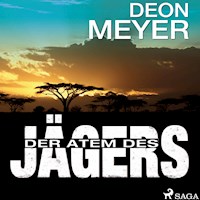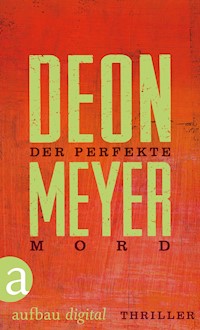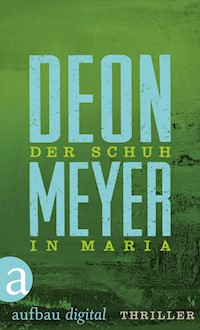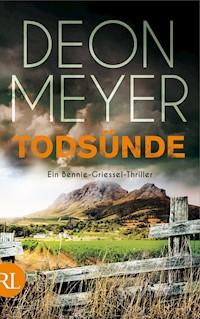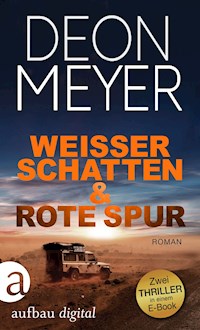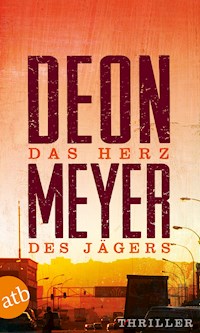
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine rasante Jagd durch ein geheimnisvolles Land
Thobela führt ein ordentliches Leben in Kapstadt. Er hat sich in Miriam verliebt und kümmert sich rührend um deren Sohn. Niemand ahnt, dass Thobela ein Killer war, der für die Befreiungsbewegung getötet hat. Als aber die Tochter eines alten Freundes vor seiner Tür steht, weiß er, dass er die Schatten der Vergangenheit nicht abschütteln konnte. Der Freund, ein ehemaliger Regierungsbeamter, ist gekidnappt worden, weil er eine Diskette mit Geheimdienstinformationen besitzt. Thobela soll diese Diskette nach Lusaka bringen. Wenn er es nicht tut, wird man seinen Freund töten ...
„Deon Meyer ist etwas Besonderes gelungen. Hochspannend erzählt er die Geschichte eines wahren Helden.“ Die Zeit.
"Deon Meyer hat mich sofort am Haken gehabt. Eine Geschichte mit Tiefgang." Michael Connelly.
"'Das Herz des Jägers' ist ein brillantes Buch." Michael Ridpath.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 528
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Deon Meyer
Das Herz des Jägers
Thriller
Autorisierte Übersetzung aus dem Englischen von Ulrich Hoffmann
Impressum
ISBN E-Pub 978-3-8412-0016-7ISBN PDF 978-3-8412-2016-5ISBN Printausgabe 978-3-7466-2328-3
Aufbau Digital,veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, Februar 2010© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2010Copyright © 2003 by Deon MeyerErstmals erschienen 2005 bei Rütten & Loening Berlin; Rütten & Loening ist eine Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung heilmann/hißmann, Hamburgunter Verwendung eines Motivs von © africamediaonline / images.de und © istockphoto/Qweek
Konvertierung Zentrale Medien, Bochum
www.aufbau-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Impressum
Inhaltsübersicht
1984
März
1
Oktober
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
November
45
46
47
Danksagungen
Für Anita
1984
Er stand hinter dem Amerikaner und wurde durch das Gedränge in der Metro beinahe an ihn gepreßt. Doch seine Seele befand sich weit entfernt an der Küste der Transkei, wo große Wellen donnernd an den Strand rollten.
Er dachte an die Steine, auf denen er sitzen und die Schaumkronen beobachten konnte, die nach ihrer endlosen Reise über lange, einsame Weiten vom Indischen Ozean heranrollten, um sich schließlich gegen die Steine des dunklen Kontinentes zu werfen und hier zu zerschellen.
Zwischen zwei Wellen entstand ein Augenblick absoluter Stille, Sekunden der vollkommenen Ruhe. Es war so still, daß er die Stimmen seiner Vorfahren hören konnte – Phalo und Rharhabe, Nquika und Maqoma, sein Blut, seine Herkunft und Zuflucht. Er wußte, daß er zu ihnen gehen würde, wenn seine Zeit gekommen war, wenn er die lange Klinge verspürte und das Leben aus ihm herausflutete. Er würde dann zu diesen Momenten zwischen den sich brechenden Wellen zurückkehren.
Er wandte sich langsam, beinahe vorsichtig, wieder der Gegenwart zu. Er bemerkte, daß sie nur noch wenige Minuten von der Metrostation St. Michel entfernt waren. Er beugte sich vor, neigte sich etwa einen halben Kopf herunter, zum Ohr des Amerikaners. Seine Lippen waren so nah wie die eines Liebhabers.
»Wissen Sie, wohin Sie reisen, wenn Sie sterben?« fragte er mit einer Stimme tief wie ein Cello, und in einem Englisch, das schwer war vom Akzent Afrikas.
Er wartete geduldig darauf, daß der Mann sich in der Enge des Wagens umdrehte. Er wartete, bis er seine Augen sehen konnte. Dies war der Augenblick, nach dem ihn dürstete. Konfrontation, der Beginn des Kampfes. Dies war seine Berufung – instinktiv, erfüllend. Er war ein Krieger aus den Weiten Afrikas, jede Sehne und jeder Muskel waren nur für diesen Augenblick geschaffen worden. Sein Herz schlug schneller, Energie erfüllte ihn, er war besessen vom göttlichen Wahnsinn des Kampfes.
Zuerst wandte sich der Körper des Amerikaners ihm zu, ohne Eile, dann der Kopf, schließlich der Blick. Er sah einen Falken, einen Jäger ohne Angst, selbstsicher, sogar amüsiert, die Mundwinkel der dünnen Lippen hoben sich. Die Männer waren wenige Zentimeter voneinander entfernt, und zwischen ihnen herrschte eine eigenartige Intimität.
»Wissen Sie es?«
Die Augen schauten ihn an.
»Denn bald werden Sie dort sein, Dorffling.« Er sagte den Namen voller Verachtung, es war die endgültige Kriegserklärung, die klarstellte, daß er seinen Feind kannte – er hatte den Auftrag akzeptiert, die Akte gelesen und auswendig gelernt.
In dem gelassenen Blick war keine Reaktion auszumachen. Die Bahn verlangsamte ihre Fahrt und hielt in St. Michel. »Das ist unsere Station«, sagte er. Der Amerikaner nickte und ging, nur einen Schritt vor ihm, die Treppe hinauf in die umtriebige Sommernacht des Quartier Latin. Doch dann rannte Dorffling los. Den Boulevard St. Michel in Richtung der Sorbonne entlang. Er wußte, daß Opfer bekanntes Territorium bevorzugten. Dort vorne lag Dorfflings Wohnung, gleich um die Ecke vom Place du Pantheon. Dort befand sich auch seine Sammlung an Messern und Garrotes und Schußwaffen. Aber er hatte nicht mit Flucht gerechnet, er hatte gedacht, Dorfflings Ego wäre zu groß. Sein Respekt für den Ex-Marine, der zum CIA-Killer geworden war, nahm zu.
Sein Körper hatte instinktiv reagiert, die langen Beine ließen seinen massigen Körper rhythmisch vorwärts schnellen, zehn, zwölf Schritte hinter dem Fliehenden. Franzosen schauten ihnen nach. Ein weißer Mann, der von einem schwarzen Mann verfolgt wurde. Eine Urangst blitzte in den Augen auf.
Der Amerikaner bog in die Rue des Ecoles, dann nach rechts in die Rue St. Jacques. Nun befanden sie sich in den Gassen der Universität, beinahe menschenleer in den Ferien im August, die uralten Gebäude düster, die Schatten abweisend. Mit langen, sicheren Schritten erreichte er Dorffling und stieß ihn mit der Schulter nieder. Der Amerikaner stürzte ohne einen Laut auf die Straße, rollte sich ab und richtete sich in einer geschmeidigen Bewegung wieder auf, kampfbereit.
Er griff über seine Schulter nach dem gekürzten Assegai, das in der Scheide steckte, die sich an seinen Rücken schmiegte. Kurzer Griff, lange Klinge.
»Mayibuye«,sagte er sanft.
»Was für eine beschissene Sprache ist das, Nigger?»Die Stimme heiser, ausdruckslos.
»Xhosa«, sagte er, und der harte Klang seiner Stimme brach sich scharf an den Hauswänden. Dorffling bewegte sich selbstsicher. Er hatte sein Leben lang nichts anderes getan. Er beobachtete, schätzte, tarierte, sie bewegten sich im Kreis – die kleiner werdenden Kreise eines rhythmischen Todestanzes.
Der Angriff kam unvorstellbar schnell, doch bevor Dorfflings Knie seinen Bauch erreichte, schlang er seinen Arm um den Hals des Amerikaners und stieß die lange dünne Klinge durch das Brustbein. Er hielt ihn eng an seinen eigenen Körper gepreßt, während die blaßblauen Augen ihn anstarrten.
»Uhm-sing-gelli«, sagte der Ex-Marine.
»Umzingeli.« Er nickte, er korrigierte die Aussprache sanft und höflich. Er hatte Respekt für den Vorgang, dafür, daß sein Gegenüber nicht bettelte, für die stille Akzeptanz des Todes. Er sah das Leben aus den Augen weichen, fühlte, wie der Herzschlag sich verlangsamte, der Atem unregelmäßig wurde, dann nichts mehr.
Er ließ die Leiche sinken, spürte, wie die großen, festen Muskeln des Rückens sich lösten, und legte den Körper vorsichtig nieder.
»Wo gehst du hin? Weißt du es jetzt?«
Er wischte sein Assegai am T-Shirt des Mannes ab, schob es langsam in die Scheide zurück.
Dann wandte er sich um und ging davon.
März
1
Transkript des Verhörs von Ismail Mohammed durch A.J.M. Williams, 17. März, 17:52, Büro der South African Police Services, Gardens, Kapstadt.
W: Sie wollten mit jemandem vom Geheimdienst sprechen?
M: Sind Sie das?
W: Das bin ich, Mr. Mohammed.
M: Woher soll ich das wissen?
W: Sie müssen mir glauben.
M: Das ist nicht gut genug.
W: Was wäre denn gut genug für Sie, Mr. Mohammed.
M: Haben Sie einen Ausweis?
W: Sie können sich das hier ansehen, wenn Sie wollen.
M: Verteidigungsministerium?
W: Mr. Mohammed, ich vertrete staatliche Ermittlungsstellen.
M: NIA?
W: Nein.
M: Geheimdienst?
W: Nein.
M: Was dann?
W: Die, auf die es ankommt.
M: Militär?
W: Es scheint hier ein Mißverständnis vorzuliegen, Mr. Mohammed. Ich habe die Nachricht erhalten, daß Sie Probleme haben und Ihre Position dadurch verbessern wollen, daß Sie bestimmte Informationen zur Verfügung stellen. Stimmt das?
[Unverständlich]
W: Mr. Mohammed?
M: Ja?
W: Stimmt das?
M: Ja.
W: Sie sagten der Polizei, Sie würden diese Informationen nur an jemanden vom Geheimdienst weitergeben?
M: Ja.
W: Nun, dies ist Ihre Chance.
M: Woher soll ich wissen, daß wir nicht belauscht werden?
W: Laut Gesetz muß die Polizei Sie informieren, bevor ein Verhör mitgeschnitten wird.
M: Ha!
W: Mr. Mohammed, haben Sie mir etwas zu sagen?
M: Ich will Immunität.
W: Oh?
M: Und garantierte Vertraulichkeit.
W: Niemand bei Pagad soll wissen, daß Sie geredet haben?
M: Ich bin kein Mitglied von Pagad.
W: Sind Sie ein Mitglied der »Muslims Against Illegitimate Leaders«?
M: Illegal Leaders.
W: Sind Sie ein Mitglied von MAIL?
M: Ich will Immunität.
W: Sind Sie ein Mitglied von Quibla?
[Unverständlich]
W: Ich kann versuchen, mich für Sie einzusetzen, Mr. Mohammed, aber ich kann Ihnen nichts garantieren. Die Anklage gegen Sie ist wasserdicht. Wenn Ihre Information etwas wert ist, kann ich Ihnen nur versprechen, daß ich tun werde, was ich kann …
M: Ich will eine Garantie.
W: Dann müssen wir uns jetzt voneinander verabschieden, Mr. Mohammed. Viel Glück vor Gericht.
M: Geben Sie mir nur …
W: Ich rufe jetzt die Detectives.
M: Warten Sie …
W: Auf Wiedersehen, Mr. Mohammed.
M: Inkululeko.
W: Wie bitte?
M: Inkululeko.
W: Inkululeko?
M: Es gibt ihn.
W: Ich weiß nicht, wovon Sie reden.
M: Warum setzen Sie sich dann wieder hin?
Oktober
2
Ein junger Mann steckte seinen Kopf aus einem Minibus-Taxi, winkte höhnisch mit den Fingern und lachte mit weißen Zähnen in Thobela Mpayiphelis Richtung.
Thobela wußte, warum. Oft genug hatte er sein Spiegelbild in den großen Schaufensterscheiben gesehen – ein riesiger Schwarzer, hochgewachsen und breitschultrig, auf der kleinen Honda Benly, deren Zweihundert-Kubik-Motor mühsam, aber tapfer, unter seinem Gewicht vor sich hin tuckerte. Seine Knie berührten fast die Griffe, die langen Arme waren scharf abgewinkelt, der Motorradhelm war unpassend groß und schwer.
Es war ein besonderes Schauspiel.
In den ersten paar Wochen wußte Thobela genau, was für einen Anblick er bot, als er zu allem Überfluß noch hatte lernen müssen, auf dem Ding zu fahren. Auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause, an jedem Morgen und Nachmittag im dichten Verkehr auf der N2 war er unsicher und ungelenk gewesen, doch als er es erst einmal heraushatte, als er wußte, wie man den Vans, Geländewagen und Bussen auswich, als er gelernt hatte, sich in die Lücken zwischen den Autos zu quetschen, störten ihn auch die höhnisch gereckten Finger nicht mehr.
Später begann er es sogar zu genießen: Während die Autos im Stau gefangen waren, rauschten er und seine Benly zwischen ihnen hindurch, die langen Gassen entlang, die sich zwischen den Autoreihen bildeten.
Unterwegs nach Guguletu zu Miriam Nzululwazi.
Und Pakamile, der an der Straßenecke auf ihn warten würde und dann die letzten dreißig Meter bis zur Einfahrt neben der Benly herlief. Stumme, sieben Jahre alte Bewunderung in den weitaufgerissenen Augen, ernsthaft wie seine Mutter, wartete der Junge geduldig, bis Thobela seinen Helm abnahm und die metallene Lunchbox herunternahm, mit seiner großen Hand über den Kopf des Jungen strich und sagte: »Hallo, Pakamile.« Dann überwältigte ihn der Junge mit seinem Lächeln und schlang seine Arme um ihn, ein magischer Augenblick jedes Tages, und danach ging er zu Miriam hinein, die schon damit beschäftigt war, zu kochen, zu waschen oder sauberzumachen. Die große, schlanke, wunderschöne Frau küßte ihn dann und fragte ihn nach seinem Tag.
Der Junge geduldete sich, bis er mit ihr geredet und sich umgezogen hatte. Dann die wundervollen Worte: »Laß uns in den Garten gehen.«
Pakamile und er gingen in den Hof, um das Wachstum der letzten vierundzwanzig Stunden zu betrachten und zu besprechen. Die Maiskolben, die Stangenbohnen (»Mußtet ihr ausgerechnet die Sorte ›Lazy Housewife‹ pflanzen«, beschwerte sich Miriam, »soll mir das etwas sagen?«), die Karotten, Beete voller Zucchini und Kürbisse und Wassermelonen. Sie zogen probehalber eine Karotte heraus. »Zu klein.« Pakamile wusch sie später, um sie seiner Mutter zu zeigen, und dann kaute er knackend die rohe, orange leuchtende Wurzel. Sie suchten nach Schädlingen und sahen nach, ob die Blätter von Pilzen oder Krankheiten befallen waren. Er erklärte, Pakamile nickte ernsthaft und nahm das Wissen mit weitaufgerissenen Augen auf.
»Das Kind ist verrückt nach dir«, hatte Miriam mehr als einmal gesagt.
Thobela wußte das. Und er war verrückt nach dem Kind. Nach ihr. Nach ihnen.
Zuerst aber mußte er mit dem Hinderniskurs der Rushhour fertig werden, den Kamikaze-Taxis, den ungeduldigen Geländewagen, den Bussen, den wilden Audis der Yuppies, die ihre Spuren wechselten, ohne in die Rückspiegel zu schauen, den rostigen, klapprigen Pick-ups – Bakkies genannt – aus den Townships.
Der Direktor lächelte. Janina Mentz hatte ihn nie ohne dieses Lächeln gesehen.
»Was für Probleme gibt es?«
»Johnny Kleintjes, Herr Direktor, aber Sie sollten das selbst hören.« Mentz stellte den Laptop auf den Schreibtisch des Direktors.
»Setzen Sie sich, Janina.« Er lächelte immer noch sein herzliches, einnehmendes Lächeln, sein Blick war zärtlich, als schaute er sein Lieblingskind an. Er ist so klein, dachte sie, klein für einen Zulu, klein für einen Mann, der so eine große Verantwortung trägt, aber makellos gekleidet, das weiße Hemd ein energischer Kontrast zu der dunklen Haut, der dunkelgraue Anzug ein Ausdruck guten Geschmacks, irgendwie genau richtig. Wenn er so saß, konnte man den Buckel, die kleine Verwachsung von Rücken und Hals, kaum ahnen. Mentz bewegte den Cursor über den Bildschirm, um die Wiedergabe zu starten.
»Johnny Kleintjes«, sagte der Direktor. »Der alte Spitzbube.«
Er tippte auf die Computertastatur. Die Stimmen hallten blechern durch die kleinen Lautsprecher.
»Sind Sie Monica?« Kein Akzent. Dunkle Stimme.
»Ja.«
»Johnny Kleintjes Tochter?«
»Ja.«
»Dann möchte ich, daß Sie gut zuhören. Ihr Daddy hat ein kleines Problem.«
»Was für ein Problem?« Sofortige Besorgnis.
»Sagen wir mal, er hat etwas versprochen, was er dann nicht einhalten konnte.«
»Wer sind Sie?«
»Das werde ich Ihnen nicht sagen, aber ich habe eine Nachricht für Sie. Hören Sie zu?«
»Ja.«
»Es ist sehr wichtig, daß Sie mich gut verstehen, Monica. Sind Sie ruhig?«
»Ja.«
Stille, einen Moment lang. Mentz schaute zum Direktor auf. Sein Blick war immer noch sanft, sein Körper immer noch entspannt hinter dem breiten, aufgeräumten Schreibtisch.
»Daddy sagt, es befände sich ein Festplatten-Laufwerk in dem Safe in seinem Arbeitszimmer.«
Stille.
»Haben Sie mich verstanden, Monica?«
»Ja.«
»Er sagt, Sie wüßten die Kombination.«
»Ja.«
»Gut.«
»Wo ist mein Vater?«
»Er ist hier. Bei mir. Und wenn Sie nicht mit uns zusammenarbeiten, werden wir ihn umbringen.«
Ein Keuchen. »Ich … bitte …«
»Bleiben Sie ruhig, Monica. Wenn Sie ruhig bleiben, können Sie ihn retten.«
»Bitte … Wer sind Sie?«
»Ein Geschäftsmann, Monica. Ihr Daddy hat versucht, mich hereinzulegen. Jetzt müssen Sie die Sache in Ordnung bringen.« Der Direktor schüttelte reumütig den Kopf. »Ach, Johnny«, sagte er.
»Sie werden ihn trotzdem töten.«
»Nicht, wenn Sie uns helfen.«
»Wie kann ich Ihnen glauben?«
»Haben Sie eine Wahl?«
»Nein.«
»Gut. Wir machen Fortschritte. Jetzt gehen Sie zum Safe und holen Sie das Laufwerk.«
»Bitte bleiben Sie dran.«
»Ich bleibe dran.«
Das leise Zischen der Elektronik. Eine statische Störung in der Leitung.
»Wann hat dieses Gespräch stattgefunden, Janina?«
»Vor einer Stunde, Herr Direktor.«
»Sie sind schnell, Janina. Das ist gut.«
»Vielen Dank, Sir, aber es war das Überwachungsteam. Sie sind am Ball.«
»Der Anruf ging bei Monica zu Hause ein?«
»Ja, Sir.«
»Was glauben Sie, um was für Daten es geht, Janina?«
»Sir, gibt es so viele Möglichkeiten?«
Der Direktor lächelte mitfühlend. Seine Augen waren von Fältchen umgeben, regelmäßig, würdevoll. »Aber wir müssen vom Schlimmsten ausgehen?«
»Ja, Sir. Wir müssen vom Schlimmsten ausgehen.« Mentz konnte keine Panik entdecken, nur Ruhe.
»Ich … ich habe das Laufwerk.«
»Wunderbar, jetzt haben wir nur noch ein Problem, Monica.«
»Was?«
»Sie sind in Kapstadt und ich nicht.«
»Ich bringe es Ihnen.«
»Wie reizend.« Ein gedämpftes Lachen.
»Ja. Sagen Sie mir nur, wo Sie sind.«
»Das mache ich, meine Liebe, aber Sie müssen wissen, daß ich nicht ewig warten kann.«
»Das verstehe ich.«
»Das glaube ich nicht. Ihnen bleiben zweiundsiebzig Stunden, Monica. Und es ist ein weiter Weg.«
»Wo muß ich hin?«
»Sind Sie wirklich sicher?«
»Ja.«
Wieder eine Pause, die sich lange hinzog.
»Treffen Sie mich im Republican Hotel, Monica. Im Foyer. In zweiundsiebzig Stunden.«
»Im Republican Hotel?«
»In Lusaka, Monica. Lusaka in Sambia.«
Man konnte sie einatmen hören.
»Haben Sie das?«
»Ja.«
»Verspäten Sie sich nicht, Monica. Und tun Sie nichts Unüberlegtes. Er ist kein junger Mann mehr. Alte Männer sterben schnell.«
Die Leitung war tot.
Der Direktor nickte. »Das ist nicht alles.« Davon ging er aus.
»Nein, Sir.«
Sie tippte erneut auf die Tastatur. Das Wählgeräusch. Ein Telefon klingelte.
»Ja?«
»Kann ich mit Tiny sprechen?«
»Wer ist da?«
»Monica.«
»Warte mal.« Gedämpft, als hielte jemand eine Hand über die Sprechmuschel: »Eine von Tinys Freundinnen sucht nach ihm.«
Dann eine neue Stimme: »Wer ist da?«
»Monica.«
»Tiny arbeitet hier nicht mehr. Schon seit fast zwei Jahren.«
»Wo ist er jetzt?«
»Versuch’s mal bei Mother City Motorrad. In der Innenstadt.«
»Danke.«
»Tiny?« fragte der Direktor.
»Sir, wir arbeiten daran. Auf den Listen steht nichts. Die Nummer, die Monica angerufen hat, gehört einem Orlando Arendse. Auch unbekannt. Aber wir gehen der Sache nach.«
»Es gibt noch mehr.«
Mentz nickte. Sie ließ das Programm weiterlaufen.
»Motorrad.«
»Kann ich bitte mit Tiny sprechen?«
»Tiny?«
»Ja.«
»Ich glaube, Sie haben die falsche Nummer.«
»Tiny Mpayipheli?«
»O Thobela. Er ist schon nach Hause gegangen.«
»Ich muß ihn dringend sprechen.«
»Augenblick.« Papier raschelte. Jemand fluchte leise.
»Hier ist eine Nummer. Versuchen Sie es. 555-7970.«
»Vielen Dank.« Die Leitung war schon tot.
Neuer Anruf.
»Hallo.«
»Kann ich bitte mit Tiny Mpayipheli sprechen?«
»Tiny?«
»Thobela?«
»Er ist noch nicht zu Hause.«
»Wann erwarten Sie ihn?«
»Wer sind Sie denn?«
»Mein Name ist Monica Kleintjes. Ich … er kennt meinen Vater.«
»Thobela ist normalerweise um Viertel vor sechs zu Hause.«
»Ich muß mit ihm sprechen. Es ist sehr dringend. Können Sie mir Ihre Adresse sagen? Ich muß ihn sehen.«
»Wir sind in Guguletu. 21 Govan Mbeki.«
»Vielen Dank.«
»Ein Team folgt ihr. Ein weiteres Team haben wir nach Guguletu geschickt, Sir. Das Haus gehört einer Mrs. Miriam Nzululwazi, und ich gehe davon aus, daß sie auch den Anruf entgegengenommen hat. Wir werden herausbekommen, wie ihre Beziehung zu Mpayipheli ist.«
»Thobela Mpayipheli, auch Tiny genannt. Was werden Sie nun tun, Janina?«
»Das Team berichtet, daß Monica Kleintjes in Richtung Flughafen fährt. Sie könnte unterwegs nach Guguletu sein. Sobald wir sicher sind, Sir, werden wir sie zum Verhör holen.«
Der Direktor faltete seine kleinen Hände auf dem glänzenden Schreibtisch.
»Ich möchte, daß Sie sich vorerst zurückhalten.«
»Ja, Sir.«
»Schauen wir mal, wie sich die Dinge entwickeln.«
Mentz nickte.
»Und ich denke, Sie sollten besser Mazibuko anrufen.«
»Sir?«
»Stecken Sie die Reaction Unit in ein Flugzeug, Mentz.«
»Aber, Sir … Ich habe alles unter Kontrolle.«
»Ich habe vollkommenes Vertrauen in Sie, aber wenn Sie sich einen Rolls-Royce kaufen, müssen Sie ihn irgendwann auch einmal probefahren. Um herauszubekommen, ob er den Preis wert ist.«
»Sir, die Reaction Unit …«
Er hob eine kleine, feingeschnittene Hand. »Selbst wenn Sie nichts tun sollten, glaube ich, daß Mazibuko mal raus muß. Und man kann nie wissen.«
»Ja, Sir.«
»Wir wissen ja, wo die Daten hin sollen. Das Ziel ist bekannt. Deshalb haben wir ein sicheres Testfeld. Eine kontrollierbare Umgebung.«
»Ja, Sir.«
»Sie können hiersein in …«, der Direktor schaute auf seine Edelstahluhr, »… einhundertundvierzig Minuten.«
»Ich werde tun, was Sie wünschen, Sir.«
»Und ich gehe davon aus, daß der Einsatzraum eingeweiht wird?«
»Das stand als nächstes auf meinem Plan.«
»Sie kriegen das hin, Janina. Ich möchte informiert werden, aber ich überlasse alles ganz Ihnen.«
»Vielen Dank, Sir.« Mentz wußte, daß sie jetzt einen Test zu bestehen hatte. Sie, ihr Team, Mazibuko und die RU. Sie hatte lange darauf gewartet.
3
Der Junge wartete nicht an der Straßenecke. Ein merkwürdiges Gefühl beschlich Thobela Mpayipheli. Dann sah er das Taxi vor Miriams Haus stehen. Keinen Minibus – einen Pkw, einen Toyota Cressida mit einem gelben Schild auf dem Dach: Peninsula Taxis, vollkommen fehl am Platz. Thobela fuhr auf die schmutzige Einfahrt und stieg ab. Er löste die Schnüre, die seine Blechdose und das Päckchen mit dem Pilzmittel, das er noch besorgt hatte, auf dem Sitz hinter ihm hielten, rollte sie sorgfältig zusammen und ging hinein. Die Eingangstür stand offen.
Miriam erhob sich aus dem Sessel, als er hereinkam. Er küßte ihre Wange, konnte aber spüren, wie angespannt sie war. Er sah die andere Frau, die in dem kleinen Zimmer saß. »Miss Kleintjes ist gekommen, um dich zu sehen«, sagte Miriam.
Er legte sein Päckchen hin, wandte sich der Besucherin zu und streckte die Hand aus. »Monica Kleintjes«, sagte sie.
»Nett, Sie kennenzulernen.« Er konnte nicht mehr länger warten und schaute Miriam an. »Wo ist Pakamile?«
»Auf seinem Zimmer. Ich habe ihm gesagt, er soll dort warten.«
»Es tut mir leid«, sagte Monica Kleintjes.
»Was kann ich für Sie tun?« Thobela schaute sie an, sie wirkte ein wenig mollig unter ihrer weiten, teuren Kleidung: Bluse, Rock, Strümpfe, Schuhe mit flachen Absätzen. Er bemühte sich, die Irritation aus seiner Stimme herauszuhalten.
»Ich bin die Tochter von Johnny Kleintjes. Ich muß unter vier Augen mit Ihnen reden.«
Johnny Kleintjes. Nach all den Jahren.
Miriam richtete sich auf. »Ich bin in der Küche.«
»Nein«, sagte er. »Ich habe keine Geheimnisse vor Miriam.«
Aber Miriam ging trotzdem hinaus.
»Es tut mir wirklich leid«, wiederholte Monica.
»Was will Ihr Vater?«
»Er steckt in der Klemme.«
»Johnny Kleintjes«, sagte er mechanisch, als die Erinnerungen zurückkehrten. Johnny Kleintjes würde ihn auswählen.
»Bitte«, sagte Monica.
Thobela kehrte in die Gegenwart zurück. »Zuerst muß ich Pakamile hallo sagen«, sagte er. »Ich bin in einer Minute zurück.«
Er ging in die Küche. Miriam stand am Herd, sie schaute zum Fenster hinaus. Er berührte ihre Schulter, aber sie reagierte nicht. Er ging durch den kurzen Flur und drückte die Tür zum Kinderzimmer auf. Pakamile lag mit einem Schulbuch auf dem kleinen Bett. Er schaute auf. »Können wir heute nicht in den Garten?«
»Hallo, Pakamile.«
»Hallo, Thobela.«
»Wir gehen noch in den Garten, nachdem ich mit unserem Besuch gesprochen habe.«
Der Junge nickte ernsthaft.
»Hattest du einen schönen Tag?«
»In der Pause haben wir Fußball gespielt.«
»Hast du ein Tor geschossen?«
»Nein. Nur die großen Jungen schießen Tore.«
»Aber du bist doch ein großer Junge.«
Pakamile lächelte bloß.
»Ich spreche jetzt mit unserer Besucherin. Dann gehen wir in den Garten.« Thobela strich mit der Hand über das Haar des Jungen und ging hinaus. Seine Sorge nahm zu. Johnny Kleintjes – das bedeutete Probleme.
Sie gingen im Gleichschritt über das Paradefeld des Fallschirmspringer-Batallions, Captain Tiger Mazibuko einen Schritt vor Little Joe Moroka.
»Der da?« fragte Mazibuko und zeigte auf eine kleine Gruppe. Vier Fallschirmspringer saßen im Schatten eines großen Thorn Tree. Ein deutscher Schäferhund lag zu Füßen eines Lieutenant, die Zunge hing ihm zur Schnauze heraus, er hechelte in der Hitze Bloemfounteins. Der Hund war groß und stattlich.
»Das ist er, Captain.«
Mazibuko nickte und ging schneller. Bei jedem seiner Schritte wirbelte roter Staub auf. Die Fallschirmspringer, drei Weiße und ein Farbiger, sprachen über Rugby, der Lieutenant hielt eine Art Vortrag. Mazibuko tauchte auf, schob sich zwischen sie und trat dem Hund mit der Stahlkappe seines Kampfstiefels kräftig gegen den Schädel. Der Hund quiekte und taumelte gegen die Beine des Lieutenant.
»Verdammt«, sagte der Fallschirmspringer-Lieutenant entgeistert.
»Ist das Ihr Hund?« fragte Mazibuko. Auf den Gesichtern der Soldaten konnte man vollkommenes Unverständnis lesen.
»Was sollte das denn?« Blut sickerte dem Hund aus der Nase. Er lehnte benommen am Bein des Lieutenant. Mazibuko trat erneut zu, diesmal erwischte er die Flanke des Tieres. Das Geräusch der brechenden Rippen wurde durch die Schreie aller vier Fallschirmspringer übertönt.
»Du Wichser …«, schrie der Lieutenant und schlug zu, eine wilde Bewegung, die Mazibuko hinten am Hals traf.
Mazibuko trat einen Schritt zurück und lächelte. »Ihr seid alle meine Zeugen. Der Lieutenant hat mich zuerst geschlagen.«
Dann machte sich Mazibuko an die Arbeit, mühelos und ungezwungen, ohne Eile. Eine rechte Gerade ins Gesicht, ein kräftiger, schmerzhafter Tritt gegen die Kniescheibe. Als der Fallschirmspringer nach vorn kippte, rammte Mazibuko dem Weißen sein Knie ins Gesicht. Der Lieutenant kippte nach hinten, Blut strömte ihm aus der gebrochenen Nase.
Mazibuko trat zurück, seine Hände hingen entspannt herunter. »Heute morgen haben Sie sich mit einem meiner Männer angelegt, Lieutenant.« Er deutete mit dem Daumen über seine Schulter auf Little Joe Moroka. »Sie haben Ihren beschissenen kleinen Hund auf ihn gehetzt.«
Der Mann bedeckte mit der einen Hand seine blutige Nase, mit der anderen stützte er sich auf den Boden auf. Zwei Fallschirmspringer kamen näher, der Sergeant kniete immer noch neben dem Hund, der still lag. »Äh …«, sagte der Lieutenant, der auf das Blut in seiner Hand schaute.
»Niemand legt sich mit meinen Leuten an«, sagte Mazibuko.
»Er hat nicht salutiert«, sagte der Lieutenant zornig und erhob sich, wackelig auf den Beinen, das braune Hemd dunkel vom Blut.
»Deswegen hast du den Hund auf ihn losgelassen?« Mazibuko trat vor. Der Fallschirmspringer hob reflexiv die Hände. Mazibuko packte ihn am Kragen, riß ihn vorwärts und rammte ihm die Stirn gegen die gebrochene Nase. Der Mann kippte wieder nach hinten. Roter Staub wirbelte durch die Mittagssonne.
Das Mobiltelefon in Mazibukos Brusttasche begann zu klingeln.
»Großer Gott«, sagte einer der Fallschirmspringer. »Sie bringen ihn ja um.« Er kniete neben seinem Kumpel.
»Heute nicht …«
Das Klingeln wurde lauter, ein durchdringendes Geräusch.
»Niemand legt sich mit meinen Leuten an.« Er knöpfte die Tasche auf und nahm das Gespräch an. »Captain Mazibuko.«
Am anderen Ende meldete sich Janina Mentz.
»Sie sind aktiviert, Captain. Um 18:15 wird ein Falcon 900 vom 21. Geschwader in Bloemspruit für Sie bereitstehen. Bitte bestätigen Sie.«
»Bestätigt«, sagte Mazibuko, der die beiden Fallschirmspringer fixierte, die noch standen, doch sie sahen nicht nach weiteren Problemen aus, sondern waren einfach fassungslos.
»18:15. Bloemspruit«, sagte Mentz.
»Bestätigt«, wiederholte er.
Die Verbindung wurde unterbrochen. Mazibuko klappte das Telefon zusammen und steckte es in seine Tasche zurück. »Joe, komm«, sagte er. »Wir haben etwas vor.« Er ging an dem Lieutenant vorbei und trat dabei auf das Hinterbein des Schäferhundes. Keine Reaktion.
»Mein Vater hat mehr als einmal gesagt, wenn ihm jemals etwas zustieße, sollte ich Sie holen, denn Sie sind der einzige Mensch, dem er vertraut.«
Thobela Mpayipheli nickte nur. Monica Kleintjes sprach zögernd, er konnte ihr ansehen, daß sie sich extrem unwohl fühlte, sie war sich des Einbruchs in sein Leben wohl bewußt, der Atmosphäre, die sie hier verursacht hatte.
»Und jetzt hat er etwas Dummes getan. Ich … Wir …«
Sie suchte nach den richtigen Worten. Er erkannte ihre Spannung, aber er wollte es nicht wissen. Er wollte nicht, daß es sein Leben hier berührte.
»Wissen Sie, womit mein Vater sich nach 1992 beschäftigte?«
»Ich habe Ihren Vater zuletzt 1986 gesehen.«
»Sie … Er mußte … Damals war alles so durcheinander, nach den Wahlen. Sie haben ihn zurückgeholt, um zu helfen … Die Integration der Geheimdienste war schwierig. Wir hatten zwei, drei Abteilungen, und das Apartheid-Regime hatte sogar noch mehr. Die Leute arbeiteten nicht zusammen. Sie behielten Informationen für sich, sie logen und traten in Konkurrenz zueinander. Das kostete viel mehr Geld, als geplant war. Man mußte es zusammenbringen. Für Ordnung sorgen. Die einzige Möglichkeit bestand darin, alles in Projekte aufzuteilen, in Abteilungen. Also haben sie ihm die Aufgabe übertragen, alle Computerdaten zusammenzuführen. Das war fast unmöglich: Es gab so viel – die Sachen von Infoplan in Pretoria allein hätten Jahre beansprucht, ganz abgesehen von Denel, der Sicherheitspolizei und dem Geheimdienst, vom Militär und dem ANC-System in Lusaka und London, vierhundert, fünfhundert Gigabyte Informationen, alles von den persönlichen Daten normaler Bürger bis zu Waffensystemen, Informanten und Doppelagenten. Mein Vater mußte das alles organisieren. Er mußte die Sachen löschen, die für Probleme sorgen konnten, und die nützlichen Daten sichern, er sollte eine zentrale, einheitliche Datenbank erstellen. Er … Ich habe in der Zeit für ihn den Haushalt geführt, meine Mutter war krank. Er sagte, es würde ihn so ärgern, die Informationen in den Systemen …«
Monica schwieg einige Zeit, dann öffnete sie ihre große schwarze Lederhandtasche und zog ein Taschentuch heraus.
»Er hat gesagt, es gebe einige merkwürdige Befehle, Dinge, die Mandela und Nzo nicht genehmigen würden, und daß er sich Sorgen mache. Zuerst wußte er nicht, was er tun sollte. Dann entschied er sich, Sicherungskopien einiger Informationen zu erstellen. Er hatte Angst, Mr. Mpayipheli, es waren unsichere Zeiten, verstehen Sie? Es herrschte große Unsicherheit, und die Leute versuchten, ihm Steine in den Weg zu legen, manche versuchten ihren Kopf zu retten, andere wollten Karriere machen. ANCs und Weiße, auf beiden Seiten des Zauns. Also brachte er Sachen mit nach Hause, Daten, auf Festplatten. Manchmal arbeitete er nachts daran. Ich hielt mich heraus. Ich vermute, daß er …«
Sie tupfte mit dem Taschentuch ihre Nase ab. »Ich weiß nicht, was auf den Festplatten war, und ich weiß nicht, was er mit den Daten vorhatte. Aber es sieht aus, als hätte er sie nie abgegeben. Es sieht aus, als hätte er versucht, die Daten zu verkaufen. Und dann haben sie mich angerufen, und ich habe gelogen, weil …«
»Zu verkaufen?«
»Ich …«
»An wen?«
»Ich weiß es nicht.« In Monicas Stimme lag Verzweiflung; ob des Vergehens oder ihres Vaters wegen, konnte er nicht sagen.
»Warum?«
»Warum hat er versucht, sie zu verkaufen? Ich weiß es nicht.«
Thobela zog die Augenbrauen hoch.
»Nach dem Projekt haben sie ihn rausgeworfen. Sie haben gesagt, er solle in Rente gehen. Ich glaube, das wollte er nicht. Er war noch nicht dazu bereit.«
Er schüttelte den Kopf. Da mußte mehr dran sein.
»Ich weiß nicht, warum er es getan hat. Nach dem Tod meiner Mutter … Ich habe mit ihm zusammengelebt, aber ich hatte mein eigenes Leben – ich glaube, er war einsam. Ich weiß nicht, was im Kopf eines alten Mannes vorgeht, wenn er den ganzen Tag zu Hause sitzt und die Zeitungen des weißen Mannes liest. Ein Mann, der im Kampf eine so große Rolle gespielt hat, den man jetzt beiseite geschoben hat. Ein Mann, der einmal ein wichtiger Spieler war. Er war angesehen in Europa. Er war jemand, doch jetzt ist er niemand mehr. Vielleicht wollte er nur noch einmal mitspielen. Mir war seine Bitterkeit bewußt und sein Überdruß, aber ich dachte nicht … vielleicht … um auf sich aufmerksam zu machen? Ich weiß es nicht.«
»Die Informationen – hat er gesagt, was ihn daran so störte?«
Monica rutschte unsicher im Sessel hin und her. »Nein. Nur daß es schreckliche Dinge waren …«
»Wie schrecklich?«
Sie schaute ihn bloß an.
»Und jetzt?« fragte Thobela.
»Sie haben angerufen. Aus Lusaka, glaube ich. Sie haben einige Festplatten, aber es sind nicht die, die sie wollen. Ich mußte eine weitere Platte aus dem Safe meines Vaters holen.«
Er schaute ihr in die Augen. Das war es also.
»In zweiundsiebzig Stunden muß ich diese Festplatte in Lusaka abgeben. Mehr Zeit haben sie mir nicht gelassen.«
»Das ist nicht viel Zeit.«
»Nein.«
»Warum verschwenden Sie Ihre Zeit dann damit, hier zu sitzen?«
»Ich brauche Ihre Hilfe, um die Daten abzuliefern. Um meinen Vater zu retten, denn sonst werden sie ihn töten. Und ich …« Sie zog den Saum ihres langen, breiten Rocks hoch, »… bin ein bißchen langsam.« Er sah das Holz und das Metall, die künstlichen Beine.
Tiger Mazibuko stand in seiner Tarnuniform mit schwarzem Barett unter dem Flügel der Falcon 900, Hände hinter dem Rücken, den Blick auf die zwölf Männer gerichtet, die Munitionskisten verluden.
Er hatte achtunddreißig Monate darauf gewartet. Über drei Jahre, seit Janina Mentz, mit einer Akte in der Hand, gekommen war, um ihn, einen einfachen Lieutenant, von der Recces-Spezialeinheit zu holen.
»Sie sind ein harter Kerl, Mazibuko, doch sind Sie hart genug?«
Es war verdammt schwer, sie ernst zu nehmen. Ein Mädchen. Eine weiße Frau, die bei der Recces reinmarschierte und alle Welt mit dieser sanften Stimme hin und her kommandierte und viel zu selbstsicher war. Und sie konnte ihm ganz schön den Kopf verdrehen. »Ist nicht die Zeit gekommen, aus dem Schatten Ihres Vaters zu treten?«
Mazibuko war von der ersten Frage an bereit gewesen. Was folgte, war bloß Mentz, die zeigte, daß sie in den offiziellen Akten zwischen den Zeilen lesen konnte.
»Warum ich?« hatte er dennoch gefragt, im Flugzeug nach Kapstadt. Mentz hatte ihn mit ihrem stechenden Blick angeschaut und gesagt: »Mazibuko, das wissen Sie.«
Er hatte nicht geantwortet, aber er hatte es sich dennoch gefragt. Lag es an seinen … Fähigkeiten? Oder seinem Vater? Er fand die Antwort nach und nach in den 44 Akten, die er durchsehen mußte, um die 24 Mitglieder der Reaction Unit auszusuchen. Er begann zu sehen, was Mentz von Anfang an gewußt haben mußte. Als er mit den Männern sprach, schaute er ihnen in die Augen und sah die Gnadenlosigkeit. Den Hunger.
Das Band zwischen ihnen.
Der Selbsthaß, der immer da war, hatte einen Ausdruck gefunden.
»Wir sind bereit, Captain«, sagte Da Costa.
Mazibuko trat unter dem Flügel hervor. »Dann an die Arbeit.«
Ja, sie waren bereit. So bereit wie eine dreijährige Ausbildung machen konnte. Vier Monate, um das Team zusammenzustellen, um jeden von Hand auszuwählen. Dann das Trennen der Spreu vom Weizen, wieder und wieder, bis es nur noch 24 gab, zwei Teams von jeweils einem Dutzend, die perfekte Zahl für »meine RU«, wie der Direktor sie besitzergreifend nannte, Aar-you, die englische Abkürzung des Buckligen für die Reaction Unit. Dann ging es erst richtig los.
Mazibuko zog die Tür der Falcon hinter dieser Hälfte des dreckigen, doppelten Dutzends zu. Die 24 Schwarzdrosseln, die Ama-killa-killa, und die anderen Namen, die sie in den 26 Monaten für sich erfunden hatten, seit die besten Ausbilder, die Geld und diplomatischer Goodwill kaufen konnten, sie in die Hände genommen und neu erschaffen hatten. Sie hatten sie zu physischen und psychischen Extremen geführt, denen sie nicht hatten standhalten sollen. Die Hälfte von ihnen, ein Team von zwölf, war zwei Wochen lang als Team Alpha in Bereitschaft, während die andern als Team Bravo daran arbeiteten, ihre Fähigkeiten zu verfeinern. Dann wurde Team Alpha zu Team Bravo, die Mitglieder wurden ausgetauscht, aber sie waren immer noch eine Einheit. Einander verbunden. Blut und Schweiß, die Intensität der Herausforderungen. Und außerdem – ein psychologischer Juckreiz, eine gemeinschaftliche Psychose, sie alle unterlagen demselben Fluch.
Sie saßen im Flugzeug, sie schauten ihn an. Ihre Gesichter strahlten erwartungsvoll, sie zeigten Vertrauen und vollkommene Bewunderung.
»Zeit, jemand in den Arsch zu treten!« sagte er.
Sie johlten begeistert.
4
CIA
LAGEBERICHT
Zur Kenntnis:
Assistant Deputy Director (Mittlerer Osten und
Afrika), CIA Zentrale, Langley, Virginia
Von:
Luke Powell (Leitender Senior Agent – südliches
Afrika), Kapstadt, Südafrika
Betreff:
Südafrika – zehn Jahre später
1. EINFÜHRUNG
Im Februar vor zehn Jahren hielt F. W. de Klerk, der südafrikanische Präsident, seine berühmte Rede, in der er das Verbot der afrikanischen Freiheitsbewegung »African National Congress« (ANC) aufhob, Nelson Mandela aus dem Gefängnis freiließ und den Schwarzen das Wahlrecht zugestand.
Nach einem erdrutschartigen Sieg bei den ersten wirklich freien Wahlen in diesem Land stieg der ANC, mit Mandela an der Spitze, vor acht Jahren zur Regierungspartei auf.
Mandela (der den Spitznamen Madiba trug) führte die Regierung fünf Jahre lang, bis 1999. Nach einem weiteren überwältigenden Wahlsieg des ANC folgte auf ihn der gegenwärtige Präsident Thabo Mbeki.
Trotz drängender Probleme wie hoher Arbeitslosigkeit und Kriminalität sowie einer ausgesprochen inflationären Währung (des Rand) ist Südafrika als politisch und wirtschaftlich stabil anzusehen – insbesondere im Vergleich zu den anderen Staaten Afrikas. Dies ist der Fall trotz elf offizieller Landessprachen und kultureller Gruppierungen (darunter Xhosa, Zulu, Tswana, Sotho, Ndebele und Afrikaaner), neun Bundesländern sowie verschiedenen Sitzen von Exekutive, Legislative und Judikative.
2. GEHEIMDIENSTE
Nach der Wahl 1994 stand die ANC-Regierung vor der Mammut-Aufgabe, drei große militärische und Spezialeinheiten zu integrieren:
militärische Strukturen: In einem aufwendigen und langen, aber letztlich weitgehend erfolgreichen Prozeß wurden die folgenden militärischen Arme in die neue South African National Defence Force eingebracht: die South African Defence Force (SADF) der weißen Regierung; der militante Arm des ANC selbst, »Umkhonto we Sizwe« (kurz MK, eine Bezeichnung auf Xhosa, die übersetzt »Speer der Nation« bedeutet); sowie der militante Zweig des Pan-African Congress (PAC – die zweite, deutlich extremere schwarze Oppositionsbewegung gegen das Apartheid-Regime); die Azanian People’s Liberation Army (APLA).
Spezialeinheiten: Weniger öffentlich und deutlich zügiger verlief die Verschmelzung des National Intelligence Service (NIS) mit den beiden Geheimdiensten von ANC und PAC zur neuen National Intelligence Agency (NIA) – die oft nur als »Agency« bezeichnet wird und verantwortlich ist für die innere Sicherheit.
Der ehemalige Secret Intelligence Service (SIS), auch bekannt als State Security Service, wurde in den SA Secret Service umgewandelt und verantwortet die Überwachung internationaler Beziehungen.
Darüber hinaus wurde die bisherige South African Police unter Einbeziehung der alten Security Police in den SA Police Service überführt.
Interne Konkurrenz und alte Seilschaften zwangen die ANC-Regierung Ende der neunziger Jahre zur Einrichtung eines neuen Geheimdienstes, der Presidential Intelligence Unit (PIU). Die Hauptaufgabe der PIU besteht darin, die übrigen Geheimdienste zu überwachen sowie Informationen sowohl über Vorgänge im Inneren des Landes als auch im Ausland zusammenzutragen.
Durch das Küchenfenster konnten sie den Jungen im Gemüsegarten stehen sehen. »Ich habe ihm nie gesagt, daß Männer verschwinden. Das muß er jetzt alleine lernen.«
»Ich komme zurück«, sagte Thobela.
Sie schüttelte bloß den Kopf.
»Miriam, ich schwöre …«
»Laß es«, sagte sie.
»Ich schulde es Johnny Kleintjes, Miriam …«
Ihre Stimme war sanft. So klang sie immer, wenn sie wütend war. »Weißt du noch, was du gesagt hast?«
»Ich weiß es noch.«
»Was hast du gesagt, Thobela?«
»Ich habe gesagt, daß ich keiner von denen bin, die einfach so verschwinden.«
»Und jetzt?«
»Es ist nur für ein oder zwei Tage. Dann bin ich zurück.«
Sie schüttelte voll düsterer Vorahnungen wieder den Kopf.
»Ich muß es tun.«
»Du mußt es tun? Sag einfach nein. Sollen sie sich doch um ihre eigenen Probleme kümmern. Du schuldest ihnen gar nichts.«
»Ich schulde Johnny Kleintjes etwas«, wiederholte er.
»Du hast mir gesagt, du könntest dieses Leben nicht mehr ertragen. Du hast gesagt, das sei erledigt.«
Thobela seufzte. Er ging in der Küche hin und her, er wandte sich Miriam zu, seine Hände und seine Stimme flehten: »Du hast recht. Das habe ich gesagt. Und ich habe es gemeint. Nichts hat sich geändert. Du hast recht – ich kann nein sagen. Ich habe die Wahl, es ist meine Entscheidung. Ich muß die richtige Entscheidung treffen. Ich muß tun, was mich zu einem ehrbaren Mann macht. Genau das sind immer die schwierigsten Entscheidungen.«
Er sah, daß sie ihm zuhörte, und hoffte, daß sie ihn verstand. »Meine Schuld Johnny Kleintjes gegenüber ist eine Ehrenschuld. Meine Ehre besteht nicht nur daraus, für dich und Pakamile zu sorgen, jeden Nachmittag nach Hause zu kommen und einer Arbeit nachzugehen, die sich innerhalb der Grenzen des Gesetzes bewegt und nicht gewalttätig ist. Ehre bedeutet auch, daß ich meine Schulden zahlen muß.«
Miriam sagte nichts.
»Kannst du das verstehen?«
»Ich will dich nicht verlieren.« Fast zu leise, um sie zu hören. »Und ich glaube nicht, daß er es verkraften kann, dich zu verlieren.« Ihr Blick deutete auf den Jungen im Freien.
»Du wirst mich nicht verlieren. Ich verspreche es dir. Ich komme zurück. Früher als du glaubst.«
Sie wandte sich ihm zu, schlang ihre Arme um seine Hüfte und hielt ihn voller Verzweiflung.
»Früher als du glaubst«, wiederholte er.
3. »ALTE SEILSCHAFTEN«
Um nachzuvollziehen, was es mit den Geheimdienstaktivitäten im heutigen Südafrika auf sich hat, muß man sich bewußt machen, welche Netzwerke vor der Gründung des »neuen Südafrikas« 1992–1994 bestanden:
Die weiße Minderheitenregierung der achtziger Jahre pflegte enge Beziehungen sowohl zu den britischen Geheimdiensten MI5 und MI6 als auch zu amerikanischen Behörden, insbesondere der CIA. Letztere führte mehrere gemeinschaftliche antikommunistische Aktivitäten in Afrika gemeinsam mit dem früheren Militärgeheimdienst SADF in Angola, Namibia, Simbabwe, Tansania und Mozambique durch. Die CIA leitete zudem während des Krieges der weißen Minderheitenregierung gegen die von Kuba und der UdSSR gestützte Regierung in Angola Ende der siebziger Jahre relevante Informationen nach Pretoria weiter.
Der ANC war eine verbotene Widerstandsbewegung, die sich im Exil befand. Naheliegenderweise unterhielt der ANC enge Verbindungen (und wurde in militärischer und finanzieller Hinsicht unterstützt) zur ehemaligen Sowjetunion, in das ehemalige Ostdeutschland (insbesondere zu KGB und Stasi), nach Kuba, zu Libyen, zur palästinensischen Befreiungsorganisation PLO sowie – wenn auch in geringerem Maße – zum Irak und anderen moslemischen Ländern.
Die PAC verfügte über eine stärkere Verbindung zu moslemischen Extremisten (z. B. im Iran) sowie der PLO.
4. MOSLEMISCHE EXTREMISTEN IN SÜDAFRIKA
Al-Kaida-Mitglied Khalfan Khamis Mohammed, von FBI und CIA nach dem Bombenanschlag auf die US-Botschaft in Tansania gesucht, versteckte sich 1999 in Kapstadt, Südafrika.
Südafrika ist keineswegs ein moslemisches Land, aber unter den Arabern am westlichen Kap findet sich ein geringer Anteil Extremisten, die zwar Mitglieder verschiedener Splittergruppen, aber allesamt Sympathisanten der Al Kaida sind:
Muslims Against Illegal Leaders (MAIL)
Quibla (das Wort bezeichnet »die Richtung, in die der oder die Gläubige sich zum Gebet neigt«), linksextrem, aggressiv, ausgesprochen heimlichtuerisch
People Against Drugs and Gangsterism (Pagad): eine Art Bürgerwehr, die durch brutale Aktionen gegen die Drogenhändler in den Cape Flats auf sich aufmerksam machte; vielleicht die öffentlichste, zumindest aber die ungefährlichste dieser Gruppen.
Der größte Saal im sechsten Stock der Wale Street Chambers wurde schlicht als »Einsatzraum« bezeichnet. Er war in vierundzwanzig Monaten nur achtmal benutzt worden – für »Bereitschaftstests«, wie Mentz die vierteljährlichen Prüfungen des technischen Netzwerks und ihrer Mitarbeiter nannte. Zwölf Fernseher an der Ostseite waren an digitales und analoges Satellitenfernsehen angeschlossen, an Überwachungskameras und eine Videokonferenzanlage. Die sechs PC an der Nordwand waren mittels Glasfaserkabel mit dem lokalen Netzwerk sowie einem Internet-Backbone verbunden. Neben der Doppeltür an der Westseite befanden sich der Digitaltuner und -receiver für Radiosender sowie eine Mobilfunk- und Festnetz-Telefonanlage mit achtzehn abhörsicheren Leitungen und Möglichkeiten für Telefonkonferenzen. An der Südseite war eine große weiße Leinwand für den Videoprojektor von der Decke heruntergelassen worden. Ein ovaler Tisch, an dem zwanzig Personen Platz fanden, nahm die Mitte des Saales ein.
Die sechzehn Personen, die an dem Tisch saßen, hatten das eindeutige Gefühl, daß der Ruf in den Einsatzraum am späten Nachmittag keine Übung war. Die Atmosphäre im Saal war gespannt, als Janina Mentz hereinkam, die Blicke folgten ihr erwartungsvoll.
Natürlich hatten sich schon die ersten Gerüchte verbreitet. Die Abhörleute würden angedeutet haben, daß sich etwas zusammenbraute, während ihre neidischen Kollegen bloß raten und alte Gefälligkeiten als Hebel benutzen konnten, um zu versuchen, doch noch ein wenig mehr zu erfahren.
Deswegen blickten nun alle sechzehn Augenpaare Mentz an. In der Vergangenheit hatte es andere unausgesprochene Fragen gegeben. Am Anfang, als sie das Team für den Direktor zusammengestellt hatte, hatten sie ihre Fähigkeiten abgeschätzt, ihre Autorität, denn die Gruppe bestand vor allem aus Männern, die aus Bereichen kamen, wo sie auch das Sagen hatten. Sie probierten sich an ihr aus und stellten fest, daß Schimpfworte und großspuriges Gehabe sie nicht aus der Fassung brachten: Aggression ließ Janina Mentz ruhig und kalt reagieren, kaum verbrämter Antifeminismus provozierte sie nicht. Stück für Stück rekonstruierten sie ihre Geschichte und lernten ihre neue Herrin kennen: Kindheit auf dem Dorf, herausragende akademische Karriere, politisches Engagement, Aufstieg in der Partei, langsam, weil sie eine weiße Afrikaanerin war, und irgendwo zwischendurch hatte sie geheiratet und sich scheiden lassen. Es war alles sehr mühsam gewesen – bis der Direktor sie ausgewählt hatte.
Nun aber respektierte man sie für das, was sie zustande gebracht hatte, und wie sie es geschafft hatte.
Daher konnte Janina Mentz den Saal mit gedämpfter Zuversicht betreten. Sie schaute auf die Uhr, bevor sie sagte: »Guten Abend, allerseits.«
»Guten Abend, Mrs. Mentz.« Ein jovialer Chor, der gehorsam dem Wunsch des Direktors nach Förmlichkeit nachkam. Sie war entspannt. Alle wußten, wer das Sagen hatte.
Janina Mentz strich energisch ihren grauen Rock glatt, als sie am Kopf des langen Tisches Platz nahm, neben dem Laptop, der an den Videoprojektor angeschlossen war. Sie schaltete den Projektor ein.
»Ich darf eines gleich klarstellen: Von diesem Moment an ist der Einsatzraum offiziell im Einsatz. Dies ist kein Test.« Die Spannung im Raum nahm zu.
»Es sollte keinerlei Zweifel daran geben, daß es sich um etwas Ernstes handelt. Wir haben hart daran gearbeitet, jetzt hierzusein und unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten unter Beweis zu stellen. Ich bin von Ihrem Einsatz abhängig.«
Mentz klappte den Laptop auf und startete Microsoft PowerPoint. »Dieses Foto wurde vor neunzehn Tagen am Eingang der amerikanischen Botschaft als Teil unserer routinemäßigen Überwachungsmaßnahmen erstellt. Der Mann, der aus der Tür kommt, ist Johnny Kleintjes, ein ehemals hochrangiger Mitarbeiter des Geheimdienstes im Freiheitskampf. Er studierte theoretische und angewandte Mathematik an der University of the Western Cape, aber wegen seiner politischen Aktivitäten, der vorgegebenen Einschränkungen und des extremen Drucks durch das damalige Regime, machte er keinen Abschluß. Von 1972 an befand er sich im Exil – zu spät, um noch zu den Frontmännern, den Mgwenya, der sechziger Jahre zu gehören. Aber er machte sich schnell einen Namen in den Büros von ANC und MK in London. 1973 heiratete er. Von 1976 an erhielt er in Odessa eine DDR-Ausbildung. Sein Spezialgebiet war Aufklärung; er trug den Decknamen Umthakathi, was Zauberer bedeutet, da er so gut mit Computern umgehen konnte. Kleintjes war dafür verantwortlich, in den achtziger Jahren das Computersystem des ANC in London, Lusaka sowie in Quibaxe in Angola einzurichten, und, wichtiger noch, er war der Projektleiter der Integration der Computersysteme und Datenbanken von Freiheitskampf und Regierung nach 1995. Er zog sich 1997 – mit zweiundsechzig – zurück, nachdem seine Frau an Krebs gestorben war, und wohnt mit seiner einzigen Tochter Monica zusammen.«
Sie schaute auf. Alle hörten aufmerksam zu.
»Die Frage ist: Was trieb Johnny Kleintjes in der amerikanischen Botschaft? Die Antwort ist, daß wir es nicht wissen. Eine Telefonüberwachung von Kleintjes’ Anschluß wurde noch am selben Abend begonnen.«
Mentz klickte mit der Maus. Ein weiteres Foto, schwarzweiß: eine Frau, ein wenig pummelig, vor einer offenstehenden Wagentür. Die grobe Körnung des Bildes deutete darauf hin, daß es mit einem Teleobjektiv auf große Entfernung geschossen worden war.
»Dies ist Monica Kleintjes, die Tochter von Johnny Kleintjes. Ein typisches Kind von Exilanten. 1974 in London geboren, ging dort zur Schule, und blieb bis 1995, um ihr Studium der Computerwissenschaft abzuschließen. 1980 wurde sie Opfer eines Autounfalls in der Nähe von Manchester und verlor dabei beide Beine. Sie bewegt sich mit Hilfe von Prothesen und weigert sich, Krücken oder andere Hilfen zu benutzen. Sie ist der Traum jedes Personalleiters, weil sie sich unbedingt beweisen muß; derzeit ist sie Bereichsleiterin in der Technologiesparte von Sanlam.«
Janina Mentz tippte auf die Tastatur. »Das sind die wichtigsten Mitspieler, von denen wir Bilder haben. Die folgenden Gespräche wurden heute nachmittag von unserem Abhör-Team aufgenommen.«
Thobela saß mit Pakamile am Küchentisch, auf dem der große blaue Atlas und eine Ausgabe von National Geographic lagen, so wie jeden Abend. Miriams Stuhl stand, wie immer, ein Stück weiter weg; in ihrem Schoß lag eine Näharbeit. Sie lasen etwas über Chile, über eine Insel an der Westküste Südamerikas, wo der Wind und der Regen phantastische Formen aus dem Stein gemeißelt hatten, wo einzigartige Pflanzen ein scheinbares Paradies erschufen und es praktisch keine Tiere gab. Thobela las Englisch vor, so wie es dort stand, denn dann konnte der Junge die Sprache besser lernen, übersetzte aber Absatz für Absatz in Xhosa. Danach würden sie den Atlas aufschlagen und auf der Weltkarte nach Chile suchen, bevor sie umblätterten und eine Karte des Landes selbst in größerem Maßstab betrachteten.
Sie lasen nie mehr als zwei Seiten auf einmal, denn Pakamiles Aufmerksamkeit nahm schnell ab, es sei denn, der Artikel handelte von einer schrecklichen Schlange oder einem anderen Raubtier. An diesem Abend jedoch war es schwieriger als sonst, den Jungen bei der Sache zu halten. Sein Blick wanderte immer wieder hinüber zu der blauen Sporttasche, die vor der Tür stand. Schließlich gab Thobela auf.
»Ich muß ein oder zwei Tage weg, Pakamile. Ich muß etwas erledigen. Ich muß einem alten Freund helfen.«
»Wo mußt du hin?«
»Erst mußt du mir versprechen, es niemandem zu sagen.«
»Warum?«
»Weil ich meinen Freund überraschen möchte.«
»Hat er Geburtstag?«
»So ungefähr.«
»Kann ich es nicht einmal Johnson erzählen?«
»Vielleicht erzählt Johnson es seinem Vater, und sein Vater könnte meinen alten Freund anrufen. Es muß ein Geheimnis zwischen uns dreien bleiben.«
»Ich erzähle es niemandem.«
»Weißt du, wo Sambia auf der Karte ist?«
»In Mpumalanga?«
Unter normalen Umständen hätte Miriam über die wilde Vermutung ihres Jungen gelächelt, aber heute abend nicht.
»Sambia ist ein Land, Pakamile. Ich zeige es dir.« Thobela blätterte im Atlas, bis er eine Karte von Südafrika gefunden hatte. »Hier sind wir.« Er zeigte es mit dem Finger.
»Kapstadt.«
»Ja. Und dort oben ist Sambia.«
»Wie kommst du dort hin, Thobela?«
»Ich fliege mit einem Flugzeug hierhin, nach Johannesburg. Dann steige ich um in ein anderes Flugzeug, das hierhin fliegt, über Simbabwe, oder vielleicht hier entlang, über Botswana. Dort ist Lusaka. Das ist eine Stadt, wie Kapstadt. Und dort ist mein alter Freund.«
»Eßt ihr Kuchen? Und trinkt was Kaltes?«
»Ich hoffe es.«
»Ich möchte mitkommen.«
Thobela lachte und schaute zu Miriam hinüber. Sie schüttelte bloß den Kopf.
»Pakamile, später nehme ich dich mit. Ich verspreche es dir.«
»Bettzeit«, sagte Miriam.
»Wann fliegst du?«
»Bald. Wenn du schläfst.«
»Und wann kommst du wieder?«
»Nur zweimal schlafen. Sei nett zu deiner Mutter, Pakamile. Und sieh nach dem Gemüsegarten.«
»Das mache ich. Bringst du mir Kuchen mit?«
»Die Unbekannte in der Gleichung heißt Thobela Mpayipheli«, sagte Janina Mentz. »Wir wissen nicht, warum Monica Kleintjes sich an ihn gewandt hat. Sie haben die Gespräche gehört – man kennt ihn auch als ›Tiny‹, er arbeitet bei Mother City Motorrad, einem BMW-Motorrad-Händler, und lebt mit Miriam Nzululwazi in Guguletu. Sie ist die eingetragene Besitzerin des Hauses, mehr wissen wir nicht.
Monica Kleintjes ist mit dem Taxi dorthin gefahren, ist über vierzig Minuten geblieben und dann direkt nach Hause zurückgekehrt. Seitdem haben sich weder Mpayipheli noch Kleintjes gerührt.
Zwei Überwachungsmannschaften sind hinter ihr her, eine weitere ist in Guguletu stationiert, bei ihm. Die Reaction Unit ist unterwegs von Bloemfontein und sollte demnächst in Ysterplaat landen. Die RU bleibt in Bereitschaft, bis wir über mehr Informationen verfügen. So steht es, Leute.«
Janina Mentz schaltete die Videopräsentation ab.
»Jetzt müssen wir uns an die Arbeit machen. Radebe, wir haben nur einen Mann in Lusaka. Ich will vier weitere, erfahrene Leute. Das Büro in Gauteng ist am nächsten, und sie haben genug Leute, auch die richtigen. Sie sollen am besten zwei Männer und zwei Frauen schicken, die sich als Paare ins Republican Hotel einquartieren können. Diskret und natürlich nicht gleichzeitig, aber das überlasse ich ihnen. Starten Sie das Telefonsystem. Quinn, wir müssen die Anrufe bei Nzululwazi in Guguletu abhören! Rajkumar, holen Sie Ihre Leute her! Ich will wissen, wer Thobela Mpayipheli ist. Mir ist völlig egal, in welcher Datenbank Sie danach suchen, es hat absolute Priorität. Gut, Leute, zwanzig Minuten, dann ist alles bereit.«
Tiger Mazibuko stieg als letzter aus der Falcon. Er ließ die Mitglieder von Team Alpha vorgehen, er beobachtete sie, weiß, schwarz, braun, jeder mit seiner eigenen Geschichte. Da Costa, sehniger Abkömmling angolanischer Flüchtlinge, mit der Messernarbe auf der Wange und einem Bartschatten am Kiefer. Weyers, der Afrikaaner aus Germiston, mit den Armen eines Bodybuilders. Little Joe Moroka, ein Tswana, der auf einer Maisfarm in Bothaville groß geworden war; er sprach sieben der elf offiziellen Sprachen des Landes. Cupido, der Kleinste, der am meisten redete, ein farbiger Junge aus Ashton, mit einem Diplom als Elektroingenieur. Sogar »Adel« hatten sie, wie Zwelitini, der großgewachsene, schlanke Zulu gern betonte – obwohl er gar nicht zur königlichen Familie zählte.
Sie standen in einer Reihe auf der Landebahn. Der Sommerwind des Kaps strich sanft über Mazibukos Wange, als er selbst herabstieg.
»Ausladen! Beeilt euch! Ihr kennt den Drill.«
In der Tür legte Thobela seine Arme um Miriam, er zog ihren schlanken Körper an sich, er genoß ihren Duft, die feinen Überreste von Shampoo, die Aromen der Küche und ihre ganz einzigartige Wärme.
»Ich muß in Johannesburg übernachten«, flüsterte er ihr ins Ohr. »Ich kann erst morgen nach Lusaka fliegen.«
»Wie viel Geld hat sie dir gegeben?«
»Genug.«
Miriam sagte nichts weiter, sie klammerte sich bloß an ihn.
»Ich rufe an, sobald ich im Hotel bin.«
Immer noch drückte sie ihr Gesicht an seinen Hals und schlang ihre Arme um ihn. Schließlich trat sie zurück und küßte ihn schnell auf den Mund. »Bitte komm zurück, Thobela.«
Janina Mentz rief aus ihrem Büro zu Hause an. Lien, ihre Ältere, nahm ab. »Hallo, Mama.«
»Ich muß heute lange arbeiten, Süße.«
»Ma, du hast versprochen, mit mir Biologie zu üben.«
»Lien, du bist fünfzehn. Du weißt, wann du das Thema gut genug kannst.«
»Ich bleibe auf.«
»Gib mir bitte mal Suthu. Sie muß über Nacht bleiben, denn ich werde heute nicht nach Hause kommen.«
»Ma, meine Haare – morgen früh.«
»Tut mir leid, Lien. Es ist ein Notfall. Du mußt mir jetzt helfen. Du bist meine Große. Hat Lizette ihre Hausaufgaben gemacht?«
»Sie hat den ganzen Nachmittag telefoniert, Ma, und du weißt ja, wie diese Siebenkläßler sind. ›Hat Kosie irgendwas über mich gesagt? Glaubst du, Pietie mag mich?‹ Es ist furchtbar kindisch, richtig ekelerregend.«
Mentz lachte. »Du warst auch mal in der siebten Klasse.«
»Ich kann es kaum ertragen, daran zu denken. War ich genauso?«
»Das warst du. Laß mich mit Lizette sprechen. Du mußt früh schlafen gehen, Süße. Du mußt ausgeruht sein für deine Arbeit. Ich rufe morgen wieder an. Versprochen.«
5
Das Taxi fuhr Thobela bis vor die Abflughalle; er zahlte, nahm seine Tasche und stieg aus. Wie lange war es her, daß er zuletzt geflogen war? Alles hatte sich verändert, alles glänzte neu, um die ausländischen Touristen zu beeindrucken.
Bei Comair kaufte er sich ein Ticket mit dem Geld, das Monica Kleintjes ihm gegeben hatte – ein Stapel neuer Hundert-Rand-Noten. »Das ist zu viel«, hatte er gesagt. »Sie können mir den Rest ja zurückgeben«, war ihre Antwort gewesen. Jetzt fragte er sich, woher das Geld kam. Hatte sie die Zeit gehabt, am Automaten Geld zu ziehen? Oder hatte Kleintjes soviel im Haus?
Er schob seine Tasche durch das Röntgengerät. Zwei Hosen, zwei Hemden, zwei Paar Socken, seine schwarzen Schuhe, ein T-Shirt, seine Waschsachen, das restliche Bargeld. Und die Festplatte, klein und flach; Technologie, die er nicht begriff. Irgendwo in diesem Elektroding steckten gefährliche Fakten über die Vergangenheit des Landes.
Er wollte gar nichts darüber wissen, er wollte nichts damit zu tun haben, er wollte das Ding nur Johnny Kleintjes in die Hand drücken, er wollte ihn in Sicherheit bringen, er wollte zurück nach Hause fahren und mit seinem Leben weitermachen. Er hatte so viele Pläne für sich und Miriam und Pakamile … Dann bemerkte er die beiden grauen Anzüge hinter sich, es war reiner Instinkt, ein Überbleibsel aus einem anderen Leben, eine dumpfe Warnung in seinem Hinterkopf. Er schaute sich um, nichts, es mußte bloße Einbildung gewesen sein. Er nahm seine Tasche und schaute auf die Uhr. Noch dreiunddreißig Minuten bis zum Boarding.
»Was machen wir jetzt?« Quinn schaute Janina Mentz mit dem Kopfhörer um den Hals erwartungsvoll an.
»Als erstes will ich wissen, wohin er unterwegs ist.«
»Darum kümmern sie sich. Er hat ein Ticket bei Comair gekauft.«
»Halten Sie mich auf dem laufenden.«
Quinn nickte, setzte seine Kopfhörer auf und sprach leise in das Mikrofon.
»Rahjev, haben Sie was?« fragte Mentz den ausgesprochen dicken Inder, der vor einem Computer saß.
»Im Bevölkerungsverzeichnis gibt es neun Thobela Mpayiphelis. Ich überprüfe die Geburtsdaten. Geben Sie mir zehn Minuten.«
Sie nickte.
Wieso hatte Monica Kleintjes sich an Mpayipheli gewandt? Was war das Besondere an diesem Mann?
Mentz ging hinüber zu Radebe, der sich telefonisch mit dem Büro in Gauteng in Verbindung gesetzt hatte. Irgendwer hatte Kaffee und Sandwiches bringen lassen. Sie wollte noch keinen Kaffee und war auch nicht hungrig. Sie kehrte zurück zu Quinn. Er hörte jemandem zu, schaute dann zu ihr auf, ruhig und kompetent.
Ein unglaubliches Team, dachte sie. Die ganze Sache wird erledigt sein, bevor es überhaupt losgeht.
»Er fliegt nach Johannesburg«, sagte Quinn.
»Und er hat nur eine Tasche bei sich?«
»Nur eine.«
»Und wir sind absolut sicher, daß Monica Kleintjes zu Hause ist?«
»Sie sitzt im Wohnzimmer vor dem Fernseher. Unsere Leute können sie durch den Spitzenvorhang beobachten.«
Mentz ging die verschiedenen Möglichkeiten durch, sie überschlug alle Implikationen und Szenarien. Thobela Mpayipheli mußte die Festplatte haben. Sie konnten sie sich jetzt holen und mit ihren eigenen Leuten nach Lusaka schicken. Das war kontrollierter, und die Reaction Unit konnte die Sache absichern. Allerdings würde es schwierig werden, Mazibuko und seine Leute nach Sambia zu schleusen. Zu viele diplomatische Gefälligkeiten. Zu viel Aufmerksamkeit. Dann mußte der Direktor seine Reaction Unit eben ein andermal ausprobieren. Die Hauptsache war: die Sache klein zu halten, alles sicher und kontrolliert zu lösen.
»Wie gut sind die Leute am Flughafen?«
»Gut genug. Erfahren«, sagte Quinn.
Sie nickte. »Ich möchte, daß sie Mpayipheli einkassieren, Quinn. Ganz ruhig, diskret und schnell – ich möchte keine Konfrontation auf dem Flughafen. Sie sollen ihn und seine Tasche in einen Wagen stopfen und herbringen.«
Thobela hielt seine Tasche auf dem Schoß, er fühlte sich immer einsamer. Seit über einem Jahr lebte er nun mit Miriam zusammen, mehr als ein Jahr hatte er die Abende mit seiner Familie verbracht, und plötzlich war er wieder so allein, wie er es früher gewesen war.
Er fragte sich, was er davon eigentlich hielt. Fehlte ihm die Freiheit? Die Antwort überraschte ihn, denn das Alleinsein befriedigte ihn nicht. Er hatte sich ein Leben lang nur auf sich allein verlassen, und dann hatten Miriam und Pakamile sein Leben in nur zwölf Monaten vollkommen umgekrempelt. Er wollte bei ihnen sein, nicht hier.
Aber er mußte diese Sache hier zu Ende bringen.
Der Johnny Kleintjes, den er kannte, hätte sich niemals verkauft. Irgend etwas mußte den alten Mann verändert haben. Wer konnte schon wissen, was tief in den innersten Zirkeln der neuen Regierung und des neuen Geheimdienstes vor sich ging? Es war nicht unmöglich, nur unwahrscheinlich: Johnny Kleintjes war integer und loyal. Ein starker Mann mit Charakter. Thobela würde ihn fragen, wenn er ihn traf, wenn er die Festplatte übergab und Johnny sein Geld bekam. Wenn alles gut ausgegangen war. Das mußte es. Er hatte keine Lust auf Ärger, nicht mehr.
Dann standen sie neben ihm, zwei graue Anzüge. Er hatte sie nicht kommen sehen, und als sie neben ihm auftauchten, schrak er zusammen, er war wirklich vollkommen außer Übung.
»Mr. Mpayipheli«, sagte einer.
»Ja.« Er war überrascht, daß sie seinen Namen kannten. Sie preßten sich dicht an ihn und hinderten ihn daran aufzustehen.
»Wir möchten, daß Sie mit uns mitkommen.«
»Warum?«
»Wir vertreten den Staat«, sagte der zweite und hielt ihm eine Ausweiskarte vor die Augen – Foto und Staatswappen. »Mein Flug geht gleich«, sagte er. Plötzlich war sein Kopf klar, sein Körper reagierte endlich.
»Heute abend nicht«, sagte Nummer eins.
»Ich will niemandem weh tun«, sagte Thobela Mpayipheli.
Die beiden lachten, sie amüsierten sich über ihn. »Ach wirklich?«
»Bitte.«
»Es tut mir leid, aber Sie haben keine Wahl, Mr. Mpayipheli.« Der Mann klopfte auf die blaue Tasche. »Der Inhalt …«
Wieviel wußten sie? »Bitte hören Sie zu«, sagte Thobela. »Ich will keinen Ärger.«
Der Agent hörte die Verzweiflung in der Stimme des großen Xhosas. Er hat Angst, dachte er. Mach dir das zunutze. »Wir können Ihnen mehr Probleme bereiten, als Sie sich je vorstellen können«, sagte er und zog seinen Jackettaufschlag ein wenig zur Seite, um den Stahlgriff seiner Pistole im schwarzen Schulterholster zu zeigen. Er streckte die Hand nach der Sporttasche aus. »Kommen Sie«, sagte er.
»Na gut«, sagte Thobela Mpayipheli. In den Sekundenbruchteilen, die der Agent brauchte, um die Sporttasche zu greifen, mußte er eine Entscheidung treffen. Er hatte etwas aus ihrem Verhalten geschlossen: Sie wollten kein Aufsehen. Sie wollten ihn still und leise hier herausführen. Er sah das Jackett von Nummer eins aufklaffen, als der Arm sich zur Tasche ausstreckte. Er sah den Griff der Pistole, packte zu und zog sie aus dem Holster, er drehte sie um und stand auf. Nummer eins hatte die Tasche in den Händen und riß erschrocken die Augen auf. Thobela beugte sich zu ihm herüber; der Lauf der Pistole zielte direkt auf sein Herz. Nummer zwei stand hinter Nummer eins. Die anderen Passagiere in der Wartehalle hatten noch nichts mitbekommen.
»Ich will keinen Ärger. Geben Sie mir einfach meine Tasche zurück.«
»Was soll das?« fragte Nummer zwei.
»Er hat meine Pistole«, zischte Nummer eins.
»Sie nehmen die Tasche«, sagte Thobela zu Nummer zwei. »Was?«
»Nehmen Sie ihm die Tasche ab und legen Sie Ihre Pistole hinein.« Er drückte mit der Pistole, die er in der Hand hielt, kräftig gegen die Brust von Nummer eins; er achtete darauf, ihn als Schutzschild zwischen sich und Nummer zwei zu belassen.
»Tu, was er sagt«, sagte Nummer eins leise.
Nummer zwei war unsicher, sein Blick wanderte zu den Passagieren, die in der Abflughalle warteten; er versuchte, sich zu entscheiden.