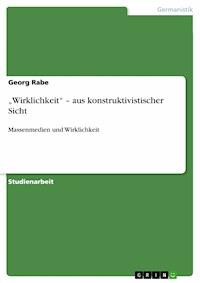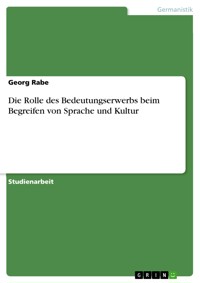29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Masterarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Didaktik - Germanistik, Note: 1,0, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (Institut für Germanistik), Veranstaltung: -, Sprache: Deutsch, Abstract: In der vorliegenden Masterarbeit wird sowohl die eng miteinander verbundene Tradition von Literatur und Tonträgern als auch die geschichtliche Entwicklung von Hörmedien aufgezeigt. Im zweiten Schritt werden Ansätze zum Füllen einer aktuellen Forschungslücke entwickelt, indem dargestellt wird, wie die noch nie dagewesene Vielfalt, Mobilität und Verbreitung heutiger Hörmedien für den Literaturunterricht in der Grundschule förderlich genutzt werden kann. Aus der Einleitung: [...] Um eine Antwort auf die Fragen zu erhalten, warum und wie Hörbücher im Literaturunterricht der Grundschule besonders förderlich eingesetzt werden können, wird zuerst die geschichtliche Entwicklung von Hörmedien kurz dargestellt (Kapitel 2), woraufhin diese in Kapitel 3 einzeln definiert werden. In Kapitel 4 erfolgt die Begründung der Verwendung von Hörbüchern in der Grundschule aus drei Perspektiven: dem bestehenden Nutzungsverhalten der Kinder im Grundschulalter, dem Mangel an Verwendung von Hörbüchern in der Grundschule und dem didaktischen Potenzial von Hörbüchern im Literaturunterricht. Dem letzten Punkt dient das Literarische Lernen nach Spinner als theoretische Grundlage, auf die das Hörbuch und seine Verwendungsmöglichkeiten bezogen werden. Darauf folgen zwei Unterrichtsvorschläge, in denen aufgezeigt wird, wie das didaktische Potenzial von Hörbüchern im Literaturunterricht der Grundschule zum Tragen kommen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com hochladen und weltweit publizieren.
Inhalt
1 Einleitung
2 Geschichtlicher Hintergrund des Hörbuchs
2.1 Zur Entstehung und Entwicklung der Tonträger und Hörmedien
2.2 Zur kommerziellen Vermarktung des Hörbuchs
2.3 Zum derzeitigen Stand des deutschen Hörbuchmarktes
3 Das Hörbuch als Oberbegriff – Definition derzeitiger Sprach-Hörmedien
4 Zur Nutzung von Hörbüchern in Schule und Freizeit
4.1 Kindspezifisches Angebot des Hörbuchmarktes
4.2 Private Nutzung und Verbreitung von Hörbüchern bei Grundschul-kindern
4.3 Zum Stand des Hörbuchs im Kerncurriculum und der schulischen Praxis
4.4 Zum didaktischen Potenzial von Hörbüchern im Literaturunterricht
4.4.1 Zum Verhältnis von Lesen und Zuhören
4.4.2 Beim Lesen und Hören Vorstellungen entwickeln
4.4.3 Subjektive Involviertheit und genaue Wahrnehmung miteinander ins Spiel bringen
4.4.4 Perspektiven literarischer Figuren wahrnehmen
4.4.5 Sprachliche Gestaltung aufmerksam wahrnehmen
4.4.6 Metaphorische und symbolische Ausdrucksweise verstehen
4.4.7 Zur Wechselbeziehung von Leselust und -kompetenz und Litera-rischem Lernen
4.4.8 Verwendungsmöglichkeiten des Hörbuchs in weiteren Aspekten Literarischen Lernens
5 Vorschläge für die Verwendung von Hörbüchern im Literatur-unterricht der Grundschule
5.1 Zur Auswahl von Hörbüchern für den Unterricht
5.2 Literaturunterricht mit Hör- und Bilderbuch in der zweiten Klassenstufe
5.3 Mit einer vierten Klasse ein Hörspielkapitel selbst erstellen
6 Fazit
7 Literatur- und Quellenverzeichnis
1 Einleitung
Literatur und Tonträger[1] haben eine eng miteinander verbundene Tradition. Radio, Schallplatte und Tonband waren über viele Jahre von großer Wichtigkeit für die Verbreitung von Literatur, so saßen zu bestimmten Anlässen Erwachsene wie Kinder vor den entsprechenden Abspielgeräten und lauschten der gesprochenen Literatur.[2] Heute haben Hörmedien eine noch nie dagewesene Vielfalt, Mobilität und Verbreitung erreicht. Der Markt der sogenannten Hörbücher[3] boomt und erweitert sich seit Jahren hinsichtlich Vielfalt und Quantität. Darüber hinaus hat es die Weiterentwicklung der Unterhaltungstechnologie möglich gemacht, Hörbücher nahezu immer und überall rezipieren zu können. Bereits Kinder im Kindergartenalter nutzen dieses Medium häufig, da die Abspielgeräte in den meisten elterlichen Haushalten verfügbar und zudem robust und leicht bedienbar sind. Generell sind Hörmedien bei Kindern heute stark verbreitet und werden auch von den jüngeren gerne genutzt.[4] All dieser Entwicklung zum Trotz wird in der Institution Schule und besonders im Literaturunterricht noch eher selten auf Hörbücher, also die Verwendung von Literatur auf Tonträgern, zurückgegriffen. Ebenso hat die Fachliteratur erst vor einigen Jahren damit begonnen, sich intensiver mit den eben genannten Veränderungen auseinanderzusetzen und fachwissenschaftlich wie fachdidaktisch aufzuarbeiten.[5] Zum Ausfüllen dieser Forschungslücke möchte ich im Rahmen des mir Möglichen beitragen, indem ich in dieser Arbeit folgende These zu belegen versuche:[6]
Die Verwendung von Hörbüchern ist für den Literaturunterricht in der Grundschule förderlich.
Um eine Antwort auf die Fragen zu erhalten, warum und wie Hörbücher im Literaturunterricht der Grundschule besonders förderlich eingesetzt werden können, wird zuerst die geschichtliche Entwicklung von Hörmedien kurz dargestellt (siehe Kapitel 2), woraufhin diese in Kapitel 3 einzeln definiert werden. In Kapitel 4 erfolgt die Begründung der Verwendung von Hörbüchern in der Grundschule aus drei Perspektiven: dem bestehenden Nutzungsverhalten der Kinder im Grundschulalter[7], dem Mangel an Verwendung von Hörbüchern in der Grundschule und dem didaktischen Potenzial von Hörbüchern im Literaturunterricht. Dem letzten Punkt dient das Literarische Lernen nach Spinner als theoretische Grundlage, auf die das Hörbuch und seine Verwendungsmöglichkeiten bezogen werden. Darauf folgen zwei Unterrichtsvorschläge, in denen aufgezeigt wird, wie das didaktische Potenzial von Hörbüchern im Literaturunterricht der Grundschule zum Tragen kommen kann.
2 Geschichtlicher Hintergrund des Hörbuchs
Betritt man heute eine beliebige Filiale einer Buchhandelskette, sieht man sich im Regal mit der Überschrift Hörbücher einer Vielzahl von Angeboten gegenüber. So ist nicht nur die Bandbreite der verfügbaren Titel überaus groß, man hat darüber hinaus auch die Auswahl zwischen vielen verschiedenen Formen von Hörmedien, wie z. B. Lesungen, Hörspielkassetten, Collagen oder O-Ton-Hörbücher.[8] „Das Hörbuch ist in mediengeschichtlicher Perspektive kein Kind mehr, sondern schon im besten Erwachsenenalter. Seine Wurzeln reichen in die Anfangszeit der Tonkonserve: bis hinab zu Walze, Phonograph und Grammophon.“[9] Um einen Überblick über die verschiedenen Formen und ihre jeweilige Entstehung zu erhalten, wird im Folgenden der Werdegang der Musik- und Worttonträger und der auf ihnen gespeicherten Hörmedien verkürzt dargestellt.
2.1 Zur Entstehung und Entwicklung der Tonträger und Hörmedien
Die Möglichkeit, Töne in irgendeiner Form festzuhalten und zu einem anderen Zeitpunkt wieder erklingen zu lassen, hat die Menschen bereits im 16. Jahrhundert fasziniert. So ließ Francois Rabelais in seinem Buch Pantagruel von anno 1532 die Geräusche einer winterlichen Feldschlacht im Eis einfrieren, woraufhin diese mit Abschmelzen des Eises im Frühling wieder zu hören waren. 1632 verfasste Charles Sorel einen imaginären Reisebericht, in dem ein Südseevolk seine Nachrichten in einen Schwamm spricht und diesen versendet, um über große Distanzen miteinander kommunizieren zu können.[10] Es dauerte jedoch weitere zweieinhalb Jahrhunderte, bis Tonaufzeichnungen und ihre spätere Wiedergabe technisch möglich wurden. Nachdem Anfang des 19. Jahrhunderts sowohl Töne als auch die menschliche Stimme erstmals aufgezeichnet und die Frequenz und Intensität ihrer Schallwellen bestimmt werden konnten, entwickelte Charles Cros die Idee zu einem Gerät namens Parléophone, das es vermag, eben diese Schwingungen mit einem Stichel in eine Walze zu übertragen und die Aufzeichnung auch wieder ertönen zu lassen.[11] Zwar wird Cros‘ Erfindung im Jahr 1877 als Patent angemeldet, jedoch gewährt die Pariser Académie des Sciences der von Thomas Edison den Vorrang, die auf denselben Prinzipien beruht und im selben Jahr patentiert wird.[12] Edison erfand den sogenannten Phonographen während seiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Leiter des Menlo Park Laboratoriums. Der Phonograph zeichnete Töne auf, indem die über eine Membran auf eine Schreibspitze übertragenen Schwingungen Vertiefungen auf den Stanniolstreifen einer rotierenden Walze hinterließen. Zur Wiedergabe von aufgenommenen Tönen oder Sprache musste die Walze der Sprechmaschine von Hand gedreht werden, sodass die Vertiefungen über die Schreibspitze die Membran zum Schwingen und somit zum Tönen brachten. Den ersten Test führte Edison selbst durch, indem er das Kinderlied Mary had a little lamb zum Besten gab, den Gesang und sein darauf folgendes unfreiwilliges Gelächter aufzeichnete und die Aufnahme, wenn auch mit etwas veränderter Stimme, sogleich wieder abspielte.[13] Für Edison lagen die Einsatzgebiete des Phonographen allerdings eher darin,
Diktat aufzunehmen, Zeugnis vor Gericht abzulegen, Reden festzuhalten, Vokalmusik wiederzugeben, Fremdsprechen zu unterrichten. [Außerdem] für Briefwechsel, zivile und militärische Befehle, […] die Distribution von Liedern großer Sänger, für Predigten und Ansprachen und die Worte von großen Männern und Frauen.[14]
Neben anderen Erfindern, die an der Weiterentwicklung dieser Technologie arbeiteten, erweiterte auch Edison seine Sprechmaschine um einen Elektromotor und ersetzte die Stanniolfolie durch einen Wachszylinder.[15] Der verbesserte Phonograph war in der Folge auch das Gerät, das bei der Weltausstellung 1889 in Paris für Furore sorgte und zum Publikumsmagnet wurde, was nicht verwundert, war es doch erstmals möglich, Töne und Stimmen sowohl aufzunehmen, als auch wiederzugeben und somit von der konkreten Gegenwart unabhängig der Nachwelt zugängig zu machen. „Der Apparat eröffnete märchenhafte Möglichkeiten. Der Ton wurde in Raum und Zeit veränderbar. Musik, von alters her die vergänglichste unter den Künsten, wurde […] reproduzierbar.“[16] Die Fokussierung auf die Aufnahme und Wiedergabe von Musik war entscheidend für die Art der Verwendung von Edisons Phonographen. So nutzten die Menschen diesen hauptsächlich zum Abspielen von Musik, da die Wiedergabequalität mittlerweile annehmbar war.[17] Zudem konnte man an aufgestellten Phonographen für einige Cent für die Dauer einer Walzenrotation der abgespielten Musik über Hörschläuche lauschen.[18] Obwohl Edison die Verwendung seiner Erfindung zur Lebenszeit überdauernden Dokumentation der Stimmen berühmter Persönlichkeiten, wie z. B. Otto von Bismarck, und auch der Verbreitung von mündlich vorgetragener Literatur favorisierte, lag der Erfolg der Phonographen doch hauptsächlich im Unterhaltungsbereich.[19]
Um die Jahrhundertwende wurde Edisons Erfindung durch das Grammophon Emil Berliners technisch überholt, „ein Gerät, das die Phone, die Stimme, als Gramme, als Einschreibung und Schrift, festhält.“[20] Da das Grammophon in Verbindung mit Schallplatten als Tonträger eine leicht bessere Klangqualität, längere Laufzeiten und mehr Bedienungskomfort bot, löste es die Phonographen zunehmend ab.[21] In Deutschland begann man 1922 damit, Schallplatten über ein elektronisches Aufnahmeverfahren mit Mikrofon und Verstärker zu bespielen, was deren Qualität erhöhte. Darüber hinaus wurden viele Versuche zur Weiterentwicklung der Schallplatte unternommen, jedoch konnte sich erst ab 1948 diesbezüglich ein neuer Standard in Form der Mikrorillen-Langspielplatte (LP) durchsetzen. Die LP klang besser und hatte eine deutlich längere Spielzeit.[22] Zur Zeit früher Walzen und Schallplatten wurden neben der Musik hauptsächlich echte und arrangierte Reden und Ereignisse aus Politik und Krieg aufgenommen, so z. B. der Beschuss von Paris als Hörbildnis. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden in Deutschland weiterhin viele Politiker auf Schallplatte festgehalten. Zudem waren kurze Kabarettszenen und Auszüge aus Literaturklassikern, wie Shakespeares Othello, Hofmannsthals Jedermann, Schillers Die Räuber und verschiedenen Texten Goethes auf sogenannten Sprechplatten erhältlich. Spezielle Kinder- und Jugendtonträger gab es bis in die 1920er Jahre hinein fast überhaupt nicht. Dies änderte sich geringfügig mit der Einführung des Hörfunks in Deutschland im Jahr 1923. Zwar bestand das Hörfunkprogramm schwerpunktmäßig aus Unterhaltungsmusik, beinhaltete aber ab 1924 darüber hinaus auch Hörspiele. Mit dem Ende der 1920er Jahre begannen in der Folge einzelne Schallplattenhersteller damit, in Verbindung mit Hörfunkanstalten spezielle Hörspiele für Kinder herzustellen, wie z. B. Märchen und Kasperlestücke und später auch kurze Kindertheaterstücke nach den Gebrüdern Grimm, wobei diese Art von Kindertonträgern bis Mitte der 1950er Jahre eher eine Randerscheinung blieb.[23]