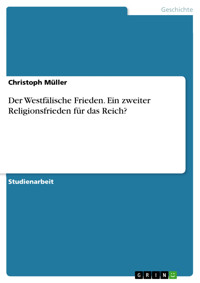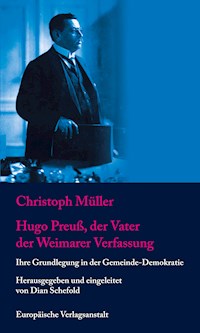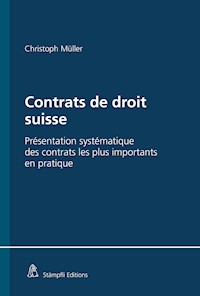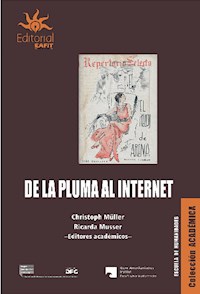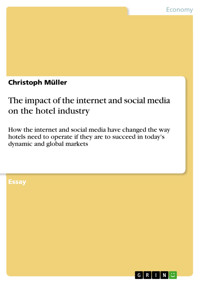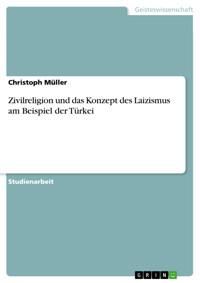15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CEP Europäische Verlagsanstalt
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Christoph Müllers Werk über das imperative und freie Mandat ist "ein Klassiker von unbestrittenem Rang" (Horst Dreier). Das Buch zeichnet sich durch drei Stärken aus: eine methodologische, eine historische und ein politikwissenschaftliche. Die methodologische Stärke besteht im nachdrücklichen Insistieren darauf, dass Normen immer in den Kontext der sozialen Beziehungen und politischen Voraussetzungen gestellt werden müssen. Die historische Stärke zeigt sich an der Gründlichkeit und Intensität, mit der die Verfassungsentwicklung in England und Frankreich nachgezeichnet wir. Schließlich ist die Studie politikwissenschaftlich stark, weil sie das Blatt nicht überreizt, also das freie Mandat nicht in den höchsten Tönen feiert, sondern auf die notwendigen Rückkopplungsprozesse verweist, die es gerade im modernen Parteienstaat gibt und geben muss. "Angesichts einer Situation, in der auch und gerade in einigen westlichen Demokratien die Tendenz besteht, gewählte Abgeordnete nicht als die wahren Repräsentanten … anzuerkennen, sondern – in welcher Gestalt auch immer – Identitätspolitik zu betreiben, sind Müllers Grundeinsichten ein bleibender Gewinn, der nicht verspielt werden sollte." (Horst Dreier)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 555
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Christoph Müllers Werk über das imperative und das freie Mandat ist „ein Werk von unbestrittenem Rang“ (Horst Dreier) und wird hier in einer Neuausgabe wieder zugänglich gemacht. Das Buch zeichnet sich durch drei Stärken aus: eine methodologische, eine historische und eine politikwissenschaftliche. Die methodologische Stärke besteht im nachdrücklichen Insistieren darauf, dass Normen immer in den Kontext der sozialen Beziehungen und politischen Voraussetzungen gestellt werden müssen. Die historische Stärke zeigt sich an der Gründlichkeit und Intensität, mit der die Verfassungsentwicklung in England und Frankreich nachgezeichnet wird. Schließlich ist die Studie politikwissenschaftlich stark, weil sie das Blatt nicht überreizt, also das freie Mandat nicht in den höchsten Tönen feiert, sondern auf die notwendigen Rückkopplungsprozesse verweist, die es gerade im modernen Parteienstaat gibt und geben muss.
Christoph Müller, Jahrgang 1927, Promotion 1965 an der Universität Bonn; Postdoctoral Studies an der Harvard University u.a.; Habilitation 1972 an der Universität Gießen; ab 1973 ordentlicher Professor für Staatsrecht und Politik am Fachbereich Rechtswissenschaft der Freien Universität Berlin; Emeritierung 1993; Gastprofessuren an den Universitäten Universidad de Belgrano Buenos Aires 1986, Beijing University 1994, Daito Bunka University Tokyo 1995; ab 2000 war er Vorsitzender der Hugo-Preuß-Gesellschaft e.V.
Horst Dreier, Jahrgang 1954, Inhaber des Lehrstuhls für Rechtsphilosophie, Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Würzburg bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2020.
Christoph Müller
Das imperativeund das freie Mandat
Überlegungen zur Lehrevon der Repräsentation des Volkes
Mit einer Einführung zur Neuausgabevon Horst Dreier
E-Book (ePub)
© CEP Europäische Verlagsanstalt GmbH, Hamburg 2022Alle Rechte vorbehalten.Covergestaltung: Christian Wöhrl, HoisdorfSignet: Dorothee Wallner nach Caspar Neher »Europa« (1945)
ePub:ISBN 978-3-86393-580-1
Auch als gedrucktes Buch erhältlich:Neuausgabe © CEP Europäische Verlagsanstalt GmbH, Hamburg 2021
Print: ISBN 978-3-86393-120-9
Informationen zu unserem Verlagsprogramm finden Sie im Internet unter www.europaeischeverlagsanstalt.de
Meinem LehrerMARTIN DRATH
Editorische Notiz
Prof. Helmut Ridder hatte 1965 an der Universität Bonn meine Dissertation betreut und mit summa cum laude bewertet. Noch 1970 hielt er sie „für die instruktivste Untersuchung aus den letzten Jahren“. Aber 1970 hat er den Titel etwas modifiziert: durch Einfügung eines bestimmten Artikels. Ich nehme die Kritik an. Der Titel soll jetzt lauten: „Das imperative und das freie Mandat. Überlegungen zur Lehre von der Repräsentation des Volkes“ (vgl. Ridder: Vom „freien Mandat“ zur Freiheit vom Mandat, in: Die Öffentliche Verwaltung, 21. Jg., Heft 18, S. 617–629, Fn. 1 und 14, jetzt erneut abgedruckt in Ridder, Kommunikation in der Demokratie, hg. von F. Hase, K.-H. Ladeur, Ulrich K. Preuß, Tübingen 2019, S. 157–164. – Der Text der Arbeit aber ist völlig unverändert.
Christoph Müller
INHALT
Horst Dreier
Zur Einführung: Genese und Funktion des freien Mandats
Einleitung
Erstes Kapitel
VERFASSUNGSRECHTLICHE PROBLEMSTELLUNG
A.Auslegung des freien Mandats
1.Die Interpretation der Abgeordnetenfreiheit
2.Parteien und freies Mandat
3.Fraktionsdisziplin und freies Mandat
4.Die Repräsentationstheorie von Gerhard Leibholz
5.Die Repräsentationstheorie von Carl Schmitt
6.Die Auffassungen Edmund Burkes über das freie Mandat
B.Auslegung des imperativen Mandats
1.Das imperative Mandat als Verfassungswirklichkeit
2.Das imperative Mandat als Ausdruck der Volkssouveränität
3.Plebiszitäre Demokratie im Sinne Max Webers
4.Demokratische Identität im Sinne Carl Schmitts
5.Plebiszitärer Parteienstaat im Sinne von Gerhard Leibholz
Zweites Kapitel
EMPIRISCHE PROBLEMSTELLUNG
A.Rechtsvergleich
1.Frankreich
2.Deutsche Territorialverfassungen
3.Deutsche gesamtstaatliche Verfassungen
4.Deutsche Kommunalverfassungen
5.Schweiz
6.Niederlande
7.Polen
8.Ausbreitung des freien Mandats
9.Instruktionsrecht in nordamerikanischen Verfassungen
10.Volksdemokratische Verfassungen
11.Die Verfassungsentwicklung Englands
B.Ermittlung überprüfbarer Rechtstatsachen
1.Mißverhältnis von Rechtsvergleich und Auslegung
2.Funktion des imperativen Mandats in föderativen und unitarischen Verfassungen
3.‚Entwicklung‘ des imperativen Mandats zum freien Mandat
4.Organisatorische Wirkungen und politische Bedingungen des freien Mandats
Drittes Kapitel
PRIVATRECHTSORDNUNG, VERTRAGSORDNUNG, STELLVERTRETUNG
A.Die Bedeutung älterer Kontraktvorstellungen
1.Die patrimoniale Theorie
2.‚From Status to Contract‘
3.Privilegienstruktur des Mittelalters
4.Volkssouveränität und Herrschaftsvertrag
B.Plena Potestas und Instruktion
1.Die Ausbildung des Instituts der Stellvertretung
2.Plena Potestas und Unterhändlermandat
3.Plena Potestas und Prozeßvollmacht
Viertes Kapitel
PLENA POTESTAS UND REPRÄSENTATIVE VERSAMMLUNGEN
A.Das freie Mandat in England
1.Politische Entscheidung als Rechtsfindung
2.Traditionaler consensus omnium und feudaler Individualismus
3.Die Prärogative der Krone
4.Repräsentative Stellung der Magnaten
5.Repräsentative Stellung der Commoners
6.Der ‚Adressat“ der Repräsentation
7.Der Loyalitätskonflikt parlamentarischer Repräsentation
8.Common Petition und freies Mandat
9.Zusammenfassung
B.Das imperative Mandat in Frankreich
1.Das Mandat zu den Generalständen von 1789
2.Repräsentation und Regionalismus
3.Repräsentation und imperatives Mandat
4.Repräsentation und Absolutismus
5.Zusammenfassung
C.Imperatives und freies Mandat als soziologische Typen
1.Das imperative Mandat
2.Das freie Mandat
Fünftes Kapitel
SCHLUSSFOLGERUNGEN
A.Politische Repräsentation als rechtliche Befugnis
1.Unmittelbare Demokratie und imperatives Mandat
2.Beschlußkörper und freies Mandat
3.Repräsentation organisierter Interessen
4.Parteienstaat und freies Mandat
5.Freies Mandat und Mandatsverlust
B.Politische Repräsentation als gesellschaftlicher Prozeß
1.Absorptive Repräsentation
2.Volksrepräsentation
Anhang
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Personenverzeichnis
Sachverzeichnis
Horst Dreier
Zur Einführung: Genese und Funktion des freien Mandats
I.
Christoph Müllers Buch über das imperative und das freie Mandat ist ein Werk von unbestrittenem Rang. Schon in den ersten Rezensionen wurde zu Recht hervorgehoben, die Arbeit biete „in dieser Komplexität eine seltene Fülle des Materials und der in methodologischer Sauberkeit gewonnenen Ergebnisse“1. Udo Bermbach, obwohl zu jener Zeit noch ein wenig skeptisch gegen die seiner Meinung nach allzu positive Bewertung des freien Mandats, sprach anerkennend von dem „sehr sorgfältig gearbeiteten Buch“2. In einer weiteren Besprechung des Werkes wurde seine „geschliffene Argumentation“ gerühmt3. Selbst in den SPIEGEL hat es die Schrift geschafft, aus der sogar korrekt zitiert wurde4. In der bedeutenden Habilitationsschrift von Helmut Quaritsch begegnet sie uns mehrfach5, und in Hasso Hofmanns großer Ideen- und Begriffsgeschichte der Repräsentation heißt es schlicht und ergreifend: „vgl. jetzt maßgeblich die profunde Arbeit von Christoph Müller“6; zwei weitere Male vergibt Hofmann das bei ihm eher seltene Prädikat „vorzüglich“7. Und in seiner erst kürzlich erschienenen Habilitationsschrift schreibt Florian Meinel in der Fußnote zu der Aussage, die Herausbildung eines umfassenden privilegierten Status der Repräsentanten sei Bedingung parlamentarischer Herrschaft: „Dazu immer noch vor allem Müller, Das imperative und freie Mandat“8. Das Buch ist dauerhaft präsent in Handbüchern zum Parlamentsrecht9 und sonstigen Sammelwerken10. Es bildet auch in einschlägigen Staatsrechtslehrerreferaten einen Referenzpunkt11.
Doch wie das bei Klassikern leicht vorkommt: Sie werden oft nur noch ganz pauschal zitiert, nicht immer aber wirklich paßgenau herangezogen oder gar des näheren inhaltlich gewürdigt. Von daher sei im folgenden der Argumentationsgang des Buches zunächst noch einmal in seinen Grundzügen rekapituliert (II.), bevor wir dann der Frage nach der bleibenden Aktualität der Abhandlung nachgehen wollen (III.).
II.
1. Das erste Kapitel ist überschrieben: „Verfassungsrechtliche Problemstellung“. Was wird vor- oder dargestellt? Es sind tradierte Konzepte des freien und des imperativen Mandats. Doch handelt es sich hier weniger um eine Exposition als um eine Dekonstruktion, wenn der Autor immer wieder in seiner knappen, hochkonzentrierten Art auf die Schwachpunkte jener Konzepte aufmerksam macht. Einer Phase entstammend, die man rückblickend als „Lehrjahre der Demokratie“ bezeichnet hat, liest sich die Schrift wie eine Katharsis. So wird beispielsweise der These, das freie Mandat schütze gegen jede denkbare Beeinflussung ganz unabhängig davon, von wem „im Einzelfalle Bindungen ausgehen, wie intensiv sie sind oder welche soziale Richtung und Wirkung sie haben“ (S. 7), entgegengehalten, sie lasse Zweifel „an der Uninteressiertheit dieser Generalisierung entstehen“ – denn faktisch richte sie sich nur gegen die Einflußnahme der politischen Parteien. Konsequenz: „Die Norm des freien Mandats wird auf diese Weise in eine Waffe umgeschmiedet, mit der die Staatsrechtslehre gegen die Demokratie ankämpfte.“ (S. 7). Ein anderes Beispiel: Die These, das freie Mandat richte sich gegen Instruktionen der Wähler, bestimmter Verbände, Parteien und Fraktionen gleichermaßen, verkennt nicht allein, daß die Befreiung von der einen Abhängigkeit (etwa gegenüber einem Verband) gerade durch die Bindung an eine andere Größe (etwa die Fraktion) bewirkt sein kann – ganz abgesehen davon, daß unser Verfassungssystem gewisse Bindungen für sein Funktionieren zwingend voraussetzt (S. 12 f.). Leibholz „Wesensanalyse“ der Repräsentation (S. 14) führt diesen zu der Annahme, sie funktioniere der Idee nach am besten bei parteimäßig nicht gebundenen Abgeordneten. Doch wie, fragt unser Autor, verträgt sich das damit, daß ein „Parlament immer organisierte Kooperation“ (S. 17) benötige?
Mit ähnlichen Fragen und Einwänden begegnet Müller denjenigen Autoren, die demgegenüber das imperative Mandat (sei es als Verfassungswirklichkeit, als Ausdruck der Volkssouveränität oder als plebiszitäre Demokratie im Sinne Max Webers verstanden) entweder pauschal favorisieren oder perhorreszieren. Das alte System des frühliberalen Konstitutionalismus „benötigte Fraktionsdisziplin aus den gleichen Gründen wie moderne Parlamente […] Das alte und das neue System unterscheiden sich jedenfalls nicht dadurch, daß eine früher vorhandene Unabhängigkeit verlorenging, sondern dadurch, daß konkrete Abhängigkeiten ausgewechselt werden.“ (S. 37) Besonders entschieden wird Carl Schmitts Vorstellung demokratischer Identität zurückgewiesen: „Nur als spontane Gruppe billigt er dem Volk zu, Träger des demokratischen Prozesses zu sein, gerade also in einer Organisationsform, in der es aller Techniken beraubt ist, mit denen es im qualifizierten Sinne handlungsfähig würde.“ (S. 42) Daraus und weil nach Schmitt Diktatur nur auf demokratischer Grundlage möglich ist, folgt letztlich: „aus der Repräsentation, dem wesentlichen Mittel seiner organisierten Einflußnahme, hatte Carl Schmitt das Volk vertrieben; in der Identität muß es – empirisiert und desorganisiert – eine Struktur haben, die als einzige Möglichkeit, um die erforderliche gesellschaftliche Entscheidungseinheit zu gewährleisten, die Diktatur übrig läßt“ (S. 44).
2. Eingedenk der „Schwäche bloß ideengeschichtlicher Konstruktionen“ (S. 27) setzt unser Autor nach erfolgreicher Auf- und Abräumarbeit entsprechender Konzepte noch einmal neu und ganz anders an. Das zweite Kapitel steht unter dem Titel „Empirische Problemstellung“ und beginnt – mit Rechtsnormen, genauer: einer umfänglichen Rekonstruktion der Normierungen des freien Mandats in verschiedenen Ländern und auf verschiedenen Stufen der Normenordnung (S. 50 ff.). Müller sucht und findet reichlich Material für eine Verankerung des freien Mandats in einschlägigen Rechtstexten von der französischen Revolutionsverfassung und territorialstaatlichen Konstitutionen über deutsche gesamtstaatliche Verfassungen bis hin zu Kommunalverfassungen. Nur selten finden sich aber (auch in älteren Dokumenten) Regelungen eines imperativen Mandats – und wenn, dann (außer in Volksdemokratien wie der Sowjetunion) in föderativen oder gesandtschaftlichen Kontexten (S. 72 f.). Von eminenter Bedeutung ist für Müller die englische Verfassungsentwicklung. Er zeigt auf, daß es hier bereits im 13. Jahrhundert der Krone gelang, die commons mit einer plena potestas ausstatten zu lassen, womit sie in die Lage versetzt waren, Erklärungen für das gesamte Königreich abzugeben. So war denn mit dem „Umfang der Vollmacht der Vertreter der commons […] seit Beginn der repräsentativen Versammlungen ein imperatives Mandat nicht zu vereinbaren“ (S. 71). Der Verfasser formuliert eindringlich: „Denn wenn die Repräsentanten auch von den einzelnen commons entsandt werden, so reißt die Krone sie doch von ihnen los, indem sie die Konstituenten durch königlichen writ zwingt, unumschränkte Vollmachten zu erteilen und die Versammlung der Repräsentanten vor die Autorität des king in council stellt.“ (S. 71)
Diese Einsicht hat weitreichende Konsequenzen. Es geht ihr zufolge nicht länger an, der These von der „Entwicklung des imperativen zum freien Mandat“ (S. 74) zu folgen und diese Entwicklung mit der vom mittelalterlichen zum modernen Staat zu parallelisieren: „Das freie Mandat kann nicht gut Ausdruck des modernen Konstitutionalismus sein, wenn seine wesentlichen Elemente in England bereits gegen Ende des 13. Jahrhunderts erfaßt worden sind.“ (S. 74; ähnlich S. 176) Das freie Mandat ist also keinesfalls „selbstverständliches Resultat eines gradlinig verlaufenen historischen Prozesses“ (S. 77). Hinfällig ist aber auch die gängige Sichtweise, Repräsentation und Identität als unterschiedliche, ja gegensätzliche Formprinzipien zu begreifen (S. 72; s. auch S. 232). Und nichts anderes gilt für die gängige Entgegensetzung von „Vertretung“ als Inbegriff privater, rechtsgeschäftlicher Interessen und „Repräsentation“ als öffentliche Darstellung der politischen Einheit des Landes (S. 75; s. auch S. 125 u.ö.). Das führt uns direkt in das nächste Kapitel.
3. Dieses dritte Kapitel mit der ein wenig sperrigen Überschrift „Privatrechtsordnung, Vertragsordnung, Stellvertretung“ führt uns weit zurück in das Mittelalter, den Patrimonialstaat und den Ständestaat. Der Autor zeigt im einzelnen auf, daß die vorgeblich klare Unterscheidung zwischen vermeintlich privaten Zwecken, für die dann Stellvertretung und imperatives Mandat leitend seien, und öffentlichen Zwecken, die den Prinzipien von Repräsentation und freiem Mandat folgen, nicht trägt und zudem unschlüssig ist (S. 85, 108). Der Begriff der Repräsentation kann der Rechtsfigur der Stellvertretung nicht einfach entgegengesetzt werden, da diese durch Kanonistik und Legistik geformte Rechtsfigur mit dem Gedanken der plena postestas nicht unbedingt andere Weg geht als die Repräsentation (S. 111 ff.). Am Mandat diplomatischer Unterhändler und der Prozeßvollmacht von Anwälten demonstriert Müller sodann die Vielgestaltigkeit von Stellvertretungsverhältnissen und somit in rechtssoziologischer Sicht deren Vorreiterrolle für die plena postestas in repräsentativen Versammlungen (S. 113 ff.). Bei der ersten Fallgruppe, der diplomatischen Stellvertretung, zeigt sich, daß es ungeachtet einer plena potestas des Unterhändlers „nicht als tolerabel galt, wenn sich das Außenverhältnis der Vollmacht verselbständigt und vom Innenverhältnis der Instruktion gelöst hätte“ (S. 117). Weiter führt aber die zweite Fallgruppe, die anwaltliche Prozeßvollmacht. Hier geht es um die Reichweite der Prozeßvertretung vor Gericht, bei der sicherzustellen ist, „daß die abwesende Prozeßpartei die Erklärungen ihres Vertreters sowie die Entscheidung des Gerichts anerkennen muß“ (S. 122). Diese neuen Standards der Vertretung stellen vor allem die Autorität des Gerichts sicher. Der Autor wird nicht müde zu betonen, daß Rechtsfiguren erst in konkreten Instituten und Kontexten mit ihren Formen und Formalien ihre charakteristische Ausprägung erfahren. Dieser Übung gilt das folgende Kapitel.
4. In eingehender historischer Tiefenbohrung wendet sich das Buch im vierten Kapitel dem Thema „Plena Potestas und repräsentative Versammlungen“ zu. Es ist in zwei Unterabschnitte unterteilt, die plakativer nicht hätten überschrieben werden können: das freie Mandat in England und das imperative Mandat in Frankreich.
a) Beim freien Mandat in England geht die Darstellung bis zur Magna Carta zurück und schildert eingehend, wie sich die curia regis des Königs zum council entwickelte und sich das Zustimmungsrecht der Magnaten, das ursprünglich ein personales war, in einem längeren Prozeß zu einem „korporativen Beschlußkörper“ (S. 136) umwandelte. Nun gilt der Satz: „der korporative Akt bindet das ganze Land.“ (ebd.) Zudem müssen sich die Magnaten ihre Beschlußfassung auf Dauer mit den commoners teilen, die immer stärker die „Last der Repräsentation“ (S. 137) zu tragen haben. Zwar wäre es ganz ahistorisch, „der Krone den klaren Willen zuzuschreiben, eine einheitliche Vertretung des ganzen Landes zu schaffen“ (S. 138), aber deutlich weisen deren Aktionen letztlich, zwar tastend und experimentierend, in eben diese Richtung. Die Krone war das „Bewegungszentrum bei der Entwicklung repräsentativer Versammlungen“ (S. 141; s. auch S. 76, 156, 208, 223 u.ö.). Sie ist es, die „die Repräsentanten von ihren Konstituenten löst“ (S. 143). Dabei geht es nicht an, die Entwicklung im Sinne eines Prozesses „vom imperativen zum freien Mandat“ darzustellen, sondern zu erkennen, daß das später voll ausgebildete Bewußtsein vom Parlament als communitas communitatum, welches durch „einheitliche Zustimmungsakte das ganze Land rechtlich bindet“ (S. 144), lediglich eine längst realisierte Tatsache nachholt. Insofern vermögen auch die faktischen Rückkoppelungen der Repräsentanten zu ihren constituencies und die oft bekundeten Loyalitäten ihnen gegenüber keine „Abhängigkeiten zu begründen, die ihre Kompetenz im Parlament limitiert und sie zu Trägern imperativer Mandate gemacht hätten.“ (S. 150) Letztlich zeigt sich, daß die spätmittelalterlichen Parlamente Englands sukzessive in den Prozeß des Erlasses von statutes einbezogen und so zu gesetzgebenden Faktoren wurden. Die commoners, von der Krone zu kohärentem Handeln genötigt, konnten die „welthistorische Chance des Parlaments“ (S. 158) erkennen, der Ort zu werden, an dem „alle Gegensätze und Spannungen des politischen Verbandes ausgetragen und ausgeglichen“ werden können (ebd.). „Die Freistellung der Repräsentanten von ihren Konstituenten, die die Krone im Interesse ihrer Prärogative erzwang, wird zur Chance eigener politischer Aktivität.“ (ebd.).
b) Gerade dieser Schritt bleibt in Frankreich bis zur Revolution aus. Warum? Frankreich bildet das Gegenmodell, nicht weil hier das Verständnis vom „Wesen“ der Repräsentation ein anderes gewesen wäre, sondern weil hier die „konkreten politisch-sozialen Bedingungen“ (S. 161) andere sind. Es lag also nicht an einer anderen Strategie der Krone. Vielmehr war es der Wunsch des französischen (nicht anders als der des englischen) Königs, daß die Generalstände umfassende Vollmachten mitbrächten, auch wenn der Terminus plena potestas fehlt. Doch läßt sich dieser Wunsch nicht realisieren. Daraus resultiert freilich keineswegs, daß die Abgesandten mit strikt imperativen Mandaten ausgestattet gewesen wären. Kennzeichnend für die Lage ist vielmehr die regellose Vielfalt der Vollmachten (S. 162 ff.). Doch immer dort, wo das imperative Mandat auftaucht bzw. man sich darauf beruft, zeigt sich, daß es ein Mittel der Obstruktion ist (S. 181 ff.).
Auch der Ausgangspunkt der Versammlungen ist in Frankreich ein anderer als in England. Hier war es der Krone gelungen, schon relativ früh das Parlament für die zentrale Frage der Steuerbewilligung zu gewinnen. In Frankreich treffen entsprechende Vorstöße des Königs bei den Generalständen auf taube Ohren. Deren Einberufung erfolgt in Not- und Krisenzeiten, doch stellen sie „kein normales Element im Verfassungsaufbau Frankreichs“ dar (S. 168 f.). Der Hauptgrund für den Mißerfolg der Krone liegt darin, daß dem Land eine „feste administrative Durchdringung“ (S. 173) fehlt und der Regionalismus mit seinem lokalen Eigenleben und den Privilegien deutlich stärker und länger ausgeprägt bleibt als in England. Die französischen Repräsentativversammlungen überregionaler Art erlangen bis zur Revolution „nie das Recht, mit unmittelbarer Wirkung für die Konstituenten finanziellen Forderungen der Krone zuzustimmen“ (S. 175, ähnlich S. 168). Die Steuerbewilligung bleibt Sache der regionalen Versammlungen. Auf überregionaler Ebene bedeutet der Rekurs auf das imperative Mandat die „Ausdrucksform des Regionalismus, der diese Kompetenz nicht auf eine überregionale, nationale Versammlung übergehen lassen will“ (S. 181). Ihre Berufung auf das imperative Mandat war ein Akt des Widerstandes in Gestalt der Obstruktion; ein taktisches Mittel, ohne offenen Bruch mit dem König Beschlußfassungen mit großer Reichweite für das ganze Land zu verhindern. Mit anderen Worten: es handelt sich um eine Veto-Position. Aber Veto heißt eben auch, nur negative Politik zu betreiben, nur zu verhindern, nicht zu gestalten und sich am Ende nur umso tiefer „in die eigenen Privilegien einzugraben“ (S. 184). Erst als der Dritte Stand in der französischen Revolution die „Chance einer positiven Regelungskompetenz erkennt“ (S. 180), gibt er das imperative Mandat auf.
c) Zusammenfassend ergibt sich, daß das imperative Mandat kein „allgemeines Kennzeichen der älteren Repräsentativverfassungen“ ist, „keine spezielle Modalität, um repräsentative Versammlungen zu organisieren“ (S. 198). Vielmehr sind Versuche der französischen Krone, Vertretungskörperschaften zu schaffen, an imperativen Instruktionen und limitierten Vollmachten gerade gescheitert. Das bedeutet umgekehrt, daß auch „repräsentative Versammlungen älteren Typs“ jedenfalls dann, „wenn sie funktionieren sollen, unbeschränkte Vollmacht und rechtliche Freistellung der Abgeordneten“ erfordern (S. 199), wie das in England durchgesetzt wurde.
5. Die Schlußfolgerungen des fünften und letzten Kapitels rekapitulieren die Ergebnisse. Das imperative Mandat ist ein „Instrument der Obstruktion gegen die Kompetenz der Beschlußfassung“ (S. 210). Nur das freie Mandat macht „repräsentative Beschlußfunktionen möglich“ (S. 212; s. auch S. 230) – weil die rechtliche Freistellung von Bindungen Vermittlungsschritte und Kompromißbildung erlaubt und so Entscheidungen des politischen Gesamtkörpers ermöglicht, die zwar nicht dem Willen aller Abgeordneten, aber doch ihrer Mehrheit entsprechen. Mit imperativen Mandaten hingegen lassen sich zwar „Entscheidungskompetenzen blockieren, nicht aber organisieren“ (S. 213). Freilich darf die Instruktionsfreiheit nicht ahistorisch zur Freiheit von allen Bindungen übersteigert werden. Für die liberale Repräsentationstheorie etwa soll die „Instruktionsfreiheit einen Individualismus der Abgeordneten verbürgen, den funktionierende Parlamente, gerade auch in der liberalen Epoche, nie gekannt haben.“ (S. 220) Die Freistellung der Abgeordneten impliziert kein striktes „Verbot politischer Kooperation“ (ebd.), sondern ermöglicht diese – gegebenenfalls auch und gerade gegen die Wünsche der Wähler der Abgeordneten. Die politischen Parteien und deren Fraktionen, die Mehrheiten organisieren wollen und müssen, können hoffen, konfligierende Loyalitäten zugunsten einheitlicher politischer Entscheidungen aufzulösen. Doch hat nicht die politische Partei das freie Mandat inne, sondern der Abgeordnete, der es im Falle eines Konflikts auch gegen seine (alte) Partei verwenden und sich einer neuen Fraktion anschließen kann, ohne dadurch zwangsläufig sein Mandat zu verlieren. In einem Wort: Die Repräsentation des Volkes ist ein „Instrument der Volkssouveränität“ (Martin Drath), nicht deren Negation.
III.
Während das vorangegangene längere Referat einen kleinen Eindruck von der Weite und Tiefe der vorgelegten Analysen vermitteln sollte, so sei nun das wesentliche Ergebnis der Untersuchung noch einmal in aller Kürze festgehalten. Es sind vornehmlich zwei Punkte. Erstens: Das imperative Mandat, ein gängiges Instrument im Kontext föderativer und völkerrechtlicher Prozesse, ist im Gefüge innerstaatlicher Entscheidungsprozesse stets ein Mittel der Obstruktion (S. 29, 165, 181 ff., 200, 202, 206, 210). Man kann negative Politik und Interessensicherung mit ihm bestreiten, aber keine auf Kompromiß und Interessenvermittlung beruhende Politik für das ganze Land betreiben. Zweitens: Das freie Mandat, das keineswegs Freiheit von allen denkbaren Einflüssen bedeuten muß, ist notwendige Voraussetzung für die korporative Beschlußfassung in politisch führenden Versammlungen (S. 2, 71, 199, 206, 230 f.). Es hat seine Bedeutung keineswegs mit dem Aufkommen moderner Parteien und der Fraktionsdisziplin eingebüßt. Die These von einem „Gestaltwandel der Repräsentation“ (Gerhard Leibholz) ist ahistorisch und haltlos.
So weit, so gut. Das imperative Mandat hat durch die Darstellung Müllers viel von seinem Nimbus verloren, das freie Mandat, wie auch immer im einzelnen ausgestaltet, steht eindeutig als der große Gewinner dar: schlicht aus Gründen der Funktionalität beschließender Repräsentativversammlungen, für die eine gewisse Freistellung der Abgeordneten zwingend ist. Müllers Buch hätte nach seinem Erscheinen vielleicht noch sehr viel größere und durchschlagendere Wirkung entfaltet, wenn nicht in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren im Gefolge der 1968er-Bewegung Vorstellungen einer jederzeitigen Abberufung von gewählten Abgeordneten durch ihre Wahlkörperschaft oder der Erteilung bindender Instruktionen an diese im Sinne eines imperativen Mandats jedenfalls in linken SPD-Kreisen und bei den GRÜNEN viel an Unterstützung erfahren hätten12. Doch, wie wir alle wissen: das blieb Episode. So wirkt das Buch möglicherweise heute sogar frischer als in den ersten Jahren nach seiner Publikation. Was können wir von ihm außer der historischen Belehrung über die frühe Ausprägung repräsentativer Versammlungen im hochmittelalterlichen England und der Aufklärung über die verfehlten Repräsentationsvorstellungen von Carl Schmitt und Gerhard Leibholz noch entnehmen? Was hat es uns Bleibendes zu sagen?
Das Buch zeichnet sich durch drei Stärken aus: eine methodologische, eine historische und eine politikwissenschaftliche. Die methodologische Stärke besteht im nachdrücklichen Insistieren des Autors darauf, daß Normen immer in den Kontext der sozialen Beziehungen und politischen Voraussetzungen ihrer Ausübung und Handhabung gestellt werden müssen. Das schützt vor bloßer Wesens-Schau und rein begrifflichen Entgegensetzungen, wie sie für Carl Schmitt und Gerhard Leibholz typisch sind. Die historische Stärke zeigt sich an der Gründlichkeit und Intensität, mit der der Autor die Verfassungsentwicklung namentlich in England und Frankreich nachzeichnet. Hier kann er dann mit großer Überzeugungskraft nachweisen, daß die gängigen Periodisierungen „vom imperativen zum freien Mandat“ schlicht und ergreifend nicht zutreffen, sondern die Problemlage sich von Beginn an bei der Einrichtung repräsentativer Versammlungen stellt. Dabei fällt die Antwort in England aufgrund der unterschiedlichen politisch-sozialen Umstände anders aus als in Frankreich. Schließlich ist die Studie politikwissenschaftlich stark, weil sie (was gerade im Fazit des Schlußkapitels deutlich wird) das Blatt nicht überreizt, also das freie Mandat nicht in den höchsten Tönen feiert, sondern auf die notwendigen Rückkopplungsprozesse verweist, die es gerade im modernen Parteienstaat gibt und geben muß.
Es sind diese drei sich wechselseitig verstärkenden Vorzüge des Werkes, die es zu einem dauerhaften Erfolg haben werden lassen. Es schützt vor begriffsgeschichtlichen Illusionen, steht fest auf historischer Grundlage, vertieft den Sinn für Wert und Funktion des freien Mandats und ist nicht zuletzt frei von dessen idealistischer Überhöhung. Angesichts einer Situation, in der auch und gerade in einigen westlichen Demokratien die Tendenz besteht, gewählte Abgeordnete nicht als die wahren Repräsentanten oder nicht als die Repräsentanten des wahren Volkes anzuerkennen, sondern in welcher Gestalt auch immer Identitätspolitik zu betreiben, sind diese Grundeinsichten ein bleibender Gewinn, der nicht verspielt werden sollte.
1Klaus Grimmer, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 1968, S. 119 f. (120); dort noch das Lob der „Prägnanz des sprachlichen Ausdrucks“.
2Udo Bermbach, Repräsentation, imperatives Mandat und Recall: Zur Frage der Demokratisierung im Parteienstaat, in: Theory and Politics. Festschrift zum 70. Geburtstag für Carl Joachim Friedrich, Haag 1971, S. 497 ff. (517 Fn. 88).
3Martin Stock, in: Der Staat 8 (1969), S. 109 ff. (109). Lobend auch die (ansonsten allerdings seltsame) Rezension von Fritz Morstein Marx, in: JZ 1968, S. 198.
4 Der SPIEGEL v. 25.6.1973 („Der Abgeordnete hat sich zu unterwerfen“) und v. 4.4.1983 („Die Angst der Grünen vor Amt und Macht. Sind imperatives Mandat und Rotation verfassungswidrig?“).
5Helmut Quaritsch, Staat und Souveränität, Frankfurt/M. 1970, S. 170 Fn. 549; S. 437; S. 456 Fn. 250a; S. 466 Fn. 293.
6Hasso Hofmann, Repräsentation. Studien zur Wort- und Begriffsgeschichte von der Antike bis ins 19. Jahrhundert (1974), 4. Auflage mit einer neuen Einleitung, Berlin 2003, S. 22 Fn. 37.
7Hofmann, Repräsentation (Fn. 6), S. 340 Fn. 83; S. 362 Fn. 156.
8Florian Meinel, Selbstorganisation des parlamentarischen Regierungssystems, Tübingen 2019, S. 5 Fn. 16.
9Hans-Peter Schneider/Wolfgang Zeh (Hrsg.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis in der Bundesrepublik Deutschland. Ein Handbuch, Berlin–New York 1989; Martin Morlok/Utz Schliesky/Dieter Wiefelspütz (Hrsg.), Parlamentsrecht. Praxishandbuch, Baden-Baden 2016.
10Siehe Adalbert Podlech, Art. Repräsentation, in: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, herausgegeben von Otto Brunner, Werner Conze und Reinhart Koselleck, Bd. 5, Stuttgart 1984, S. 509 ff.
11Etwa Martin Kriele, Das demokratische Prinzip im Grundgesetz, VVDStRL 29 (1971), S. 46 ff. (70 mit Fn. 73) sowie aus jüngerer Zeit Andreas Kley, Kontexte der Demokratie, VVDStRL 77 (2018), S. 125 ff. (148 f. mit Fn. 91).
12Illustrativ die beiden Beiträge im SPIEGEL von 1973 und 1983 (Fn. 4).
EINLEITUNG
Kaum eine Vorschrift des Bonner Grundgesetzes scheint in einem auffälligeren Mißverhältnis zur Welt der Tatsachen zu stehen, als Artikel 38 Absatz 1 Satz 2, der von den Abgeordneten des Bundestages verlangt, sie sollten
„Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen“
sein. Denn in der Regel sind alle Abgeordneten Mitglieder von Parteien; das geschlossene Abstimmen nach Fraktionen oder gar Koalitionen läßt für ihren Individualismus nicht viel Raum.
Auf der anderen Seite ist schwer zu verstehen, wie das parlamentarische System funktionieren könnte, wenn dieser Individualismus nicht hinter verhältnismäßig festen Kooperationsformen zurücktreten würde. Sollen wir unter diesen Umständen annehmen, die Rechtsnorm sei durch die Kraft der Fakten derogiert worden; oder sollen wir umgekehrt versuchen, der durch die Fakten bedrohten Norm wieder Geltung zu verschaffen?
Die traditionelle Auslegung des freien und imperativen Mandats führt in diese Alternative. Wir zeichnen die Diskussion und ihre inneren Widersprüche nach und kritisieren vor allem die Lehren, die Carl Schmitt und Gerhard Leibholz von der Repräsentation des Volkes und von dem Gegenmodell, der Identität von Herrschern und Beherrschten in der unmittelbaren Demokratie, entwickelt haben und die sich trotz ihrer ganz gegensätzlichen Konsequenzen in den Ansätzen ähneln; allerdings verdanken wir diesen nach vielen Seiten hin durchdachten Theorien, daß sie den eigenen Entwurf erst hervorgerufen und denkbar gemacht haben.
Wir beschränken uns aber nicht auf immanente Kritik, sondern suchen einen anderen Zugang zu den Fragen. Zunächst skizzieren wir rechtsvergleichend, ohne Vollständigkeit anzustreben, das außerordentlich umfangreiche normative Material, um hinter dem Wortlaut der Normen die gesellschaftlichen Probleme aufzufinden. Dabei zeigt sich, daß dieses Material und seine traditionelle Interpretation auf ganz verschiedenen Ebenen liegen. Verfassungsgeschichtliche und rechtssoziologische Überlegungen führen uns zu den typischen organisatorischen Konstellationen, die den rechtlichen Konzeptionen eines imperativen oder eines freien Mandats zugrunde liegen.
Wir kommen zu dem Ergebnis, daß der Widerspruch, der nach der Verfassungslehre zwischen der Norm vom freien Abgeordnetenmandat und der Wirklichkeit der modernen Parlamentsverfassung bestehen soll, nur ein Scheingegensatz ist, der sich aus einer theoretisch nicht genügend fundierten Begriffsbildung ergibt. Wir halten das repräsentative Prinzip der Instruktionsfreiheit für ein rechtliches Konstruktionsmittel, dessen organisatorischen Wirkungen sich gleichen, auch wenn die Verfassungen, in die es eingefügt ist, verschieden sind oder sich wandeln. Das freie Mandat soll nicht eine bloße Modalität der Stellung von Abgeordneten repräsentativer Versammlungen verbürgen, sondern ist notwendige Voraussetzung jeder politisch führenden, beschließenden Versammlung.
Urteile über Tatsachen und Aussagen über den Inhalt von Rechtssätzen lassen sich logisch nicht aufeinander zurückführen. Wir gehen den methodischen Fragen, wie sich Seinsurteile und Sollensgebote zueinander verhalten, nicht weiter nach, können aber aus den empirischen Überlegungen eine Reihe von unmittelbaren Konsequenzen auf die staatsrechtliche Auslegung der Verfassungsnorm vom freien Mandat ziehen. Rechtsnormen können nicht nur — gewissermaßen von außen — als Faktoren des gesellschaftlichen Lebens betrachtet werden; in die rechtlichen Tatbestände und Konstruktionen selbst gehen Urteile über Tatsachen ein, die — anders als die voluntativen Elemente der Normen — falsch und richtig sein können. Wir beschränken uns darauf, solche Rechtstatsachen im Sinne Arthur Nußbaums zu ermitteln und glauben, daß einige juristische Konstruktionen zur Auslegung des freien Mandats auf unrichtigen Tatsachenbehauptungen beruhen.
Den neuen Zugang haben wir in der Souveränitätslehre Hermann Hellers und in den Überlegungen Martin Draths über die Bedeutung des freien Mandats für den Frühkonstitutionalismus sowie über den soziologischen Gegensatz einer traditionalen und einer dynamischen Rechtsordnung gefunden. Eduard Albrecht hatte in seiner berühmten Rezensionsabhandlung aus dem Jahre 1837 von den Ständen der deutschen Territorien gesagt, ihnen sei die allgemeine Gesetzgebung, soweit sie ihre Privilegien unberührt ließ, gleichgültig gewesen. Traf dies zu, so konnte man fragen, ob mit der parlamentarischen Gesetzgebung lediglich die bisherigen legislativen Befugnisse des Monarchen auf repräsentative Versammlungen übergehen sollten oder ob mit repräsentativen Versammlungen universelle Regelungskompetenzen, die sich gegen Privilegien, lokale Gewohnheit und das gute alte Recht des traditionalen Denkens durchsetzten, überhaupt erst geschaffen wurden. In diesem Falle hätte das freie Mandat mit der Entstehung ganz neuer gesellschaftlicher Funktionen erklärt werden müssen.
Der heutige Stand der historischen Forschung macht es möglich, das freie Mandat der Französischen Revolution stärker als bisher in den Zusammenhang der Entwicklung repräsentativer Versammlungen zu stellen. Ulrich Scheuner hat auf diese neuere Literatur hingewiesen,1 die in der deutschen Staatstheorie völlig vernachlässigt wird und die den bisher üblichen Versuchen den Boden entzieht, das Modell des modernen Staates am Phänomen des Absolutismus zu entwickeln. Sie läßt vielmehr die Kompetenz des englischen king in parliament2 bereits im Spätmittelalter als wirksamer und umfassender erscheinen, als die der absoluten Monarchen Frankreichs der Renaissancezeit, die auf den Weg der einseitigen Steigerung der fürstlichen Prärogative nicht zuletzt deshalb gedrängt wurden, weil ihre Versuche, mit Hilfe einer nationalen Repräsentativversammlung zu herrschen, gescheitert waren. Während das freie Mandat bisher nur wegen der durch die Französische Revolution ausgelösten Verfassungsentwicklung in das Bewußtsein der Staatslehre getreten war, verliert es in der historisch erweiterten Perspektive den Charakter, ein Phänomen des modernen Konstitutionalismus zu sein; es erscheint vielmehr als ein Kennzeichen funktionierender Repräsentativverfassungen schlechthin.
Die Arbeit hat, weil sie an organisatorischen Bedingungen repräsentativer Versammlungen interessiert ist, eine soziologische, keine historische Fragestellung. Die historischen Überlegungen nehmen zwar einen breiten Raum ein, sie sollen aber nur dem Versuch dienen, zu differenzieren, an welchen Punkten eine soziale Einrichtung von kontingenten Faktoren abhängt und an welchen Punkten sie aus gesellschaftlich verfestigten Bedingungen reproduziert wird.
Bei der Lösung der aufgeworfenen Fragen haben wir vor allem auf die Studien zurückgreifen können, die seit 1937 der Commission internationale pour l’histoire des assemblées d’État vorgelegt worden sind.3 Unter den Autoren, denen wir besonders verpflichtet sind, möchten wir hier nur Helen Maud Cam, Gaines Post, James Russel Major und Owen Ulph hervorheben. Helmut K. J. Ridder hat diese Arbeit mit viel Geduld gefördert. Ich konnte die Thesen in seinem kritischen Seminar erproben und danke ihm für sein großes Verständnis und seine Ermutigungen. Für wichtige Hinweise und nicht zuletzt für kritische Einwendungen bin ich auch Ulrich Scheuner zu großem Dank verpflichtet. Teresa Pusylewitsch war so freundlich, einige Abschnitte aus den wichtigen Arbeiten von Konstanty Grzybowski und Marek Sobolewski zu übersetzen. Dem Council der Early English Text Society in Oxford habe ich für die freundliche Genehmigung zu danken, zwei Passagen aus Mum and the Sothsegger, bei deren Übertragung Heide Schmitt behilflich war, abdrucken zu dürfen.
Der Universität Bonn und der Stiftung Volkswagenwerk danke ich für finanzielle Hilfe, mit der sie das Erscheinen der Arbeit erleichtert haben.
1Cf. Ulrich Scheuner, „Das repräsentative Prinzip in der modernen Demokratie“, in: Verfassungsrecht und Verfassungswirklichkeit. Festschrift für Hans Huber, Bern 1961.
2Bertie Wilkinson hat gezeigt, daß die politische Basis dieser Formel aus der Tudor-Zeit schon im 13. Jahrhundert gelegt worden ist, Constitutional History of Medieval England, 1216-1399, II (1952), 4 f.
3Eine Bibliographie der Études présentées à la commission internationale pour l’histoire des assemblées d’État (jetzt: Studies Presented to the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions) bis zur Étude XXIV (1961) findet sich in: Album Helen Maud Cam, Louvain-Paris 1961, vol II.
Erstes Kapitel
VERFASSUNGSRECHTLICHE PROBLEMSTELLUNG
A. AUSLEGUNG DES FREIEN MANDATS
1.Die Interpretation der Abgeordnetenfreiheit
Die Norm vom freien Mandat hat eine Geschichte, die weit zurückreicht und eng mit dem Vorgang der Französischen Revolution verbunden ist. Dies ist unstrittig und allgemein bekannt; problematisch ist jedoch, was hieraus für die Staatsrechtswissenschaft folgt. Denn nach den Regeln der juristischen Hermeneutik, die grundsätzlich auch für die Interpretation von Verfassungsnormen gelten, ist die Auslegung an den Wortlaut einer Norm gebunden. Die objektive Theorie verlangt, daß sich die Norm von dem Willen derer, die sie gesetzt haben, löst und sich verselbständigt. Nur aus besonderem Grund ist es zulässig, auf die ursprünglichen Motive der an dem Normsetzungsverfahren beteiligten Personen zurückzugehen.
Diese Interpretationslehre ist nicht durch ihre Enge, sondern ihre Weite gekennzeichnet.1 Denn unter den Interessen derer, die der Norm unterworfen sind oder sie anwenden, kann sie unmerklich ganz verschiedene Inhalte annehmen, ohne die — vieldeutigen — hermeneutischen Kriterien zu verletzen. Wir beabsichtigen nicht, diese methodischen Fragen hier zu vertiefen, sondern gehen von der objektiven Theorie der Interpretation des Rechts aus, die mit gutem Grund die positive Rechtsordnung interpretationsfähig und damit wandlungsfähig hält.
Es ist deshalb von vornherein nicht zu beanstanden, wenn die Staatsrechtslehre gegenüber der Entwicklungsgeschichte des freien Mandats gleichgültig ist und die Rechtsnorm auf gesellschaftliche Probleme anwendet, die sich erst in unserer Zeit stellen. Aber sie darf sich nicht in innere Widersprüche verwickeln, zu absurden Ergebnissen führen oder zufälligen und verdeckten Interessen dienstbar werden. Sofern darüber hinaus die Auslegung nur über komplizierte juristische Konstruktionen möglich ist, dürfen diese keine unzutreffenden Behauptungen über Tatsachen enthalten.
So garantiert es zwar nicht eine adäquate juristische Interpretation, widerspricht aber auch nicht den hermeneutischen Regeln, daß die traditionelle Auslegung des freien Mandats aus dem Instruktionsverbot ganz unspezifische, generelle Schlüsse zieht. Geht man von dem Wortlaut aus, so scheint es einzuleuchten, daß die Norm schlechthin jede Einschränkung der Unabhängigkeit eines Abgeordneten verbietet. So schreibt Gerhard Anschütz, die Tätigkeit eines Abgeordneten vollziehe sich „heute wie ehedem“ in „voller Unabhängigkeit gegenüber jedermann: gegenüber der Partei, Gesellschaftsklasse, Interessengruppe, der er angehört, namentlich auch gegenüber seinen Wählern“.2 In seinen „Willensentschlüssen bei Ausübung seines Amtes“ soll der Abgeordnete nach Julius Hatschek „durch niemanden kontrolliert und beeinflußt“ sein.3 Gerhard Leibholz erwartet von ihm die „Qualitäten eines Herren“, der seine Entscheidungen in „völliger Freiheit“ trifft.4 Heinrich Triepel verlangt, er solle „ohne Instruktion, ohne imperatives Mandat“ in die Versammlung kommen und „Herr seiner eigenen Meinung“ sein; es sei deshalb das beste, wenn er sich seine Meinung „erst bildet in der Beratschlagung mit den anderen“.5 Ganz entsprechend spricht Hans Kelsen unter der Herrschaft des freien Mandats von einem „rechtlich geradezu ausgeschlossenen“ Einfluß der Wähler auf die Funktion des Parlaments.6 Bei einer so allgemein verstandenen Unabhängigkeit kommt es auf Differenzierungen, etwa nach typischen Sachzusammenhängen, nicht mehr an. Es ist dann gleichgültig, von wem im Einzelfalle Bindungen ausgehen,7 wie intensiv sie sind8 oder welche soziale Richtung und Wirkung sie haben.9
2.Parteien und freies Mandat
Es ist aber auffällig und läßt Zweifel an der Uninteressiertheit dieser Generalisierung entstehen, daß die emphatische Verurteilung jeder Bindung sich faktisch nur gegen eine Abhängigkeit richtet. Die Wiederbelebung der bisher rein traditionell hingenommenen Norm fällt in Deutschland in die Zeit, in der die Parteien auf größeren Einfluß drängen. Heinrich Triepel gesteht auch ganz offen, daß er an die Norm des freien Mandats eine ganz konkrete politische Erwartung knüpft: der „deutsche Bürger der Biedermeierzeit“ habe die Parteien als eine „Gefahr für die Ruhe des Staates“ und das Parteiwesen als eine „moralische Verirrung“ betrachtet;10 da nun aber auch „die neuesten Verfassungen“ das imperative Mandat „klipp und klar“ ablehnten, könne der Parteienstaat, solange sich das „geschriebene Recht von dieser Linie nicht abdrängen“ lasse, eine „rechtliche Legitimität“ nicht erlangen.11 Die Norm vom freien Mandat wird auf diese Weise in eine Waffe umgeschmiedet, mit der die Staatsrechtslehre gegen die Demokratie ankämpfte.
Laband hatte seine parteifeindliche Auslegung des freien Mandats damit begründet, es wende sich gegen den „Partikularismus der Parteien und Fraktionen“, genauso, wie es sich früher gegen den „Partikularismus der Stände“ gerichtet habe.12 Diese volksetymologische Gleichsetzung von Partei mit pars13 fand ohne weiteres Zustimmung, weil die Staatsrechtslehre mit Hegel den Staat als das „allgemeine Interesse“ auffaßte, das die „besonderen Interessen“ zu erhalten habe14 und gleichzeitig die Plätze traditionell besetzte mit dem monarchischen Staat und einer unpolitischen Gesellschaft.15 Von diesem „Standpunkte einer monarchischen Staatsleitung“ aus hatte Bismarck versucht, die Parteien als „scharf charakterisierte wirtschaftlich-soziale Interessengemeinschaften”16 zu behandeln. Die „Zersplitterung und Kleinlichkeit“17 des deutschen Parteiwesens, die ein Argument gegen die Parteiregierung zu sein schien, war die Folge dieser Politik. Denn „ohne Verantwortung und daher ohne Integrationszwang“18 waren die Parteien nicht in der Lage, die auseinanderstrebenden Interessen zu politisieren und damit in eigener Verantwortung entscheidbar zu machen.19 Sogar Otto Hintze, der die Entwicklung zum Parlamentarismus eher hemmen als fördern wollte, erklärte die „Entartung des Parteiwesens“ ursächlich nicht mit zu großem Parteienfluß, sondern im Gegenteil damit, daß „der Einfluß des Parlaments auf die Regierung ein verhältnismäßig so geringer“ sei.20
Hinter der scheinbar uninteressierten juristischen Konstruktion des freien Mandats verbarg sich also eine politische Alternative:21 sollte es bei der „Unkontrolliertheit einer reinen Beamtenherrschaft”22 bleiben und der Obrigkeitsstaat aufrechterhalten werden, der die Fiktion der „Überparteilichkeit der Regierung“, wie es Radbruch einmal ausgedrückt hat, geradezu als „Lebenslüge”23 benötigte; oder sollte die parlamentarische Regierungsweise, die nur von politischen Parteien getragen sein konnte, voll entfaltet werden? Von der Stellung zu dieser Frage, die die Verfassung von Weimar allerdings schon entschieden hatte, hing es ab, ob der Rechtsbegriff des freien Mandats so konstruiert werden sollte, daß ihm Parteien nur entsprechen konnten, solange sie unverbindliche Einflußgruppen waren und nicht darauf ausgingen, Träger der politischen Entscheidungsgewalt zu werden.
Inzwischen ist der Kampf gegen die Parteien „endgültig verloren“.24 Die Norm vom freien Mandat, die mit parlamentarischer Parteienregierung als unvereinbar aufgefaßt wurde, steht im Bonner Grundgesetz neben einer Vorschrift, die den Parteienstaat legitimiert. Widerspricht sich damit aber die Verfassung nicht selbst?25 Und muß sich das freie Mandat nun auf die Verteidigungslinie zurückziehen, „gewisse äußerste Konsequenzen des Parteienstaates abzuwehren“?26
Die Norm vom freien Mandat war überfragt, wenn sie hierauf antworten sollte. Als historisches Produkt einer Zeit, in der auf dem Kontinent das Parteienproblem nicht erörtert wurde, konnte sie nur in ausdehnender Auslegung auf Parteien angewendet werden. Die juristische Hermeneutik leugnet nicht, daß sich der Bedeutungsgehalt von Rechtsnormen ändert; auffällig ist jedoch, daß die parteienfeindliche Auslegung unter den hermeneutischen Gesichtspunkten gar nicht diskutiert wurde.
Gegen eine ausdehnende Auslegung hätte sachlich der Einwand bestanden, das freie Mandat habe ursprünglich die Abhängigkeit der Abgeordneten von ihren Konstituenten beseitigen sollen. Eine Partei, die einen Abgeordneten nominiert, und eine Wählerversammlung, die ihn konstituiert, sind aber nicht dasselbe. Es hätte paradoxe Auswirkungen, würde man annehmen, sie unterlägen in beiden Fällen dem gleichen Instruktionsverbot. Denn wenn die Rechtsordnung die Abgeordneten von bindenden Weisungen ihrer Konstituenten befreit, ermöglicht sie damit, gegensätzliche Interessenstandpunkte politisch entscheidbar zu machen. Die Parteien, die diese Prozesse der politischen Vermittlung organisieren, werden insofern durch das freie Mandat gerade begünstigt. Sollte es nicht um solcher Chancen willen geschaffen worden sein?27
3.Fraktionsdisziplin und freies Mandat
Die traditionelle Auslegung, die sich an einem allgemeinen Begriff der Unabhängigkeit orientiert, hält auch Absprachen, die parlamentarische Fraktionen treffen, um die Gesetzgebungsarbeit zu planen, Kooperation zu ermöglichen und das Gewicht von Stimmen zu verstärken, für unvereinbar mit dem freien Mandat. Auch Fraktionsdisziplin verstößt nach dieser Auslegung gegen die „für die repräsentative Demokratie unverzichtbare Freiheit des Abgeordneten“ und ist daher sowohl „illegitim“ als auch „illegal“.28
In diesem Zusammenhang entfaltet jedoch die Klausel der Weimarer und Bonner Verfassung, nach der die Abgeordneten nur dem Gewissen unterworfen sind, ihre eigene Logik. Klar ist die Bestimmung — übereinstimmend mit älteren Verfassungstexten — in ihrem negativen Sinne: sie stellt von rechtlicher Verantwortlichkeit frei. Diese Wirkung deckt sich mit der Freistellung von Aufträgen und Weisungen. Sobald aber die Gewissensklausel einen positiven Sinn erhalten soll,29 werden Fragen aufgeworfen, die unentscheidbar sind. Denn wenn etwa die Zugehörigkeit eines Abgeordneten zu einer Partei mit seinem Gewissen vereinbar war, dann konnte er unter Umständen „um der Gesamtaufgabe der Partei willen“ das „Opfer seiner Überzeugung“ bringen und es gerade als „Gewissenspflicht“30 ansehen, sich im Einzelfall der Parteidisziplin zu unterwerfen. Wenn aber die inhaltliche Bestimmung des freien Mandats „allein im Gewissen feststellbar“31 ist, dann würde die Norm eine „zwar unbeweisbare, aber auch unwiderlegbare Überzeugung“32 zum Gegenstand haben, und so, auf bloße innere Motivation gerichtet, nicht praktikabel sein.
Wegen dieser Unentscheidbarkeit würde das freie Mandat die Fraktionsdisziplin erst dann erfassen können, wenn sich ein Abgeordneter offensichtlich „lediglich aus Furcht vor Sanktionsmitteln“ unterwirft.33 Eine solche Unterscheidung zwischen Fraktionsdisziplin und Fraktionszwang löst aber, wenn wir von den Schwierigkeiten, die Tatbestände abzugrenzen, einmal ganz absehen, das theoretische Problem nicht, ob die Norm vom freien Mandat es erlaubt, wenn Abgeordnete sich durch Fraktionsbeschlüsse binden lassen, oder ob sie diese Formen der Kooperation mißbilligt, als lex imperfecta aber nur nicht die Kraft hat, der Normverletzung durch rechtliche Sanktionen entgegenzuwirken.34 Noch weniger klärt sie, ob de lege ferenda die Unabhängigkeit der Abgeordneten vergrößert35 oder verringert36 werden soll.