
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Der neue Roman von Lieblingsautor Barry Jonsberg!
Jamie ist 16 Jahre alt und ein Mathe-Genie. Verblüffend logisch und ehrlich ist sein Blick auf seine eigene Familie – und darauf, dass da etwas schief läuft. Zum Beispiel bei Summerlee, seiner rebellischen älteren Schwester. Als die an ihrem 18. Geburtstag mehrere Millionen im Lotto gewinnt, sagt sie sich endgültig von der Familie los – und provoziert eine Kettenreaktion von Unheil. Jamies kleine Schwester Phoebe wird entführt und der Kidnapper verlangt zwei Millionen. Ausschließlich mit Jamie will er darüber verhandeln. Warum? Wieso weiß der Täter so viel über Jamie? Und weshalb fühlt sich das Ganze wie ein einziges Duell an, bei dem Jamies Kombinationsgabe auf eine tödliche Probe gestellt wird?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Barry Jonsberg
DAS IST KEIN
SPIEL
Thriller
Aus dem Englischen
von Ursula Höfker
Für Sonja und Kate Jonsberg
Prolog
Wolken teilen sich und Mondlicht stiehlt sich durch meine Vorhänge. Ein silberner Eindringling.
Ich sitze aufrecht im Bett und halte die Pistole in meiner rechten Hand. So habe ich die ganze Nacht gesessen. Das Kissen in meinem Rücken ist zerknautscht und mein Nacken schmerzt. Meine Hand tut weh, weil ich den Pistolengriff zu fest umklammert habe. Ich habe nicht geschlafen, auch wenn ich es anfangs noch versucht habe.
Jemanden zu erschießen, ist nicht einfach. Ich weiß das von meinen Recherchen. Zwei Seiten sind zu beachten – die physische und die psychologische. Die psychologische Seite stellt das offensichtlichste Problem dar. Es ist eine Sache, in einer Schießanlage auf Ziele zu schießen, und eine ganz andere, eine Pistole auf etwas aus Fleisch, Blut und Verstand zu richten. Logisch. Selbst wer Tiere jagt – also jemand, dem es Spaß macht, einem Schwein oder Känguru das Lebenslicht auszublasen –, findet, dass es etwas ganz anderes ist, auf einen Menschen zu schießen. Einem Menschen in die Augen zu schauen, die Waffe auf ihn zu richten und gleichmäßigen Druck auf den Abzug auszuüben in dem Wissen, dass es einen Punkt gibt, an dem der Hammer auf eine Zündspitze trifft, was Sprengstoff zur Explosion bringt und als Folge eine Patrone durch die Luft fliegen lässt. Es dauert weniger als eine Sekunde. Viel weniger als eine Sekunde vom Krümmen des Fingers bis zur Verletzung eines Körpers, wenn sich Metall durch Fleisch bohrt und alles auf seinem Weg zerstört. Alles ist Ursache und Wirkung. Aber diese Wirkung ist gigantisch, steht in keinem Verhältnis zur physikalischen Ursache. Minimaler Druck, zarter als eine Liebkosung. Leben ausgelöscht.
Ich habe noch nie eine geladene Waffe abgefeuert. Bis heute.
Dann ist da noch der physikalische Teil. Herbeiführung von Tod durch einen Schuss. Die meisten Menschen machen sich darüber keine Gedanken, weil es im Fernsehen so einfach aussieht. Im Fernsehen sieht alles einfach aus. Richtig ist sicher, dass es bei einem Gewehr mit einer größeren Reichweite anders wäre. Auch bei einer automatischen Waffe. Betätige den Abzug und Patronen strömen heraus. Zielt man mit der Waffe in die ungefähre Richtung des Objekts, kann man davon ausgehen, dass man Schaden anrichtet. Deshalb ist so ein Automatikteil die Waffe der Wahl für Psychopaten, deren Dämonen sie in Schulhäuser und Einkaufszentren führen.
Ich habe eine Handfeuerwaffe. Diese Dinger sind notorisch unpräzise, selbst wenn sie qualitativ hochwertig sind. Was meine vermutlich nicht ist.
Der Rückstoß einer Handfeuerwaffe bewegt den Lauf, was die Geschossbahn verändert. Nicht zu treffen, ist ganz einfach. Ohne Übung ist es tatsächlich viel einfacher, danebenzuschießen, als zu treffen. Ich habe keine Übung. Ich werde nah herangehen müssen. Nah genug, um zu sehen, wie die Augen sich weiten, und die Angst zu riechen. Nah und persönlich wird es werden. Während der Nacht war ich viele Stunden mit diesen Gedanken beschäftigt. Sie kreisen in meinem Kopf, summen wie Insekten.
Ich schwinge meine Beine über die Bettkante und lege die Pistole neben mich. Meine Hand ist steif. Ich hebe sie auf Augenhöhe und bewege die Finger, um die Muskeln zu lockern. Sie fühlt sich an wie eine Klaue – und genauso sieht sie auch aus.
Ich stehe auf, schleiche zum Fenster und ziehe die Vorhänge zurück. Ich kenne mein Zimmer, weiß, welche Dielen knarren, und kann mich geräuschlos bewegen. Ich schaue hinaus. Noch eine Stunde bis Sonnenaufgang. Am Horizont ist ein winziger, hingetuschter Streifen Orange zu erkennen. Darüber hockt eine einzelne Wolke. Ihre weißen Ränder gehen in die Schwärze der Nacht über. Zeit zu gehen. Noch nicht Zeit für meine Verabredung. Die ist erst in über drei Stunden. Dennoch ist es Zeit für mich aufzubrechen.
Bevor ich ins Bett ging, habe ich meine Kleider zurechtgelegt. Dunkle Jeans und ein schwarzes T-Shirt. Schwarze Turnschuhe. Ich komme mir vor wie ein wandelndes Klischee, ziehe die Sachen aber trotzdem an. Als ich mein T-Shirt über den Kopf streife, rieche ich mich. Ein scharfer, unangenehmer Geruch. Ich bin versucht, die Pistole hinten in den Bund meiner Jeans zu stecken, entscheide mich dann aber dafür, den Lauf so tief wie möglich in meine rechte Hosentasche zu schieben. Ich prüfe, ob die Waffe gesichert ist. Zum hundertsten Mal. Das ist auch so ein Bild. Die Pistole geht los und die Kugel fährt mir ins Bein. Das ist absurd genug, um passieren zu können.
Früher kam Summerlee, meine ältere Schwester, gewöhnlich morgens um drei oder vier nach Hause, stolperte die Treppe herauf und stieß dabei gegen alles Mögliche, doch Mom und Dad wachten nie auf. Sie lachte darüber. Ich war so zugedröhnt, dass ich kaum noch kriechen konnte, und sie haben einfach weitergeschlafen. Jetzt kann Dad nicht mehr schlafen. Wenn ich nachts meine Tür öffnen würde, stünde er sofort da, die Augen vor Angst geweitet und bleich wie der Tod. Sein Haar ist grau und wird von Stunde zu Stunde schütterer. Ich stelle ihn mir im Bett vor, halb sitzend wie ich die ganze Nacht. Er starrt ins Leere und spinnt Albträume daraus. Eine Hand zupft an der Bettdecke. Ich kann nicht durch die Tür verschwinden. Nicht nur wegen Dad, sondern auch wegen der beiden Polizisten im Wohnzimmer. Deshalb habe ich das Fenster die Nacht über offen gelassen. Einer der Gründe – nicht der Hauptgrund –, weshalb ich nicht geschlafen habe.
Der Rucksack liegt unter meinem Bett, das Seil an die Trageschlaufe geknüpft. Er ist schwer, und meine Muskeln verkrampfen sich, als ich ihn auf die Erde hinunterführe. Sobald ich das Gewicht nicht mehr spüre, lasse ich das Seil los. Dann schwinge ich ein Bein übers Fensterbrett und strecke die rechte Hand nach dem Regenrohr aus. Ich ziehe das andere Bein nach und sitze jetzt auf meinem Sims. Die schwere Pistole beult meine Tasche aus und ihr Gewicht stört. Mein Zimmer liegt im ersten Stock, deshalb das Regenrohr. Ich bin nicht sportlich. Es liegt nicht in meiner Natur, Regenrohre hinunterzurutschen, aber ich schaffe es, nicht abzustürzen. Ich bin erleichtert, es schon mal bis hierher geschafft zu haben, ohne jemanden aufzuwecken.
Ich stehe auf dem Rasen und blicke mich um. Büsche und Bäume bedrängen mich mit dunklen Schatten. Nichts ist vertraut. Ich löse das Seil vom Rucksack und setze ihn auf. Ich ziehe die Pistole aus der Tasche und stecke sie jetzt doch hinten in meine Jeans. Es ist Zeit zu gehen, aber etwas hält mich. Es ist wie beim Krümmen des Fingers am Abzug. Bewege ich mich von meinem Haus weg, mache ich den ersten Schritt meiner Reise, dann setze ich eine Folge von Ereignissen in Gang, die zum einen oder anderen Ergebnis führen. Ursache und Wirkung. Mich fröstelt, obwohl mir nicht kalt ist.
Irgendwo schreit eine Eule. Der Ton klingt traurig und dünn. Ich mache den ersten Schritt, und der zweite ist schon einfacher, der dritte noch einfacher. Mein Körper bewegt sich, und mein Kopf folgt unterwürfig, still und feige, froh, dass der Rhythmus der Muskeln das Kommando übernimmt und mich Sekunde um Sekunde welchem Ziel auch immer näher bringt.
Ich trete auf die Straße und wende mich nach rechts, halte mich an den aufgemalten unterbrochenen Mittelstreifen. Ringsherum ist es dunkel. Ringsherum ist es still, bis auf das leise Knautschgeräusch meiner Gummisohlen auf dem Asphalt.
Die Spieltheorie hat mich an diesen Punkt gebracht, und ich muss gehen, wohin sie mich führt.
Auch wenn das kein Spiel ist.
Teil Eins
Fünf Monate früher …
Kapitel 2
Summerlee, Jamie und Phoebe.
Vielleicht war es ein Insiderwitz meiner Eltern. Vielleicht gefielen ihnen aber auch nur Namen, die auf einen i-Laut enden. Aus welchem Grund auch immer sie uns so genannt hatten – ich fand’s bescheuert. Aber es lässt sich nichts mehr dagegen machen.
Phoebe liebt Mom und Dad. Ich ertrage sie. Summerlee verachtet sie. Funktioniert das immer so? Jemand hat mal gesagt, dass man seine Eltern anfangs liebt, dann rechnet man mit ihnen ab, und selten, wenn überhaupt, verzeiht man ihnen. Es klingt so clever, dass es wahr sein könnte. Aber es ist auch traurig. Ich will nicht, dass Phoebe aufwächst und sich von ihnen wegentwickelt. Auch nicht, dass sie sich von mir wegentwickelt. Nicht wegen der Gefühle meiner Eltern oder gar wegen meinen, aber in ihrer Liebe ist etwas Reines und Unschuldiges. Sie stellt keine Bedingungen und erwartet keine Enttäuschungen. An irgendeinem Punkt verändert sich das, und ich weiß nicht, warum.
Ich bin Mathematiker und Geschichten liegen mir nicht. Ich weiß nicht, wie ich diese Geschichte erzählen soll, denn Worte sind nicht meine Stärke. Und man braucht so viele davon, nur um eine einfache Wahrheit auszudrücken. Mathematik ist da anders. Nimm zum Beispiel E=mc 2 , die berühmteste Gleichung der Welt. Fünf Symbole, aber sie erzählen eine Geschichte des Universums und der Gesetze, die darin herrschen. Sie in Worten aufzuschreiben, hätte – hat – etliche Bücher gefüllt, und man hat doch nur an der Oberfläche gekratzt. Energie, Masse, die Geschwindigkeit des Lichts und in welchem Verhältnis sie zueinander stehen. Es ist die Geschichte von allem. Erzählt in fünf Symbolen. Wie wunderbar ist das denn?
Es gibt keine Symbole, die Summerlees Geschichte erzählen könnten, weshalb ich mich mit schwerfälligen Worten behelfen muss. Summerlee ist achtzehn und meine andere Schwester. Zwischen dreizehn und sechzehn sah sie wahnsinnig gut aus, aber das hat sich in den letzten zwei Jahren geändert. Sie hat sich zum Beispiel die Haare gefärbt. Ihr Haar ist von Natur aus dunkel, und wenn die Sonne darauf schien, glänzte und schimmerte es explosionsartig. Jetzt ist es mattblond, ohne Leben. Wie Stroh. Ihre Augen sind genauso. Natürlich nicht blond, aber von einem blassen Blau, das mit der Zeit immer blasser zu werden scheint. Manchmal glaube ich, dass sie sich als Person irgendwie auflöst – ihre Lebendigkeit, Persönlichkeit und Lebensfreude waren irgendeinem Element ausgesetzt, das alles abgeschält hat. Was noch übrig ist, ist hart und gleichzeitig spröde. Blass. Es ist, als beobachte man etwas, das in der Sonne vertrocknet und nach und nach stirbt.
Ich weiß nicht mehr, wann sie sich verändert hat. In meiner Erinnerung geschah es ganz plötzlich, aber es muss wohl doch allmählich gekommen sein. Ich erinnere mich an einen Vorfall, bei dem ich merkte, dass die Schwester, die ich kannte, mir irgendwie abhandengekommen war. Sie war in der zehnten Klasse, also ungefähr fünfzehn. Ich war an derselben Schule in der Achten. Wir saßen beim Frühstück, und ich futterte eine Schüssel Müsli, während Mom Phoebe für den Kindergarten fertig machte. Es war Routine. Dad war zu der Zeit gewöhnlich schon bei der Arbeit. Er kümmert sich um die Hypotheken anderer Leute, wozu anscheinend stundenlange Schreibtischarbeit gehört. Also war es Moms Job, drei Kinder zu verköstigen, zu kleiden, vorzeigbar zu machen und sie dann in ihre jeweiligen Lehranstalten zu bringen. Ich gehe davon aus, dass sich dasselbe Ritual gleichzeitig in vielen Familien im ganzen Land so abspielte. Und ich gehe auch davon aus, dass die Zeit für Mom ziemlich stressig war. Aber ich war in der achten Klasse. Der Stress anderer Leute, besonders der meiner Eltern, war mir egal.
Phoebe packte Sachen in ihren kleinen Schulranzen – der Himmel weiß, was man für die Vorschule braucht, aber sie nahm das alles sehr ernst. Ich hatte den Kopf in der Müslischüssel. Mom flitzte wie üblich herum.
»Wo ist deine Schwester?«, fragte sie mich.
Ich zuckte mit den Schultern. Nicht meine Verantwortung. »Wahrscheinlich noch im Bett«, antwortete ich.
»Verflixt noch mal«, murmelte sie. »Ruf sie bitte, ja?«
»Ich frühstücke«, bemerkte ich. Wahrscheinlich deutete ich sogar noch auf meine Müslischüssel als unwiderlegbaren Beweis.
Mom hielt eine Sekunde lang inne und schaute mich an. Sie wog Entscheidungen gegeneinander ab. Sich mit mir anlegen und einen weiteren Konflikt heraufbeschwören? Zu anstrengend. Also den Weg des geringsten Widerstands gehen. »Dann pass auf den Toast auf, Jamie. Kannst du das für mich tun?«
»Klar.« Darauf aufzupassen, erforderte nicht viel Energie.
Mum lief zur Treppe und brüllte hinauf: »Summerlee! Aufstehen. Sofort. Du kommst zu spät.«
Mom kehrte in dem Moment zurück, als der Toast nach oben ploppte, was mir sehr gelegen kam. Ein Job weniger. Ich widmete mich wieder meinem Müsli, während Mom den Toast mit Margarine bestrich. Sie tat es mit geübter Effizienz. Ich aß bedächtig einen Löffel Müsli. Phoebe packte ihren Ranzen aus und begann ihn wieder neu zu packen. Sie war schon immer pingelig, praktisch seit ihrer Geburt. Alles musste genau so sein, wie sie es richtig fand. Ich leerte meine Schüssel und stellte sie in die Spüle. Mom hatte versucht, mich zum Abspülen zu bringen, sobald ich fertig war, doch ich drückte mich davor, wann immer es ging.
Mom schmierte Brote für uns alle. Sie musste unterschiedliche Stapel machen, weil wir alle unterschiedliche Vorlieben hatten. Phoebe stand auf Vegemite, doch das Brot durfte nur hauchdünn mit der Hefepaste bestrichen sein. Manchmal war es schwer zu sagen, ob überhaupt etwas drauf war. Wahrscheinlich funktionierte es am besten, wenn man das Glas einige Male über dem Brot hin und her schwenkte und ein paar Moleküle hinunterschweben ließ. Ich mochte Käse und Tomaten. Zumindest hatte ich Mom gesagt, dass ich Käse und Tomaten mochte, aber meistens warf ich das Sandwich in der Schule in einen Mülleimer und kaufte mir in der Cafeteria einen Hotdog – jedenfalls immer dann, wenn ich es mir leisten konnte. Das tut mir jetzt leid. Damals tat es das nicht. Bei Summerlee musste es etwas mit Wurst sein, vorzugsweise Salami.
Mom schnitt ab, belegte und wickelte ein. Sie legte die Sandwiches in drei unterschiedliche Dosen und packte in jede noch einen Müsliriegel und einen Apfel. Den Apfel schmiss ich immer weg. Dann lief sie wieder zur Treppe.
»Summerlee! Du liebe Güte. Wir fahren in zehn Minuten. Komm endlich runter!«
Von oben kam eine genuschelte Antwort, gefolgt von beträchtlichem Gestampfe und dem Geräusch von zerbrechendem Glas.
»Summerlee!«, brüllte Mom.
Was dann geschah, war nicht schön. Im Gegenteil, es war eines der hässlichsten Dinge, die ich je erlebt habe, und ich habe einige erlebt. Das Gestampfe wurde lauter, dann kam ein Mädchen die Treppe herunter. Kam gewalttätig die Treppe herunter. Phoebe hielt beim Ranzenpacken inne. Ich hielt, bei was immer ich gerade tat – wahrscheinlich nichts –, inne. Wir schauten zur Küchentür. Eine Art Energie näherte sich. Ich spürte sie auf meiner Haut und das Gefühl war hypnotisch.
Als sie ungefähr dreizehn war, entdeckte Summerlee irgendwann die Macht des V-Wortes. Damit war sie nicht allein. Von uns anderen unterschied sie sich dadurch, dass sie kapierte, dass Sanktionen gegen das Wort grundsätzlich Unsinn waren. Oder anders herum: Die meisten von uns wussten, dass fluchen unsozial war, dass es die Leute aufregte und man es deshalb am besten nur im Kreis seiner Freunde tat. Bei meinen Freunden fluchte ich ständig. Es war ein Merkmal für Mut, eine Eintrittskarte in einen exklusiven Klub, eine Art Pass zum Erwachsenwerden. Aber nicht einmal in meinen kühnsten Träumen hätte ich es zum Beispiel einem Lehrer gegenüber getan. Oder meinen Eltern gegenüber. Nicht aus Angst vor körperlicher Strafe. Was konnten sie einem schon tun? Sondern weil ich ihr Zartgefühl nicht verletzen und mir ihre gute Meinung von mir nicht verscherzen wollte. Das war – und ist – mir immer noch wichtig. Summerlee legte sich solche Beschränkungen nicht auf. Es kümmerte sie ganz einfach nicht. Und so war sie etwas Elementares, als sie in der Küchentür erschien, das Haar zerzaust und in einer lächerlichen Unterwäsche, die sich als Nachthemd ausgab. Eine feindselige Aura umgab sie.
»Ich bin verdammt noch mal krank«, schrie sie. »Warum lässt du mich verdammt noch mal nicht in Ruhe?«
Mom hatte sie natürlich schon öfter fluchen hören. Es gefiel ihr nicht, aber was sie auch sagte oder tat, es machte nicht den geringsten Unterschied. Dad ignorierte es einfach, wie er die meisten Dinge ignorierte, aus denen Konflikte resultieren konnten. Hypotheken schrien nicht, was ihm sehr entgegenkam. Inzwischen versuchte auch Mom die Flucherei zu ignorieren, als würde sie dadurch von allein aufhören. Als Taktik war das zum Scheitern verurteilt.
»Du bist nicht krank, Summerlee«, erwiderte sie. »Und du gehst auf jeden Fall in die Schule.«
Einer der Gründe, weshalb ich auch in Gesellschaft meiner Freunde nicht mehr so viel fluchte, war, dass es mit der Zeit langweilig wurde. Schlimmer, es wirkte in Wahrheit nicht wie eine Imitation des Erwachsenseins, sondern eher wie ein permanentes Sinnbild der Kindheit. Ich wiederhole deshalb nicht wortgetreu, was Summerlee darauf erwiderte. Der Hinweis möge genügen, dass sie keinen Satz, ich glaube nicht einmal ein Satzglied von sich gab, in dem kein Kraftausdruck vorkam. Sie erklärte Mom, dass die Schule Zeitverschwendung sei und sie nicht mehr hinginge. Des Weiteren informierte sie meine Mutter, dass sie selbst an den Tagen, an denen sie bis zum Eingang gegangen war, geschwänzt hatte. Der Stundenplan sei so bescheuert wie sinnlos und habe nichts mit der realen Welt zu tun. Was könne man schon mit Geschichte, blöden Kurzgeschichten oder Algebra anfangen? Die Lehrer seien alle Loser. Die Schule als solche sei zum Kotzen. Sie würde abgehen und niemand könne sie daran hindern. Niemand könne sie zwingen zu bleiben.
Mir ist bewusst, dass diese Auflistung von Argumenten gar nicht so dramatisch klingt. Im Lauf der Jahre hatte ich viele davon selbst vorgebracht. Es war die Art und Weise, wie Summerlee sie vorbrachte. Selbst ohne die Kraftausdrücke war das Gift in ihren Bemerkungen nicht zu überhören. Als zapfe sie ein gewaltiges Reservoir an Wut an. Und nachdem es einmal angezapft war, ließ es sich nicht mehr verschließen. Es strömte aus ihr heraus, eine Flut von Hass. Sie brach über uns herein.
Phoebe verließ den Raum nach einer Minute. Ich sah Tränen in ihren Augen. Wie Dad hasste sie Konflikte und lief vor ihnen davon, wann immer das möglich war. Ich hätte ebenfalls gehen sollen, doch ich war wie gelähmt. Erst später überlegte ich mir, dass mein Dabeistehen und Mitbekommen eine weitere Demütigung für meine Mutter gewesen war, dass es sie geschmerzt haben muss, zu wissen, dass ihr Sohn Zeuge ihrer Machtlosigkeit war. Aber es ist schwer, vor einer unabwendbaren Katastrophe davonzulaufen. Und das war eine unabwendbare Katastrophe.
Als Summerlee ihren Zorn abgelassen hatte, stürmte sie wieder die Treppe hinauf. Ich beobachtete Mom während der Nachwirkungen des Unwetters. Sie hatte keine Chance gehabt, auch nur ein Wort dazu zu sagen. Sie fuhr sich über die Stirn und wandte sich wieder ihrem Schneidbrett zu. Nahm Summerlees Frühstücksdose und stellte sie in den Kühlschrank. Das war das Traurigste, was ich sie je habe tun sehen, ich schwör’s. Dann schob sie mich und Phoebe rasch zum Wagen.
Sie fuhr schweigend zum Kindergarten, begleitete Phoebe bis zur Tür und küsste sie zum Abschied. Dann ging’s zu meiner Schule. Sie hütete sich, mich zu küssen, und winkte nur durchs Wagenfenster, als ich mich auf dem Hof zu meinen Kumpels stellte. Ich winkte zurück, in dieser verlegenen Art, die charakteristisch ist für einen Achtklässler. Dann wandte ich mich ab. Einer der Jungs wollte mir etwas zeigen, keine Ahnung mehr, was es war. Ich vergaß Mom, sah sie nicht davonfahren in ihre Welt. Ich hatte meine eigene Welt und sie verlangte meine gesamte Aufmerksamkeit.
Im Rückblick weiß ich, was ich hätte tun sollen. Ich hätte reden sollen, sie in den Arm nehmen, ihr sagen, dass ich sie lieb habe und dass alles wieder gut würde. Selbst wenn es nicht wieder gut würde. Mom und Dad kamen mit unserer Kindheit gut zurecht. Sie machten alles richtig, lasen uns Gutenachtgeschichten vor, tupften unsere Stirnen ab, wenn wir krank waren, beschützten uns vor allem und jedem und umgaben uns mit bedingungsloser Liebe. Die Probleme kamen mit der Jugend, als ihre süßen Kinder eine Metamorphose durchmachten und als Fremde daraus hervorgingen. Und eine dieser Fremden war voller Hass. Der andere war einfach nur distanziert. Dad zog sich zurück, verschanzte sich hinter seiner Arbeit. Mom war verwirrt, verletzt und machtlos. Ich hätte ihr vielleicht helfen können. Ich tat es nicht.
Summerlee ging nicht mehr zur Schule, zumindest nicht mehr richtig. Sie tauchte nach Lust und Laune zu einigen Stunden auf, bekam Probleme wegen ihres Verhaltens und wurde unzählige Male vom Unterricht ausgeschlossen. Mir kam das absolut bescheuert vor, weil sie ohnehin nur noch an zwanzig Prozent des Unterrichts teilnahm und der Ausschluss ganz offensichtlich keine Strafe für sie war. Schließlich fand sie einen Job in einem der Supermärkte in unserer Nähe, wo sie Regale einräumte. Natürlich hasste sie es und hielt es für unter ihrer Würde. Ihre direkte Vorgesetzte war, wie wir mitbekamen, ein Pestzecke.
Dann traf sie Spider und mit ihm gingen die Probleme erst richtig los.
Kapitel 3
Das ist der springende Punkt.
Greift man Höhepunkte oder auch Tiefpunkte aus Summerlees Verhalten heraus, ergibt das eine Geschichte, aber es ergibt nicht die ganze Geschichte. Von ihren achtzehn Jahren können drei oder vier nicht wirklich die Person widerspiegeln, die sie ist. Unter dem Gesichtspiercing, dem einen sichtbaren Tattoo, den gefärbten Haaren und dem kompromisslosen Make-up liegt ein Kern des Mädchens, das sie war, und der Erwachsenen, die sie immer noch sein kann. Summerlee ist ganz Äußerlichkeiten, doch gelegentlich verbirgt sie sich hinter diesen Äußerlichkeiten; sie sind eine Maske, die sie nicht immer überzeugend trägt.
Deshalb ist hier eine andere Geschichte. Sie liegt erst sechs Monate zurück und stellt vielleicht einen Ausgleich her.
Phoebe machte in der Grundschule bei einer Tanzdarbietung mit. Die war Teil einer größeren Veranstaltung aus Anlass des fünfundzwanzigsten Jubiläums der Schule. Eltern und sogenannte Würdenträger waren an einem Freitagnachmittag zu Getränken, Snacks und einer Demonstration der an der Schule geförderten Talente eingeladen. Es war eine große Sache und Phoebe liebte große Sachen. Sie war fast krank vor Lampenfieber. Wann immer wir uns zum Essen an den Tisch setzten, gab sie Geschichten über die Proben zum Besten, darüber, was die Lehrerin zur Aufführung gesagt hatte und welche Fehler die Truppe verzweifelt auszumerzen versuchte. Hinter all dem nervösen Geplapper verbarg sich zweifellos Panik vor der bevorstehenden Feuerprobe. Phoebe wollte nicht patzen, hatte aber entsetzliche Angst, doch Fehler zu machen. Also tat sie, was sie immer tat, wenn sie nervös war. Sie arbeitete fieberhaft. Sie war überzeugt, dass Katastrophen abgewendet werden konnten, wenn man nur genügend Schweiß vergoss.
Ich war auch einmal davon überzeugt. Jetzt weiß ich es besser.
Zu Phoebes wilder Entschlossenheit, ein spektakuläres Scheitern zu vermeiden, gehörten ständige private Proben in unserem Wohnzimmer, sobald sie mit den Hausaufgaben fertig war. Ich schaute manchmal zu und murmelte gelegentlich ein Lob. Aber es gibt Kinder, die kann man nicht täuschen, und Phoebe konnte man nie täuschen. Sie begriff, dass ich ihr emotionale Unterstützung bot, aber sie wollte mehr. Sie brauchte Hilfe.
Und die gab ihr Summerlee.
Sie schaute Phoebe stundenlang zu und sagte ihr nicht einfach, sie sei gut, wenn sie es nicht war. Ich tat das die ganze Zeit, vor allem weil Phoebe selbst für mein ungeübtes Auge nicht gut war. So hatte sie zum Beispiel kein Rhythmusgefühl. Sie stellte die Musik an – Phoebe hatte Mom dazu überredet, ihr die CD mit der Musik zu kaufen, nach der sie in der Schule tanzten – und tanzte dann das Stück ein ums andere Mal durch. Ich versuchte ihr klarzumachen, dass sie andere Kinder dazu brauchte, dass allein zu tanzen nicht viel brachte, weil sie sich nicht nach den anderen richten konnte. Phoebe verstand das zwar und gab mir recht, doch um sich selbst machte sie sich eben die meisten Sorgen. Sie fürchtete, sie könnte den Erfolg der ganzen Truppe verderben, und alles, was sie im Vorhinein tun konnte, würde helfen, diese Schmach zu verhindern. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das funktionierte. Phoebe wurde nicht besser, wie sehr sie sich auch anstrengte. Da ich selbst zwei linke Füße habe, verstand ich das. Wenn man für irgendetwas einfach von Natur aus total unbegabt ist, wird man auch durch noch so viel Üben nicht wirklich besser. Phoebe versuchte ihren Körper zu zwingen, die richtigen Bewegungen zu machen, anstatt sich auf ein natürliches Rhythmusgefühl zu verlassen, das sie einfach nicht besaß. Es half alles nichts, Phoebe tanzte einfach grottenschlecht.
»Du machst diesen Seitwärtsschritt falsch«, sagte Summerlee. »Du musst zwei Schritte machen, so.« Sie zeigte es ihr. Summerlee hatte ein natürliches Rhythmusgefühl. »Siehst du? Geh mit dem Takt. Im Moment bist du aus dem Takt. Hör auf die Musik, Mäuschen, und lass deinen Körper darauf reagieren.«
Phoebe versuchte es erneut. Ich konnte keinerlei Verbesserung feststellen, aber Summerlee nickte.
»Schon besser«, sagte sie. »Mach’s noch mal und denk an deine Arme. Du konzentrierst dich so sehr auf deine Füße, dass du alles andere darüber vergisst.«
Ich ließ sie allein. Wenn ich ehrlich bin, interessierte es mich nicht sonderlich, und außerdem fühlte ich mich ohnehin wie das fünfte Rad am Wagen. Aber sie gaben nicht auf. Als ich eineinhalb Stunden später aus meinem Zimmer kam, hörte ich sie durch die Tür.
»Vergiss deine Arme nicht, Mäuschen«, sagte Summerlee. »Denk an deine Arme und hör auf die Musik …« Sie brachte ihrer Schwester gegenüber eine Geduld auf, die sie für mich nie übrig gehabt hatte.
Am Tag der Veranstaltung war Phoebe lächerlich früh auf den Beinen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie überhaupt geschlafen hat. Als ich zum Frühstück nach unten ging, probierte sie gerade in der Küche ihr Kostüm an.
»Hallo, Dumpfbacke«, begrüßte ich sie. »Dein großer Tag heute, was?«
Phoebe runzelte die Stirn. »Wirkt mein Hintern darin dick, Jamie?«, fragte sie. »Aber sei ehrlich.«
Gut, dass ich gleich nach dem Aufwachen gepinkelt hatte, sonst hätte ich mir womöglich auf der Stelle ins Hemd gemacht. Aber ich hütete mich zu lachen. Phoebe hätte mich mit einem Blick einen Kopf kürzer gemacht. Dafür gibt es in unserer Familie ein Gen, aber es beschränkt sich auf die weibliche Seite. Deshalb legte ich einen Finger an die Lippen und betrachtete sie vollkommen ernst von oben bis unten.
»Dreh dich um«, verlangte ich.
Die Kostümteile passten zusammen wie die Faust aufs Auge. Sie trug ein enges Top, das ein bisschen aussah wie ein Unterhemd aus einem elastanähnlichen Material. Es war grellgrün und voller Glitzerpunkte. Im Grunde war das gesamte Kostüm voller Glitzerpunkte. Ein kurzer, gerüschter Rock in Gold und rote Strumpfhosen machten das Outfit komplett. Keine Ahnung, was es darstellen sollte, aber es war total geschmacklos. Phoebe drehte sich einmal um die eigene Achse. Sie war spindeldürr wie so viele in ihrem Alter, die Brust ein schmales Brett, Beine wie Bambusstangen. Ihren Hintern sah man kaum, so klein war er.
»Nö, alles gut«, urteilte ich nach einer angemessenen Pause. »Du siehst echt super aus.«
»Danke. Ich gehe nur noch mal ins Wohnzimmer und übe ein letztes Mal.«
»Stell die Musik nicht zu laut«, warnte ich. »Sonst weckst du Summer, und die sorgt dafür, dass du es dein Leben lang bereust.«
»Okay.«
Ich frühstückte zu gedämpfter, schlechter Tanzmusik. Ich gebe zu, ich war ein wenig besorgt. Diese Aufführung war so wichtig für Phoebe, und ich hatte den leisen Verdacht, dass sie in einer Katastrophe enden würde.
Dad konnte sich auf der Arbeit nicht freinehmen, obwohl er gesagt hatte, er würde es versuchen. Aber Summer hatte ihre Schicht im Supermarkt getauscht, und Mom holte mich direkt nach der letzten Stunde ab, sodass wir uns alle in Phoebes Schule trafen. Da war die Hölle los. Natürlich waren Hunderte von Eltern da, aber sie hatten auch diverse wichtige Leute angeschleppt, darunter den Bürgermeister, ein paar Mitglieder des Stadtparlaments und sogar eine ehemalige Schülerin, die vor zwei Jahren in die Endausscheidung von Australia’s Got Talent gekommen war. Sie war ziemlich früh ausgeschieden, trotzdem war sie das, was einer Berühmtheit in unserer Gegend am nächsten kam. Ein paar der kleineren Kinder schwirrten um sie herum und versuchten ihr ein Autogramm abzuluchsen. Sie hatten keine Ahnung, wer sie war, aber es war eine Art Hysterie ausgebrochen.
Knirpse in Schuluniform führten sämtliche Gäste in die Aula, wo wir unsere Plätze einnahmen. Erster Programmpunkt war die Talentshow-Finalistin, die die Nationalhymne sang. Schlecht. Es folgte eine Ansprache der Rektorin, die uns versicherte, wie stolz sie auf ihre Schüler war, und das geschickt mit der Bitte verband, sich doch für den Elternbeirat zu melden. Danach eröffnete der Bürgermeister mit einer kurzen, aber enthusiastischen Rede die Feierlichkeiten und gab dann das Mikrofon weiter an den hiesigen Parlamentsabgeordneten, Erziehungsminister im Schattenkabinett. Der laberte eine halbe Ewigkeit über irgendetwas, während die Zuhörer mit den Füßen scharrten und murrten. Der Politiker hörte auf, als klar wurde, dass wir kurz davor waren, das Podium zu stürmen und ihn Hals über Kopf aus der Stadt zu jagen.
Endlich ging es los mit den Aufführungen. Fünfhundert Camcorder begannen zu surren, und Blitzlichter zuckten durch den Saal, als hätten wir ein mittelschweres Gewitter.
Phoebes Auftritt kam als zweiter, nach einem missglückten Warm-up von ein paar Kids mit Blockflöten. Ich erinnerte mich, dass ich in der Grundschule auch Blockflöte gespielt hatte und auch nichts anderes als Gequietsche herausgekommen war. Dann begann die nur zu vertraute Tanzmusik und sieben oder acht Mädchen betraten im Gänsemarsch die Bühne. Phoebe war die Zweite von rechts. Ich schaute zu Mom hinüber. Sie hatte eine Hand auf den Mund gelegt und um die Augen herum waren Falten. Ich sah meine eigenen Befürchtungen in ihrem Gesicht gespiegelt. Es ist so schwer, jemandem, den man liebt, zuzuschauen, wie er sich – wahrscheinlich – gleich zum Affen macht. Zu einem Affen, der von unzähligen Camcordern aufgenommen und für alle Ewigkeit auf Dutzenden von DVD s festgehalten würde. Summer dagegen lächelte entspannt. Ich sah, wie sie ihrer Schwester aufmunternd zunickte, obwohl Phoebe sie unmöglich sehen konnte. Bitte lieber Gott , flehte ich, lass das gut gehen. Wenn es gut geht, fange ich vielleicht sogar an, an dich zu glauben.
Allem Anschein nach gibt es keinen Gott.
Man kann nicht behaupten, dass Phoebe schlechter war als die anderen. Soweit ich es beurteilen konnte, wusste nur ein Mädchen wirklich, was sie tat. Die sechs oder sieben anderen taten, was ihnen gerade so einfiel. Es war super, echt. Ich meine, wer braucht bei einem Tanz in der Grundschule schon eine fehlerfreie Choreografie? Es sind schließlich nur Kinder, die herumhüpfen und Spaß haben. Nur dass es Phoebe keinen Spaß machte. Ich sah es ihr an. Sie schaute ständig auf ihre Mittänzerinnen und versuchte, deren Schritte nachzumachen. Leider waren deren Schritte genauso daneben wie ihre eigenen, sodass es mehr und mehr in ein allgemeines zielloses Herumzappeln ausartete. (Mit Ausnahme des einen Mädchens, das den Takt hielt. Jede Wette, dass ihre Eltern den Camcorder ausschließlich auf sie hielten. Vielleicht blendeten sie den Rest der Truppe auch später einfach aus.) Je mehr Phoebes Rhythmusgefühl, das schon zu Anfang so gut wie nicht vorhanden war, durcheinandergeriet, desto steifer bewegte sie sich, und desto schlimmer wurde es. Doch erst am Ende ging alles schief. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Geplant war wahrscheinlich, dass alle Mädchen beim letzten Ton die Sache in einer Reihe beendeten, auf einem Knie und die linke Hand in Richtung Publikum ausgestreckt. Dass der Plan aufging, war natürlich völlig utopisch. Der letzte Ton erklang und die eine Tänzerin in der Gruppe nahm graziös ihre Position ein. Der Rest folgte im eigenen Tempo. Zwei hatten die rechte Hand ausgestreckt, drei die linke und Phoebe hatte diesen Teil offensichtlich komplett vergessen. Wegen der ständigen Positionswechsel, beabsichtigt oder nicht, war Phoebe jetzt ganz rechts in der Reihe. Sie balancierte auf einem knochigen Knie, verlor das Gleichgewicht und kippte nach rechts. Es war fast wie bei einer dieser Filmszenen, wenn alles in Zeitlupe abläuft. Wäre sie nach links gekippt, hätte es noch gut gehen können. Doch sie fiel auf das Mädchen neben ihr, die ihrerseits umkippte und die nächste in der Reihe umwarf. Die Dominosteine fielen. Ich hörte, wie Mom keuchte und das Publikum lachte. Es war kein hässliches Lachen. Das hörte ich. Es war ein Lachen, das eine Art Freude über die linkische Art von Kindern zum Ausdruck brachte. Es war warmherzig.
Doch Phoebe hörte es anders. Sie blickte die Reihe der gefallenen Soldaten entlang und auf ihrem Gesicht breitete sich ein Ausdruck schieren Entsetzens aus. Dann rappelte sie sich auf und lief von der Bühne, das Gesicht in den Händen vergraben. Vom Publikum kam frenetischer Applaus, aber Mom und ich waren zu geschockt, um zu klatschen.
Summer schob sich an mir vorbei. »Komm mit, Jamie.«
Ich stand instinktiv auf und folgte ihr den Seitengang hinunter in Richtung Bühne. Mom blieb sitzen.
»Wohin gehen wir?«, fragte ich.
»Ein gebrochenes Herz zusammenflicken«, antwortete sie über die Schulter. »Du hältst also verdammt noch mal die Klappe und überlässt mir das Reden.«
Hinter die Bühne zu gelangen, war nicht schwer. Ein Lehrer wies auf Phoebe, die allein in der letzten Ecke kauerte und schluchzte. Ich muss zugeben, dass sich mein Herz zusammenzog. Es gibt fast nichts Schlimmeres auf dieser Welt als unglückliche Kinder. Summer ging schnurstracks auf sie zu und hockte sich auf die Fersen.
»Hey, Mäuschen, warum die Tränen?«, fragte sie.
Phoebe nahm die Hände vom Gesicht. Die Augen waren verquollen und der Mund war fratzenhaft verzogen. Sie versuchte nicht, ihr Elend zu verbergen. Sie wollte etwas sagen, doch heraus kam nur ein ersticktes Heulen. Summer rieb ihr den Rücken, strich ihr eine Haarsträhne aus dem Gesicht und wartete.
»Ich hab’s vermasselt«, schluchzte Phoebe schließlich.
»Nein«, widersprach Summerlee. In ihrer Stimme lag eine gewisse Strenge. »Das stimmt nicht , Phoebe. Du hast es verkackt. Hochgradig.« Phoebes Gesicht verzog sich erneut. »Aber es war genial und niemand hat es gemerkt. Nur ich und nur weil ich wusste, wie es enden sollte. Hast du den Applaus am Ende gehört? Hast du ihn gehört?«
Phoebe hörte lang genug auf zu weinen, um ihre Verwirrung zum Ausdruck zu bringen. »Was meinst du damit?«
Summer nahm ihre Hand und hielt sie fest umschlossen. »Was ich damit meine, Mäuschen? Was ich meine? Ich meine, dass das geplante Ende totaler Schwachsinn war. Langweilig. Der ganze Auf-ein-Knie-Scheiß und die blöde Hand in der Luft. Gähn . Was du getan hast – und ich weiß, dass es keine Absicht war –, hat das Ganze zu etwas Fantastischem gemacht. Alle Mädchen liegen in einer Reihe auf der Bühne. So ein Ende hat die Aufführung gebraucht. Genau wie beim Ballett. Und du hast das geschafft, Mäuschen. Du. Es war großartig. War es nicht großartig, Jamie?«
»Absolut«, bestätigte ich. »Vom Künstlerischen her gesehen war es … perfekt.«
»Echt?«, fragte Phoebe.
Da hätte ich fast geweint. Vielleicht kann man Kindern, selbst Phoebe, doch etwas vormachen, wenn der Anreiz, eine Lüge zu glauben, stark genug ist.
»Großes Indianerehrenwort?«
»Ich schwör’s.« Summerlee legte eine Hand aufs Herz. »Ich bin so stolz auf dich, Mäuschen. Dieser Applaus. Das Publikum fand die Aufführung toll. Sie fanden dich toll.«
Phoebe wandte sich an mich. Die Tränen auf ihrem Gesicht trockneten und hinterließen helle Spuren. »Schwörst du es auch, Jamie?«



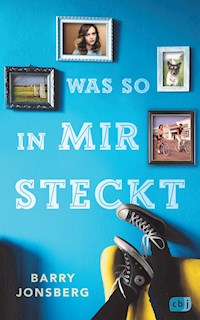














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










