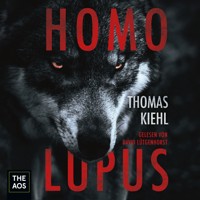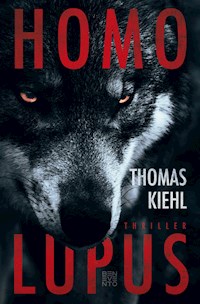13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Benevento
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der gefährliche Wunsch nach ewiger Jugend: Lena Bondroit ermittelt Die Biologin Lena Bondroit wird auf eine kleine schwedische Insel eingeladen. Sie soll herausfinden, was es mit der gehäuften Unfruchtbarkeit der jungen Frauen dort auf sich hat. Hängen ihre Beschwerden am Ende mit dem Verjüngungsmittel zusammen, das an ihren Eltern erprobt wurde? Nach und nach deckt die Wissenschaftlerin düstere Zusammenhänge auf. Auch der dritte Teil der Krimi-Reihe um die angesehene Biologin Lena Bondroit zeigt das Können des Autors Thomas Kiehl. Sein Wissenschafts-Thriller entwickelt schnell eine beklemmende Dynamik. Was passiert, wenn die Testprobanden das Mittel absetzen? Gab es unvorhersehbare Nebenwirkungen und Auswirkungen auf die Epigenetik? Und wie verhält sich das Pharmaunternehmen, das gerade den Börsengang plant? - Spannender Inselkrimi: Was geht auf dem kleinen schwedischen Eiland vor? - Packender Spannungsroman um einen Pharmaversuch mit unerwarteten Folgen - Unschuldig zwischen den Fronten: Kann Lena Bondroit den Fall aufklären? - Mitreißende Urlaubslektüre für Thriller-Fans Forschung ohne Skrupel: Was geschah auf der mysteriösen Insel? Ein Serum, das einem Jungbrunnen gleichkommt, und eine Studie, die für alle Beteiligten zum Albtraum wird. Das Rätsel um die unfruchtbaren jungen Frauen zieht Lena in seinen Bann – bis sie selbst in Gefahr gerät. Der dritte Band um die Verhaltensbiologin ist ein ebenso spannender Roman wie seine Vorgänger. Kenntnisreich zeichnet Thomas Kiehl das Bild der Inselbewohner, die sich dem Pharmaunternehmen als Probanden zur Verfügung stellten – und jetzt von dem mysteriösen Präparat abhängig sind. Ein düsterer Thriller, der nicht nur Nervenkitzel garantiert, sondern auch zum Nachdenken über die Möglichkeiten und Grenzen moderner Medizin anregt!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
THOMAS KIEHL
Das Jungblut-Serum
Thriller
Diese Geschichte ist frei erfunden. Tatsächlich existierende Personen und Firmen wurden verändert und/oder vom Autor ausgedacht, Geschehnisse anderen und/oder fiktiven Personen zugeordnet. Verbleibende Übereinstimmungen mit etwaigen realen Personen wären somit rein zufällig und sind nicht gewollt.
Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr.
Eine Haftung der Autoren bzw. Herausgeber und des Verlages ist ausgeschlossen.
1. Auflage 2022
Copyright © 2022 Benevento Verlag bei Benevento Publishing Salzburg – München, eine Marke der Red Bull Media House GmbH, Wals bei Salzburg
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übersetzung, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:
Red Bull Media House GmbH
Oberst-Lepperdinger-Straße 11–15
5071 Wals bei Salzburg, Österreich
Satz: MEDIA DESIGN: RIZNER.AT
Gesetzt aus der Minion Pro, Futura
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Umschlagmotiv: © plainpicture/C&P
ISBN: 978-3-7109-0143-0
eISBN: 978-3-7109-5136-7
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Nachwort
Danksagung
Prolog
1610, Burg ČachticeWohnsitz der Gräfin Elisabeth Báthory-Nádasdy
Es war Dezember, kurz nach Weihnachten. Durch das kleine Burgfenster drang nur wenig Licht. Gräfin Báthory-Nádasdy stand mit zwei ihrer Diener vor einem großen Spiegel. Tränen flossen ihre fahlen Wangen herab, der geöffnete Mund wie ein stummer Schrei.
»Seht ihr, wie meine Haut welkt?«, flüsterte sie beinahe tonlos.
Sie war nackt. Doch sie fror trotz der Kälte nicht. Man sagte, sie gleiche einer Frau um die dreißig, dabei hatte sie die fünfzig bereits überschritten. Aber was kümmerte sie, was die Menschen sagten. Der Spiegel sprach eine ganz andere Sprache. Tiefe Falten begannen sich wie Ackerfurchen durch ihr Gesicht zu fräsen. Ihr Busen, zwei hängende Säcke. Und ihre Haut – schlaff wie die eines gekochten Huhns.
»Raus! Holt mir neue Mädchen! Möglichst jung müssen sie sein, hört ihr? Und dann bereitet mir ein neues Bad.«
Die Diener eilten davon, um nach dem zu suchen, wonach ihre Herrin verlangte. Die Alchemie hatte es der Gräfin angetan. Sie experimentierte viel, vor allem mit Blut, jungem Blut, für das sie die Mädchen und jungen Frauen töten ließ.
Als der königliche Stadthalter von dem Treiben auf der Burg erfuhr, war das Schicksal der Gräfin und ihrer Diener jedoch schnell besiegelt. Schuldig des Mordes an über hundert Frauen ließ man die Diener hinrichten. Die Gräfin mauerte man indes – aufgrund ihres Standes ohne Urteil – in einen Trakt der Burg ein. Sie verstarb drei Jahre später. Ihr Traum von der ewigen Jugend wird der Menschheit hingegen wohl für immer erhalten bleiben.
So (oder so ähnlich) muss es sich nach den Angaben von Historikern um das Jahr 1610 auf der Burg Čachtice in der heutigen Slowakei zugetragen haben. Die Grausamkeiten der Gräfin Elisabeth Báthory-Nádasdy, auch als »Blutgräfin« bekannt, wurden Ausgangspunkt von vielen Geschichten und sollen auch Bram Stoker zu seinem Werk Dracula mit inspiriert haben.
Die Zukunft hat bereits begonnen:
You must be at least 30 years old to receive this treatment. […] Our blood is obtained from licensed blood banks within the United States and is matched to your blood type. […] 1 liter: $5.500, 2 liters: $8.000.
Ambrosia Plasma1
1Zuletzt abgerufen am 09.08.2021 unter www.ambrosiaplasma.com. In der Zwischenzeit wurde diese Website gelöscht. Existent ist am 21.06.2022 noch der Facebook-Auftritt unter »Ambrosia Plasma«.
1
Mittwoch, 21. Mai 2003Auf einer Insel in der Ostsee, Nordschweden
In dem kleinen Büro von Bürgermeister Granqvist herrschte eine ausgelassene Stimmung. Granqvists Frau Wilma hatte für Gebäck, Kuchen und Kaffee gesorgt, die Gäste für den Champagner. Ein paar der einflussreicheren Bürger der Insel und deren Frauen hatte er eingeladen, darunter den ansässigen Bauunternehmer, den Pfarrer, diverse Bauern, den Leiter der Polizeidienststelle. Aus Deutschland war der komplette Vorstand des jungen Pharma-Start-ups angereist.
Granqvist war sich sicher, dass er mit dem Vertrag, den er soeben unterschrieben hatte, auf geniale Weise gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen hatte. Zum einen würde das Projekt einiges an Geld in die leere Stadtkasse spülen, was nach dem Konkurs des Sägewerks auf der Insel dringend nötig war. Zum anderen schien das, was die Herren des Pharmaunternehmens versprachen, wirklich bahnbrechend zu sein. Die Inselbewohner würden ihn, den Bürgermeister, noch Jahrzehnte dafür feiern, dass er ihnen diese einzigartige Möglichkeit geschenkt hatte. Sie durften, fast als erste Menschen der Welt, dieses Wundermittel testen. Versuche an Tieren waren zumindest sehr erfolgversprechend gewesen. Und auch die ersten Tests an Menschen machten Hoffnung. Es war fast zu gut, um wahr zu sein.
Natürlich hatte Granqvist in dem Vertrag darauf geachtet, dass niemand zu »seinem Glück gezwungen wurde«, wie er gern sagte. Die Teilnahme an der Langzeitstudie beruhte auf Freiwilligkeit. Aber er hatte auf der letzten Bürgerversammlung auch klargemacht, dass der Deal nur dann zustande kommen würde, wenn mindestens zweihundert Inselbewohner die ihnen vorgelegten Verträge unterschrieben.
Zum Glück vertrauten ihm die Einwohner der Insel, so dass die Mindestanzahl an Probanden schnell erreicht war; sicherlich auch deshalb, weil er mit gutem Beispiel vorangegangen war und sich selbst bereits die erste Spritze hatte setzen lassen.
Carsten Schmidt-Lüder, der Chief Executive Officer und Gründer des Pharma-Start-ups aus Deutschland, ein großer, hagerer Mann mit einer durchaus sympathischen Ausstrahlung, klopfte ihm anerkennend auf die Schulter. »Mr Granqvist«, begann er auf Englisch. »Ich glaube, Ihre Insel hat Ihnen viel zu verdanken. Sie können mir glauben, es gab Orte, die hätten für weniger Geld unterschrieben. Aber es geht uns schließlich um eine langjährige, vertrauensvolle Partnerschaft. Da ist es wichtig, Menschen wie Sie an Bord zu haben, Partner, die genauso an die Sache glauben wie wir. Es freut mich daher sehr, Sie auf unserer Seite zu wissen. Dafür möchte ich mich im Namen aller meiner Kollegen bei Ihnen bedanken.«
»Vielen Dank«, sagte Granqvist, sichtlich geschmeichelt und auch ein wenig berührt. Er nickte Schmidt-Lüder freundlich zu. Dann wandte er sich an die anwesende Gesellschaft. Er straffte stolz und zufrieden die Schultern, hielt eine kurze Rede, ebenfalls auf Englisch, damit sie auch die Gäste verstanden, die er mit den Worten enden ließ: »Und nun lasst uns gemeinsam auf diesen wunderbaren Moment und auf unsere Zukunft anstoßen. Eine Zukunft, die für die meisten von uns noch sehr lang sein dürfte.« Er lachte. Es wurde geklatscht. Gläser stießen aneinander. Dann endlich ein erster Schluck von dem köstlichen Schampus.
2
Sechsundzwanzig Jahre späterMontag, 31. Juli 2029Kemi-Tornio, Finnland
Dem Gespräch, das sie in dem Hotelzimmer in der Nähe des Flughafens von Kemi-Tornio führten, war ein E-Mail-Austausch vorausgegangen, in dem man das Problem nie wirklich beim Namen genannt hatte, weil auf beiden Seiten Bedenken bestanden, dass die E-Mails ihnen zu einem späteren Zeitpunkt auf die Füße fallen könnten.
»Was wollen diese Idioten denn noch, damit sie endlich Ruhe geben?«
»Beachte sie einfach nicht. Wir haben alles unter Kontrolle. Glaub mir.«
»Fällt mir ehrlich gesagt schwer. Was ist mit dieser Frau, die da in den sozialen Medien gegen uns wettert? Auf sämtlichen Plattformen! Das bekommen wir nicht unter den Teppich gekehrt. Zum Glück nimmt die keiner ernst. Aber wenn die Presse auf den Zug aufspringt und da eine Geschichte draus webt … Weißt du, was dann los ist?«
»Natürlich.«
»Natürlich. Das ist alles, was dir dazu einfällt?«
»Alles ist gut.«
»Wie, alles ist gut?«
»Das Problem hat sich von selbst gelöst.«
»Von selbst? Ihr habt doch nicht etwa Geld …«
»Nein, kein Geld.«
»Zum Glück. Geld wäre ein indirektes Schuldanerkenntnis gewesen. Zudem würde es nicht lange dauern, dann würde sie mehr wollen. Und nicht nur sie. Die halbe Insel, wenn sich herumspricht, dass sie damit durchgekommen ist.«
»Sie hat sich umgebracht.«
Für einen Moment sagte keiner etwas. Beide richteten ihren Blick betreten zu Boden.
»Verstehe. Ich hoffe, das führt zu keinen Schlagzeilen.«
»Es war Selbstmord. Für die Polizei gibt es keinen Zweifel.«
Einem tiefen Schnaufen folgte ein: »Wie auch immer. Vielleicht besser so.«
Erneute Stille.
»Wir können den Studien doch trauen, oder? Es gibt da keinen Zusammenhang? Da seid ihr absolut sicher?«
»Wie oft soll ich das noch sagen: Ein Präparat mit derartigen Folgen auf den Markt zu bringen, wäre allein wegen der drohenden Schadenersatzforderungen undenkbar.«
»Ich weiß. Es ist nur wirklich seltsam …«
»Was auch immer der Grund ist, es hat nichts mit Insovital zu tun. Ganz sicher. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Ich würde euch daher dringend bitten, dass auch ihr eure erledigt.«
3
Ein halbes Jahr späterDonnerstag, 25. Oktober 2029In der Nähe von Haparanda, Nordschweden
Wie der Spaziergang über einen Friedhof an einem Sommertag, dachte Lena, während sie der Musik aus den Lautsprechern lauschte. Obwohl die Melodie eigentlich fröhlich war, hatte das Lied durch die dunkle, warme Stimme von Zarah Leander eine unterschwellig traurige Note.
Der alte Volvo rollte indessen ermüdend langsam über die schmale Landstraße. Die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h unterschritt Astrid konstant. Lena war niemand, der gerne raste. Trotzdem begann sie das Schneckentempo zu nerven.
Viel gesprochen hatten sie noch nicht, seitdem Astrid Lena auf dem kleinen finnischen Flughafen Kemi-Tornio nicht weit hinter der schwedischen Grenze abgeholt hatte. Lena sah auf die Uhr. Sie waren jetzt eine knappe Dreiviertelstunde unterwegs. Obwohl es noch nicht einmal vier Uhr war, war die Sonne bereits hinter dem Wald, der die Straße säumte, verschwunden. Die angrenzenden Bäume verloren ihre Farbe, und im Wald selbst herrschte bereits Dunkelheit.
An sich liebte Lena Wälder. Sie liebte Bäume, besonders die hohen und starken. Sie liebte die weichen Moosfelder, das pralle Grün der Farne, den Duft von feuchtem Laub und sauerstoffgeschwängerter Luft. Am Tag fühlte sich Wald für sie immer wie Heimat an. Nachts hingegen weckte er in ihr dasselbe ängstliche Gefühl, das sie überkam, wenn sie schnorchelnd im Meer schwamm und der Boden plötzlich nicht mehr zu sehen war. Je dunkler, desto schlimmer. Es war die Furcht davor, in etwas hineingesogen zu werden, aus dem sie nicht wieder herauskam.
Lena wandte ihren Blick ab und sah zu dem Traumfänger, der vom Rückspiegel baumelte. Sie hatte Traumfänger noch nie gemocht. Das spinnennetzartige Muster in der Mitte und die am Rand befestigten Federn erinnerten sie an die abstoßenden Devotionalien eines Voodoo-Doktors oder einer Hexe. Ihre Mutter hatte ihr als Kind ein besonders großes Exemplar ans Fenster gehängt. Anstatt böse Träume zu vertreiben, hatte er jedoch eher welche ausgelöst. Lena hatte ihn deshalb abgenommen, doch ihre Mutter hatte ihn immer wieder zurückgehängt. Er sei gut gegen die Gedanken, die sie sich mache, viel zu viele für so ein kleines Mädchen, behauptete sie. Sie liebte okkulten Schnickschnack. Jedem esoterischen Trend – egal ob Geisterbeschwörung, Trommelworkshops oder durch irgendwelche selbst ernannten Schamanen angeleitete Trancetänze – lief sie kritiklos hinterher. Hauptsache, man konnte die »Wahrheit« erspüren und musste sich nicht mühsam mit wissenschaftlichen Erklärungen auseinandersetzen, die ihre Mutter nicht verstand. Nachdem der Traumfänger bei Lena keine Wirkung zu haben schien, wurde ein Schlafkräuterkissen angeschafft und schließlich Bachblütentropfen, die ihre Mutter ihr jeden Tag in ein Glas Wasser tröpfelte, das sie dann austrinken musste.
Lena hatte sich geschworen, nie wie sie zu werden – nicht äußerlich und nicht innerlich. Keine buntgefärbten Wickelröcke, keine Ketten mit einem Stein, der ihrem Sternzeichen entsprach, kein selbstgestrickter Pullover aus Biowolle von schottischen Hochlandschafen. Dabei gab es Bequemeres als die Kostüme, in die sie sich bereits während des Studiums gezwängt hatte.
Wahrscheinlich war sie deshalb Naturwissenschaftlerin geworden, hatte Biologie studiert, das Verhalten von Ameisen und Wölfen analysiert und vor zwei Jahren den Job am »International Institute for Epigenetics« in Köln angenommen. Sie wollte Beweise finden, die wirklichen Gründe für das Verhalten von Tier und Mensch, anstatt wie ihre Mutter nach falschen Göttern und ihren Propheten zu suchen.
Ihre Mutter hatte sie dafür immer nur ausgelacht. Sie warf Lena vor, nicht zu verstehen, dass es noch mehr zwischen Erde und Himmel gab als seelenlose Moleküle.
»Deine ganze Forschung. Was soll das eigentlich?«, hatte sie Lena während ihrer Arbeit mit Ameisenstaaten einmal gefragt. »Meinst du wirklich, eine Frau, die sich mit Ameisen beschäftigt, findet mal einen Mann? Wenn ich einen Typen kennenlernen würde, der den ganzen Tag in einem Labor voller Ameisen sitzt … Ich glaube, es würde mir ständig überall kribbeln.«
Das musste gerade sie sagen, sie, die von Lenas Vater verlassen worden war, als Lena gerade sechs Jahre alt war. »Mama, wäre es dir lieber, ich würde in einer Fischfabrik arbeiten?«
»Na ja …« Ihre Mutter nahm Lenas rhetorische Fragen gerne ernst oder tat zumindest so, natürlich nur, um sie noch weiter auf die Palme zu bringen. »Eine heiße Dusche und gut. Aber Ameisen? Da entsteht was im Kopf. Das kann man nicht einfach wegwaschen.«
»Und wenn ich gar keinen Mann will?«
Ihre Mutter hatte nur dumm gelacht. »Schätzchen. Du willst einen. Glaub mir. Nur weil dein Vater ein Idiot ist, heißt das noch lange nicht, dass du auf einen verzichten könntest. Das steckt in unseren Genen. So wie du auch Kinder haben möchtest. Aber das solltest du als Biologin eigentlich besser wissen als ich.«
Astrid bog in einen Schotterweg ab. Kurz darauf erreichten sie einen kleinen Parkplatz, hinter dem zwischen vereinzelten Bäumen die Ostseeküste vor ihnen auftauchte. Die Landschaft erschien in der Abenddämmerung in unterschiedlichen Blau- und Grautönen. Auf dem Wasser war keine Welle zu sehen. Das Meer wirkte wie ein großer, dunkler See.
Astrid stellte den Motor aus und stieg aus. »Komm, das musst du sehen.«
Lena öffnete die Autotür. Die frische, kalte Abendluft kam ihr entgegen. Es roch nach Harz, Laub und ein wenig auch nach Meer. Sie folgte Astrid, die auf einem kleinen Pfad in Richtung Wasser hüpfte wie ein kleines Kind.
»Nice, oder?«, fragte Astrid ein wenig verträumt, als Lena bei ihr angekommen war. Sie hatte sich auf einen großen, flachen Stein gestellt und ließ ihren Blick über das Wasser schweifen. Lena gesellte sich neben sie auf den Stein. Die friedliche Abendstimmung inmitten dieser scheinbar fast unberührten Natur war wirklich atemberaubend.
»Ja, wunderschön«, gab ihr Lena recht. Seit sie wieder in der Großstadt wohnte, vermisste sie die Natur immer häufiger.
Auch sie ließ ihren Blick über das Meer und die Landschaft schweifen. Sie schaute zu Astrid, die ihre Augen geschlossen hatte und tief durchatmete. Als sie die Augen wieder öffnete, war da dieser Ausdruck in ihrem Gesicht, der Lena schon vor einer Woche aufgefallen war, als Astrid sie im Gerichtsgebäude in Köln angesprochen hatte. Sie schien auf etwas in weiter Ferne konzentriert, wie eine Sängerin in Ekstase, die vollkommen in ihrem Gesang aufging. Menschen bekamen in solchen Momenten eine ganz bestimmte Aura, die weit über ihre äußerliche Schönheit hinausging. Überhaupt gefiel ihr Astrid. Obwohl sie sich kaum kannten, spürte sie eine gewisse Vertrautheit und Nähe, ohne benennen zu können, woran das lag.
»Und trotzdem will ich weg von hier«, sagte Astrid plötzlich. Die Sanftheit war aus ihrem Gesicht verschwunden.
»Und warum?«
»Die Enge … Ich weiß auch nicht.« Sie sah zu Boden, dann zu einer kleinen bewaldeten Insel in nicht allzu weiter Ferne. »Wollen wir weiter?«
Lena kam es vor, als wollte Astrid nicht über den wirklichen Grund sprechen. Auch der plötzliche Aufbruch sprach dafür. Also hakte Lena nicht weiter nach. Dabei hätte sie es an diesem Ort durchaus noch ein wenig länger ausgehalten.
»Nur noch gute zehn Minuten«, sagte Astrid. »Dann sind wir da.« Sie lachte kurz auf. »In der Hölle.«
»So schlimm?«
Astrid verdrehte die Augen. »Quatsch. War nur ein Spaß.«
»Hölle klingt nicht gerade nach Spaß.«
»Ach.« Astrid strich sich ihre Haare aus dem Gesicht. »Es ist nur so: Insovital hat die Menschen verändert. Das sehe zumindest ich so. Aber urteile selbst.« Mit einem Satz war sie von dem Stein gesprungen. Sie drehte sich ein paarmal um sich selbst und rannte zurück in Richtung Wagen. »Komm, weiter. Du wirst schließlich erwartet.«
Sie stiegen ins Auto, und Astrid lenkte den Wagen zurück auf die Straße, von der sie abgebogen waren. Kurz danach erreichten sie über einen kleinen Damm die Insel, die sie vom Parkplatz aus gesehen hatten, der eine weitere dem Festland vorgelagerte Insel folgte. Von dieser führte schließlich eine lange Brücke auf eine weiter im Meer liegende größere Insel – das musste ihr Ziel sein.
Am Ende der Brücke wurde die Fahrbahn einspurig. Auf der linken Fahrspur befand sich eine abgegrenzte Baustelle. Im Licht von mehreren großen Scheinwerfern arbeiteten dort zwei Männer. Astrid reduzierte das Tempo. Während der eine Arbeiter damit beschäftigt war, Säcke mit Baumaterial zu stapeln, stemmte der andere eine schwere Eisenstange von einem Lastwagen.
Astrid fuhr jetzt so langsam, dass sie fast anhielt. Sie nickte in Richtung der Männer. »Wie alt schätzt du die?«, fragte sie Lena.
Lena sah sich die Männer genauer an. Den Falten nach zu urteilen, hätte sie sie um die sechzig geschätzt. Doch von der Art her, wie sie sich bewegten und das schwere Material schleppten, mussten sie deutlich jünger sein. Wahrscheinlich waren ihre Gesichter nur durch die harte Arbeit, die Sonne und die raue Meeresluft früh gealtert.
»Schwer zu sagen. Anfang fünfzig?«, riet sie.
»Sie sind beide fast siebzig.«
Lena konnte es kaum glauben, sie musste noch einmal genauer hinsehen. »Und das kommt von Insovital?«
Astrid nickte. »Das Mittel ist schon krass. Sonst würden es sicherlich nicht so viele freiwillig nehmen, noch immer. Anfangs waren es gerade mal zweihundert. Inzwischen nimmt es mehr als die halbe Insel. Unser Oberindianer, Ole Granqvist, der Bürgermeister, ist fünfundachtzig und denkt noch gar nicht an den Ruhestand, so fit fühlt er sich. An der gesunden Ernährung liegt das zumindest nicht. Wir essen hier viel Fleisch und Kartoffeln, gerne fettig, wenig Gemüse.«
»Wirklich beeindruckend«, murmelte Lena.
Astrid beschleunigte leicht das Tempo, bremste aber gleich wieder ab, weil sich plötzlich ein großer, stämmiger Mann mitten in den Weg stellte. Mit hochgehobenen Händen gab er zu verstehen, dass sie anhalten mögen. Dann kam er zur Fahrerseite und beugte sich zum Fenster hinab. Astrid ließ die Scheibe runter.
Da sie Schwedisch miteinander sprachen, verstand Lena nichts von der Unterhaltung. Was sie allerdings trotzdem sofort begriff, war, dass es um sie ging. Der Mann begann irgendwann wild zu schimpfen und zeigte zurück in Richtung Festland, woraufhin ihm Astrid nur einen Vogel zeigte. Dann, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, dass er noch mit ihr sprach, drückte sie auf den Knopf für den Fensterheber und fuhr los.
Lena drehte sich um und sah, wie der Mann zu einem riesigen Pick-up rannte, der am Ende der Baustelle geparkt war. Er riss die Fahrertür auf und sprang hinein.
»Wer war das?«, fragte Lena Astrid. Die Situation war ihr höchst unangenehm gewesen, zumal sie nicht verstanden hatte, worum es ging.
»Lars Åberg. Ein totaler Idiot.«
»Und was wollte er?«
»Wissen, wer du bist.«
»Und was hast du gesagt?«
»Dass ihn das nichts angeht.«
»Aber warum interessiert ihn das überhaupt? Und warum hält er uns an, wie in einer Polizeikontrolle?«
»Weil er ein Arschloch ist«, sagte Astrid. Lena bemerkte, wie sie in den Rückspiegel schaute. Ihr Blick verfinsterte sich. Dann gab sie Gas. Lena drehte sich nochmals um und sah, wie der Pick-up von Åberg gerade auf der Brücke drehte. Astrid fuhr jetzt alles andere als gemütlich. Aber warum? Hatte sie Angst davor, dass dieser Typ sie verfolgen würde? Und wenn ja, weshalb?
Sie erreichten die Insel. Astrid blickte immer wieder in den Rückspiegel. Auch Lena beobachtete, wie der Pick-up weiter aufholte. Sie rasten um eine scharfe Kurve, und ihr Verfolger war für einen Moment nicht zu sehen, was Lena jedoch nicht wirklich beruhigte, denn er würde wohl sicher bald wieder hinter ihnen auftauchen.
»Was will er von uns?«, fragte Lena nervös.
Sie bekam keine Antwort. Astrid beschleunigte immer mehr. Sie waren zu schnell, um Schlaglöchern auszuweichen, und es gab einen dumpfen Schlag und einen Knall, der so laut war, dass Lena für einen Moment die Befürchtung hatte, eine der Achsen könnte gebrochen sein. Der gesamte Inhalt der Mittelkonsole flog durch die Luft.
»Halt an, verdammt noch mal! Du bringst uns ja um!«, schrie Lena panisch. Ihr Herz schlug ihr bis zum Hals. Ihre Hände waren feucht vor Schweiß. Was immer der Mann auch von ihnen wollte, es konnte nicht schlimmer sein, als mit dem alten Volvo vor dem nächsten Baum zu landen.
Astrid reagierte nicht, sondern brüllte nur: »Festhalten!« Eine Sekunde später direkt nach einer Kurve löschte sie die Scheinwerfer und bremste abrupt, riss das Steuer herum und schlitterte in einen kleinen Seitenweg. Für einen Moment hatte Lena das Gefühl, dass Astrid die Kontrolle über den Wagen verloren hatte. Doch das Gegenteil war der Fall. Schon setzte sie zu einer neuen scharfen Kurve an und beschleunigte noch einmal. Lena, die in der düsteren Umgebung kaum etwas ausmachen konnte, stieß einen spitzen Schrei aus. Dann erkannte sie, dass sie direkt auf eine riesige Lagerhalle zufuhren, die hier mitten im Wald stand. Hinter der Halle angekommen, brachte Astrid den Wagen endlich zum Stehen.
»Bist du denn total übergeschnappt!«, schimpfte Lena auf sie ein. »Du hättest uns umbringen können. Und was will der Typ überhaupt? Warum hat er uns verfolgt?«
Astrid antwortete nicht, sondern sprang aus dem Wagen, rannte bis an das Ende der Halle und spähte dort um die Ecke. Wenn der Mann sie tatsächlich verfolgte, wovon Lena fest ausging, und mitbekommen hatte, dass sie abgebogen waren, musste er jeden Moment auftauchen. Doch das tat er nicht. Lena wartete. Dann beschloss sie, Astrid, die immer noch am Ende der Lagerhalle stand, zu folgen.
»Er ist vorbeigefahren«, sagte Astrid, als Lena bei ihr ankam. Sie wirkte weniger erleichtert als vielmehr belustigt, fast triumphierend. Lena dahingegen steckten die halsbrecherischen Manöver von Astrid immer noch in den Gliedern.
»Schön, dass dich das so erheitert. Ich finde es eher weniger amüsant.«
»Sorry«, entschuldigte sich Astrid. »Aber das musste sein. Der ärgert sich jetzt bestimmt schwarz.« Sie hatte die letzten Worte kaum ausgesprochen, da waren Motorengeräusche zu hören, die sich näherten. Dann sah man die Lichtkegel von Scheinwerfern.
»Zurück!«, zischte Astrid.
Lena sprang zusammen mit Astrid zurück hinter die Halle. Von dort aus spähten sie um die Ecke. Sie sahen, wie der Wagen sein Tempo reduzierte, um kurz darauf auf dem Weg vor der Halle stehen zu bleiben. Sie hörte, wie eine Wagentür ins Schloss fiel. Durch die wenigen Bäume hindurch konnten sie beobachten, wie Åberg um seinen Wagen herumging und mit einer großen Taschenlampe in ihre Richtung leuchtete. In der anderen Hand trug er ein Gewehr.
Lena duckte sich instinktiv zu Boden. »Und jetzt?«, flüsterte sie Astrid panisch zu. »Der will doch nicht nur reden!«
Astrid hielt ihren Zeigefinger an die Lippen. Dann schaute sie noch einmal vorsichtig um die Ecke, zog ihren Kopf jedoch sofort wieder zurück.
Lena begann hektisch ihr Handy aus ihrem Mantel zu kramen. Als sie es herausgezogen hatte, schüttelte Astrid nur den Kopf. Doch Lena sah das anders. Sie begann die Ziffern für den Notruf einzugeben, auch wenn ihr im selben Augenblick klar wurde, dass jede Hilfe zu spät kommen würde. Verdammte Insel! Bis hier ein Polizist auftauchen würde, vergingen bestimmt Stunden. Was passierte eigentlich gerade? Und wo war sie hier nur gelandet? Sie musste an Astrids zuvor so beiläufig ausgesprochene Worte denken: »Dann sind wir da – in der Hölle.«
4
Sechs Tage zuvorFreitag, 19. Oktober 2029Köln
Im Gerichtssaal 225 des Kölner Landgerichts war es noch ruhiger geworden. Kein Rascheln mehr, kein Flüstern, nicht mal ein leises Räuspern. Alle Blicke waren auf Lena gerichtet. Sie sah zu dem vorsitzenden Richter auf, einem älteren, kleinen Mann mit einer schwarzen Lesebrille auf der Nase, der sie streng musterte. Sein Gesichtsausdruck war dem Thema, das hier verhandelt wurde, durchaus angemessen. Sein Blick gab ihr allerdings das Gefühl, als wäre sie die Angeklagte – dabei war sie nur die Sachverständige des Klägers, die vom Institut geschickt worden war, um diesen Termin wahrzunehmen.
»Frau Dr. Bondroit, wir kommen nun zu der entscheidenden Frage bezüglich der Behauptung des Klägers. Können Sie uns erklären, ob und, wenn ja, wie Traumata vererbt werden können?«
Lena wandte sich in Richtung des Beklagten. Den Kopf gesenkt, starrte er auf den Tisch. Lediglich als sie den Saal betreten hatte, hatte er kurz zu ihr aufgesehen, mit den glasigen Augen eines alten, gebrochenen Mannes und einem leeren Blick, der davon zeugte, dass der Mann sich bereits mit einem Fuß auf der anderen Seite des Styx befand. Abgesehen von seinem Vermögen machte er den Eindruck, dass es nichts gab, was man ihm noch nehmen könnte.
»Was wir an unserem Institut, aber auch Forscher an anderen Einrichtungen, immer wieder nachweisen konnten«, begann Lena, »ist, dass Traumata biochemische Veränderungen im Körper hervorrufen können. Das ist nicht weiter verwunderlich. Stellen Sie sich vor, Sie sind andauerndem Stress ausgesetzt. In Stresssituationen produzieren wir bestimmte Stoffe. Muss der Körper dies ständig tun, wird er sich anpassen, um dieser Aufgabe besser gerecht zu werden. Es ist am Ende wie bei einem Muskel, der größer wird, wenn wir ihn ständig benutzen. Nicht nur unser Gehirn lernt, sondern unser gesamter Körper. So entstehen dauerhafte Veränderungen in der Biochemie eines Menschen.«
»Verstanden. Das erklärt die biochemischen Veränderungen im Blut des Vaters des Klägers. Aber …«, der Richter hob seinen Finger, »… noch nicht beim Kläger selbst. Dazu müssten diese Veränderungen vererbt worden sein. Und eine Vererbung erfolgt doch über die Keimzellen – also über die DNA, die in Spermien und Eizellen enthalten ist. Aber die Keimzellen wurden nicht genetisch verändert. Oder verstehe ich da was falsch?«
»Das ist keineswegs falsch, es verhält sich nur etwas komplexer. In den Keimzellen ist der Bauplan für sämtliche Zellen enthalten, der über die DNA weitergegeben wird. Es stellt sich allerdings die Frage, ob sich biochemische Veränderungen in unserem Körper eben auch auf die Keimzellen auswirken können, und zwar dergestalt, dass diese Veränderungen auf die nächste Generation übertragen werden. Und das ist der Fall.«
»Über die DNA?«
»Im Fall von Traumatisierungen nicht.«
Der Richter schob erstaunt seine Augenbrauen nach oben. »Aber die Vererbung erfolgt doch über die Gene?«
»Richtig, aber nicht ausschließlich«, erklärte Lena. »Dürfte ich zum besseren Verständnis vielleicht ein wenig ausholen?«
»Ich bitte darum.«
Lena holte Luft. »Im 18. Jahrhundert gab es einen berühmten Biologen mit dem Namen Jean-Baptiste de Lamarck. Er erklärte die Evolution der Rassen mit Lernprozessen innerhalb des Körpers, die zu Anpassungen an spezifische Gegebenheiten der Umwelt führen. Den langen Hals einer Giraffe würde er damit begründen, dass sie ihn ständig strecken musste, um an die hohen Blätter eines Baumes zu gelangen. Lange Jahre hat man sich über diese Theorie lustig gemacht. Man folgte mehr der Theorie von Charles Darwin. Ihm zufolge entstanden Giraffen, weil es bestimmte Vorfahren dieser Gattung gab, deren Hälse, aufgrund einer genetischen Mutation, etwas länger waren. Diese Individuen hatten einen klaren Überlebensvorteil, weil sie auch an die Blätter herankamen, die an höheren Ästen wuchsen. Es war also wahrscheinlicher, dass Giraffen mit einem längeren Hals überlebten und besser genährt waren als die ohne. Und damit waren sie die Individuen, die sich am ehesten vermehren konnten und damit ihre Gene an die nächste Generation weitergaben.«
»Survival of the fittest, das ist uns wohl allen bekannt. Und jetzt hat man herausgefunden, dass diese Theorie falsch ist?«, fragte der Richter.
»Nein«, sagte Lena. »Aber man hat herausgefunden, dass Lamarck in gewisser Weise ebenfalls recht hatte. Wir wissen heute, dass sich auch unser Verhalten, unsere Erfahrungen und unsere Ernährung auf die Keimzellen auswirken können. Nicht direkt auf die Gene, die sehr starr sind, sondern auf Strukturen und Elemente um die Gene herum, unter anderem sogenannte Histone und epigenetische Faktoren. Wir sprechen hier von der Epigenetik.«
»Und wie funktioniert das genau?«, fragte der Richter interessiert nach.
Lena suchte nach einem passenden Bild, um weder den Richter noch die übrigen Personen im Saal mit unnötigen Fachbegriffen zu verwirren. »Sie müssen sich die Zellen wie kleine Fabriken vorstellen. Und die Gene sind innerhalb der Zellen die Steuerzentralen. Sie entscheiden darüber, was eine Zelle genau tut oder auch nicht. Das sind je nach Zellart sehr unterschiedliche Aufgaben. Beispielsweise können bestimmte Zellen dafür sorgen, dass ein Stoff produziert wird, der uns in Stress versetzt. Ob die Steuerzentralen die Produktion dieses Stoffs starten, hängt allerdings davon ab, dass bestimmte Knöpfe auf diesen Steuerzentralen gedrückt werden. Man spricht hier auch davon, dass die Steuerzentralen, also die Gene, aktiviert werden müssen. Dafür sind epigenetische Faktoren zuständig – eine Art Mitarbeiter, die die Steuerzentralen bedienen. Wenn diese Mitarbeiter beeinflusst werden, drücken sie unter Umständen die Knöpfe nicht mehr. Oder zu oft. So dass die Steuerzentrale einer Zelle die Produktion eines Stoffes sehr unterschiedlich ausführt, je nach Aktivierungsgrad durch diese epigenetischen Faktoren. Und diese Faktoren können vererbt werden.«
»Moment.« Der Richter überlegte kurz. »Lassen Sie mich das, was Sie gerade gesagt haben, noch einmal kurz mit meinen eigenen Worten zusammenfassen und auf unseren konkreten Fall anwenden. Ein wichtiger Mitarbeiter, der bestimmte Knöpfe drücken muss, ist in der Fabrik des Vaters des Klägers ausgefallen. Und so fehlt dieser Mitarbeiter jetzt auch in der Fabrik seines Sohnes?«
»Ganz genau«, bestätigte Lena.
»Womit es aufgrund dieser neuen Erkenntnisse der Forschung als bewiesen angesehen werden kann, dass die Depressionen meines Mandanten auf die Traumatisierungen seines Vaters zurückzuführen sind«, stellte der Anwalt des Klägers zufrieden fest.
»Widerspruch«, meldete sich der Beklagtenanwalt zu Wort. Lena war ihm schon einmal in einem anderen Prozess begegnet. Er gehörte einer renommierten Anwaltskanzlei aus Frankfurt an, die vor allem auf Arzthaftungsfragen spezialisiert war. Er war ein blitzgescheiter Mann, mit dem man sicherlich einen unterhaltsamen Abend verbringen konnte, den man sich jedoch nur ungern als Gegner in einem Prozess wünschte. »Es könnte sein, dass es so gewesen ist. Bewiesen ist dieser Umstand damit noch lange nicht.«
»Natürlich ist er das!«, entrüstete sich der Kläger, woraufhin er einen bösen Blick des Richters erntete. Sein Anwalt legte ihm beruhigend die Hand auf den Arm. Der Kläger war ein junger Mann Anfang zwanzig. Sein Blick hatte etwas Gnadenloses und ließ weder einen Funken Empathie noch Mitgefühl durchscheinen. Doch war das verwunderlich, nach dem, was der Beklagte dessen Vater angetan hatte? Trotzdem musste Lena einmal mehr feststellen, dass für das Richtige zu kämpfen einen nicht automatisch zu einem sympathischen Menschen machte.
Der Beklagte hatte als junger Mann den Vater des Klägers im Alter von neun Jahren entführt, fünf Jahre lang in einem Kellerverlies gefangen gehalten und sexuell missbraucht. Am Ende hatte er ihn freigelassen. Der Beklagte hatte versucht, sich das Leben zu nehmen, was ihm allerdings misslungen war. Es folgte ein langer Prozess und die Verurteilung zu einer Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung. Der Beklagte hatte bis zu seinem siebzigsten Lebensjahr hinter Gittern gesessen.
»Warum nicht bewiesen?«, fragte der Richter.
»Weil«, der Anwalt sah jetzt zu Lena, »und das wird uns die sachverständige Zeugin sicherlich bestätigen können, es mit der Epigenetik nicht ganz so einfach ist wie in dem gerade bemühten Bild. Epigenetische Veränderungen, wenn ich das mal so nennen darf, vererben sich im Gegensatz zu mutierten Genen nicht immer. Oder um bei ihrem Bild zu bleiben: Totgesagte Mitarbeiter können auferstehen.«
Der vorsitzende Richter sah zu Lena. »Stimmt das?«
Sie wog den Kopf hin und her. »Zum Teil. Wir verstehen die exakten Prozesse noch nicht bis ins letzte Detail. Aber es stimmt, dass ein traumatisierter Vater nicht nur traumatisierte Kinder zeugen kann. Hier spielt das Löschen von epigenetischen Informationen eine gewisse Rolle. Früher hat man angenommen, es gibt bei der Zeugung von neuem Leben generell ein ›Zurück auf Null‹. Doch das ist heute widerlegt. Es spricht daher in diesem Fall vieles dafür, dass epigenetische Veränderungen in den Zellen des Vaters an den Kläger vererbt wurden und dessen Depressionen hier ihren Ursprung haben.«
»Verstanden.« Der Richter nickte. »Dennoch die Frage an Sie: Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass die Depressionen des Klägers auf die seines Vaters zurückzuführen sind? Oder anders gefragt: Können Sie eine andere Erklärung zu einhundert Prozent ausschließen?«
Wieder fühlte sich Lena, als säße sie auf der Anklagebank. Sie spürte, wie sie ihre Finger in den gefalteten Händen gegeneinander presste. Konnte sie diese Frage überhaupt seriös beantworten?
»Entschuldigung.« Der Beklagtenvertreter wandte sich an sie, bevor sie antworten konnte. »Ich bin mir nicht sicher, ob die Gegenseite Sie über die folgenden unbestrittenen Tatsachen in Kenntnis gesetzt hat, die Sie jedoch vor der Beantwortung der Frage unbedingt kennen sollten. Der Urgroßvater des Klägers war über zehn Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft. Könnte es daher nicht schon hier zu den im Blut nachweisbaren Veränderungen gekommen sein? Der Kläger hätte somit gar nicht nur die Biochemie seines Vaters, sondern bereits die seines Großvaters geerbt. Zudem wissen wir, dass der Kläger ein kleines Drogenproblem hatte. Auch hier stellt sich die Frage, ob nicht vielmehr die Designerdrogen, die er genommen hat, an der Veränderung seiner Epigenetik schuld sind?«
»Aber die Drogen habe ich doch nur genommen, weil es mir so schlecht ging!«, echauffierte sich der Kläger.
Auf den Zuhörerbänken wurde leise getuschelt.
»Ruhe!«, mahnte der Richter.
Der Anwalt hob beschwichtigend die Hände. »Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich möchte nicht die Gräueltaten meines Mandanten rechtfertigen. Für die er im Übrigen bereits bestraft wurde und für die er seine Strafe verbüßt hat, wie ich an dieser Stelle anmerken möchte. Doch die nachweisbaren Unstimmigkeiten im Blutbild des Klägers könnten auch andere Gründe haben.«
Der Richter nickte. Er sah zu Lena. »Ich wiederhole noch einmal meine Frage. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass die Depressionen des Klägers von seinem Vater und dessen Traumatisierung durch den Beklagten stammen? Ist dies in diesem Fall überhaupt beweisbar?«
Gefühlt war sie sich sehr sicher. Sie wusste allerdings, dass es dem Gericht nicht um Gefühle ging. Es war leider nicht auszuschließen, dass die Veränderungen tatsächlich einen anderen Ursprung hatten.
»Das kann ich nicht sagen«, sagte Lena. »Beantworten kann ich Ihnen nur die Frage, ob Traumata und damit verbundene Krankheiten vererbt werden können. Das ist der Fall. Und so kann es auch in diesem Fall gewesen sein. Meiner Ansicht nach spricht vieles dafür, dass es so war. Aber die Einwände des Beklagtenvertreters sind durchaus berechtigt.«
Der Richter runzelte die Stirn. Lena sah zur Klägerbank, auf der es unruhig geworden war. Der Kläger flüsterte seinem Anwalt aufgeregt etwas ins Ohr. Auf der Beklagtenseite gab es entgegen ihrer Erwartung keine weitere Reaktion. Sie hätte mit einem siegessicheren Lächeln zumindest des Anwalts gerechnet, doch er und sein Mandant verzogen keine Miene.
Der vorsitzende Richter sah auf die Uhr. »Ich möchte an dieser Stelle noch einmal einen Vergleich anregen. Da durchaus einige Gründe für die Vererbung sprechen …« Er sah zu dem Beklagtenvertreter, der nur den Kopf schüttelte. »Auf keinen Fall?«, fragte der Richter noch einmal nach.
»Nein. Wir wollen ein Urteil.«
»Also gut.« Der vorsitzende Richter sah zu seinen Kollegen. »Ich erkläre die Sitzung damit für geschlossen. Die Urteilsverkündung erfolgt in zwei Wochen zur gleichen Zeit im selben Saal.«
5
Noch im Gerichtsgebäude wurde Lena von einer jungen Frau eingeholt. »Hier!«, sagte sie auf Englisch. Sie drückte Lena eine kleine Styroporschachtel in die Hand und sah sie mit ihren schmalen blauen Augen erwartungsvoll an.
Die Frau war vielleicht Anfang zwanzig. Sie war groß, fast einen Kopf größer als Lena, und sehr schlank, wirkte aber nicht androgyn, sondern hatte durchaus weibliche Formen. Sie trug einen olivfarbenen Parka mit einem »Fridays for Future«-Button auf der Brust. Unter dem offenen Parka blitzte eine Kette mit einem Anahata-Symbol hervor, eine Chakra-Kette, wie Lena von ihrer Mutter wusste. Ihre kritischen Augen drückten eine gewisse Scheu, vor allem aber Neugierde aus.
Ohne darüber nachzudenken, was sich in der Schachtel befinden könnte, öffnete Lena diese sofort wie ein Geschenk, das ihr gerade von einer Kollegin überreicht worden war. Im selben Augenblick wunderte sie sich über sich selbst. Wie kam es, dass sie dieser Frau so bedenkenlos vertraute? Wahrscheinlich war ihr Verhalten jedoch weniger über ihr Vertrauen der Fremden gegenüber zu erklären als über ihre kaum zu bremsende Neugierde.
In der Schachtel befand sich etwas Kühlmaterial und eine Ampulle mit einer orangenen Flüssigkeit.
Die Frau war Lena schon zuvor im Gerichtssaal aufgefallen, wo sie in der letzten Reihe auf der Zuschauerbank neben einigen eifrig mitschreibenden Journalisten gesessen hatte. Der Prozess, von der Presse immer nur der »Trauma-Prozess« genannt, hatte für einiges Aufsehen gesorgt. Wenn Lena die Lage richtig einschätzte, würde das zu erwartende Urteil das ebenfalls tun, ein Urteil, das sie, obwohl sie keine Sympathie für den Kläger empfand, nicht wirklich befriedigte.
»Ms Bondroit, Sie arbeiten doch für das International Institute for Epigenetics«, sagte die Frau. Ihr Englisch hatte einen nordischen Akzent. Lena tippte auf Norwegen oder Schweden.
»Richtig. Und wer sind Sie?«
»Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie den Inhalt dieser Ampulle auf Substanzen untersuchen könnten, die möglicherweise Eizellen schädigen können? Gegen Bezahlung natürlich.«
Lena trat einen Schritt zurück und ging ein wenig auf Abstand. Das ging ihr jetzt doch zu weit. Sie mit einem derartigen Anliegen im Gericht regelrecht zu überfallen, noch dazu, ohne sich überhaupt vorzustellen, empfand sie als unpassend. Daran änderte leider auch der Umstand nichts, dass ihr die junge Frau durchaus sympathisch erschien. Wäre sie Lena in einem Seminar oder auf einer Party begegnet, dann hätte Lena sie bestimmt näher kennenlernen wollen. Sie hatte etwas Besonderes an sich, wirkte nicht null-acht-fünfzehn, gerade ihr Blick machte sie interessant – neugierig und wach, und gleichzeitig lag ein Schatten darin. »Nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich würde es für das Beste halten, wenn Sie sich mit dieser Bitte direkt ans Institut wenden.«
Die junge Frau sah betreten zu Boden. »Aber …«, druckste sie herum.
»Ja?«, half Lena nach.
»Da war ich heute morgen schon.«
»Und?«, fragte Lena, obwohl sie ahnte, was man ihr dort gesagt hatte.
»Der Mann, mit dem ich sprach, meinte, dass man mir nicht helfen könne und ich mich an ein Labor wenden solle.«
Dieselbe Absage hätte Lena ihr wahrscheinlich auch erteilt. Das Institut lehnte es vom Grundsatz her eher ab, Proben von Privatpersonen zu analysieren. Auch nicht für Geld.
»Ich habe dort nach Ihnen gefragt. Da sagte man mir, dass Sie heute bei Gericht sind. Ich dachte, ich versuche einfach noch mal mein Glück. Wenn ich Sie direkt frage, vielleicht … Ich habe einfach gehofft, dass Sie …«, erklärte die Frau weiter und begann, etwas hilflos mit den Armen zu rudern.
»Ich?«, fragte Lena verwundert. »Warum wollten Sie ausgerechnet zu mir?«
»Na ja. Weil wir Sie doch aus der Presse kennen. Sie werden immer wieder im Zusammenhang mit Fällen zitiert, in denen Sie für Opfer vor Gericht stehen.«
»Verstehe«, sagte Lena. In der Tat war es in der Regel sie, die das Institut vor Gericht vertrat, auch wenn die Gutachten eher in Teamarbeit erstellt wurden. Einige ihrer Kollegen waren zwar brillante Wissenschaftler, hatten aber wenig Talent, sich und damit das Institut in offiziellen Zusammenhängen angemessen zu repräsentieren. Und so fiel die Wahl recht häufig auf Lena.
»Hören Sie, es ist wirklich wichtig«, bat die Fremde und holte tief Luft. Sie sah auf die Uhr.
Irgendwie tat sie Lena leid. Zudem erweckte sie in ihr fast mütterliche Gefühle. »Darf ich fragen, wie Sie überhaupt darauf kommen, dass diese Substanz«, Lena schüttelte das Kästchen mit der Ampulle, das sie immer noch in der Hand hielt, »Eizellen schädigen könnte?«
Die Frau seufzte. »Weil ich keine Kinder bekommen kann. Ich bin unfruchtbar.«
Lena war verblüfft über die Offenheit. Sie verstand jetzt auch, warum die junge Frau beinahe etwas Verzweifeltes an sich hatte. »Das tut mir leid«, sagte sie.
Für einen Moment sagten sie beide nichts. Die Frau sah zur Seite, den Blick auf etwas in der Ferne gerichtet, das es gar nicht gab. Sie wirkte abwesend, wie in einer anderen Welt.
»Ist es ein Präparat, das Sie einnehmen müssen?«, fragte Lena nach.
Die Frau schüttelte den Kopf. Jetzt war sie wieder voll da. »Nicht ich, meine Mutter. Und ich glaube, meine Unfruchtbarkeit ist vererbt. Ich möchte wissen, ob meine Eizellen durch epigenetische Veränderungen bei meiner Mutter geschädigt wurden.«
»Ach so?« Das erklärte zumindest, warum sie auf Lena und das Institut gekommen war. Ihr Anliegen war speziell, aber Sie schien sich auszukennen und zu wissen, wonach sie suchte: nach Spezialisten, die sich mit der Vererbung von epigenetischen Faktoren auskannten. Es schien sich um eine Art Contergan-Fall zu handeln, nur dass es hier um ihre Fruchtbarkeit ging. »Und wofür nimmt ihre Mutter das Präparat?« Ob sie wollte oder nicht, der Fall begann Lena zu interessieren.
»Um ewig jung zu bleiben«, sagte die Frau.
Einmal mehr war Lena verblüfft über eine Antwort, die sie so nicht erwartet hätte. Die Frau sah erneut auf die Uhr.
»Sie haben es eilig?«
»Ehrlich gesagt …« Die Frau verdrehte die Augen. »Ms Bondroit, wenn Sie mir nicht helfen können, würde ich wenigstens gern meinen Rückflug bekommen.«
»Rückflug?«
»Nach Schweden. In gut zwei Stunden.«
»Sie sind extra aus Schweden angereist, um mir diese Ampulle zu überreichen?«, fragte Lena überrascht.
»Wir wollten sicherstellen, dass die Ampulle heil bei Ihnen ankommt.«
»Wir?«, fragte Lena.
Die junge Frau sah erneut auf die Uhr. Sie begann wie ein kleines Kind, das auf die Toilette musste, von einem Bein aufs andere zu tänzeln. »Es gibt noch jede Menge anderer Frauen auf der Insel, die ebenfalls unfruchtbar sind und deren Mütter dieses Mittel genommen haben. Die Geschichte ist ein wenig länger. Aber …«
»Sie müssen los«, vervollständigte Lena den Satz, während ihr etliche Fragen in den Kopf schossen. Sie sah auf die Schachtel in ihrer Hand. Auch wenn das Institut diese Art von Anfragen normalerweise nicht annahm, hatte Lena das Bedürfnis, bei dieser Frau eine Ausnahme zu machen. Sie war extra aus Schweden angereist, hatte sich nicht abschütteln lassen. Sie hatte Biss. Das gefiel Lena. Zudem klang der Fall nicht uninteressant. »Passen Sie auf. Sie lassen mir jetzt einfach die Ampulle da und geben mir Ihren Namen und Ihre Nummer. Wir telefonieren dann noch einmal in Ruhe. Ich werde sehen, ob ich etwas für Sie tun kann.«
»Wirklich? Das ist super! Danke!« Die Frau begann über beide Wagen zu strahlen. »Vielen Dank!« Sie griff in die Tasche, die sie bei sich trug, und entnahm ihr eine Visitenkarte, die sie Lena übergab.
»Apotek – Ägare: Ebba Langholm«, las Lena laut vor. »Respekt. Sie sind die jüngste Apothekerin, die ich je kennengelernt habe.«
Die Frau verdrehte beschämt ihre Augen. »Ist nicht meine Karte. Sie gehört einer Freundin. Es wäre toll, wenn Sie direkt sie anrufen könnten. Ebba kennt sich besser mit den Hintergründen aus.« Die junge Frau zog sich die Kappe ihres schwarzen Kapuzenpullis über den Kopf, den sie unter dem Parka trug, und hielt Lena ihre Hand hin. »Ich bin übrigens Astrid.«
»Freut mich, Lena«, sagte sie. Sie hatte es immer schon seltsam empfunden, in englischer Sprache mit Ms Bondroit angesprochen zu werden.
Ihre Blicke trafen sich. Es war ein intensiver Blickkontakt, keine flüchtige Begegnung, eher so, als wollte jede von ihnen ergründen, was für ein Mensch die andere war. Dabei hatte Lena das Gefühl, dass sie das gar nicht nötig hatte. Vielleicht lag es an der Offenheit, mit der Astrid intime Details über sich verraten hatte. Denn obwohl sich Lena sicher war, Astrid noch nie begegnet zu sein, hatte sie das Gefühl, sie bereits zu kennen.
6
Tagebuch, 19.10.2029
Die Reise war toll. Ich bin Ebba und Loke sehr dankbar dafür, dass sie mich ausgewählt haben, nach Deutschland zu fliegen. Ebba fehlte die Zeit wegen ihrer Apotheke. Und Loke wäre sicherlich der Falsche gewesen. Da hatte Ebba schon recht. Zum Glück gab es keine weitere Freiwillige.