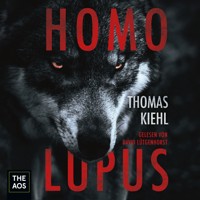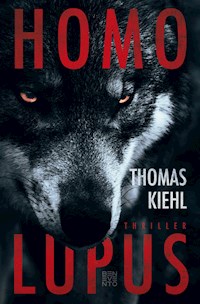
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Benevento
- Sprache: Deutsch
Der Kampf der Alphatiere: packender Thriller aus der Welt der Politik und Wissenschaft Wie stoppt man die kriminellen Machenschaften eines gefährlichen Clans? Diese Frage bringt einen Beamten des Verfassungsschutzes eines Tages zu Lena Bondroit. Die Verhaltensbiologin erforscht, wie Wölfe miteinander kommunizieren. Kann ihr Wissen über die Rudel-Organisation der Wölfe dabei helfen, das Familiensystem von Clans zu verstehen? Die Aufgabe ist denkbar heikel: Der Aziz-Clan plant einen Anschlag, der unbedingt verhindert werden muss. Im Vorfeld der Wahlen beginnt nun ein Wettlauf gegen die Zeit. Wovon Lena Bondroit nichts ahnt: Zur gleichen Zeit setzt ein antidemokratischer Männerbund alles daran, die Wahlen zu manipulieren. Die neue Partei »Die bürgerliche Mitte« um den Kanzlerkandidaten Jan Berger treibt ein dubioses Spiel. Die Biologin gerät bald in ein Fadenkreuz aus Intrigen und skrupellosen Machtkämpfen. Kann sie gerettet werden, bevor das Pulverfass explodiert? - Der zweite Teil der Krimireihe rund um die Biologin und Verhaltensforscherin Lena Bondroit - Fundiert recherchiert: Welche Rückschlüsse können wir vom Verhalten des Wolfes auf uns Menschen ziehen? - Rasanter Thriller mit einer geballten Ladung Spannung, Naturwissenschaft und Gesellschaftskritik Das Tier in uns: entlarvende Einblicke in die menschliche Psyche Der Autor Thomas Kiehl nutzt in seinen Thrillern verhaltensbiologische Phänomene als Ansatz für die Ermittlungen. So zeigt er interessante Parallelen zwischen menschlichem und animalischem Verhalten. In diesem Politthriller entwirft er ein beängstigendes Zukunftsszenario, das sich als überraschend realitätsnah herausstellt: So konnten wir während der Corona-Pandemie das Entstehen neuer Parteien und politischer Bewegungen ebenso beobachten wie einen kleineren Börsencrash im März 2020. Ein spannender Roman, der nicht nur Nervenkitzel garantiert, sondern auch die Aufmerksamkeit auf wichtige gesellschaftliche Themen richtet! »Kiehl schürt die Angst vor der Angst. So können Verschwörungstheorien wirklich Spaß machen!« 3sat Kulturzeit
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
THOMAS KIEHL
Homo Lupus
Thriller
Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Autoren bzw. Herausgeber und des Verlages ist ausgeschlossen.
1. Auflage 2021
Copyright © 2021 by Thomas Kiehl
Copyright deutsche Erstausgabe © 2021
Benevento Verlag bei Benevento Publishing Salzburg – München, eine Marke der Red Bull Media House GmbH, Wals bei Salzburg
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übersetzung, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:
Red Bull Media House GmbH
Oberst-Lepperdinger-Straße 11–15
5071 Wals bei Salzburg, Österreich
Satz: MEDIA DESIGN: RIZNER.AT
Gesetzt aus der Minion Pro, Futura
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Umschlagmotiv: © Chris Ensminger on Unsplash
Tatzen: © shutterstock.com
ISBN: 978-3-7109-0108-9eISBN: 978-3-7109-5112-1
Für meine Familieund alle,die sich auf das ExperimentFamilie eingelassen haben.
Inhalt
Zwei Tage nach der Wahl
Zwei Tage vor der Wahl
14 Tage vor der Wahl
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
13 Tage bis zur Wahl
Kapitel 10
Kapitel 11
9 Tage bis zur Wahl
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
8 Tage bis zur Wahl
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
7 Tage bis zur Wahl
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
6 Tage bis zur Wahl
Kapitel 25
Kapitel 26
5 Tage bis zur Wahl
Kapitel 27
4 Tage bis zur Wahl
Kapitel 28
3 Tage bis zur Wahl
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
2 Tage bis zur Wahl
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
1 Tag vor der Wahl
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Wahltag
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Ein Monat nach der Wahl
Kapitel 61
Zwei Monate nach der Wahl
Nachwort
Danksagung
»Mächtige Rituale halten uns zusammen,leere bringen uns auseinander.«
Prof. Van Dahlen
Zwei Tage nach der Wahl
»In diesen Zeiten lernt man seine Freunde von einer ganz anderen Seite kennen.«
Lothar Schmidt, Ingenieur, Dresden
»Alle sehen mich böse an. Dabei ich kommen aus Marokko. Ich mit ganzen Scheiß nix zu tun haben!«
Mohammed Qamari, Taxifahrer, München
»Immer, wenn meine beiden erwachsenen Kinder sonntags zum Kuchen zu mir kommen, gibt es Streit. Wie soll es nur weitergehen mit uns? Ich hoffe, die Zeiten führen uns wieder ein wenig zusammen.«
Vanessa Oberländer, Mutter, Nürnberg
»Ich habe mich vor ein paar Wochen in einen Teilnehmer meines Seminars verliebt. Er meldet sich nicht mehr. Ob das was mit der Wahl zu tun hat?«
Hanna Riefen, Erwachsenenbildung, Berlin
»Für mich hat sich wenig geändert. Das Vieh will sein Futter. In zwei Monaten wird gesät.«
Adrian Buschwerk, Landwirt, Münster
Zwei Tage vor der Wahl
Abgesehen von der abwaschbaren Gummimatratze gab es in der Zelle nichts, was man hätte zerstören können. Das Bett war gemauert und wie der gesamte restliche Raum weiß gekachelt. In einer Ecke hatte man eine Toilette ohne Klobrille und ein kleines Waschbecken, alles aus Stahl, angebracht. Es roch säuerlich, im besten Fall nach einem stark essighaltigen Reinigungsmittel – im schlechtesten nach dem Erbrochenen irgendeines armen Teufels, den sie hier zuvor untergebracht hatten.
Er hörte, wie sie die Tür hinter ihm zuschlossen. Immer noch fassungslos darüber, was gerade passiert war, brauchte er einen Moment, um sich zu sortieren. Dann drehte er sich um und hämmerte gegen die Stahltür.
»Ich will einen Anwalt sprechen!«
Keine Reaktion.
Er versuchte es erneut, dieses Mal deutlich lauter: »Ich will verdammt noch mal mit einem Anwalt sprechen!«
Wieder keine Reaktion, obwohl sie ihn hörten, da war er sich sicher.
Er blickte nach oben, zur Decke. Das grelle, sirrende Licht der Leuchtstoffröhren machte ihn wahnsinnig. Und dieser Geruch!
Dann trat er zu. Das dumpfe Geräusch von Gummisohlen, die auf Metall trafen.
»Hallo! Einen Anwalt! Sofort!«
Er trommelte mit der Faust gegen die Tür und stieß die übelsten Beschimpfungen aus, obwohl er wusste, dass das alles nichts brachte. Diese Schweine. Es würde keinen Anwalt geben.
Frustriert ließ er sich gegen die kalten Fliesen fallen. Eine unglaubliche Müdigkeit brach über ihn herein. Die letzten 48 Stunden waren die Hölle gewesen. Doch daran lag es nicht. Er liebte die Hölle – war wie für sie geschaffen. Was ihn so kraftlos machte, war das Gefühl, eine Partie verloren zu haben, ohne die Chance auf Revanche – denn die würden sie ihm sicherlich nicht geben.
Langsam ließ er sich zu Boden gleiten. Dann kämpfte er sich auf allen vieren zum Bett. Dort legte er sich auf den Rücken und schloss die Augen.
Er fragte sich, ob sie Bondroit auch schon in ihrer Gewalt hatten. Oder vertrauten sie darauf, dass sie ihren Mund hielt? Denn darum ging es ihnen doch?
Er musste an ihre erste Begegnung denken, damals, sechs Jahre war es her. Aufgrund ihrer aufbrausenden Art hatte er sie für ein unsicheres, verstocktes Frauchen gehalten, das man nicht wirklich ernst nehmen musste. Er hatte sich getäuscht. Bondroit war blitzgescheit. Und sie hatte etwas, was man immer seltener fand: einen unbestechlichen Glauben an die Gerechtigkeit und den Mut, dafür zu kämpfen. Wer sie herausforderte, musste damit rechnen, dass er in ihr ungeahnte Energien freisetzte. Zudem hatte sie jetzt als Mutter noch etwas dazugewonnen, um das es sich zu kämpfen lohnte – einen Sohn. »Unterschätzen Sie nie die Bindungskräfte einer Familie«, hatte sie ihn gelehrt, und die Kampfbereitschaft einer Mutter, wenn es um ihre Kinder geht.
Er hingegen, obwohl gerade erst fünfzig Jahre alt, hatte das Gefühl, sein Leben gelebt zu haben. Alles, was jetzt noch kam, waren Erniedrigungen im Job, zunehmende Fettleibigkeit, Magengeschwüre und Erektionsprobleme. Zudem gab es wenige Menschen, die ihn vermissen würden, da machte er sich keine Illusionen.
Er ballte die Faust und schlug mit aller Kraft gegen die Wand. Verdammt! Wie hatte er sich nur so blenden lassen können. Blut rann an seinen Knöcheln herab. Der Geruch von Eisen.
Wenn sie Bondroit etwas antaten … Er hätte sie nie in den Fall reinziehen dürfen.
Erneut schlug er zu, und jetzt spürte er auch den Schmerz, der ihm von der Hand bis in den Arm schoss.
»Gott, ich hasse dich! Ich hasse dich so sehr, als würde ich wirklich an dich glauben.«
14 Tagevor der Wahl
1
»Und warum hast du einen so großen Mund?«
»Damit ich dich besser fressen kann«, kam es kichernd von hinten.
»Und ehe das Rotkäppchen es sich versah, sprang der Wolf aus dem Bett und verschlang es mit einem Biss. Dann schlief er zufrieden ein. Kurz darauf kam der Jäger zum Haus der Großmutter. Der Wolf hatte sich zwar als Großmutter verkleidet, doch der Jäger durchschaute ihn sofort. Und als er den dicken Bauch sah, war ihm klar, was passiert sein musste. Er nahm sein Messer aus dem Gürtel, schnitt dem Wolf den Bauch auf und befreite die Großmutter und das Rotkäppchen. Und wenn sie nicht gestorben sind …«
»… leben sie noch heute.«
Lena blieb stehen und hielt sich die Hand zum Schutz gegen die tief stehende Sonne an die Stirn. Das bunte Glitzern der unberührten Schneedecke, der angrenzende dichte Wald, dessen Tannen mit Weiß überzuckert waren, der Duft nach feuchter Kälte und Holz. Das waren die Momente, in denen ihr wieder klar wurde, warum sie aufs Land gezogen war. Ein perfekter Ort, an einem perfekten Tag. Wenn das mit Michael nicht gewesen wäre. Und die Wölfe fehlten.
»Mami!«
»Ja?« Lena langte mit ihrer Hand hinter ihren Kopf und streichelte Jean über seine dicke Mütze. Während sie sich seit zwei Stunden im knöcheltiefen Schnee durch kleinere Waldstücke in der Brandenburger Schorfheide kämpfte, saß ihr dreieinhalbjähriger Sohn gemütlich in seiner Kraxe und wollte Geschichten hören. Bereits fünfzehn Minuten nach ihrem Aufbruch hatte er behauptet, nicht mehr laufen zu können. Ein wenig konnte sie ihn sogar verstehen. Das Laufen durch den frischen Schnee war beschwerlich. Doch wenn man Wölfe beobachten wollte, war Schnee von erheblichem Vorteil. Die Tiere waren mit ihrem überwiegend braungrauen Fell vor einer weißen Kulisse besser auszumachen. Vor allem aber vereinfachte der Schnee die Spurensuche. So weit die Theorie.
»Und dann?«
»Was meinst du?« Lena war über die Frage verwundert. »Der Wolf ist tot. Und die Geschichte zu Ende.«
»Ja. Aber dann?«
Für Jean war die Geschichte anscheinend noch nicht zu Ende. »Na ja, das Rotkäppchen hat sich dann ein Gewehr gekauft und alle Wölfe erschossen.«
»Wirklich?«, fragte Jean.
»Wirklich«, sagte Lena.
Sie musste daran denken, wie man den Wolf in Deutschland ausgerottet hatte. Er hatte weiß Gott keinen guten Ruf gehabt. Doch im Märchen vom Rotkäppchen ging es – wollte man den Psychologen glauben, die das Märchen interpretiert hatten – gar nicht nur um den angeblich so bösen Räuber. Es ging vor allem darum, Mädchen davor zu warnen, sich von fremden Männern ansprechen und verführen zu lassen. In älteren Versionen der Geschichte fraß der Wolf das Rotkäppchen daher zunächst auch gar nicht auf, sondern lockte es ins Bett.
»Aber die Wölfe sind wieder da!«
»Genau«, gab Lena ihrem Sohn recht. »Sie sind wieder da. Und sie sind gar nicht so böse wie im Märchen.«
»Aber wo?«, fragte Jean.
»Wölfe sind scheue Tiere, du musst Geduld haben.«
Obwohl Geduld nicht gerade zu den Stärken von Jean gehörte, war seine Frage berechtigt. Die nahe gelegenen Felder und Wiesen hatte sie bereits alle abgesucht, ohne auch nur eine einzige Spur zu entdecken. Lenas letztes Ziel war eine größere Lichtung. Dort war sie der Wolfsfamilie – bestehend aus den beiden Leittieren, den zwei Jährlingen und einem älteren Jungtier – vor zwei Tagen vor einem gerissenen Rehkadaver begegnet. Die Wölfe hatten ihre Mahlzeit bereits beendet gehabt und lagen faul in der Sonne. Nur einer der Jährlinge machte sich einen Spaß daraus, die Raben, die sich über die Essensreste hermachten, immer wieder zu vertreiben. Obwohl die Wölfe Lena entdeckt hatten, hatten sie keinerlei Anstalten gemacht aufzubrechen. Vielleicht waren sie durch das Essen einfach zu müde. Oder sie spürten, dass Lena keine Gefahr für sie war. Lena hatte im Laufe der Zeit gelernt, dass Wölfe ein sehr gutes Gespür für Gefahr hatten.
»Bist du noch böse?«
»Böse?« Lena verstand nicht.
»Auf Papa.«
Wie kam er nur plötzlich darauf? »Warum meinst du das?«
»Weil du nicht lachst. Schon die ganze Zeit.«
Lena bezweifelte, dass sie jeden Tag lachte. Aber man durfte nicht alle Worte eines Kindes auf die Goldwaage legen.
»Nein, Jean. Ich bin nicht böse auf Papa«, sagte Lena, was nicht gelogen, aber auch nicht die ganze Wahrheit war. Als sie heute Morgen aufgestanden war, war Michael nicht da gewesen. Er hatte einen Zettel in der Küche hinterlassen, dass er kurz in die Werkstatt müsse, aber mittags wieder zurück sei, um sich ums Essen zu kümmern. »Böse« war sie wegen des Zettels und seiner Abwesenheit nicht gewesen – eher enttäuscht, und diese Enttäuschung musste Jean ihr angemerkt haben. Der Sonntagmorgen war eigentlich ihr gemeinsamer Morgen. Michael machte Kaffee und brachte ihnen zwei Tassen ans Bett. Dann, wenn das Drängeln von Jean nicht mehr zu ertragen war, standen sie auf und bereiteten ein üppiges Frühstück mit Eiern, Speck und frischem Obstsalat zu. Der Sonntag war einer der wenigen Tage, an denen sie sich Zeit ließen. Es war ihr festes Ritual. Zumindest war es das mal gewesen.
»Aber Mami!«
»Ich bin wirklich nicht böse auf Papa!«, sagte Lena ein wenig genervt.
Wahrscheinlich hätte sie Michaels Abwesenheit beim Frühstück nicht mal gestört, wenn sie nicht das Gefühl gehabt hätte, dass er sich in letzter Zeit ein wenig zu viele »Auszeiten« gönnte. Dass er am Sonntag wirklich zum Arbeiten in die Behindertenwerkstatt musste, bei der er seit einigen Jahren angestellt war, nahm sie ihm einfach nicht ab. Wofür? Am Sonntag war die Werkstatt zu. Und selbst wenn es dringenden Papierkram gab, so hätte er diesen von zu Hause aus erledigen können. Erst letztes Wochenende war er auf einer Schulung in Süddeutschland gewesen. Und jetzt schon wieder den halben Sonntag weg? Die ganze Arbeit mit Jean und dem Haushalt blieb an ihr hängen, und sie kam mit ihrem Wolfsprojekt nicht weiter. So war das ursprünglich nicht verabredet gewesen.
»Und wir finden bestimmt noch Spuren«, lenkte Lena das Thema wieder auf die Wölfe. Wirklich glauben konnte sie das allerdings selbst nicht. Sie ergriff das um ihren Hals baumelnde Fernglas und ließ ihren Blick über den Schnee und den Waldrand schweifen.
»Ich will auch!«, kam es direkt von hinten.
»Moment!« Lena meinte ein paar Spuren am gegenüberliegenden Waldrand entdeckt zu haben. Sie stellte das Fernglas scharf. Zwei größere Abdrücke vorne, zwei kleinere nacheinander gesetzt hinten. Eindeutig ein Hase. »Da gibt es nicht viel zu sehen.«
»Trotzdem.«
»Aber dann läufst du ein Stück.« Sie hätte nie für möglich gehalten, welch großen Anteil das Androhen von Strafen, Bestechung und Erpressung in der Erziehung von Kleinkindern einnahm.
Hinter ihr wurde es kurz ruhig. »Okay.«
»Versprochen?«
Wieder eine längere Pause. Zumindest schien sich Jean bewusst zu sein, dass man Versprechen nicht einfach so brach.
»Ja. Gib her!«
Nachdem Lena die Kraxe auf den Boden gestellt und Jean daraus befreit hatte, griffen seine kleinen Finger gierig nach dem Fernglas. Zunächst ahmte er Lena nach und ließ es langsam über die Lichtung und den angrenzenden Waldrand schweifen. Dann sah er abwechselnd zu Boden und in die Baumkronen, um am Ende durch das Objektiv Lena anzustarren. Er begann zu kichern. »Mami. Ich sehe dich gar nicht.«
Lena musste lachen. Wie süß er aussah, den Kopf in den Nacken gelegt, das viel zu große Fernglas vor den Augen. »Du musst es an dem kleinen Rad in der Mitte scharf stellen.«
»Wo?«
Jean nahm das Fernglas von den Augen und suchte nach dem Rad. Nachdem er es entdeckt hatte, drehte er ein wenig daran herum. Dann setzte er es erneut vor die Augen. »Es funktioniert nicht!« Und schon war das Fernglas wieder uninteressant. Er reichte es ihr zurück.
»Ich glaube, wir haben heute einfach kein Glück. Komm!« Lena reichte ihm ihre Hand. »Wir kehren um. Papa wartet sicherlich schon mit dem Mittagessen. Wir könnten nach Stöcken suchen«, schlug sie vor. Das würde ihn eine Zeit lang motiviert halten, selbst zu laufen. »Da hinten im Wald. Da gibt es bestimmt welche.«
Jean rannte sofort los. Kurz darauf kam er mit einem dicken Ast zurück und drückte ihn Lena in die Hand, damit sie ihn vom Schnee und den Verästelungen befreite.
»Für dich«, sagte Jean stolz. Und schon rannte er wieder los und verschwand hinter einer kleinen Felsformation. Ihr wäre es lieber gewesen, er hätte sich seine Kräfte eingeteilt.
»Mami!«
»Ja?« Jetzt kam er bestimmt gleich mit einem halben Baum zurück, der alle Dimensionen sprengte, denn der zweite Stock war schließlich für ihn selbst bestimmt. »Was denn?«
Keine Antwort.
»Jean?« Lena ging um die Felsen herum.
Wie angewurzelt stand er da. Instinktiv blieb sie ebenfalls sofort stehen.
»Ganz ruhig!«, flüsterte Lena. »Sieh ihnen nicht in die Augen, hörst du!«
Keine zehn Meter von Jean entfernt standen fünf Wölfe. Sie starrten abwechselnd sie und ihren Sohn an. Dann löste sich eines der Tiere aus dem Rudel und bewegte sich langsam auf Jean zu.
2
Der Wolf sah Jean einfach nur an. Kein Zähnefletschen, kein wildes Knurren oder Heulen, wie man es aus Horrorfilmen kannte. Alles war gespenstig ruhig.
»Nicht bewegen!«, flüsterte Lena. Vor allem nicht wegrennen, dachte sie, sprach es aber nicht aus, damit Jean gar nicht erst auf die Idee käme.
Sie hob den Stock, den ihr Jean gegeben hatte, über den Kopf und ging langsam auf den Wolf zu. Der Wolf sah verunsichert zu ihr herüber. Dem vollen Fell und der Größe nach zu urteilen, war er einer der Jährlinge. Jetzt blickte er zu seinem Rudel zurück.
Auch Lena sah zu dem Rudel. Sie merkte, wie angespannt sie war. Dabei gab es eigentlich keinen Grund. Menschen werden von Wölfen nicht als Beutetier angesehen. Und Wölfe gehören auch nicht zu den Tierarten, die sofort angreifen, dazu sind sie viel zu scheu. Solange es eine Möglichkeit gibt zu flüchten, werden sie das tun. Ihr schlechter Ruf basiert mehr auf den Märchen und Geschichten, die man sich seit Jahrhunderten über sie erzählt. Fakt ist allerdings, dass es um ein Hundertfaches wahrscheinlicher ist, auf einer Weide von Kühen zertrampelt, als von einem Wolfsrudel verletzt zu werden. Doch all das Wissen beruhigte Lena nicht wirklich, denn leider konnte man nie hundertprozentig ausschließen, dass sich ein Wolf nicht doch anders verhielt und dass dieser hier ihrem Sohn etwas antun könnte. Wer wusste schon, was das Rudel für Erfahrungen mit Menschen gemacht hatte? An Tollwut wollte sie gar nicht erst denken.
Den Stock so über ihrem Kopf platziert, dass sie damit sofort zuschlagen konnte, bewegte sie sich langsam weiter auf den Jährling zu.
Der junge Wolf blickte jetzt zu dem größten Tier des Rudels, als wartete er auf Anweisung. Der Leitwolf sah kurz zu Lena, dann zu Jean. Dann ging er einfach weiter. Das Rudel folgte ihm. Auch der Jungwolf drehte ab und sprang seiner Familie hinterher. Kurz darauf waren sie im Gebüsch verschwunden und nicht mehr zu sehen.
Lena sprang auf ihren Sohn zu, der immer noch wie angewurzelt dastand und in die Richtung starrte, in die die Wölfe verschwunden waren. Sie umarmte ihn, drückte ihn so fest an sich, wie sie ihn noch nie gedrückt hatte. »Oh, Jean. Das hast du toll gemacht.« Tränen schossen ihr in die Augen.
Auch Jean presste sich an sie. Doch dann versuchte er, sich aus ihrer Umarmung zu lösen. »Mensch, Mami. Du verdrückst mich ja!«
Lena ließ ihn los. Sie wischte sich die Tränen aus den Augen. »Ich verdrück dich nicht. Ich habe dich nur so unendlich lieb.« Sie streichelte ihm über die Wange. »Hattest du gar keine Angst?«
»Quatsch.« Er schüttelte den Kopf. »Mama, waren das echte Wölfe?«
Sie nickte.
»Und wollte der mich essen?«
Lena schüttelte den Kopf. »Nein. Der Wolf war nur neugierig. Er war noch sehr jung. So wie du.«
Jean grinste. »Komm, Mama. Das müssen wir Papa erzählen! Unbedingt!« Er lief sofort los, blieb dann jedoch wieder stehen und rannte zu ihr zurück. Er ergriff ihren Stock. »Brauchst du den noch?«
»Nein. Nimm nur.«
»Wegen der Wölfe. Wenn sie wiederkommen.«
Eine knappe Stunde später hatten sie die große Weide, die an ihr Haus angrenzte, fast erreicht. Im Sommer grasten dort die Kühe des Nachbarn. Lena drückte sich durch das den Wald umgebende Gebüsch und bahnte den Weg für Jean. Und schon tauchte sie vor ihnen auf, die weite weiße Fläche, und dahinter, rund hundert Meter entfernt, das kleine alte Bauernhaus mit dem rauchenden Schornstein. Sie hatten es kurz nach Jeans Geburt gekauft. Michael und sie waren das Berliner Großstadtleben leid gewesen, die vielen Menschen und Touristen, die zunehmende Kriminalität, den Schmutz. Vor allem aber waren sie wegen Jean hier rausgezogen, da sie ihrem Kind ein Aufwachsen in der Natur, mit Tieren und weniger Schadstoffen ermöglichen wollten. Obwohl ihnen klar gewesen war, dass es viel Mühe machen würde, das Haus vernünftig zu renovieren, hatten sie sich sofort verliebt. Dass sie allerdings drei Jahre später immer noch nicht mit dem Renovieren fertig sein würden – die neue Küche kam erst in vier Wochen –, das hätte sich Lena selbst in ihren übelsten Träumen nicht vorstellen können. Und dass sie das anderthalb Stunden entfernte Berlin so häufig vermissen würde, auch nicht.
»Runter!«, forderte Jean. Er war die überwiegende Strecke des Heimwegs selbst gelaufen, doch vor rund einem Kilometer hatte er Lena dann doch gebeten, wieder in die Kraxe zu dürfen. Sie nahm sie vom Rücken und ließ ihn herausklettern.
»Aber Mama! Das mit dem Wolf, Mama, das erzähle ICH!«
»Ist doch klar.«
Hoffentlich hatte Michael schon das Mittagessen vorbereitet. Sie hatte einen wahnsinnigen Hunger. Und auch wenn Jean sich bisher noch nicht beschwert hatte, er sicherlich auch. Da konnte die gute Stimmung schnell kippen.
»Mama!« Jean zeigte auf die kleine Landstraße, die auf der einen Seite der Wiese vorbeiführte. Ein schwarzer Van fuhr dort entlang. »Besuch!«
»Der will nicht zu uns«, erklärte Lena.
Obwohl auf der Straße, die die zwei benachbarten Dörfer miteinander verband, sonntags eher wenig Verkehr war, war sich Lena sicher, dass sie keinen Besuch erwarteten. Michael hätte ihr auf jeden Fall gesagt, wenn er jemanden eingeladen hätte. Die Sonntage waren Familientage, die sie am liebsten allein verbrachten. Das war eine unausgesprochene Regel, die nur in den seltensten Fällen gebrochen wurde. Und nur nach Absprache.
»Schade.« Jean wandte sich von ihr ab. »Denen hätte ich auch vom Wolf erzählen können.« Er rannte durch das Gebüsch weiter in Richtung Weide. Dann stoppte er.
»Schau!« Er zeigte wieder auf den Van, der nun tatsächlich in den kleinen Schotterweg eingebogen war, der zu ihrem Haus führte. »Der will doch zu uns!«
Lena holte zu ihrem Sohn auf. Gemeinsam beobachteten sie durch das Gebüsch hindurch den Wagen, der auf dem großen Hof vor der alten Scheune zu stehen kam. Kaum hatte er geparkt, wurden auch schon die Seitentüren aufgeschoben, und zwei schwarz gekleidete Männer verließen den Wagen.
Lena merkte, wie ihr plötzlich ganz anders wurde.
»Wer ist das?«, fragte Jean.
»Keine Ahnung«, sagte Lena, was auch der Wahrheit entsprach. Aber sie überkam eine üble Vorahnung. Alte Bilder stiegen in ihr auf. Die Geschichte vor sechs Jahren. Damals war sie aufgrund ihrer Forschung in eine gefährliche Politintrige geraten, bei der sie nur knapp mit heiler Haut davongekommen war. Die Verantwortlichen hatte man zur Rechenschaft gezogen, allerdings waren die Hintergründe nie an die Öffentlichkeit gelangt, geschweige denn vollständig verarbeitet worden. Bislang hatte sie sich damit sicher gefühlt. Doch sie wusste zu viel. War heute der Tag, an dem sie die Sache einholte?
»Komm, Mama!« Jean war bereits dabei, sich aus dem Gebüsch zu kämpfen.
»Nein. Warte!«, zischte sie ihm hinterher.
Er blieb stehen und schaute sie irritiert an. Der Ton in ihrer Stimme ließ ihn zum Glück gehorchen.
Lena ergriff ihr Fernglas. Sie legte es an die Augen und stellte es scharf. Die Männer gingen in Richtung Haus. Was sie schon meinte, ohne Fernglas erkannt zu haben, wurde zur Gewissheit: Beide Männer trugen Pistolengürtel.
Lena griff in ihre Jackentasche und zog ihr Handy heraus. Sie wählte Michaels Nummer. Kein Freizeichen. Sie nahm das Handy vom Ohr und prüfte die Netzqualität. Nicht ein Balken war zu sehen. Diese verdammte Gegend hier draußen!
»Mist!«, fluchte sie leise.
»Was?«
»Ach, nichts. Ich habe nur keinen Empfang.«
»Wen willst du anrufen?«
»Papa.«
»Wegen dem Wolf?«
Lena sah erneut durch das Fernglas. Leider war der Van so geparkt, dass sie von ihrer Position aus die Eingangstür ihres Hauses nicht mehr sehen konnte.
»Mama, ich will das mit dem Wolf …«
»Ich weiß«, unterbrach Lena ihren Sohn herrisch. »Später, Liebling, versprochen.« Sie wollte Jean nicht unnötig Angst einjagen. Sicherlich gab es für diesen »Besuch« eine ganz harmlose Erklärung.
Sie sah erneut auf ihr Handy, als würde der Empfang allein durch das Draufstarren besser werden. Dann überlegte sie, zu den Nachbarn zu gehen, den Tönnes, um Michael vom Festnetz aus anzurufen. Doch bis zum Hof der Tönnes waren es fast zwei Kilometer. Mit Jean auf dem Rücken brauchte sie dafür bestimmt zwanzig Minuten, wenn nicht länger.
Während sie weiter überlegte, was sie tun könnte, sah sie, wie die zwei Männer wieder zum Vorschein kamen und auf den Van zugingen. Lena beobachtete sie durch ihr Fernglas. Der eine öffnete die Seitentür, während der andere über das Feld blickte, als würde er etwas suchen. Zwei Spuren führten über die ansonsten unberührte Schneedecke. Die von Jean und ihre. Geradewegs auf sie zu.
»Bück dich!«, flüsterte Lena Jean zu, der zum Glück sofort gehorchte. Sie selbst ging ebenfalls in die Hocke.
Nun verließ der zweite Mann wieder den Wagen. Er hatte jetzt etwas in der Hand. Lena erhob sich leicht, um besser sehen zu können. Sie legte erneut die Objektive an die Augen.
»Scheiße«, rutschte es ihr heraus, während sie sich wieder zu Jean kniete. Sie hatte genau in die Linsen eines Fernglases gesehen, das auf sie gerichtet war.
»Sagt man nicht! Sagt man nicht!« Jean grinste.
Lena zog ihn hinter sich durch das Gebüsch in Richtung Wald.
»Ich will zu Papa!«, protestierte er.
»Später. Wir gehen erst noch zu den Tönnes.«
»Nein, Mama. Nicht zu den Tönnes. Ich hab Hunger.«
Lena blieb stehen. Sie beugte sich zu ihrem Sohn hinunter. »Jean, bitte, steig jetzt einfach in die Kraxe. Und dann lässt du Mama so schnell laufen, wie es geht. Ich erkläre dir alles später.«
»Wegen der Wölfe?«, fragte Jean.
Wie kam er nur darauf? Aber vielleicht gab er dann Ruhe. »Ja.«
Lena riss sich die Kraxe von den Schultern. Dann half sie ihm beim Einsteigen. Ein letztes Mal blickte sie zu ihrem Haus zurück. Jetzt standen beide Männer vor dem Van. Der mit dem Fernglas in der Hand zeigte genau in ihre Richtung.
3
»Willkommen zurück bei unserer Sendungsserie ›Countdown zur Wahl‹! Jeden Tag liefern wir Ihnen, liebe Zuhörer, einen Einblick in ein aktuelles Thema zu den bevorstehenden Neuwahlen des Bundestags. Heute haben wir ein hoch spannendes Interview für Sie zum Thema ›Die manipulierte Wahl‹, das wir gestern für Sie aufgezeichnet haben. Mit unserem Kollegen Arno Stange diskutierten der Politologe Professor Manfred Fender und der Parteivorsitzende und Kanzlerkandidat der Partei ›Neue bürgerliche Mitte‹, Jan Berger.«
Das Interview vom Vortag. Berger drosselte die Geschwindigkeit seines Porsche und drehte das Volumen ein wenig auf. Dabei wäre es wahrscheinlich besser, das Radio einfach auszuschalten. Er hatte sich bereits den gesamten gestrigen Tag darüber geärgert, wie man versucht hatte, ihn vorzuführen.
»Herr Professor Fender, Herr Berger, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Seit der Corona-Krise vor fünf Jahren kommt dieses Land nicht mehr zur Ruhe. Zuletzt hat sich der Bundestag kurz nach der Wahl aufgrund von Streitigkeiten der Koalitionspartner wieder aufgelöst. In zwei Wochen sind Neuwahlen – Wahlen in nicht ganz einfachen Zeiten. Das zeigen auch die Umfragen. Fast fünfzig Prozent aller Wähler geben an, noch nicht zu wissen, wen sie wählen wollen. Unser heutiges Thema dazu: Wahlmanipulation. Wir haben es bereits in anderen Ländern erlebt und jetzt auch bei uns: Fremde Staaten mischen sich über die Wahlen in unsere Politik ein, indem sie unter anderem versuchen, über die sozialen Medien und gezielt gestreute Fake-News Parteien zu unterstützen, die ihren Interessen am dienlichsten sind. Derzeit werden die behaupteten Unterschlagungsvorwürfe diskutiert, die dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten seinen Posten und seine politische Karriere kosteten, die sich dann jedoch als falsch herausstellten. Daher die provokante Frage an Herrn Professor Fender: Leben wir überhaupt noch in einer Demokratie, in der das Volk seine Führung wählt, oder sind wir alle nur noch Puppen an fremdgesteuerten Schnüren?«
»Guten Tag zunächst einmal. Und nein, Ihre Frage ist überhaupt nicht provokant. Eine funktionierende Demokratie setzt voraus, dass sich die Wähler frei entscheiden können. Das Grundgesetz garantiert deshalb die freien Wahlen. Ein manipulierter Wähler ist eindeutig kein freier Wähler.«
»Womit wir beim Problem wären. Die sozialen Medien machen es möglich. Und das wissen wir nicht erst seit gestern. Vor vielen Jahren gab es bereits die Einmischung von Russland in die Wahlen der USA. Weniger bekannt sind die politischen Manipulationen vieler Dritte-Welt-Staaten durch große Industrienationen. Und jetzt sind wir dran?«
»Na ja. Lassen Sie uns fair bleiben: Wahlbeeinflussungen gibt es, seitdem es Wahlen gibt. Viel diskutiert wurden im letzten Jahrhundert sogenannte Hirtensprüche. Das waren Wahlempfehlungen des lokalen Geistlichen. Und in Italien hat man sich über die Mafia immer wieder Stimmen gekauft.«
»Also alles nichts Neues, sagen Sie?«
»Das habe ich nicht gesagt. Ich wollte nur klarstellen, dass es Wahlbeeinflussung schon immer gegeben hat. Was in diesem Ausmaß allerdings wirklich neu ist, ist die manipulative Beeinflussung von außen, also durch andere Staaten, vor allem auch durch Fake-News und manipulierte Inhalte in den sozialen Medien.«
»Also doch! Wie können wir uns dagegen schützen?«
»Eine schwierige Frage, auf die ich Ihnen leider keine befriedigende Antwort geben kann. Das Problem ist, dass man die Beeinflussungsmöglichkeiten, die uns das digitale Zeitalter bietet, zu lange nicht ernst genug genommen hat. Die systematische Hetze über das Netz, oft mit perfider technischer Hilfe von Bots aus dem In- und Ausland, ist eine große Gefahr. Hätte man schon vor Jahren mit gesetzlichen und technischen Anpassungen experimentiert, dann wären wir hier sicherlich weiter.«
»Vielleicht genau der Punkt, um zu Ihnen zu kommen, Herr Berger. Selten hat es eine Partei in so kurzer Zeit geschafft, so viele Stimmen zu vereinen. In der ersten Bundestagswahl nach der Corona-Krise schoss Ihre Partei von null auf fünfzehn Prozent. Den neuesten Umfragen zufolge wäre jetzt mit viel Glück sogar eine absolute Mehrheit im Parlament möglich. Doch Ihre reißerische Wahlkampfkampagne in den sozialen Medien steht in der Kritik. Zulässige Wahlwerbung oder schon Manipulation?«
»Guten Tag auch von meiner Seite. Und ich muss sofort klarstellen: Unsere Kampagne zu verdächtigen, manipulativ zu sein, ist natürlich an den Haaren herbeigezogen. Wir kommunizieren einfach, knapp und gut verständlich. Das ist keine Manipulation, sondern unsere Fähigkeit, die Sprache der Bürger zu sprechen, anstatt sie von oben herab mit leeren oder unverständlichen Floskeln abzuspeisen.«
Jetzt, wo er das Interview noch einmal hörte, ärgerte sich Berger über den Vorwurf fast noch mehr. Warum wurde ihre Kommunikationsstrategie immer wieder angefeindet? Die Medien arbeiteten größtenteils ganz ähnlich. Denn wie hatte noch der Philosoph Karl Popper gesagt: »Was man nicht versteht, ist nicht.« Nicht erst seit heute musste man auf dem Niveau von Castingshows kommunizieren, um die Massen zu begeistern. »Sorry, deine Stimme ist scheiße. Aber du siehst geil aus. Und deine Story hat mich echt berührt. Daher willkommen im Recall.« Dass das die anderen Parteien nur sehr begrenzt begriffen hatten, war nicht sein Problem.
Zudem verdankten sie ihren Erfolg nicht allein ihrer Kommunikationsstrategie. Sie waren schlicht und einfach die einzige Partei, die mit einem Programm aufwarten konnte, das für den in Deutschland dringend notwendigen Wandel stand. Von der Wirtschaft wurden sie für ihre liberalen Standpunkte und Vorschläge zur Deregulierung immer nur gelobt. Die Idee, Europa in einen Norden und einen Süden zu zerschlagen, kam ebenfalls gut an, genauso wie auch ihre fundamentale Kritik an der Politik des offenen Geldhahns; Geld, das größtenteils in den korrupten Süden von Europa floss und dort in den durstigen Kehlen von Politikern und Lobbyisten versickerte.
»Es wird Ihnen vorgeworfen, dass Sie sehr populistisch unterwegs sind und es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen. Auch der Vorschlag einer sogenannten Kanzlerdemokratie wird sehr kritisch gesehen. Diesbezüglich wurden Sie in letzter Zeit sogar als ›moderner Möchtegerndiktator‹ bezeichnet.«
»Zunächst zum Punkt, dass wir es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen: Ich weiß, dass sich die Medien hier gerne die alleinige Deutungshoheit zuschreiben. Aber nicht mit uns. Und zum ›Möchtegerndiktator‹ – ich möchte Sie doch bitten, solche Vergleiche in Zukunft zu unterlassen. Eine Kanzlerdemokratie, wie wir sie fordern, ist keine Diktatur. Sie ist schlicht und einfach eine Weiterentwicklung unseres derzeitigen demokratischen Systems. Letztlich ist sie nichts anderes als eine Umsetzung von Führungsprinzipien, nach denen Demokratie schon in vielen Ländern gelebt wird.«
»Auch wenn wir jetzt ein wenig vom Thema abkommen, möchte ich doch kurz darauf eingehen. Sie wollen demokratische Gremien außer Kraft setzen, die gerichtliche Überprüfbarkeit von staatlichen Entscheidungen reduzieren und viele Mitspracherechte des Parlaments einschränken. Sie wollen insbesondere auch ein erweitertes Durchgriffsrecht des Kanzlers nicht nur im Kriegsfall. Das mag so manch einen von uns an ein sehr dunkles Kapitel in der deutschen Geschichte erinnern.«
»Jetzt hören Sie doch bitte mit diesen Vergleichen auf! Sie machen sich ja lächerlich! Lassen Sie uns einfach bei den Fakten bleiben. Demokratische Prozesse sind gut und richtig. Ich liebe Diskussionen. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, da müssen Entscheidungen gefällt und konsequent umgesetzt werden. Wenn ein Virus die Welt im Griff hat, dann ist das plötzlich möglich. Das haben wir aus der Corona-Krise gelernt. Doch anschließend sind alle Parteien – außer uns – wieder in ihren Dornröschenschlaf gefallen. Es kann nicht sein, dass wir den durch moderne Technologien geschaffenen Fortschritt, vor allem auch bezüglich einer schnelleren Umsetzbarkeit von Dingen, durch unsere politischen Prozesse immer wieder auf ein mittelalterliches Niveau zurücksetzen. Vor allem können wir uns das im internationalen Umfeld nicht mehr leisten. Ich möchte hier nicht wieder die vielen Beispiele bemühen, wie viele Autobahnen, Bahnhöfe, Krankenhäuser und Flughäfen die Chinesen bauen, während wir gerade den nächsten Gerichtsprozess abwarten oder über den Brandschutz diskutieren. Lassen Sie uns ehrlich sein: Europa ist vergleichbar mit dem Römischen Reich. Selbst träumenden Nostalgikern muss klar sein, wo das alles endet: Wir werden von China überrannt. Und über unsere Arbeits- und Lebensbedingungen werden dann andere entscheiden. Wenn Ihnen das lieber ist – keiner zwingt Sie, mich zu wählen. Aber ich und meine Partei werden das niemals akzeptieren.«
»Aber Herr Berger …«
»Ich bin Demokrat, aus vollem Herzen. Ich liebe unser Land, unsere Werte. Waren die Kanzler und Politiker vor mir, die mit harter Hand regiert und dadurch einiges erreicht haben, Nazis oder Diktatoren? Natürlich nicht. Und was haben die Parteien erreicht, die versucht haben, politische Probleme basisdemokratisch mit Tausenden von Abstimmungsrunden und Diskussionen zu lösen? Manche von ihnen gibt es nicht mal mehr!«
»Demokratie braucht manchmal Zeit. Glauben Sie nicht, dass man die ein oder andere Diskussion benötigt, um sich einem Thema anzunähern?«
»Diskussion? Ja! Endlose Debatten? Ein entschiedenes Nein! Und wissen Sie, warum? Weil das, worauf man sich dann einigt, nicht mehr aktuell ist. Die Zeiten haben sich geändert. Wir sitzen nicht mehr auf einer Kutsche, sondern im Überschallflieger. ›Fail fast‹ heißt es in der Wirtschaft. Und das bedeutet, lieber schnell eine falsche Entscheidung treffen und aus ihr lernen als langsam eine richtige, die dann für den Markt nicht mehr relevant ist. Ich bin für eine Fehlerkultur in den Behörden, nicht eine Kultur, deren Hauptanliegen es ist, ja nicht den eigenen Beamtenstatus zu gefährden. Und wie ich schon sagte: Ich liebe Deutschland. Und ich glaube, wir können auf dieser Welt einiges bewirken … wenn wir wollen.«
Berger schaltete das Radio aus. Den Rest dieses höchst tendenziösen Interviews, in dem fast nur noch dieser alberne Professor zu Wort gekommen war, würde er sich nicht erneut antun. Zudem hatte er das Anwesen der Coppenfelds fast erreicht. Hinter ein paar Bäumen sah man es bereits durchblitzen, das kleine Schloss seines Studienfreundes. Nur noch die Kiesauffahrt, dann wäre er da.
4
Lena wischte sich den Schweiß von der Stirn. Sie keuchte, als hätte sie gerade einen Marathon hinter sich. Ihre Beine und ihr Rücken schmerzten. Vielleicht noch hundert Meter Wald, dann der brache, schneebedeckte Acker, und dann wären sie endlich bei den Tönnes.
Jean saß brav in seiner Kraxe und sagte kein Wort. Kinder können einen in den unmöglichsten Situationen in den Wahnsinn treiben, doch sie spüren auch, wenn es wirklich ernst wird.
Lena drehte sich um und lauschte. Kein lautes Rufen, keine knackenden Äste. Wenn die Männer sie überhaupt verfolgt hatten, mussten sie noch ein ganzes Stück hinter ihnen sein. Sie setzte ihren Weg in leicht reduziertem Tempo fort.
»Wann sind wir da?«
»Gleich«, schnaufte Lena.
Als sie den Acker erreicht hatten, blieb sie kurz stehen und sah sich erneut um. »Ab zum Hof«, sagte Lena mehr zu sich selbst als zu Jean. Dann rannte sie los.
Kurz darauf hatte sie die Scheune der Tönnes erreicht. Sie rannte um einen Haufen alter Bretter herum. Von dort aus suchte sie die Waldgrenze mit ihrem Fernglas nach Bewegungen ab.
Nichts.
Sie verließ ihre Deckung und ging um die Scheune. Mit großer Erleichterung stellte sie fest, dass Eckard Tönnes’ Toyota Land Cruiser vor dem Haus stand. Er schien zu Hause zu sein. Sie ging auf die Haustür zu, die eine Handbreit offen stand. Hier auf dem Land nahmen es die Leute – mit Ausnahme von ihr – mit dem Zuschließen von Türen nicht so genau. Doch Lena überkam ein ungutes Gefühl. Vorsichtig drückte sie die Tür ganz auf.
»Eckard? Sabine?«
Keine Antwort.
Lena lauschte. Irgendwo spielte Musik. Ein bekannter Schlager dudelte das Bild einer heilen Welt vor sich hin. Ansonsten war es still.
»Hallo! Jemand zu Hause?«
Wieder keine Antwort.
Sie betrat den breiten Flur. Ein paar Meter weiter stand eine kleine Kommode, auf der sich die Ladestation für ein mobiles Festnetztelefon befand. Doch das Telefon selbst war nicht zu sehen.
»Hallo?«
Sie machte einen Schritt in Richtung Wohnzimmertür, die direkt neben der Kommode vom Flur abging. Ihre Hand legte sich auf die Klinke und drückte sie langsam herunter. Dann schob sie vorsichtig die Tür auf.
Warme Luft strömte ihr entgegen. Wahrscheinlich war der Kachelofen an. Lena sah sich in dem mit alten Eichenmöbeln vollgestellten Zimmer um. Abgesehen von Tönnes’ Katze, die Lena verschlafen ansah, war niemand hier. Sie ging in den Raum hinein und suchte nach dem Telefon. Dann hörte sie Schritte im Flur.
»Eckard?« Sie drehte sich zur Tür um.
Ein fast zwei Meter großer Mann tauchte im Türrahmen auf. »Ja. Der Eckard.« Sein breites Gesicht wurde durch das freundliche Grinsen noch ein wenig breiter. Er hatte seinen alten, löchrigen Norwegerpulli an, den er eigentlich immer trug. Vielleicht hatte er aber auch mehrere davon. Seine störrischen grauen Haare waren voller Sägespäne. »Was verschafft mir die Ehre?«
»Ich muss dringend telefonieren!«, sagte Lena, der schon in dem Moment, als sie den Satz aussprach, bewusst wurde, wie seltsam das klingen musste.
Eckard sah Lena an, als hätte er sie nicht richtig verstanden. »Alles gut mit dir?«
Lena spürte, wie sich Jean in der Kraxe bewegte. »Hallo, Eckelhard!«
»Ach!« Er ging ein paar Schritte auf sie zu. »Und der kleine Räuber besucht mich auch mal wieder. Da hätte sich Sabine aber gefreut. Die ist dieses Wochenende mit ihrem Chor unterwegs.«
»Entschuldige, Eckard.« Auch wenn es ein wenig unhöflich war, Lena musste so schnell wie möglich Michael anrufen. »Wo ist dein Telefon? Ich erkläre dir alles später.«
Eckard zog sich ein paar Sägespäne vom Pullover. »Ihr Stadtmenschen!« Er schüttelte den Kopf. »Warum zieht ihr eigentlich aufs Land, wenn ihr hier so weitermacht wie vorher?« Er knuffte Jean in die Wange. »Stimmt’s, mein Junge?« Dann ging er zurück in den Flur. »Ich mach uns jetzt erst mal einen Kaffee. Und dann suche ich das Telefon. Keine Ahnung, wo das wieder rumliegt.«
»Eckard …« Lena wollte gerade dazu ansetzen, ihm alles zu erklären, da meinte sie Motorengeräusche zu hören. Sie spitzte die Ohren. Das Brummen eines Dieselmotors, das kurz darauf wieder verklang. Dann das leise Rollen von Schiebetüren.
»Noch mehr Besuch?«
Ohne auf Eckards Frage einzugehen, sah sich Lena hektisch um. Vom Wohnzimmer führte eine Tür zum benachbarten Esszimmer. »Ich bin nicht hier! Verstanden?« Eckard sah ihr verdutzt hinterher, wie sie zur Tür sprang und sie hinter sich zuzog. Vorsichtig legte sie ihr Ohr dagegen und horchte.
»Hallo?«, rief eine ihr unbekannte Stimme.
Sie hörte die schweren Schritte von Eckard, die sich in Richtung Haustür entfernten.
»Guten Tag.«
»Ist Frau Bondroit bei Ihnen?«
»Nein. Warum?« Eckard hielt sich zum Glück an ihre Bitte.
»Wir müssen sie dringend finden«, sagte eine andere Stimme. Wie Lena verwundert feststellte, war es die Stimme von Michael. Das meinte sie zumindest.
»Und wer sind Sie?« Das war wieder Eckard Tönnes.
Die Stimmen wurden leiser. Sosehr Lena auch ihr Ohr gegen die Tür presste, sie konnte nur einzelne Wortfetzen verstehen. Also öffnete sie vorsichtig die Tür zum Wohnzimmer und ging langsam hindurch in Richtung Flur.
»Was hat sie denn ausgefressen?«, hörte sie Eckard fragen.
Jetzt erschallte ein Lachen. Auch das von Michael.
5
»Jungs!« Coppenfeld holte so tief Luft, dass die Knöpfe seiner Weste spannten. Er trug einen seiner Glencheck-Anzüge, darunter ein weißes Hemd mit goldenen Manschettenknöpfen, auf denen das Familienwappen der von Coppenfelds eingraviert war. »Es gibt da etwas Unschönes, von dem ich euch berichten muss.«
Sie waren beim Hauptgang, einem Rehbraten mit diversen Beilagen, angelangt. Frederick von Coppenfeld – oder Coppi, wie sie ihren Freund gerne nannten – hatte sie, wie jedes Jahr an diesem Tag, zur Wildschweinjagd auf sein Schloss in Oberfranken eingeladen. Traditionell ging der Jagd ein üppiges Essen voraus. Es war ein lieb gewonnenes Ritual, mit dem sie ihre lange Freundschaft feierten, mit dem sich aber vor allem auch Coppenfeld für seine Kochkünste feiern ließ. Kochen war seit ein paar Jahren seine neue Religion und der Herd der Altar, auf dem er die erlesensten Jagd- und Importprodukte opferte. Wollte man es sich mit ihm nicht verscherzen, hielt man mit Kritik bezüglich seiner Kochkünste lieber hinterm Berg.
Scheidung, war der erste Gedanke, der Berger bei Coppenfelds Worten durch den Kopf schoss. Warum sonst diese theatralische Ankündigung? Die Ehe zwischen Coppenfeld und seiner Frau glich, soweit Berger wusste, schon seit Jahren nur noch einer Arbeitsgemeinschaft, die vergessen hatte, an welchem Projekt sie arbeitete. Oder vielleicht war das Projekt, das im Wesentlichen dem Ziel der Reproduktion zur Fortführung der Familienlinie sowie der Aggregation von Vermögen galt, auch einfach nur abgeschlossen.
»Ich setze auf eure absolute Vertraulichkeit.« Coppenfeld sah bedeutungsschwanger in die Runde.
Oder vielleicht eine schwere Krankheit?, überlegte Berger. Denn auch wenn es zwischen Coppenfeld und seiner Frau nicht mehr ganz rundlief, sie beide gehörten immerhin zum alten deutschen Adel, und der Adel ließ sich nicht einfach scheiden. Schließlich bedeutete eine Scheidung Vernichtung von Kapital, ein Umstand, den das Proletariat nicht zu scheuen schien, wenn es ihn überhaupt durchschaute, der dem entromantisierten Adel jedoch zutiefst zuwider war. Bevor man sich scheiden ließ, einigte man sich lieber auf außereheliche Experimente.
Coppenfeld atmete erneut tief durch. Er war derjenige gewesen, der nach dem Studium am längsten gebraucht hatte, eine gute Anstellung zu finden. Dank der hervorragenden politischen Kontakte seines Vaters, der ein hohes Tier im Innenministerium gewesen war, hatte er am Ende aber natürlich doch noch Karriere gemacht. Er hatte mehrere hohe Ämter in verschiedenen Ministerien durchlaufen und in unterschiedlichen Projektgruppen des Bundesinnenministeriums mitgearbeitet. Vor drei Jahren schließlich kam die Krönung: die Ernennung zum Präsidenten des Verfassungsschutzes.
»Es wird einen Anschlag geben«, verkündete Coppenfeld mit einem Gesichtsausdruck, als würde morgen die Welt untergehen. Trotz der hohen Vertraulichkeit seines Amtes ließ sich Coppenfeld immer wieder – und das sogar sehr gerne – dazu verleiten, aus dem Nähkästchen zu plaudern.
»O Gott!« Berger spielte den Erschrockenen. In der Regel berichtete Coppenfeld über die schmutzigen Hintergründe von Rücktritten von wichtigen Politikern oder Managern. Das hatte immer einen gewissen Unterhaltungswert. Aber ein Anschlag? Es gab ständig Anschläge. Wenn er nicht gerade ihm oder einem Atomkraftwerk galt, war es keine Nachricht, um die man so ein Aufsehen machen musste.
Berger sah zu Sebastian Saum. Im Gegensatz zu Coppenfeld, der in den letzten Jahren stark an Gewicht zugelegt hatte und an dessen roten Wangen man seinen hohen Blutdruck erkennen konnte, sah Saum immer noch ausgesprochen gut aus. Obwohl ebenfalls fast fünfzig, schien er kaum gealtert zu sein. Seine vollen, braunen Haare hatte er mithilfe von Gel oder Wachs wild durcheinandergewühlt. Das stand ihm erschreckend gut und verlieh seinem Gesicht etwas zusätzlich Jugendliches. Die enge, graue Chino saß perfekt, und auch das schwarze Hemd wölbte sich nicht an den kritischen Stellen. Er wirkte irgendwie … – Berger suchte nach dem richtigen Wort – … energetisch und … potent. Ja, potent, das war das Wort, nach dem er gesucht hatte, ein Attribut, das er anderen Männern nur ungern gönnte.
Saum hatte es vor allem mit Fleiß und Ellenbogen geschafft, sich in der weltweiten Top-Liga der Hedgefonds-Manager zu etablieren – einer neuen Generation von Investmentbankern, die es nicht nur mit Mehrheiten, sondern vor allem über psychologischen Druck auf das oberste Management und auf Regierungen schaffte, ihre Interessen durchzusetzen. Er hatte in der Corona-Krise ein goldenes Händchen bewiesen. Seitdem mischte er ganz oben mit, auch wenn es andere Manager gegeben hatte, die noch mehr »abgesahnt« hatten. Sein Jahresverdienst lag bei schlappen 1,7 Milliarden Euro. Auch ihn schien Coppenfelds Ankündigung nicht vom Hocker zu reißen.
Der Vierte im Bunde, Paul Wittkowski, wirkte hingegen ein wenig betroffen. Er sah neben dem dynamischen Saum wie ein ausgemusterter Buchhalter aus, dessen Dynamik sich auf die PS seines Autos beschränkte. Wegen des leicht schiefen Mundes hatten sie ihm früher immer eine Hasenscharte nachgesagt, die er aber gar nicht hatte. Vorsichtig ausgedrückt: Es gab Menschen mit einem einnehmenderen Äußeren. Auch ihn hatte Berger an der London School of Economics kennengelernt. Er war damals schon ein brillanter Computernerd und Mathematiker gewesen, weitaus fähiger als viele seiner Kommilitonen, und hatte Coppenfeld aus der Patsche geholfen. Jetzt arbeitete er für eine der größten deutschen Banken als Quant und erstellte Modelle, von denen Risikoabschätzungen und Investitionsentscheidungen abhingen. Er betonte häufig, das Zünglein an der Waage zu sein, was Berger jedoch für eher fraglich hielt.
»Drei Tage vor der Wahl!«, ergänzte Coppenfeld mit aufgerissenen Augen.
»Bitte?« Berger verschluckte sich am Wein. Das war natürlich direkt eine ganz andere Sache. Seine Gedanken galten sofort den möglichen Auswirkungen für ihn und seine Partei, der auch Wittkowski und Saum angehörten. Coppenfeld war auf Anraten seines Vaters offiziell parteilos geblieben, stand ihnen jedoch sehr nahe. »Geht es ein wenig konkreter?«, fragte Berger. »Wer? Wo? Und warum so kurz vor der Wahl? Zufall?«
»Ausgeführt werden soll der Anschlag von einem der großen Araber-Clans in Berlin.« Coppenfeld schob sich sein letztes Stück Fleisch in den Mund. »Dem Aziz-Clan. Gesteuert oder zumindest unterstützt wird das aber vermutlich alles von den Saudis. Es geht um die Ermordung von Journalisten, die sich kritisch gegenüber den Saudis und Clanleuten geäußert haben. Drei Tage vor der Wahl findet eine internationale Journalistenkonferenz in Berlin statt. Vier der Teilnehmer haben von dem Clan bereits Morddrohungen erhalten. Da scheint es ein paar offene Rechnungen zu geben.«
Verrückte Muslime, die einen Anschlag verübten? Bergers Gedanken waren direkt wieder bei der Wahl. Das Thema seiner Partei im Wahlkampf war eigentlich nicht das elende, spaltende Thema »Ausländer raus! Grenzen zu!« gewesen. Dafür stand die »Partei der Heimatverbundenen«, der ein solcher Anschlag kurz vor der Wahl zweifelsohne in die Karten spielen würde. Sie war mit ihren rhetorischen Grenzüberschreitungen, billigen Hetzereien und einfachen Schuldzuweisungen einige Jahre lang bei einer bestimmten Wählerklientel nicht unerfolgreich gewesen. Zum Glück für die anderen Parteien hatte sie jedoch seit gut einem Jahr ein Plateau erreicht, von dem es nicht mehr aufwärtsging. Ein Anschlag allerdings würde dieser Partei neuen Aufwind geben, und das, wie die Vergangenheit immer wieder zeigte, auch aus der unzufriedenen Mitte der Gesellschaft. Bei seinen Wählern.
»So ein Mist«, murmelte Berger.
»Kann man wohl sagen«, pflichtete ihm Coppenfeld bei. »Wir alle wissen, wer von so einem Anschlag profitieren würde.«
»Ganz genau.« Jetzt, wo er gedanklich die Stimmenverteilung durchspielte, verging Berger auch noch der Rest seiner guten Laune. »Laut aktueller Umfragen sind fünfzig Prozent aller Wähler noch unentschlossen. Die werden sich dann spontan aufgrund der Ereignisse der letzten Tage vor der Wahl entscheiden. Weiter zurück können die meisten von denen eh nicht denken. Ein größerer Anschlag von einem muslimischen Clan! Da würde selbst ich mir überlegen, die PdH zu wählen.«
»Ich nehme an, die Beweislage ist zu dünn, um diese Clanmenschen präventiv einzubuchten?«, fragte Saum.
»Exakt«, gab ihm Coppenfeld recht. »Auch erste Vernehmungen haben nichts ergeben. Zudem reden wir hier über den Aziz-Clan. Das sind mehr als hundert Leute. Schneid einen Kopf ab, und es wachsen zwei neue nach.«
Es wurde wieder still am Tisch. Jeder schien nachzudenken.
Was für eine verdammte Scheiße! Berger betrachtete das letzte Stück Rehbraten auf seinem Teller. Neben der guten Laune war ihm nun auch der Appetit vergangen. Er hatte einen glänzenden Wahlkampf hingelegt. Und jetzt das! Der Wahlkampf war ein Marathon, das zeigte sich immer wieder. Wer anfangs zu schnell loslief, der schaffte es kaum bis zur Ziellinie. Gut war der beraten, der am Ende noch genug Reserven oder ein Ass im Ärmel hatte, um seine Widersacher auf den letzten Kilometern zu überholen. Doch dieses Ass spielte das Schicksal gerade der PdH zu.
»Wie wäre es, wenn wir der PdH einfach ein paar Slogans klauen und uns auch gegen Ausländer positionieren?«, schlug Wittkowski vor.
»Bullshit!«, raunzte Saum. Er schien nicht mal darüber nachdenken zu wollen. »Wir bleiben bei unseren Themen: Mehr freie Marktwirtschaft. Weniger Sozialstaat. Agilität. Abbau von Verwaltung. Mehr Macht für den Kanzler.«
»Moment!« Wittkowski wirkte beleidigt. »Was spricht denn gegen ein paar Statements gegen die Zuwanderung? Nach so einem Anschlag werden die Wähler unsere wirtschaftspolitischen Vorschläge nicht die Bohne interessieren. Warum sie nicht da packen, wo wir sie kriegen?«
»Witti!« Saum rollte mit den Augen. »Denk doch mal nach, bevor du sprichst. Ausländerraus-Parolen? Damit wir unser Programm verwässern und zwei Wochen vor der Wahl am Ende noch einen innerparteilichen Streit auslösen? Totaler Bullshit!«
Wittkowski duckte sich, als hätte ihm Saum nicht nur verbal eine Ohrfeige verpasst. Berger wusste, dass ihm Kritik von Saum besonderes zusetzte. Von Anfang an war es Wittkowski gewesen, der Saum am meisten bewundert hatte – dessen selbstbewusstes Auftreten, die lockere Art, mit der er mit Frauen umging, die Fähigkeit, schnell Entscheidungen zu fällen.
»Ich meine ja nur.«
»Und er hat nicht unrecht«, sprang ihm Berger zur Seite, den es ein wenig ärgerte, wie schnell Saum Wittkowskis Vorschlag unter den Tisch kehren wollte.
»Guys!« Saum erhob beide Arme wie ein Priester, der seine Gemeinde segnete. »Keep calm, keep cool! Es gibt Dinge, die kann man nicht ändern. Ein Anschlag auf ein paar von der Lügenpresse – so what? Wichtig ist jetzt nur eins: dass wir der Welt zeigen, dass wir die einzige Partei sind, die einen schnellen Umbau von Deutschland hinbekommt, bevor uns die Tataren und Hunnen aus dem Osten komplett überrennen. Vertraut mir.«
»Ich weiß nicht …« Berger war alles andere als überzeugt. »Wir sind so nah dran. Und wir haben diesen Wissensvorsprung. Sollten wir den nicht zu unseren Gunsten nutzen?«
Saum wandte sich an Coppenfeld. »Sag mal! Bekommt ihr das denn nicht mehr unter Kontrolle?« In seiner Frage schwang mit, was er vom Verfassungsschutz hielt. Genau genommen gar nichts. Er hatte Coppenfeld mal vorgeworfen, dass der Verfassungsschutz über das wirkliche Ausmaß von Verbrechen so viel wusste wie ein Arzt, der versuchte mit einem Zungenspatel Magenkrebs zu diagnostizieren.
»Wir sind dran, keine Frage. Mit absolutem Hochdruck. Das Problem ist nur …« Coppenfeld tupfte sich mit einer Serviette seine speckigen Lippen sauber, »… dass präventive Eingriffe in unserem Rechtsstaat nur bedingt zulässig sind. Ihr kennt das Problem. Ohne Beweise sind sogar mir die Hände gebunden. Zudem rennt uns die Zeit davon.« Ob wirklich frustriert über seine beschränkten Möglichkeiten oder nur um vor ihnen zu betonen, was für ein »harter Hund« er doch eigentlich war, schlug Coppenfeld mit der Faust energisch auf den Tisch.
»Macht sie nervös. Gebt ihnen das Gefühl, dass ihr sie auf Schritt und Tritt beobachtet. Dann geben sie ihre Pläne schon auf«, schlug Saum vor.
»Ach!« Coppenfelds Miene versteifte sich. Sein Gesicht wurde eine Nuance dunkelroter, und sein Hals schwoll an. »Für wie doof hältst du uns eigentlich?«
»Alles gut, mein Lieber.« Saum klopfte seinem Freund auf die Schulter. Dann wandte er sich zufrieden an Berger. »Siehst du. Coppi ist dran. Mach dir keinen Kopf. Jetzt die Strategie zu wechseln wäre der falsche Schritt. Trust me. Never change a winning horse! Du musst auch an die negativen Folgen denken. Sollte es am Ende doch keinen Anschlag geben, dann haben wir es uns unnötig mit bestimmten Wählern verdorben. Das mit der Kanzlerdemokratie ist sowieso schon eine Gratwanderung.«