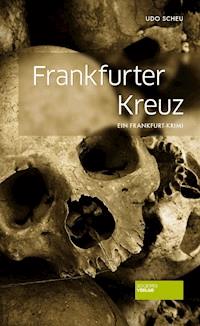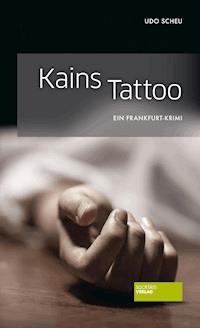Udo Scheu
Das jüngste Gericht
Ein Frankfurt-Krimi
Alle Rechte vorbehalten • Societäts-Verlag
© 2009 Frankfurter Societäts-Druckerei GmbH
Umschlaggestaltung: Katja Holst, Frankfurt
Satz: Nicole Proba, Societäts-Verlag
eBook: SEUME Publishing Services GmbH, Erfurt
ISBN 978-3-942921-95-4
Wir brauchen keinen Hurrikan
Wir brauchen keinen Taifun
Was der an Schrecken tuen kann
Das können wir selber tun.
(Bertolt Brecht, Aufstieg und Fall der Stadt
Mahagonny, Edition Suhrkamp, 1963)
Prolog
Als Wolfgang Beuchert von dem lächelnden Mönch durch die goldlackierte eiserne Pforte der unendlich langen Ziegelmauer gebeten wurde, eröffnete sich ihm ein überwältigendes Bild. Seine Müdigkeit nach dem zehnstündigen Flug von Frankfurt nach Bangalore in Südindien war wie weggeblasen. Von einer Sekunde auf die andere war ihm klar, dass er in eine märchenhafte fremde Welt eingetaucht war.
Schon am Flughafen hatte er einen Vorgeschmack darauf bekommen, was ihn hier erwartete. Als er mit unsicheren Schritten die Gangway betreten hatte, war ihm der am Eingang zur Ankunftshalle wartende kahl geschorene Mann in seiner erdfarbenen Robe aufgefallen. Das musste der ihm telefonisch angekündigte Transportservice zum buddhistischen Kloster der Samsara Society sein.
Der Mönch hatte ihm zur Begrüßung eine Sandelholzkette aus handgeschnitzten Blumenornamenten um den Hals gelegt. Anschließend hatte er ihm den Weg durch ein Ameisenheer von gestikulierenden und marktschreierisch werbenden Taxifahrern gebahnt, bis sie an dem kleinen verbeulten Landrover angelangt waren. Ungläubig hatte er immer wieder nach dem Mönch am Steuer geblickt, der sie mit infernalischem Hupen und atemberaubender Geschwindigkeit zum Ziel gebracht hatte.
Nun stand Wolfgang Beuchert im Innenhof des Klosters und traute seinen Augen nicht. Mehrmals musste er die Brille absetzen und die Gläser abwischen. Der Schweiß lief ihm in Strömen über das füllige Gesicht, so dass von seinem glatt rasierten Kinn ein kleines Rinnsal tropfte. Dort sammelten sich in kurzen Intervallen Tropfen, die auf dem klatschnassen weißen Hemd landeten, das für hohe Temperaturen einfach zu körperbetont geschnitten war.
Vor ihm bildeten etwa einhundert braunhäutige dunkelhaarige Jungens aller Altersstufen nach Größe aufgestellt eine schmale Gasse. Alle trugen saubere helle Hemden und dunkle kurze Hosen. Jeder hielt eine rote Rose in der Hand.
Am Kopf des Spaliers standen zwei Mönche, die ihre zusammengelegten Hände vor das Gesicht hielten und sich vor Beuchert zum Gruß verneigten. Der Junge in der vordersten Reihe nahm vom Boden ein silbernes Tablett auf, das er Beuchert in die Hände drückte. Anschließend begleiteten ihn die beiden Mönche durch den von den Kindern gebildeten Weg. Dabei legte ihm jeder der Buben seine Rose auf das Silbertablett, während sämtliche Kinder gemeinsam ein Lied anstimmten.
Nach dem Ende des Defilees nahm einer der Mönche Beuchert das Tablett ab, während der andere ihn zu einem weiß getünchten Flachbau geleitete, der durch eine Hibiskushecke vom Innenhof abgeschirmt war. Lächelnd kehrte er Beuchert sein Gesicht zu. »Ich bringe Sie jetzt zu Bodhi Bhante, unserem Abt.«
Seitlich vor dem Eingang des Gebäudes saß neben einem mit Buddhafiguren ausgestatteten Schrein ein alter Mönch kerzengerade in einem mit dicken Kissen ausgepolsterten Weidenkorbsessel. Auf einem runden Holztischchen drehte sich gemächlich ein Ventilator, der auf sein Gesicht gerichtet war. Rechts und links von ihm saßen je zehn Mönche im Lotossitz auf dem Boden. Der alte Mönch winkte Beuchert zu sich.
Mit verlegenem Gesichtsausdruck ging Beuchert auf den Abt zu, während sein Begleiter zurückblieb. Als er vor dem alten Mann stand, bedeutete der ihm, auf dem dunkelroten runden Kissen vor seinem Sessel Platz zu nehmen. Mit unsicherem Blick schaute Beuchert auf den Halbkreis der Mönche, die jedoch ihre halb geschlossenen Augen starr zu Boden gerichtet hatten. Er zog die Bügelfalten seiner dunkelblauen Anzughose hoch und ließ seinen Körper mit einem kurzen Seufzer auf das Kissen sinken. Dabei machte er eine leichte Verbeugung zu dem Abt hin.
Der alte Mann setzte ein strahlendes Lächeln auf und sah Beuchert aus wachen Augen an. Er zupfte mit einer raschen Bewegung das Oberteil seiner Robe über der rechten Schulter zurecht.
»Herzlich willkommen im Samsara-Kloster in Bangalore. Hatten Sie eine gute Reise?«
»Danke, ja! Nur der Jetlag steckt mir noch ein wenig in den Knochen. Vielen Dank auch für die großartige Begrüßungszeremonie. Wie geht es Ihnen?«
Bodhi Bhante schien die Frage nicht wahrgenommen zu haben. Mit unveränderter Haltung maß er den sich hin und her räkelnden Beuchert, der Probleme mit der Lage seiner Beine zu beheben versuchte. »Soll ich Ihnen einen Stuhl bringen lassen? Ich hatte vergessen, dass die Europäer an unsere Art des Sitzens nicht gewöhnt sind.«
Beuchert wehrte ab. »Bitte machen Sie sich keine Mühe. Es geht recht gut. Der Flug hat etwas lange gedauert. Dadurch ist mein Körper ein bisschen steif geworden. Darf ich Sie etwas fragen?«
»Selbstverständlich!«
»Ich habe bei meiner Ankunft hier keine Mädchen gesehen. Nur Jungen. Ihnen ist sicher bekannt, dass ich die beiden Töchter meines Bruders abholen möchte.«
Der Abt schmunzelte. »Ich kann verstehen, dass Sie zur Eile drängen. Bei uns gehen die Dinge ihren Weg nicht so schnell wie in Ihrer Heimat. Sie werden Ihre beiden Nichten morgen in die Arme schließen können. Sie sind nicht hier.«
Beuchert machte ein erstauntes Gesicht. »Das verstehe ich nicht. Ich hatte geglaubt, sie hier in Empfang nehmen zu können.«
Bodhi Bhante schüttelte den Kopf. »Dies ist ein Kloster für Männer. Frauen haben hier keinen Zutritt. Die Jungen, die Sie gesehen haben, sind Schüler unserer Klosterschule. Sie sind alle aus ärmsten Verhältnissen. Wenn sie möchten, können sie Mönche werden. Ansonsten lernen sie einen Beruf oder studieren. Unser Abschluss ist staatlich anerkannt.«
»Ja, aber die Mädchen ...?«
Der alte Mann machte mit erhobener Hand deutlich, dass er mit seinen Ausführungen noch nicht fertig war. »Wir haben Zeit, miteinander zu sprechen. Ihr Rückflug geht nicht schon heute. Unsere Mädchenschulen befinden sich im Norden Indiens. Wir wollten Ihnen nicht zumuten, sich dorthin zu begeben. Nach Ihrer Zeitrechnung leben wir im Mai des Jahres 2003. Wir feiern gerade Buddhas Geburtstag und seine Erleuchtung. In der Himalaya-Region ist es zu dieser Zeit noch sehr kühl. Es fallen viele Flüge aus. Auch wären unsere Möglichkeiten, Sie dort unterzubringen, nicht angemessen gewesen.«
Bodhi Bhante legte eine Pause ein. Beuchert entlastete seinen schmerzenden linken Arm, machte eine Drehbewegung mit dem Körper und stützte ihn mit dem anderen Arm vom Boden ab. Es drängte ihn, weitere Fragen zu stellen. Nach der vorangegangenen Belehrung bevorzugte er jedoch, sich auf das Abwarten zu verlegen.
Der Abt nahm ein neben ihm stehendes Wasserglas in die Hand und trank in langsamen Schlucken. Dann wandte er sich wieder zu Beuchert. »Wir haben die beiden Mädchen in unser Schulheim nach Mysore bringen lassen. Mein Sekretär, der ehrenwerte Mönch Kassapa, wird Sie morgen mit dem Zug dorthin begleiten. Auf der Fahrt passiert die Eisenbahn den Streckenabschnitt, wo Ihr Bruder mit seiner Frau vor über einem Jahr tödlich verunglückte. Sie werden sicher die Stelle sehen wollen.« Beuchert bekam einen heftigen Schweißausbruch, den er weder auf die vorherrschenden hohen Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit noch auf die an Bord genossenen Alkoholmengen zurückführte. Er schämte sich. Wahrscheinlich wusste sein zurückhaltendes Gegenüber, dass er der Beerdigung seines Bruders und seiner Schwägerin ferngeblieben war. »Unbedingt. Ich bin noch nie zuvor in Ihrem Land gewesen.«
Bodhi Bhante wiegte den Kopf mehrmals nach rechts und links. »Wir haben natürlich keine Veranlassung, Ihnen Ihre Nichten vorzuenthalten. Zumal es bestimmt einen gewichtigen Grund geben dürfte, warum Sie die beiden Mädchen erst nach einem längeren Zeitablauf nach Deutschland holen wollen. Sie haben sicher die seit dem Unglück verstrichene Zeit benötigt, um in Ihrem Land alle Vorbereitungen für die Aufnahme Ihrer Nichten zu treffen. Immerhin differieren die gesellschaftlichen Verhältnisse im Vergleich zu unserem Land nicht ganz unerheblich.« Beuchert wischte sich mit der flachen Hand den Schweiß von der Stirn und änderte erneut seine Sitzhaltung. Jetzt hätte er wieder einen Schnaps gebrauchen können. Ob dieser alte Mann etwas ahnte oder sogar wusste, warum er erst jetzt diese Reise unternommen hatte? Ihm war unbehaglich.
Seltsamerweise strahlte dieser Mann, der weit über achtzig Jahre sein musste und ihm unverändert wie ein steinernes Monument gegenübersaß, auf der anderen Seite eine ungeheure Vertrauenswürdigkeit aus.
Wie ein Beichtvater.
»Sehe ich Sie noch einmal, bevor ich in meine Heimat zurückkehre? Oder bleibt dies unser einziges Treffen?«, fragte Beuchert. Der alte Abt lächelte. »Hier bin ich. Ich atme, und Sie atmen. Das ist die Gegenwart. Mehr gibt es nicht. Alles liegt in uns. Folgen Sie dem Pfad.« Er schnipste mit dem Finger und gab dem ihm am nächsten sitzenden Mönch ein unauffälliges Zeichen. Der Mönch betrat den Flachbau und kehrte mit einem schmalen Buch zurück, das er unter einer Verbeugung vor Beuchert auf dem Boden ablegte.
Der achtfaltige Pfad, las Beuchert. Eine totale Verwirrung zeichnete sich auf seinem Gesicht ab. Der Mut verließ ihn. Zu gerne hätte er sich diesem lebenden Fels anvertraut. Doch was nützte dies, wenn er nicht einmal den Inhalt seiner Rede und den Titel der überreichten Schrift verstand? »Danke, vielen Dank!«
Bodhi Bhante bedeutete ihm mit einer Handbewegung, dass die Begegnung beendet sei. Aus dem Haus kam gleichzeitig ein weiterer Mönch, der auf Beuchert zuging. Er mochte um die vierzig Jahre alt sein und hatte die Gesichtszüge der nördlichen Bergvölker. Mit Beuchert sprach er im Flüsterton. »Mein Name ist Kassapa. Bitte folgen Sie mir. Ich zeige Ihnen jetzt Ihr Zimmer.« Gemeinsam durchschritten sie den mit Palmen, Aurelien und blühendem Hibiskus bestandenen Klostergarten. Sie passierten eine alte säulengeschmückte Tempelanlage, von deren Galerie die vielfarbige buddhistische Fahne im lauen Abendwind wehte. Wenige Meter dahinter erreichten sie eine Treppe, die zu einer auf Stelzen gebauten Terrasse führte. An ihrer Seitenwand waren drei kleine steinerne Bauten aneinandergereiht.
Kassapa öffnete die vorderste Tür. Sie traten in das Einzimmerappartement, das gerade Raum für ein Bett und einen Schreibtisch bot. Darauf standen eine Buddhafigur, eine kleine Glasvase mit frischen Blumen und ein Teller mit Obst. An der linken Wandseite war eine Nasszelle eingelassen.
»Hier können Sie jetzt ausruhen und noch ein paar Früchte zu sich nehmen. Ihr Gepäck liegt neben dem Bett. Wir sehen uns morgen früh um 5:00 Uhr zu unserer Puja, unserer allmorgendlichen Gesangsund Meditationsfeier. Sie findet im großen Tempel an der östlichen Mauerseite statt. Im Anschluss daran sage ich Ihnen, wie es weitergeht.«
Der Mönch zog sich unter einer Verbeugung mit dem Rücken zur Tür zurück. Beuchert war zu verblüfft, um zu antworten. Offenbar war es keine Frage, dass er sich als Gast den Gepflogenheiten des Klosters zu unterwerfen hatte.
Er nahm sein Gepäck und legte es auf das Bett. Mit zittriger Hand griff er zu der Duty-free-Tüte und entnahm ihr eine Flasche Jack Daniels, die er auf dem Flughafen erstanden hatte. Er setzte sich vor den Schreibtisch und trank einen tiefen Schluck aus der Flasche.
Nach dem dritten Whisky zog er sich aus, legte sich auf sein Bett und fiel in einen unruhigen Schlaf. Vor den drei Hyänen, die ihn im Traum gerade erreicht hatten und an seinen Beinen hochspringen wollten, bewahrte ihn ein seltsames blechernes Geräusch, das ihn aus dem Schlaf riss. Zufällig konnte es nicht sein, da die Töne eine rhythmische Folge aufwiesen.
Beuchert schaute auf seine Armbanduhr. 4:30 Uhr. Er benötigte eine Weile, bis er seinen Aufenthaltsort erkannte. Oberflächlich machte er Toilette und verließ den Raum.
Den großen Tempel fand er auf Anhieb. Mehrere Marmorstufen führten ihn in eine große geflieste Halle, an deren Stirnseite ein goldener Buddha auf einem Altar thronte. Rechts und links umgab die Figur ein Meer von frischen Blumen und brennenden Kerzen. Beuchert nahm sich von einem in der Ecke liegenden Stapel ein Kissen und setzte sich nahe an den Ausgang.
Mit dem Gesicht zu der Statue saßen die Mönche zu deren Füßen in langen parallelen Reihen. In der Mitte der ersten Reihe erkannte er Kassapa, der die Rolle des Vorsängers einnahm. Mit ihm stimmten die übrigen Mönche und die hinter ihnen sitzenden Kinder in die einfachen Melodien ein. Der Abt war nicht anwesend.
Plötzlich erhoben sich die Mönche und die Kinder nach und nach und verließen den Tempel. Kassapa trat auf Beuchert zu.
»Um sieben Uhr gibt es in dem großen dreistöckigen Gebäude neben dem Haus unseres Abtes ein Frühstück«, sagte er. »Der Speisesaal ist im Erdgeschoss.«
Bevor Beuchert nach dem Zeitpunkt der geplanten Zugfahrt fragen konnte, war Kassapa verschwunden. Er ging zurück auf sein Zimmer und überlegte, ob er sich umziehen oder es bei der Tuchhose und dem weißen Hemd belassen sollte. Die steigenden Temperaturen nahmen ihm die Entscheidung ab. Er starrte aus dem Fenster und verspürte Angst.
Als er den Frühstückssaal betrat, war er verwirrt. In langen Reihen standen die Kinder mit Blechgeschirr in den Händen vor einem Tisch, hinter dem zwei ältere Jungen aus einigen Blechtöpfen das Essen ausgaben. Mehrere Sorten buntes Gemüse, Reis und Tee. Die bereits abgefertigten Kinder setzten sich an die Längsseiten hölzerner Tische, aßen und flüsterten miteinander.
Die Mönche saßen abgesondert am Ende des Speisesaals schweigend um ihre Tische und wurden dort bedient. Beuchert wollte auf Kassapa zugehen und ihn nach dem weiteren Programm fragen. Der Mönch bedeutete ihm mit vor den Mund gelegten Zeigefinger zu schweigen und deutete auf einen kleinen leeren Einzeltisch.
Beuchert setzte sich. Ein kleiner Junge trug sofort das Frühstück auf. Gedünstetes Gemüse und gedämpfte Linsen in einer sehr flüssigen Sauce. Beuchert nippte nur ein wenig und legte dann den Löffel ab.
Kassapa trat hinzu und wies nach draußen. Vor dem Speisesaal wartete er. »Machen Sie sich bitte fertig. Wir fahren in einer halben Stunde zum Bahnhof. Ein paar Kinder werden Ihr Gepäck holen. Sie kommen bitte zur Ausgangspforte.«
Der Bahnhof quoll über vor Menschen. Die Saris der Frauen leuchteten in zahllosen Farbkombinationen im strahlenden Sonnenschein. Dagegen nahmen sich die durchgängig im europäischen Stil gehaltenen weißen oder hellblauen Hemden und dunklen Hosen der Männer langweilig aus.
Mit einer knappen halben Stunde Verspätung traf der bereits übervolle Zug ein. Dem fragenden Blick Beucherts begegnete Kassapa mit einer beruhigenden Geste. Er geleitete Beuchert zu einem Wagen der ersten Klasse und wies ihn in ein reserviertes Abteil. »Die Fahrt dauert etwas mehr als eine Stunde.«
Beuchert nickte und setzte sich in einen der nachgebenden Polstersessel. Nach fünfzehn Minuten zeigte Kassapa aus dem Fenster. »Hier war der Unglücksort.«
Irgendwo in seiner Hosentasche fühlte Beuchert den Flachmann. Er hätte einiges darum gegeben, sich unauffällig bedienen zu können. Den Gedanken, die Toilette aufzusuchen, verwarf er. Der Mönch würde es riechen. Zu eng waren die Sessel beieinandergestellt.
Mit gerunzelter Stirn schaute er aus dem Fenster. Vor seinen Augen floss Blut, krümmten sich Verletzte, lagen überall die zerfetzten Leiber der Toten. In seinen Ohren dröhnten die Schreie der entsetzten Menschen, auf einmal die Stimme seines Bruders. Er hielt sich die Hände vor sein Gesicht und wischte sich über die Augen, als könnte er damit die Bilder auslöschen, die ihn verfolgten. »Hier also. Ich hatte gehofft, alles werde sich regeln. Aber es belastet mich mehr und mehr. Mit Ihrem Abt wollte ich darüber sprechen. Er ging leider nicht darauf ein.«
»Das verstehe ich nicht. Ich habe Ihr Gespräch mitverfolgt. Er wusste um Ihr Dilemma und hat Ihnen alles Wesentliche gesagt, was es zu sagen gibt. Worauf wollten Sie ihn noch hinweisen?«
»Am Tag des Zugunglücks hatte meine Frau Karin Geburtstag. Ich weiß es noch so genau, weil ich schon früh das Haus verlassen hatte. Wir haben uns auseinandergelebt. Tags darauf habe ich von dem Tod meines Bruders und dessen Frau erfahren. Ich bin weder zur Beerdigung, noch habe ich einen Gedanken auf das weitere Schicksal der beiden Töchter verwendet.«
Kassapa saß mit ausdruckslosem Gesicht regungslos in seinem Sessel. Den erwartungsvollen Blicken Beucherts begegnete er gleichmütig. »Das war unserem Abt bekannt.«
»Dann geschah das Seltsame. Genau ein Jahr später, wieder am Geburtstag meiner Frau. Ich war gerade in einer angespannten Gemütsverfassung. Aus Niedergeschlagenheit habe ich etwas zu viel getrunken. Dann machte ich wohl einen folgenreichen Fehler. Jetzt will ich ihn wiedergutmachen, indem ich die Kinder aufnehme und sie aufziehe. Sie sollen alles haben.«
Der Mönch lächelte. »Wie anders Sie denken. Sie haben unseren Abt wirklich nicht verstanden. Niemand kann Ihnen vergeben, was Sie getan haben, ganz gleich, worum es sich handelt. Sie meinen, ein Gebet oder eine aufgelegte Hand machen Dinge ungeschehen. Das ist widersinnig. Alles liegt an Ihnen und in Ihnen. Nur Sie sind für sich verantwortlich, im Bösen wie im Guten. So waren die Worte von Bodhi Bhante gemeint.«
Beuchert schüttelte den Kopf. »Entweder will mich niemand verstehen, oder ich muss wohl immer alle Last alleine tragen. Ich habe Angst vor dem, was kommt.«
1. Kapitel
Allerheiligen, Mittwoch, der 1. November 2006. Über die nassen Pflastersteine der Haupteinkaufsmeile Frankfurts, der Zeil, bummelte am frühen Morgen ein elfjähriges Mädchen. Sie hatte ein ausgesprochen hübsches Gesicht und war auffällig zierlich, jedoch groß gewachsen. Ihre dichten schwarzen Haare reichten fast bis zur Hüfte. Die Hände hatte sie tief in die Taschen ihrer Jeans vergraben, die Schultern gegen den schneidenden Wind zusammengepresst.
Die ganze Nacht über hatte es kräftig geregnet. Erst mit Anbruch des Tages beruhigte sich das Wetter. Doch zogen nach wie vor dunkle Wolkenmassen über die Innenstadt von Frankfurt hinweg. Ein schneidend kalter Wind trieb sie vor sich her. Eine hellgraue Dunstglocke schien die oberen Stockwerke der Hochhäuser im Bankenviertel verschluckt zu haben. Nur noch einige zaghaft durch den Wassernebel blinkende rote Lämpchen deuteten die tatsächliche Höhe an.
Es war kurz vor neun Uhr. Das Mädchen schaute sich um. Hinter den frisch geputzten Glastüren der großen Warenhäuser trafen die Angestellten letzte Vorbereitungen an den Verkaufstischen. Schon jetzt warteten Menschentrauben fröstelnd darauf, eingelassen zu werden. Sie hatten, wie alljährlich an diesem Tag, zu einem großen Teil schon eine längere Anreise aus RheinlandPfalz oder Bayern hinter sich. Dort war heute, anders als in Hessen, Feiertag, den die wartenden Menschen zu einem Einkaufsbummel nutzen wollten. Als sich die Türen endlich öffneten, drängten sich alle mit einer Wucht in die Eingangsbereiche, als gelte es, eine unwiederbringliche Gelegenheit zu ergreifen.
Zwischen den Warenhäusern und den rechts und links der Fußgängerzone entlanglaufenden Platanenreihen nahmen die ersten Bettler ihre Stammplätze ein, stellten ihre Pappschilder mit den Almosenbitten auf und schützten die neben ihnen liegenden Haustiere mit einer Decke gegen das feuchtkalte Wetter. Ein Dudelsackspieler nestelte an seiner Strumpfhose, die er vorsorglich unter den Kilt angezogen hatte, um sein Publikum möglichst ohne längere Unterbrechungen mit seinem Standardlied »Amazing Grace« zu erfreuen.
Von diesen Vorgängen unbeeindruckt schlenderte das junge Mädchen aus der Richtung der Konstablerwache die Zeil entlang auf die Hauptwache zu. Sie ließ den Kopf hängen und seufzte. Mehrmals krallte sie die Fingernägel in die Innenflächen ihrer Hände. Dabei holte sie ein paar Mal zu kurzen abgehackten Schritten aus, als müsse sie einige im Weg liegende Gegenstände zur Seite treten.
An einem Laden für junge Mode blieb sie eine Weile vor einem bodenlangen Spiegel stehen und betrachtete sich. Ihr kräftiges Haar, der braune Teint, der rosa Blouson und die strassbesetzten Jeans, alles sah sehr harmonisch aus. »Sunita, du siehst nicht schlecht aus«, sagte sie zu ihrem Spiegelbild. Es geschah wohl nicht nur aus Höflichkeit, wenn ihr mit zunehmendem Alter immer mehr Jungen nachschauten und ihr Komplimente machten.
Gedankenverloren wandte sie sich ab und ging langsam weiter, den Blick auf die noch immer nassen Pflastersteine gerichtet. Alles könnte so schön sein, wenn nicht …
Drei Jahre war es nun her, seit sie aus Indien nach Deutschland gekommen war, zusammen mit ihrer zwei Jahre jüngeren Schwester. Nach dem schrecklichen Zugunglück, bei dem ihre Eltern gestorben waren, hatten sie Aufnahme in einem Schulheim in Leh gefunden, der Hauptstadt von Ladakh, auf dem Dach des Himalaya-Gebirges. Das Internat war ein Zweig der Samsara Society, die seit einigen Jahrzehnten zur Verbreitung des buddhistischen Glaubens Indien mit Klöstern, Kinderheimen und Krankenhäusern überzog. In diesem Glauben war sie schon zuvor erzogen worden.
Ihr Onkel Wolfgang Beuchert hatte sie in der Internationalen Schule Frankfurt im Stadtteil Sindlingen eingeschult. Ihre Mitschüler und Mitschülerinnen kamen aus allen Ländern der Erde. Einige von ihnen wiesen, ebenso wie Sunita, unvollkommene Deutschkenntnisse auf.
Am heutigen Mittwoch blieb diese Schule wegen irgendeiner Baumaßnahme, die sich Sunita mangels Interesses nicht weiter gemerkt hatte, geschlossen. Sie hatte sich deshalb auf der Zeil verabredet.
Da ihr Adoptivvater Wolfgang Beuchert an diesem Morgen etwas in der Innenstadt erledigen wollte, hatte er sie mit dem Auto mitgenommen und an der Konstablerwache abgesetzt. Auf der Zeil wollte sie im Telekom-Shop nach einem neuen Mobiltelefon schauen. Ihr altes Handy war gestern ins Waschbecken gefallen und durch die Nässe unbrauchbar geworden. Doch der Telefonladen war noch geschlossen.
Und auch für ihre Verabredung war es noch zu früh.
Sunita schlang ihre Arme fest um ihren Oberkörper und rieb die Hände an ihrem Blouson. Sie fror. Zu dumm, dass sie heute Morgen entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit nicht meditiert hatte. Danach fühlte sie sich immer so warm und geborgen. Aber sie war eben in Eile gewesen. Sie reckte sich auf und gebot sich mehr Disziplin.
Wieder warf sie einen Blick in eines der Schaufenster, hinter welchem eine Dekorateurin gerade einige leuchtend bunte TShirts auslegte. Das obenauf liegende rosa Top gefiel ihr ausgesprochen gut. Sie gestand sich ein, dass die Konsumwelt des Westens schon Besitz von ihr ergriffen hatte. Im Prinzip gefiel es ihr hier in Deutschland.
Das galt allerdings nicht uneingeschränkt für die Menschen, mit denen sie Umgang hatte.
Sie setzte ihren Weg fort. Fast wäre sie über einen Pappbecher gestolpert, den ein kleiner Romajunge vor sich hingestellt hatte. Der Junge saß auf dem Straßenpflaster und spielte in der Hoffnung auf ein paar Cents auf einer uralten Ziehharmonika immer wieder dieselbe unbekannte Melodie.
Erschrocken sah sie zu ihm hin. Dabei glaubte sie für einen kurzen Moment, aus den Augenwinkeln eine Person gesehen zu haben, die sie verfolgte und beobachtete.
Da war der Schatten eines Mantels, der ihr bekannt vorkam. Sie blickte sich um und meinte, dass sich die Person mit einer raschen Bewegung in den Eingang des hinter ihr liegenden Warenhauses zurückgezogen hatte, um nicht gesehen zu werden. Unschlüssig erwog sie, zu dem Ladengeschäft zu laufen und nachzusehen. Sie verwarf den Gedanken jedoch gleich wieder, zumal sie in dem Gewühl ohnehin keine Chance mehr gesehen hatte, die Person noch einzuholen.
Sie musste Opfer ihrer Einbildung geworden sein. Es gab keinen Grund, sie am helllichten Tag auf einer Einkaufsstraße zu verfolgen. Dennoch spürte sie ein Angstgefühl, wie sie es schon einmal erlebt hatte.
Damals war sie in dem Kloster neben ihrem Schulheim durch ein Geräusch aus der Meditation gerissen worden. Ihr Blick war auf einen zwischen zwei Schränken stehenden Mann gefallen, der auf eine zwischen seinen nackten Füße platzierte Rasierklinge gestiert und sie dann plötzlich mit rollenden Augen fixiert hatte. Angsterfüllt war sie damals weggerannt, das Bild hatte sie aber noch nächtelang im Traum verfolgt.
In der ersten Zeit wollte sie nie mehr nach Indien zurück. Doch was sie dann in Deutschland erwartet hatte, war noch viel schlimmer gewesen. Ihre Situation war ihr ohne Ausweg erschienen. So viele Tränen hatte sie vergossen, nächtelang ihr Gehirn gemartert.
Ihr Herz klopfte bis zum Hals. Suchend griff sie mit der linken Hand nach ihrem goldenen Halskettchen, an dem eine kleine Buddhafigur baumelte. Sie ergriff die Figur ganz fest und lenkte ihre Gedanken konzentriert auf diesen Vorgang. Ganz allmählich beruhigte sie sich wieder und ging schlurfend weiter.
Nach wenigen Metern stand sie vor einer hoch aufragenden Glasfassade. In gelber Leuchtschrift blinkte der Name Zeilgalerie. Hier oben in der Cafébar war sie später verabredet. Sie kannte das Café noch nicht und beschloss, es sich anzusehen. Ohnedies blieb noch viel Zeit.
Sunita betrat den mehrgeschossigen Bau und bewegte sich auf dem in einer Spirale nach oben führenden Weg zu den beiden gläsernen Fahrstühlen hin. Auf ihren Knopfdruck hin setzten sich die hinter den Glastüren befindlichen schwarzen Transportkabel in Bewegung und zogen den Fahrkorb aus einem der Obergeschosse nach unten ins Erdgeschoss.
Sie stieg in den Fahrstuhl ein und drückte den Knopf für das achte Stockwerk. Die Türen schlossen sich. Die Ziffer 8 blinkte auf, doch der Fahrkorb bewegte sich nicht. Ratlos verharrte sie einen Augenblick. Dann drückte sie den Knopf für die siebente Einkaufsebene. Jetzt endlich fuhr der Fahrstuhl los. Von oben konnte sie in die wie Bienenwaben im Kreis angelegten einzelnen Läden schauen und sah die Kunden ameisengleich den stufenlosen Spiralweg wie auf einer Prozession entlangziehen.
Der siebente Stock war fast noch menschenleer, die kleinen Geschäfte zumeist noch geschlossen. Sunita ging zu Fuß weiter bis zur achten Ebene, an deren Ende sich in einem Außenbogen eine schwach beleuchtete Cafébar befand. Sie blieb davor stehen, schaute durch die Glastür, konnte jedoch keinen Menschen sehen, nicht einmal eine Bedienung. Vorsichtig drückte sie gegen einen der Türflügel und stellte zufrieden fest, dass er nachgab.
An dem rechtsseitig gelegenen Tresen entlang durchquerte sie rasch das Café und schaute sich dabei nach allen Seiten um, als hätte sie Angst, bei etwas Verbotenem erwischt zu werden. Sie erreichte eine weitere Glastür, die zur Außenterrasse führte.
Aufgeregt ging sie nach draußen, quetschte sich durch die Bestuhlung von zwei winzigen Tischchen und lehnte sich auf das von drei horizontal angebrachten röhrenförmigen Eisenbändern gebildete Geländer. Es reichte ihr aufgrund ihrer überdurchschnittlichen Körpergröße gerade bis zum Bauchnabel.
Was für eine Aussicht!
Ihr Blick schweifte in die Tiefe und verursachte ihr ein krampfartiges Ziehen im Bauch. Was wäre, wenn sie jetzt schnell die Beine über das Geländer heben würde und sich dann einfach fallen ließe? Leben, so hatte sie in Indien gelernt, bedeutete ein ständiges Abschiednehmen.
Nichts auf dieser Welt würde sich ändern, niemanden würde ihr Tod berühren. Höchstens ihrer kleinen Schwester würde sie fehlen. Vielleicht sogar dieser anderen Unperson, an deren Namen und Aussehen sie nicht erinnert sein wollte.
Sie richtete den Blick nach vorn. Sie schaute auf die endlose Kette von regennassen Dächern und Türmen, die sich irgendwo am näher gerückten Horizont in den schwarzgrauen Wolken verloren, wie von einem Staubsauger verschluckt. Das erinnerte sie an die Berge im Himalaya. Wie oft hatte sie von da oben auf die Dächer von Leh geschaut.
Mit dem Unterschied, dass sie da noch glücklich gewesen war. Langsam nahm sie ihre Hände vom Geländer und spürte, wie das flaue Gefühl in ihrem Inneren wiederkehrte. Mit beiden Füßen stellte sie sich auf das flache Mäuerchen, worin das Geländer verankert war.
Dann überschlugen sich plötzlich die Ereignisse. Sunita fühlte sich an den Beinen hochgehoben, spürte gleichzeitig einen heftigen Kopfschmerz, vollzog eine Rolle vorwärts, wie um eine Reckstange geschlungen, und stürzte mit einem lang gezogenen Schrei in die Tiefe.
Als Sunita mit dem Kopf auf dem Pflaster der Zeil aufschlug, hörte alles Denken abrupt auf. Ihre Ängste waren ausgestanden, ihre Schmerzen vorbei.
Sunita war sofort tot.
Ihre Armbanduhr war durch den Aufprall auf 9:11 Uhr stehen geblieben.
2. Kapitel
Phillip Krawinckel stand im Ankleidezimmer seiner Bad Homburger Villa, zog den Ärmel seines Designeranzugs zurück und schaute auf die Armbanduhr. Ein zufriedenes Lächeln überflog seine Lippen. Noch einmal zupfte er an seiner Seidenkrawatte und warf einen prüfenden Blick auf seine spitz gefeilten, farblos lackierten Fingernägel.
Als er aus der Tür trat, lief er Mike Kellermann in die Arme.
»Vielen Dank, dass Sie mir die Sachen zum Umziehen herausgelegt haben. Dadurch bin ich gerade noch rechtzeitig fertig geworden, bevor die ersten Gäste eintreffen. Ich habe bei meinem Stadtbummel zu viel Zeit vertrödelt, und jetzt ist es schon 12:15 Uhr.« Kellermann machte eine ruckartige Bewegung mit dem Hals, als sei ihm der goldene Kragen seiner weißen Livree zu eng. »Das ist kein Wunder. Heute ist Allerheiligen. Da ist die Innenstadt übervoll von Pendlern aus den benachbarten Bundesländern. Ich geleite Sie nach unten. Es ist alles gerichtet.«
Auf der halbrunden Marmortreppe warf Krawinckel mehrmals einen Blick in die barocken Wandspiegel, um sein Aussehen zu kontrollieren. Er bückte sich und entfernte mit den Fingerspitzen eine Fluse von seinen schwarzen Lackschuhen. »Wie viele Gäste haben wir heute?«
Mit den Innenflächen seiner Hände glättete Kellermann den Sitz seiner ölig schimmernden dunklen Haare, die er zur Betonung seines kantigen Gesichts locker nach hinten gekämmt trug.
»Es sind heute zweiunddreißig Leute. Fast nur Männer, wie üblich. Ich habe davon abgesehen, Ihnen eine Liste schreiben zu lassen, da Sie alle heutigen Gäste kennen. Sie kommen aus Politik und Wirtschaft. Bei der morgigen Runde wird das anders sein. Da sind die Kulturträger und Künstler dran.«
Die beiden Männer erreichten ein mit Carrara-Marmor gefliestes, mit orientalischen Teppichen ausgelegtes Foyer, das mit zahlreichen runden Stelltischen bestückt war. Gegenüber vom Eingangsbereich waren auf einem Längstisch mit barocken Füßen alle Vorbereitungen für ein Büffet getroffen. Die auf zahlreichen Brennern abgestellten Wärmebehälter blinkten silbern.
Am Ende des Tisches erhoben sich wie eine Säule ein Stoß von hochwertigen Porzellantellern und ein in sich versetzter Stapel weißer Tuchservietten. Mehrere fünfarmige Silberleuchter mit weißen Kerzen und mächtige Sträuße weißer Rosen rundeten das Bild ab. An den Wänden dominierten zahlreiche zeitgenössische Bilder und Skulpturen. Die hintere Fensterfront gab den Blick in einen angrenzenden Park frei.
»Perfekt«, sagte Krawinckel. »Nur meine Frau fehlt noch, um das Bild zu vervollständigen.«
Wieder drehte Kellermann mit einem Ruck den Kopf zur Seite.
»Die gnädige Frau hat von unterwegs angerufen und mitgeteilt, dass sie bedaure. Sie werde sich um ein paar Minuten verspäten.« Krawinckel schaute aus einem der Fenster, die zur Außentreppe zeigten. Bei den Fahrzeugen, die jetzt nacheinander die rondellartige Auffahrt zu seinem Wohnhaus nahmen, handelte es sich nahezu ausschließlich um Nobelkarossen. Die Scheibenwischer waren durchgängig in Hochbetrieb, da es seit dem Morgen unaufhörlich schüttete. Zwei livrierte Bedienstete nahmen die Gäste an den Autotüren mit Hotelschirmen in Empfang und geleiteten sie trockenen Fußes bis in den Eingangsbereich. Dort wartete inzwischen Kellermann, um die Besucher zu Krawinckel zu begleiten, der nun Aufstellung vor den mit weißen Damasttüchern gedeckten Stelltischen genommen hatte und jeden persönlich begrüßte.
Weitere Bedienstete in schwarzer Hose und gold-weißer Jacke schlenderten umher und boten auf silbernen Tabletts reihum Getränke an. Nach und nach bildeten sich kleine Grüppchen, die sich über Belanglosigkeiten unterhielten.
Ein Mann im dunkelblauen Anzug mit schütterem Haar schlich sich an Krawinckel heran. »Sie sehen aus wie das blühende Leben. Als würden Sie gerade Ihren vierzigsten Geburtstag feiern.«
Krawinckel klopfte ihm auf die Schulter. »Danke, mein lieber Müller-Algesheim. Sehr freundlich, aber übertrieben. Bestenfalls gesund gelebt und gut gehalten. Sechsundfünfzig Jahre alt werde ich in diesem Jahr. Da muss man sehen, wo man bleibt.«
Müller-Algesheim senkte die Augenlider. »Bei dieser Gelegenheit – dürfte ich Sie in den nächsten Tagen einmal aufsuchen? Es gibt da in meiner Bank ein kleines Problem. Wir sind offenbar im Immobilienbereich hereingelegt worden. Keine ausreichenden werthaltigen Sicherheiten für unsere Kredite, Sie verstehen?«
Ein heiseres Lachen grub eine Vielzahl kleiner Fältchen in das von der Sonnenbank gleichmäßig gebräunte Antlitz Krawinckels. »Ihre Nöte stehen Ihnen im Gesicht geschrieben. Außerdem sind Sie schon Thema in der Branche. Kommen Sie trotzdem. Rufen Sie an und überlegen Sie vorher gut, was Sie mir für eine etwaige Stützaktion als Gegenleistung zu bieten haben. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss mich noch ein paar anderen Freunden widmen.«
Krawinckel steuerte schnurgerade auf einen Mittvierziger in einem nachlässig aufgebügelten grauen Zweireiher zu. »Herr Minister, wie schön, dass Sie es einrichten konnten. Es ist mir eine Ehre.«
Der Minister nahm das Kompliment mit der Haltung eines elder statesman entgegen. »Wenn die Zeit es zulässt, immer gerne, lieber Krawinckel. Da wir gerade so nett beieinander stehen, will ich Ihnen eine kleine Information zukommen lassen. Wir haben ein paar Veranstaltungsund Ausstattungsideen entwickelt, die das uns entgegengebrachte Wohlwollen stärken könnten. Im Augenblick möchte ich noch nicht präziser werden.« Er lachte. »Nicht aus Misstrauen Ihnen gegenüber, aber hier ist nicht der Rahmen dafür. Ich darf auf Ihre Unterstützung für ein Sponsoring rechnen?«
Mit abgeklärter, aber gleichwohl auch geschmeichelter Miene strahlte Krawinckel den Minister an. »Keine Frage! Ich stehe Ihnen wie immer zur Verfügung. Eine Kleinigkeit hätte ich allerdings auch auf dem Herzen. Vielleicht könnte Ihr Büro mit meinem Sekretariat einen Ihnen genehmen Termin abstimmen? Um Ihre Zeit nicht über Gebühr in Anspruch zu nehmen, komme ich gerne in Ihr Büro nach Wiesbaden.«
Als der Minister gerade seine mit einer Kopfbewegung signalisierte Zustimmung aussprechen wollte, kamen wie schlagartig alle Gespräche an den Stelltischen zu einem Ende. Die Köpfe der Gäste drehten sich in ungeteilter Bewunderung wie an einer Schnur gezogen sämtlich zu dem Treppenaufgang zum Obergeschoss hin.
Von dort kam mit klappernden Stöckelschuhen eine schlanke Mitdreißigerin in kleinen Schritten nach unten, als trippele sie einen Laufsteg entlang. Mehrmals warf sie dabei ihre wallende blondgelockte Mähne hinter ihre Schultern, die aufgrund der hauchdünnen Träger des kurzen schwarzen Kleidchens fast nackt erschienen. Sie war stark geschminkt. Ihre ebenen Züge, die großen stahlblauen Augen, die leichte Stupsnase und die vollen Lippen präsentierten das Bild einer Schönheit in den besten Jahren.
Im krassen Gegensatz zu der unauffällig eleganten Kleidung stand der protzige Schmuck, den Ellen Krawinckel trug. Die mit einkarätigen Diamanten besetzte goldene Halskette ergänzten passende Fingerund Ohrringe sowie ein daumenbreites Armband.
Mit gewohnt selbstsicherem Lächeln ging Ellen Krawinckel auf ihren Mann zu und gab ihm ein Küsschen. »Tut mir leid, Schatzi, dass es etwas später geworden ist. Ich bin aufgehalten worden. Alles hat ein bisschen länger gedauert, als ich geplant hatte.«
»Kein Problem. Die meisten unserer Gäste sind eben erst eingetroffen. Ich hatte selbst Mühe pünktlich zu sein. Du glaubst nicht, wie nervig es heute Morgen in der Innenstadt war.«
Ellen Krawinckel küsste ihn nochmals und ging dann nach und nach zur Begrüßung an die Stelltische. Sie genoss die verstohlen auf ihre Figur gerichteten Blicke der Männer sowie den unvollständig versteckten Neid der Damen. Wohin sie sich auch immer wandte, erfuhr sie die ungeteilte, überschwängliche Aufmerksamkeit der männlichen Gäste und erlebte deren überzogene Selbstdarstellungsversuche.
Nach einigen Minuten trat Kellermann an Krawinckel heran und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Krawinckel nickte, kontrollierte mit raschem Blick den Lack seiner Fingernägel und wandte sich seinen Gästen zu. »Das Büffet ist eröffnet.«
Als ein Teil der Anwesenden verstummte und sich schon auf den Weg zu der Selbstbedienungstafel machen wollte, klopfte der Minister mit einem rasch aus seiner Hosentasche gezogenen Schlüssel gegen sein Glas. »Im Namen von uns allen möchte ich dem Hausherrn für seine selbstlose Art danken, Menschen im wohlverstandenen übergeordneten Interesse zusammenzuführen.«
Die Anwesenden applaudierten. Krawinckel strahlte vor sich hin. Er ließ nicht erkennen, wie dankbar er aufgrund früherer unguter Erfahrungen für die Kürze der Dankesworte des Ministers war.
Nach und nach bewegten sich die Gäste mit gefüllten Tellern wieder vom Büffet auf die Stelltische zu. Im Anschluss daran setzte eine lebhafte Unterhaltung ein, teilweise in Zweiergesprächen, teilweise kreuz und quer über die Tische hinweg. Währenddessen reichten die Bediensteten immer wieder Getränke.
Eine ältere, in Chanel gekleidete Dame, die von mehreren Männern umstanden war, kostete mehrfach in rascher Folge ein Stück Saiblingsfilet, das sie sich aus Angst vor Gräten in kleinen Bröckchen auf ihrem Teller verteilt hatte. Andächtig kaute sie länger darauf herum, als es die portionierten Happen hätten erwarten lassen. Schließlich verdrehte sie die Augen und ließ sich zu einem begeisterten Ausruf verführen.
Während der gesamten Zeit stand Kellermann im Hintergrund und dirigierte wortlos mit Fingerzeichen das Personal. Zwischendurch suchten seine Augen Ellen Krawinckel. Dabei musterte er sie mehrmals mit einem distanzlosen Lächeln.
Phillip Krawinckel hatte sich als Gesprächspartnerin eine ergraute angeheiratete Prinzessin ausgewählt, deren Falten sorgfältig mit Make-up geglättet waren. Sie beobachtete mit Wohlwollen die ordnende Hand Kellermanns und wandte sich dann Krawinckel zu. »Eine Perle, die Sie da haben, mein lieber Herr Krawinckel. Wenn ich Ihnen nicht so verbunden wäre, würde ich Ihnen diesen Herrn gerne abwerben. Er zeigt sich so geschickt in seinen Aufgaben.«
Krawinckel lächelte. »Es gibt kaum etwas, was ich Ihnen abschlagen könnte, Hoheit. Wenn ich in diesem Falle Ihrem Ansinnen folgen würde, stünde mir allerdings erheblicher Ärger mit meiner lieben Frau ins Haus. Sie hat ihn vor einiger Zeit beim Ausführen unserer Hunde zufällig getroffen, als er ebenfalls mit seinem Hund spazieren ging. Dabei ist sie mit ihm ins Gespräch gekommen. Er ist eigentlich von Beruf Jurist. Das sollte man kaum glauben. Er hat mit seinen fast vierzig Jahren allerdings nie in diesem Beruf gearbeitet. Angeblich musste er es nicht, da seine Eltern ein ausreichendes Einkommen hatten und ihm ein eigenes Reihenhäuschen überlassen haben. Es steht fast immer leer, da er überwiegend hier wohnt. Ihm fehlt der Geschäftssinn, es zu vermieten. Als meine Frau mit ihm sprach, war er gerade mit seinen Eltern wegen einer kuriosen Geschichte uneins geworden und benötigte deshalb Geld aus eigenen Einkünften. Darf ich sie Ihnen erzählen?«
Die Prinzessin senkte fast unmerkbar den Kopf. »Selbstverständlich, lieber Freund. Ich brenne darauf.«
»Dann ist mir Ihr Wunsch Befehl. Die Geschichte trug sich so zu: Kellermann frühstückte jeden Morgen mit seinen Eltern in deren benachbartem Reihenhäuschen, fast immer zur selben Zeit. Eines Tages kam er früher zum Frühstückstisch als sein Vater. Als der schließlich hinzukam, erwartete Kellermann, sein Vater werde ihm zuerst einen guten Morgen wünschen. Der Vater bestand aber darauf, dass sein Sohn ihn immer zuerst zu grüßen habe. Seitdem reden die beiden nichts mehr miteinander. Daraus ergab es sich, dass er als eine Art Kammerdiener und Privatberater zu uns gekommen ist.«
»Köstlich, köstlich, lieber Freund. Eine derart amüsante Geschichte habe ich seit Jahren nicht mehr gehört. Bei dieser Gelegenheit will ich noch eine andere Frage loswerden. Wie Sie wissen, bin ich neugierig. Wie geht es eigentlich Ihrer reizenden Schwester? Ich habe sie seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen.«
Das Lächeln von Phillip Krawinckel gefror zu einer Maske.
»Sie ist leider zurzeit unpässlich. Vielleicht beim nächsten Mal. Ich hoffe auf Ihr Verständnis, wenn ich mich jetzt noch einem anderen Gast zuwenden muss.«
Nach kaum mehr als einer Stunde gab Kellermann Phillip Krawinckel ein Zeichen, dass auch der letzte Gast seine Mahlzeit beendet hatte. Krawinckel nahm Blickkontakt zu seiner Frau auf. Beide schlenderten die Stelltische entlang und verabschiedeten die Gäste. Wie bei einer Prozession geleitete Phillip den Zug zur Tür.
Als eben der letzte Gast gegangen war, lächelte Phillip Krawinckel seiner Frau zu. »Ich gehe jetzt mein Schönheitsschläfchen machen.« Sie nickte ihm zu.
Nachdem die Bediensteten den Esstisch wieder geordnet, das Büffet und das Geschirr abgeräumt und sich in den Küchenbereich zurückgezogen hatten, trat Kellermann von hinten an Krawinckels Frau Ellen heran, legte seinen Arm um ihre Taille und zog sie zu sich. Sie versteifte Ihren Körper, fuhr herum und fixierte ihn mit maskenhaften Gesichtszügen. »Kannst du nicht wenigstens warten, bis wir sichergehen können, dass niemand mehr zurückkehrt, Michael? Phillip darf auf keinen Fall etwas merken. Und andere erst recht nicht. Du weißt, welch großen Wert er auf Formen und Etikette legt.«
Kellermann biss die Zähne zusammen und zog seine Hand zurück. Ein dünnes Lächeln glitt über seine Lippen. »Spiel dich nicht so auf. Glaubst du, ich bin blind? Mir ist klar, was hier gespielt wird. Ihr könnt mir nichts vormachen. Keiner von euch. Seht euch vor!« Erneut schnellte sein Kopf kurz zur Seite. »Und lass endlich diesen altbackenen Namen Michael weg. Ich bestehe darauf, dass du mich Mike nennst.«
3. Kapitel
»Frau Bruns. Hören Sie zu. Geben Sie mir bitte schnell mal Herrn Leise am Telefon. Dringend. Das kann ja nicht wahr sein, was mir da wieder vorgelegt worden ist. Ich muss ihn unbedingt sprechen. Wie Sie wissen, will ich in einer halben Stunde weg, um meine Frau abzuholen. Wir sind beim italienischen Generalkonsul zum Mittagessen eingeladen.«
Herbert Hübsch, Behördenleiter der Staatsanwaltschaft Frankfurt, saß mit aufgerollten Hemdsärmeln und heruntergelassener Krawatte in seinem großräumigen Büro auf einem schwarzen Ledersessel hinter dem mahagonifarbenen Schreibtisch, sog an seiner Pfeife und fluchte vor sich hin. Er schwitzte. Sein Hemd klebte ihm am Körper. An dem kräftigen Bauchvorsprung sperrte die Knopfleiste.
Sekunden später klingelte das Telefon. Hübsch hob ab.
»Hallo, Herr Leise. Gut, dass Frau Bruns Sie angetroffen hat. Ich hatte schon die Sorge, Sie seien praktizierender Katholik und kämen heute auf Allerheiligen erst nach dem Kirchgang oder überhaupt nicht.
Hören Sie zu – vor mir liegt aufgeschlagen eine Akte von einem Ihrer Abteilungsmitglieder mit einem Gnadenbericht an das Justizministerium in Wiesbaden. Leider muss ich erneut feststellen, dass Sie mir derartige Vorgänge weitgehend ungeprüft zuleiten. Sie wissen, dass ich menschlich nichts auf Sie kommen lasse. Mir ist auch bekannt, dass Sie ehrenamtlich für die Arbeiterwohlfahrt tätig sind und deshalb nachmittags schon früh die Behörde verlassen. Das nehme ich auf meine Kappe und toleriere es. Es darf aber nicht zu Mehrarbeit für mich führen. Die wesentlichen Vorarbeiten haben Sie und die Staatsanwälte Ihrer Abteilung zu erbringen. Haben wir uns verstanden? Lassen Sie den Vorgang bitte sofort bei Frau Bruns abholen.«
Hübsch legte auf, erhob sich, legte die Pfeife in den großflächigen Aschenbecher und zog die Gardine vor dem seinem Schreibtisch nächstgelegenen Fenster zurück. Er öffnete es einen Spalt, damit der Pfeifenqualm abzog, griff erneut zum Telefon und drückte die Verbindungstaste zu seinem Vorzimmer. »Ist Herr Schultz da? Dann schicken Sie ihn bitte umgehend herein. Wie Sie wissen, will ich in einer halben Stunde weg.«
Kaum hatte Hübsch den Hörer mit Schwung auf die Gabel zurückgelegt, als es klopfte. Frau Bruns, eine Frau mit halblangem grauweißem Haar trat ein, hielt die mit Lederwaben gepolsterte Tür auf, strich ihr schwarzes Kleid glatt und sagte in vorwurfsvollem Tonfall:
»Hier ist Herr Schultz für Sie. Er war pünktlich um 11:30 Uhr hier.«
Ein Lächeln glitt über Hübschs Gesicht. Er fuhr sich mit der Hand über sein dunkelbraunes, mit den Jahren schütter gewordenes gewelltes Haar. »Verstehe. Ich war also wieder zu laut am Telefon. Also, herein mit Herrn Schultz.«
Mit schnellem Schritt trat Hanspeter Schultz ein. Er trug einen dunkelblauen Anzug mit Weste und silbergrauer Krawatte. Sein graumelierter Vollbart war frisch gestutzt, sein Bürstenhaarschnitt auf Zentimeterlänge geschoren. Dadurch erschienen seine rötlichen Wangen voller, als sie ohnehin waren. Nachdem Frau Bruns geräuschlos das Zimmer verlassen hatte, blieb Schultz in respektvoller Haltung an der Tür stehen. Verstohlen zupfte er an den Knöpfen seiner Weste, die nur mühevoll kaschierte, dass er sich wieder einmal mit Riesenschritten der Hundert-Kilo-Marke näherte. Hübsch wies auf die aus sechs Lederstühlen und einem runden Holztisch bestehende Sitzgruppe, gab Schultz die Hand und sagte:
»Hallo, Herr Schultz. Nehmen Sie ruhig Platz. Sie können gern Ihr Jackett ablegen. Ich will allerdings nur kurz etwas mit Ihnen besprechen.«
Schultz wartete, bis sich Hübsch hingesetzt hatte. Dann ließ er sich auf dem ihm gegenüberstehenden Stuhl nieder, legte die Hände gefaltet auf den Tisch und sah Hübsch an.
Hübsch rückte mit Daumen und Mittelfinger seine rechteckige Brille zurecht, hustete mehrfach und sog tief die Luft ein. »Passen Sie mal auf, Herr Kollege. Sie haben sich da vor einiger Zeit auf eine Abteilungsleiterstelle in unserem Haus beworben. Es gab dabei noch etliche Mitbewerber. In meinem Vorschlag an das Justizministerium habe ich mich für Sie ausgesprochen. Ich schätze Ihren Einsatz und Ihren Fleiß, wenn auch in der Vergan-
genheit einige Ihrer Kapriolen nicht ganz meine Zustimmung fanden. Das Ministerium hat ungewöhnlich lange auf dem Vorgang gesessen, bis es sich zu einer Entscheidung durchgerungen hat. Welche Gründe diese lange Zeitdauer verursacht haben, ist mir nicht bekannt.« Hübsch machte eine Pause und schaute sich suchend im Zimmer um. »Stört es Sie, wenn ich rauche?«
Schultz schüttelte den Kopf. »Ich rauche selbst gerne. Zigarren.«
Die Hoffnung von Schultz, Hübsch würde ihm ebenfalls das Rauchen gestatten, erfüllte sich nicht. Andererseits verbot ihm sein hierarchisches Verständnis, aus seiner Anzugjacke eine seiner Metallhülsen mit einer Partagas zu holen.
Hübsch ging zu seinem Schreibtisch, zündete seine Pfeife an und nahm wieder seinen alten Platz ein. Er schmauchte in Richtung des geöffneten Fensters und sah einen Moment den Rauchwolken nach. »Kurzum, Herr Schultz. Das Ministerium hat sich, wie ich erfahren habe, für einen anderen Bewerber entschieden. Das tut mir leid für Sie. Ich habe mich allerdings anschließend bei unserem Staatssekretär für Sie starkgemacht. Und jetzt kommt der bessere Teil der Botschaft, die ich für Sie habe. Herr Staatssekretär Willeführ hat mir gesagt, dass er beabsichtigt, Ihnen die nächste frei werdende Abteilungsleiterstelle zu geben. Selbstverständlich hat er betont, dass dies keine Zusage sei, weil er das nicht dürfe. Aus meiner früheren Tätigkeit im Ministerium weiß ich, dass sich Ministerialbeamte immer so ausdrücken. Jetzt aber mal mit meinen Worten: Wenn Sie keine silbernen Löffel klauen, ist die nächste Stelle eines Oberstaatsanwalts Ihnen. Unsere Vizechefin wird Sie allerdings jetzt verstärkt zur Vertretung abwesender Abteilungsleiterkollegen einsetzen, damit wir für die nächste Bewerbung noch ein paar mehr Pluspunkte sammeln können. Das beginnt schon heute damit, dass Sie die Vertretung der Leitung unserer Verkehrsabteilung übernehmen müssen. Der Kollege Asche ist voraussichtlich für längere Zeit erkrankt.«
Schultz nahm die Mitteilung ohne erkennbare Gemütsbewegung auf. »Ich danke Ihnen dafür, dass Sie sich so für mich eingesetzt haben, und für das große Vertrauen, das Sie mir schenken. Ich werde Sie nicht enttäuschen.«
Die Tür öffnete sich. Frau Bruns streckte ihren Kopf herein.
»Da wäre der Generalstaatsanwalt für Sie auf Leitung zwei.«
»Ja, ist in Ordnung. Das trifft sich gut. Herr Schultz, machen Sie es gut. Bis bald, bei hoffentlich noch besserer Gelegenheit.« Schultz verließ das Zimmer des Behördenleiters, durchschritt das Vorzimmer von Frau Bruns und betrat den Flur des L-förmigen Gebäudes. Er suchte den längeren Flügel auf, der im rechten Winkel nach links abbog. Die architektonische Gleichförmigkeit hätte es ihm bei seinem mangelhaften Orientierungssinn kaum ohne ständiges Schauen nach den Türschildern erlaubt, sein Dienstzimmer aufzufinden. Als Eselsbrücke hatte er sich jedoch gemerkt, dass es das erste Zimmer rechts nach der Feuerschutztür, die den Gang in zwei gleiche Hälften teilte, sein musste.
Bereits vor der Tür des Dienstzimmers mit der Nummer 320 roch es nach Kaffee. Schultz freute sich darüber. Mit Schwung öffnete er die Tür und sah hinter dem linken der beiden gegeneinandergerückten Schreibtische seinen jungen Kollegen Augustin Diener sitzen, der, über einer Akte brütend, seine halblangen blonden Haare nach hinten warf und in Gedanken verloren zu ihm aufschaute. Aus den Augenwinkeln stellte Schultz fest, dass der Inhalt des Bilderrahmens auf Dieners Schreibtisch wieder einmal gewechselt hatte und heute eine lächelnde Blondine zeigte.
»Schön, dass du da bist und Kaffee gekocht hast, Augustin. Ich hatte schon befürchtet, dass du aus irgendeinem Grund außer Haus wärst.«
»Wenn du pflichtbewusst wie unsereiner um halb neun Uhr in der Behörde gewesen wärest, hätte ich dir mitteilen können, dass ich nach dem Stand von heute Morgen nur einen Nachmittagstermin im Gerichtsmedizinischen Institut wahrnehmen muss. Wie üblich glänzte jedoch mein lieber Mitstreiter durch Abwesenheit.« Schultz lächelte. Er schätzte den rund zehn Jahre jüngeren Diener wegen seiner unkonventionellen Art, seines hohen Intellekts und seines Einfallsreichtums. Es erfüllte ihn mit Stolz, dass er diesen begabten Kollegen zeitweise ausgebildet und gegengezeichnet hatte. Berufsanfänger durften in den ersten drei Monaten noch nicht selbst unterschreiben. Wegen der herausragenden Fähigkeiten von Diener war diese Frist auf Vorschlag von Schultz halbiert worden.
Diener legte den Kugelschreiber zur Seite. Mit der Hand dehnte er den engen Rundkragen seines dunkelblauen Sweatshirts, das auf der Brust den knallroten Namenszug Lee Est.
1889 trug. »Erzähle. Was hat er gesagt.«
Währenddessen war Schultz zum Schrank gegangen, hatte seinen schwarzen Kaffeebecher mit der weißen Aufschrift Boss herausgeholt und hielt ihn Diener entgegen. »Gib mir bitte erst einmal einen Kaffee. Dann berichte ich dir.«
Schultz setzte sich in seinen Sessel, nahm eine Partagas heraus, kerbte das Mundstück mit einem kleinen Taschenmesser ein und zündete die Zigarre mit einem Streichholz an. Dann streckte er die Hand aus und nahm von Diener den Boss-Becher entgegen.
»Was soll er gesagt haben? Ich bekomme die Stelle nicht. Das Ministerium hat gegen mich entschieden.«
»Wundert dich das? Mich nicht. Du bist nominelles SPD-Mitglied, wenn auch dein Gedankengut häufiger einem Kontrastprogramm ähnelt. Unsere Landesregierung hat zurzeit nicht deine Farben.«
»Das siehst du falsch, Augustin. Bei der Besetzung der Stelle für einen Oberstaatsanwalt stellt man in Wiesbaden noch nicht auf die politische Einstellung des Bewerbers ab. Das beginnt erst bei höheren Positionen. Außerdem, aber das musst du für dich behalten, hat der Staatssekretär unserem Chef gesagt, dass ich die nächste frei werdende Stelle so gut wie sicher habe.«
»Warten wir es ab. Ich würde es dir von Herzen gönnen.«
»Der Chef hat mir außerdem gesagt, dass ich jetzt mehr in Vertretungen von abwesenden Abteilungsleitern eingebunden werde, um Pluspunkte zu sammeln. Ich habe ab heute schon die Vertretung des Leiters der Abteilung IX.«
»Jetzt verstehe ich. Die Kripo hat mich offenbar heute Vormittag gar nicht wegen meines Bereitschaftsdienstes angerufen. Die wussten vielmehr schon von deiner neuen Aufgabe. Wahrscheinlich waren sie durch das Vorzimmer unserer Vizechefin informiert. Der Abteilungsleiter IX soll doch tagsüber als Erster von der Auffindung einer Leiche unterrichtet werden, wenn der Verdacht eines unnatürlichen Todes nicht einwandfrei ausgeschlossen werden kann. Der Anruf galt eigentlich dir.«
»Das kann sein. Was ist denn vorgefallen?«
Diener stand auf, stemmte seine Hände in die Hüften und streckte seinen schlanken, sportlichen Körper ein paar Mal nach hinten. Tatsächlich wollte er nur ein wenig Zeit gewinnen, um eine geeignete Formulierung zu finden, wie er Schultz den Sachverhalt näherbringen sollte. Bei mehreren früheren Gelegenheiten hatte er feststellen müssen, dass Schultz mit Berichten über tote Kinder nicht gut umgehen konnte. Wie Diener wusste, hatte Schultz seine einzige Tochter im Kindesalter durch Leukämie verloren. Tote Kinder stellten seitdem ein Tabuthema dar. Diener lief in dem kleinen, mit Büromöbeln vollgestopften Zimmer auf und ab. Dann sah er Schultz in die Augen. »Ich bin schon vom vielen Sitzen ganz steif, Hanspeter. Leider kann ich es dir nicht ersparen, alte Wunden aufzureißen. Es gibt eine neue Leichensache mit einem Mädchen. Wie mir das K 11 mitteilte, ist sie aus dem achten Stock über die Brüstung der Zeilgalerie auf das Straßenpflaster gefallen. Es ist unklar, ob sie gesprungen ist oder ob jemand nachgeholfen hat.«
Der Gesichtsausdruck von Schultz nahm starre Züge an. Er zog die Augenbrauen hoch und zuckte die Schultern. »Hat die Kripo einen Verdacht?«
»Nein. Bisher nicht. Ich habe zunächst einmal wegen der Eilbedürftigkeit der Sache die Obduktion angeordnet. Die Kripo hat unmittelbar danach mit dem Gerichtsmedizinischen Institut telefoniert, um möglichst rasch eine Klärung herbeizuführen. Wie mir Köhler am Telefon mitteilte, hat ihn Frau Dr. Lubitsch kurz danach zurückgerufen und ihm gesagt, dass das Kind um 15:30 Uhr obduziert werden soll. Ich hoffe, dass ich mit meiner Anordnung in deinem Sinne gehandelt habe. Jedenfalls gehe ich hin und nehme an der Obduktion teil. Im Anschluss daran werde ich dich über das Ergebnis unterrichten. Im Übrigen bin ich hundemüde.«
Schultz paffte an seiner Zigarre und trank einen Schluck Kaffee. »Weibergeschichten?«
»Auch. Aber wie ich schon sagte, habe ich die ganze Woche Bereitschaftsdienst. Heute Nacht rief mich erst die Autobahnpolizei an und wollte von mir die Festsetzung einer Sicherheitsleistung, weil ein Ausländer einen Unfall gebaut hatte, aber weiter in sein Heimatland fahren wollte. Das habe ich noch ertragen, weil der Hinweis auf meine Unzuständigkeit länger als die Entscheidung gedauert hätte, die sich erledigte, weil der Ausländer sowieso kein Geld dabei hatte. Dann rief mich eine Stunde später die Kripo wegen eines Ladendiebstahls vom Vorabend an und fragte, ob sie den Beschuldigten, einen wohnsitzlosen Erwachsenen, dem Haftrichter vorführen sollte. Denen habe ich erklärt, dass ich nicht zuständig sei. Daraufhin rief mich nochmals eine gute Stunde später der Vorgesetzte an, um sich zu entschuldigen. Da war die Nacht herum. Jetzt verstehst du, warum ich müde bin.«
Schultz musste lachen.
4. Kapitel
»Krawinckel«, dröhnte es aus dem Hörer des Mobiltelefons in das Ohr von Sunitas Adoptivvater Wolfgang Beuchert.
Beuchert saß voll angekleidet in dunkelblauem Anzug, weißem Hemd und dunkelroter, in sich gemusterter Krawatte auf der Toilettenbrille in einem der Bäder seines am Feldrand in der Nordweststadt Frankfurts gelegenen geräumigen Bungalows. Hierher hatte er sich zurückgezogen, um eine Weile seine Ruhe vor seiner ständig an ihm herumnörgelnden Frau zu haben. Die Nummer von Phillips privatem Mobiltelefon hatte er auswendig gewusst. Er atmete tief ein. »Hallo, Phillip. Ich bin es. Hast du zwei Minuten Zeit für mich?«
»Guten Tag, Wolfgang. Das muss irgendwie Gedankenübertragung gewesen sein. Vor ein paar Minuten haben Ellen und ich unsere heutigen Gäste verabschiedet. Ich sitze im Auto und bin ganz in deiner Nähe. Gerade wollte ich anrufen und fragen, ob Sunita vielleicht Lust hat, mit mir einen kleinen Einkaufsbummel zu machen. Ich bin schon auf der Höhe der Wohnblocks vor dem Nordwest-Einkaufszentrum. Hast du etwas Besonderes auf dem Herzen, weshalb du mich anrufst?«
Beuchert drückten schwere Geldsorgen, die ihn während der vergangenen Nacht fast durchgängig wach gehalten und beschäftigt hatten. In der linken Hand, die auf seinem hervorquellenden Bauch ruhte, hielt er sein Mobiltelefon. Mit der anderen Hand wischte er sich mehrmals den Schweiß aus dem Gesicht und fuhr sich anschließend leicht zitternd durch das nach hinten gekämmte volle schwarz-graue Haar. Mehrfach musste er seine schwarze Hornbrille mit dem Zeigefinger den Nasenrücken hochschieben, weil sie auf dem nassen Gesicht ständig rutschte. Zu dumm, dass er heute Morgen auf der Fahrt in die Innenstadt sein Mobiltelefon vergessen hatte. Von unterwegs hätte er
anrufen können, ohne dass seine Frau mithörte.
Er musste wirklich schon wieder Phillip Krawinckel anrufen. Seinen alten Schulfreund Phillip, der über alles Geld der Welt verfügte. »Wenn du sowieso nur noch einen Herzschlag von hier entfernt bist, komm doch einfach vorbei. Dann brauchen wir jetzt nicht lange am Telefon hin und her zu reden. Ich setze uns bis dahin einen Kaffee auf.«
»Einverstanden, bis gleich«, sagte Krawinckel und beendete das Gespräch.
Gewohnheitsgemäß öffnete Beuchert das Toilettenfenster und spähte dann aus der Tür nach seiner Frau. Er hörte sie in der ein Zimmer weiter gelegenen Küche hantieren und ging dorthin. Als er die in schraffiertem Glas gehaltene Küchentür öffnete, stand seine Frau vor dem halb geöffneten Kühlschrank und kaute. Beuchert betrachtete ihre füllige Figur. Die grün-weiß gestreiften Leggins bedeckten barocke Oberschenkel, unter dem weißen TShirt zeichneten sich mehrere Speckröllchen ab, die blonde Kurzhaarfrisur betonte das vom Kauen in Schwingungen gebrachte Doppelkinn.
Beuchert ging auf sie zu, setzte eine giftige Miene auf und tätschelte ihr den Bauch. »Nanu, Herzchen, wie ich sehe, nimmst du gerade dein zweites oder drittes Frühstück ein. Dazu gehört bei deiner Figur ein erhebliches Selbstvertrauen.«
Karin Beuchert reckte sich zu ihrer imponierenden Größe auf und gewann an Ähnlichkeit mit einem kämpferischen Truthahn.
»Du musst gerade reden. Schon seit Jahren führst du beim Hosenkauf den Kampf mit der Frage, ob du den Bauch über oder unter dem Hosenbund unterbringen sollst. Die Art, wie die Knopfleiste deines Hemdes überall sperrt, verrät wohl kaum den jugendlichen Waschbrettbauch. Schau dir deinen Freund Phillip an. Der ist genau wie du Mitte fünfzig, aber immer noch schlank und drahtig. Bei mir ist das etwas anderes. Das sind die Wechseljahre. Da haben alle Frauen mit ihrem Gewicht zu kämpfen. Das legt sich später wieder von selbst.«
»Phillip müsste gleich hier sein. Ich habe eben mit ihm telefoniert. Wir haben etwas Geschäftliches zu besprechen.«
Karin Beuchert zog die Augenbraue hoch. »Warst du nicht eben auf der Toilette? Telefonierst du neuerdings dort? Man könnte meinen, dass du Geheimnisse vor mir hast.«
»Unfug. Ich habe natürlich vorher mit ihm telefoniert, als ich mit dem Auto unterwegs war. Schade, dass sich dein ausgeprägtes Interesse nur immer auf mein Verhalten und nicht wenigstens andeutungsweise auf die häuslichen Belange erstreckt. Du liegst
tagelang von morgens bis abends im Bett und telefonierst, liest Zeitungen oder guckst fern. Wenn ich mich nicht neben meiner vielen Arbeit auch noch um die Kinder kümmern würde, sähe es hier mit allem finster aus.«
Als Karin Beuchert nach einer wegwerfenden Handbewegung tief Luft zu einer Gegenrede holte, klingelte es an der Haustür. Schnurstracks setzte sie sich erhobenen Hauptes in Bewegung, um zu öffnen. Vor der Tür stand ein braungebrannter, hochgewachsener Mann im eleganten dunkelblauen Seidenblazer, offenem weißen Rüschchenhemd und dunkelgrauer Hose. Sie umarmte ihn und drückte ihm rechts und links ein Küsschen auf die Wangen. »Hallo, Phillip. Komm rein. Wir haben dich schon erwartet.«
Krawinckel lächelte sie an, ergriff ihre Hand, gab ihr einen flüchtigen Handkuss, trat in den mit schieferfarbenen Marmorplatten gefliesten Hausflur und begrüßte Wolfgang Beuchert.
»Grüß dich, Wolfgang. Hier bin ich, wie angedroht.« Krawinckel und Beuchert begaben sich zum Wohnzimmer. Auf
den schweren Orientteppichen, die weite Teile des Dielenparketts bedeckten, führte Beuchert seinen Gast zu der in weißem Wildleder gehaltenen Sitzgarnitur. Die beiden im rechten Winkel aufgestellten dreiteiligen Elemente gestatteten den Blick auf den sorgfältig gestutzten Rasen des mit einigen kleinwüchsigen Bodendeckern eintönig gestalteten Gartens. Nachdem Krawinckel Platz genommen hatte, setzte sich Beuchert ihm gegenüber in einen cremefarbenen Ledersessel, dessen drehbare Sitzfläche dem in einer Nische platzierten Großbildfernseher zugewandt war.
Beuchert wandte das Gesicht seiner Frau zu, die in der Tür stand. »Liebling, sei so nett und mach uns einen Kaffee. Phillip und ich haben etwas Geschäftliches zu besprechen.«
Mit den Fußspitzen versetzte Wolfgang Beuchert seinem Sessel in kleine Drehbewegungen und schaute dabei Krawinckel lächelnd an. »Hier sitze ich samstags immer, wenn ich mir die Fußballergebnisse in der Sportschau ansehe. Für deinen gesellschaftlichen Anspruch ist dieser Sport sicher zu primitiv. Wenn man, wie du, bereits im zarten Alter von Ende vierzig eine feine Privatbank gewinnbringend verkauft hat und nur noch ver-
meintliche gesellschaftliche Pflichten erfüllt, muss man sich beim Sport einfach mehr auf Reiten oder Golf konzentrieren. Da ist für die Lieblingssportarten des gemeinen Volkes kein Platz.«
Das Gesicht Krawinckels ließ keine Regung erkennen. Er lehnte sich tief in die Couch zurück und legte seine Arme ausgestreckt über die Rückenlehne. »Du vergisst, dass ich immerhin jahrelang persönlich haftender Gesellschafter meiner Bank war und ein hohes unternehmerisches Risiko gefahren bin. Wenn ich nur Leute deiner Qualität finanziert hätte, würde ich heute bestenfalls noch als Portier in meiner früheren Bank arbeiten. Ich verstehe nicht, weshalb jetzt ausgerechnet bei dir der Sozialneid aufkocht. Du lebst doch gar nicht schlecht. Jedenfalls weit über deine Verhältnisse, wie ich weiß. Und überwiegend von meinem Geld.«
Die Schärfe des Tones und der Umstand, dass Krawinckel aus der Frankfurter Mundart ins Hochdeutsche übergegangen war, warnten Beuchert.
»Das war nicht böse gemeint, Phillip. Du weißt, dass ich dir deinen Reichtum von Herzen gönne. Wie du schon zu Recht gesagt hast, profitiere ich davon. Ich bete sogar inständig, dass dir nicht solche Pannen passieren, wie ich sie hinnehmen musste. Mit meinen Bemerkungen wollte ich nur zum Ausdruck bringen, dass ich trotz meines wirtschaftlichen Höhenflugs in vielen Belangen ein einfacherer Mann geblieben bin. Diese Feststellung sollte aber kein Vorwurf sein.«
Bevor sich Krawinckel darüber einig werden konnte, ob er etwas entgegnen oder korrigieren sollte, betrat Karin Beuchert wieder den Raum. Sie stellte vor den beiden Männern ein Silbertablett ab, auf dem sie das Kaffeegeschirr, einen Teller mit Gebäck und eine Thermoskanne transportiert hatte. »Das sieht zwar nicht sehr stilvoll aus, ich habe mir aber gedacht, dass der Kaffee in dieser Kanne länger warm bleibt. Ihr könnt euch selbst bedienen. Ich bin sowieso beleidigt, da man mich ja offenbar hier nicht dabeihaben will.«
Krawinckel lachte. »Ich habe überhaupt nichts dergleichen gesagt, liebe Karin. Das war dein rüpelhafter und eifersüchtiger Mann, der mir deine Anwesenheit nicht gönnt.«