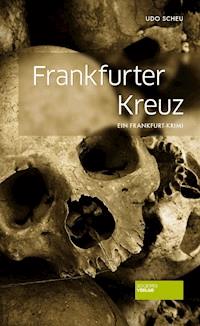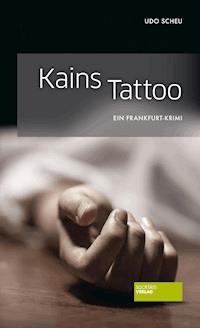Des Sängers Fluch (A66, Hofheim)
Als Kevin Richard Russell gegen 9 Uhr die Bühne betritt, wird es im Publikum totenstill. Es ist nicht die Bühne, auf der er sich heimisch fühlt. Auf der ihn seine Anhänger sehen wollen. Aber er hat keine Wahl. Den Saal des Landgerichts Frankfurt, den größten, den es dort gibt, betritt Kevin Russell mit unsicheren Schritten. Ein vorzeitig gealterter, schwer kranker Mann kommt da. Russell verläuft sich fast auf dem Weg zur Anklagebank. Dann findet er seinen Platz für die nächsten Tage doch noch. Er lässt sich in den Stuhl sinken, fängt an zu wippen und glotzt ins Leere. Minutenlang. Die Kameras klicken. Plötzlich kommt etwas Leben in den Mann. Russell lächelt wie blöde ins Blitzlicht, dann dringt es heiser und halblaut aus ihm heraus: „Eins für Mama, eins für Papa, eins für Onkel ...“ Er nuschelt. Lallt ein bisschen. Das Frankfurter Landgericht hat schon viele gespenstische Momente erlebt. Dies ist der wohl Gespenstischste seit Langem. Oben auf der Tribüne, wo Platz für 50 Journalisten ist, herrscht ebenfalls Stille. Alle starren auf diesen Mann dort unten.
Kevin Russell, 46 Jahre alt und Ex-Sänger der Böhsen Onkelz, hat zum Prozessauftakt seine langen Haare abgeschnitten. Das strähnige Haar ist zurückgekämmt. Die Sonnenbrille hat er hochgeschoben. Die Richter betreten den Saal: zwei Berufsrichter, zwei Schöffen. Die Zuschauer vergessen, aufzustehen. Sie schauen weiter gebannt auf den Mann, der mal ein böser Onkel gewesen sein will. Einer, der auf furchtlos machte, der vor Kraft kaum laufen konnte. Trotzig. Widerspenstig. Der Vorsitzende Richter schickt die Kameraleute und die Fotografen raus. Sie haben ihre Bilder. Bessere, als sie erwartet hatten. Sie haben Fotos eines Mannes, der gefragt nach seinen Personalien stammelt: „Ich bin mehr oder weniger in Frührente.“ Seine Stimme ist brüchig. Dünn. Da röhrt nichts mehr. Russell, das tätowierte Kraftpaket von einst, das auf der Bühne seinen Zorn herausschrie. Ein Mann, der mit jeder Faser zu sagen schien: Je mehr ihr mich hasst, desto stärker werde ich. Der kultiviert hatte, wofür ihn seine Anhänger noch Jahre nach der Trennung der Onkelz verehrten: an den Rand gedrängt, Außenseiter und vor allem stolz darauf zu sein. Doch der Mann, der heute auf der Anklagebank sitzt, ist nur noch der Schatten eines bösen Onkels. Nichts dringt mehr durch. In keine Richtung. Seine Miene ist versteinert. Er wirkt vollkommen abwesend. Mit letzter Kraft hält er sich am Stuhl fest, erträgt die erstaunten Blicke, die auf ihm ruhen. Wenn er sie denn wahrnimmt. Noch vor wenigen Monaten sah er völlig anders aus. Dieser Mann ist binnen Wochen um Jahrzehnte gealtert.
Kevin Russell steht vorm Frankfurter Landgericht, wobei es so aussieht, als sei er schon von einem anderen Richter verurteilt worden. Dem gnadenlosesten, den es gibt: nämlich sich selbst. Dem einzigen, der es geschafft hat, ihn kleinzukriegen.
Kevin Russell, sagt der Staatsanwalt, hat sich der Unfallflucht, der fahrlässigen Straßenverkehrsgefährdung und der fahrlässigen Körperverletzung schuldig gemacht. Er hat, glaubt der Ankläger, am Silvesterabend 2009 um 20.25 Uhr einen Unfall mit verheerenden Folgen verursacht. Er saß an diesem letzten Abend im Jahr am Steuer eines geliehenen Sportcoupés, eines Audi R8. Russell stand unter Drogen: Kokain, Methadon und Diazepam. Das soll gegen Angst helfen und ist ein Schlafmittel. Junkies wie Russell greifen gerne dazu, um sich zu beruhigen, wenn die Wirkung des Rauschgiftes nachlässt. Mit diesem Cocktail im Leib jedenfalls raste er über die viel befahrene Autobahn zwischen Frankfurt und Wiesbaden. Mit 230 Sachen. Dabei streifte er mit seinem Sportwagen auf der rechten Fahrspur ein Auto, das mit etwa Tempo 100 vor ihm fuhr. Ein Kleinwagen. Russells Auto kostet dagegen gute 120.000 Euro. Beide Autos prallten zusammen und schleuderten in die Leitplanke. Der Opel, in dem zwei junge Männer saßen, fing an zu brennen. „Der Fahrer trug Verbrennungen an mehreren Körperstellen, eine Leberblutung, eine Milzruptur sowie eine Verletzung der linken Niere davon“, sagt der Staatsanwalt in seiner Anklageschrift. Und fährt fort: Der Beifahrer hat Verbrennungen erlitten. Ihm musste außerdem eine Hand amputiert werden.
Kevin Russell dagegen stieg beinahe unversehrt aus dem Sportwagen, schaute kurz auf das brennende Fahrzeug und lief davon. Es waren andere Autofahrer, die den beiden schwer verletzten Männern das Leben retteten. Sie zogen sie aus dem brennenden Opel. Kevin Russell war da schon auf den Feldern Richtung Frankfurt-Höchst unterwegs. Ziel: Bahnhof.
Der Rocksänger ist laut Anklage erst geflüchtet, als bereits Helfer an der Unfallstelle waren. „Daher musste er nicht davon ausgehen, dass er die Unfallopfer in einer hilflosen Lage zurückgelassen hatte“, formuliert es der Ankläger in Juristenlogik. Und meint damit, dass jemand da war, der den Opfern geholfen hat. Das hat Russell wahrgenommen und ist deshalb nicht wegen versuchter Tötung durch Unterlassen und unterlassener Hilfeleistung angeklagt worden. Allerdings: Wegen der besonderen Bedeutung des Falles hat die Staatsanwaltschaft Anklage vor dem Landgericht und nicht wie sonst üblich vor dem Amtsgericht erhoben. Besonders deshalb, weil klar war: Hier kommt viel Publikum. So viel, dass ein Amtsrichter möglicherweise überfordert wäre, der auf Wachtmeister verzichten muss, wenn der Angeklagte nicht in Haft sitzt. Und Kevin Russell lief frei herum. Ein einzelner Richter wäre wohl auch überfordert gewesen, wenn renitente Onkelz-Fans erschienen wären. Und damit war zunächst gerechnet worden. Es hatte versteckte Drohungen gegeben. Vor allem im Netz gegen den Staatsanwalt.
Kevin Russell besitzt keinen Führerschein. Er hat keine gültige Fahrerlaubnis für Deutschland. Die verlor er bereits 2004 wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Er hat sie nie wieder erlangt. Auch damals saß er betrunken hinterm Steuer und ist danach abgehauen. Das Amtsgericht in Königstein hat ihn damals zu einer Geldstrafe von 2.275 Euro verurteilt.
Am Morgen nach dem verheerenden Unfall auf der Autobahn 66 stand die Polizei im Foyer des 5-Sterne-Hotels Villa Rothschild, wo es Zimmer ab 300 Euro gibt. Kevin Russell lebte hier. Die Beamten wollten wissen, ob er am Steuer des Unfallautos saß. Er verneinte. Sie nahmen ihn trotzdem mit. Sein Manager kam auch. Der Rocksänger erklärte, der Manager sei am Abend zuvor gefahren. Der Manager bestätigte das. Aber die Spuren waren eindeutig. Am Airbag des Sportwagens sind DNA-Spuren von Kevin Russell entdeckt worden. Sein Gebiss lag im Fußraum, sein Körper zeigte die typischen Zeichen eines Unfalls. Dort, wo der Gurt saß, waren blaue Flecken. Und die Überwachungskamera der nahe gelegenen Autobahntankstelle zeigte, wie Russell Minuten vor dem Unfall in der Nähe vom Tatort einkaufte. Es sei ihm dort speiübel geworden, er habe sich übergeben, sei nicht mehr ins Auto eingestiegen, sagte Russell den Polizisten. Doch die glaubten ihm nicht und fanden an der Tankstelle auch keine Hinweise für seine Version. Kevin Russell hinterlegte 50.000 Euro als Sicherheitsleistung. Damit kaufte er sich von der Untersuchungshaft frei. Und blieb auf freiem Fuß.
Während die Ermittler Beweise und Indizien sammelten, es öffentlich wurde, dass wohl Kevin Russell der Unfallfahrer aus der Silvesternacht war, sprach seine Mutter Karin mit der Presse. Die 73-Jährige, die in einem Reihenhaus in Bayern wohnt, erzählte den Journalisten, sie habe regelmäßigen Kontakt zu ihrem Sohn gehabt. Doch nach dem Unfall habe er sich nicht gemeldet. Wo er wohnt, wisse sie auch nicht. Aber dass er jeden Monat 500 Euro an sie überwies. Beleg dafür, dass er eben doch ein guter Sohn sei. „Kevin hat oft eine Weltuntergangsstimmung, alles ist schlecht, jeder ist sein Feind“, diktierte die Mutter den Journalisten. Und zeigte ihnen einen Brief, in dem er sie Mumsken nannte. Und alte Sumpfkeule. Die Probleme ihres Sohnes, sagte die 73-Jährige, habe sie immer im Blick behalten. Sie wisse von seiner schweren Drogensucht, davon, dass er nach einem heftigen Rückfall lange im künstlichen Koma gelegen hatte. Und das Sorgerecht für Sohn Julian entzogen bekommen habe. „Kevin“, sagte seine Mutter, „hatte sehr viel für seinen Sohn übrig, aber erzieherisch hat er versagt. Er dachte immer, mit Geld kann man alles kaufen, auch Glück.“
Fahdi hat am Silvesterabend drei Finger der rechten Hand verloren. Aber was schwerer wiegt, er hat an diesem Abend auch sein Selbstwertgefühl verloren. Das bisschen, was er hatte. „Ich bin im Krankenhaus aufgewacht als Krüppel“, sagt er als erster Zeuge im Prozess. Er sagt das immer und immer wieder: das Wort „Krüppel“. Aber eigentlich sagt er es nicht, er speit es aus. „Ein Behinderter bin ich jetzt, er hat mich zum Krüppel gemacht. Wie kann ein Mensch einem anderen so etwas antun?“ Er finde keine Arbeit mehr, könne sich nicht allein die Hose zumachen, werde immer aggressiver, sei lieber tot, als so weiterzuleben: als Krüppel. Er streckt Russell anklagend die Linke entgegen. Der glotzt ins Leere. An den Abend kann sich Fahdi kaum mehr erinnern. Er weiß nur noch: „Ich wollte feiern gehen und bin als Krüppel im Krankenhaus aufgewacht.“ Dann schaut er zu Kevin Russell. Und sagt wieder voller Hass und Wut: „Du hast mein Leben kaputt gemacht, ich wäre lieber gestorben.“
Die Opfer Fahdi (22) und Jamal (20) sind durch den Unfall gezeichnet. Sie erlitten schwerste Verbrennungen und wurden mehrfach operiert. In Kleidern sieht man den beiden, die als Nebenkläger auftreten, kaum etwas an. Niemand würde sich nach ihnen auf der Straße umdrehen.
Auch der Schüler Jamal hat keine Erinnerung mehr – weder an den Unfalltag noch an den langen Aufenthalt in der Klinik. Sein Gedächtnis ist völlig hinüber. Wegen der massiven Kopfverletzungen, die er bei dem Unfall erlitten hat. Er hat Gedächtnis- und starke Konzentrationsstörungen. Er sagt, er könne sich nicht mehr alleine anziehen, weil er im Schrank die Hosen nicht mehr finde. Die Mutter müsse helfen. Wie bei einem Kleinkind. Sein Verhalten vor Gericht lässt diese Aussage mehr als glaubhaft erscheinen.
In der Verhandlungspause sieht man die Onkelz-Fans. Einige tragen Shirts der Band. Sie sind schweigsam und nachdenklich. Einer gibt einem Fernsehteam ein Interview. Er stehe zu Kevin, „in guten wie in schlechten Zeiten“, und es sind für Kevin Russell verdammt schlechte Zeiten. Doch der Fan gehört nicht mehr zur Mehrheit von Kevin Russells Anhängern. Vor allem im Internet werden sie sehr deutlich, äußern klar ihre Wertevorstellungen. Eine davon ist: Schwerverletzte lässt man nicht am Unfallort zurück, schon gar nicht, wenn man den Unfall selbst verursacht hat. Dazu steht man. Erst recht als Onkel.
1980 hatten sich die Onkelz als Punkband gegründet. Sie spielten in der rechten Skinhead-Szene die führende Rolle, waren stilgebend für das, was später Rechtsrock genannt wurde. Ihr Debut-Album „Der nette Mann“ erschien 1984. Es gilt bis heute als eines der wichtigsten in der deutschen Skinhead- und Rechtsrock-Musik. Das Album kam 1986 auf den Index. Es sei jugendgefährdend, entschied die Bundesprüfstelle. Das verhalf den Böhsen Onkelz zum Kultstatus. Hauptmerkmal der frühen Böhsen Onkelz war aber nicht eine ausgefeilte politische Ideologie, sondern eine hohe persönliche Gewaltbereitschaft gegenüber denen, die ihnen nicht passten. Beim Fußball etwa. 1984 vor der Europameisterschaft in Frankreich sangen sie: „Deutschland, Deutschland ist die Macht. Ja, wir sehen uns in jedem Fall im Sommer 84 zum Frankreich-Überfall.“ Nachhaltig hat den Ruf der Band der Song „Türken raus“ geprägt, veröffentlicht auf einem autorisierten Mitschnitt noch vor dem ersten offiziellen Album der Band. Darin heißt es: „Türkenpack, Türkenpack, raus aus unserm Land! Geht zurück nach Ankara, denn Ihr macht mich krank!“ In einem anderen frühen Lied heißt es: „Jetzt gibt es einen Aufruhr in unserem Land. Die Kids von der Straße haben sich zusammengetan. Skinheads im Zusammenhalt gegen euch und eure Kanakenwelt.“ Doch trotz aller wüsten rassistischen Ausfälle liegen Welten zwischen den einschlägig harten NS-Bands wie Landser oder Stahlgewitter und den Böhsen Onkelz. 1987 verließen die Onkelz die rechtsextreme Skinhead-Szene, ließen die Haare lang wachsen, blieben aber ihrer anarchischen Lust auf Saufen, Party und Provokation treu. Seit Anfang der 90er Jahre distanzierten sie sich auch öffentlich vom Rechtsextremismus, spielten auf Konzerten gegen rechte Gewalt. Aber ihren Ruf wurden sie nicht los. Auch nicht, als sie 1993 nach den Angriffen auf Flüchtlinge in Rostock und Hoyerswerda sangen: „Ich sehe blinden Hass, blinde Wut, feige Morde, Kinderblut. Ich sehe braune Scheiße töten. Ich sehe Dich.“ In der rechten Musikszene wurde ihnen das übel genommen. Die Verkaufszahlen ihrer Alben schossen dagegen nach oben.
Trotz aller Abgrenzung zu Rechtsextremen sahen sich die Böhsen Onkelz auch weiterhin von den Journalisten bekämpft. Sie empfanden sich als unverstandene Underdogs. Das kam gut an, vor allem bei jugendlichen Fans, die selbst Schwierigkeiten mit Lehrern und Eltern hatten, die Intellektuellen misstrauisch begegneten, die sich betrogen und belogen fühlten. Sie erhoben ihre Lieblingsband zum Kult und hielten mit ihnen an einem eher tradierten Männerbild fest. Die Tatsache, dass die Böhsen Onkelz trotz ihres Ausstiegs aus der Nazi-Szene weiterhin als berüchtigte rechtsradikale Band bezeichnet wurden, verfestigte die Beziehung zwischen den Musikern und ihren Anhängern nur noch mehr. Das Lebensgefühl, gegen die Autoritäten gemeinsam zu rebellieren, und ein Gefühl von Anarchismus einten sie.
Ende Mai 2004 kündigten die Böhsen Onkelz ihren Rückzug aus dem Musikgeschäft an. Und schrieben dazu: „Aber – seien wir ehrlich zu uns – das ist die logische Konsequenz aus allem. Aus den vergangenen 24 Jahren, aus dem Keller in Hösbach und der ausverkauften Festhalle in Frankfurt. Die Onkelz hatten nie die Ambition, als Rockeremiten mit ergrautem Haar auf dem Rockolymp anzukommen, sondern wenn, mit vollem Elan und nicht schon auf dem absteigenden Ast sitzend.“ „Adios“ hieß das letzte Studioalbum. Es sprang an die deutsche Chartspitze. Am 5. August traten sie noch einmal beim Wacken Open Air, dem größten Heavy-Metal-Festival der Welt in der 2.000-Seelen-Gemeinde in Schleswig-Holstein, auf. Dann folgte die ausverkaufte Tournee La Ultima. Und das Abschieds-Open-Air-Festival unter dem Namen Vaya con Tioz (Geh mit den Onkelz) am Euro Speedway in der Lausitz. Rund 200.000 Anhänger kamen, 120.000 hatten Tickets für das Konzert. Der Rest campierte drum herum. Am 16. Februar 2008 erhielten sie für die DVD dieses Konzerts den ersten und einzigen Echo, den Musikpreis der Deutschen Phono-Akademie.
Kevin Russell war der Frontmann und das Gesicht der Böhsen Onkelz. Am 12. Januar 1964 kam er als jüngstes von drei Kindern auf die Welt. Sein britischer Vater arbeitete als Pilot, seine Mutter trank viel. Russell arbeitete seit seinem 16. Lebensjahr in verschiedenen Jobs. Unter anderem fuhr er zur See. In den 80er Jahren begann er, als Tätowierer zu arbeiten. In Frankfurt lernte er Peter Schorowsky und Stephan Weidner kennen, mit denen er 1980 die Böhsen Onkelz gründete. Ein Jahr später stieß Matthias Röhr („Gonzo“) dazu.
Doch das liegt lange zurück. Und spielt im Frankfurter Gerichtssaal jedenfalls für die Juristen keine Rolle. Die Onkelz-Fans schreiben sich ihr Entsetzen und den Schock in den Internet-Foren von der Seele. In Worten wie diesen: „Krankheit, hin oder her, ein Mensch, der scheinbar einen solchen Schaden verursacht hat, muss Farbe bekennen, zumindest einer von Format“, ist hier nun zu lesen. Oder: „Das Format scheint Kevin leider mit formatieren seiner Festplatte verwechselt zu haben.“ Oder: „Also ich mag ja den Kevin, aber der hat ja auch Mist gebaut, warum macht der sowas? Der könnte doch dazu stehen. Der Kevin ist schon cool. Aber trotzdem, Strafe muss sein. Immerhin sind zwei Menschen jetzt Krüppel.“
Die Freunde und Angehörigen der Opfer sind lauter. Zumindest vor dem Gerichtssaal und im Zuschauerraum. „Steinigung wäre das Richtige für den“, sagt einer seinem Freund. Der antwortet: „Bruder, der steht bald vor einem anderen Richter.“ Gegen Nachmittag entert an diesem ersten Verhandlungstag eine Frau den Presse-Balkon. „Kevin, du bist nicht allein“, ruft sie dem Angeklagten zu. Und der sieht kurz wie aus einem Nebel nach oben, scheint das erste Mal zu registrieren, wo er sich überhaupt befindet, und sagt den dritten und letzten Satz des ersten Verhandlungstages: „Aber ich bin allein hier unten.“
Doch nicht nur dort. Nun distanzieren sich erstmals öffentlich auch die anderen ehemaligen Onkelz von ihm. Sie schreiben auf ihrer Homepage: „Der Kevin, der dieser Tage auf der Anklagebank sitzt, ist nicht mehr der Kevin, mit dem wir gemeinsam all die Jahre durch dick und dünn gegangen sind.“ Dieser Kevin, der sich alt, gelb im Gesicht und als Wrack vor seinen irdischen Richtern verantworten muss, hat – so glauben jedenfalls seine früheren Bandkollegen – auf Einflüsterungen gehört, die ihm nicht gut taten. „Dabei sind Dinge passiert und auch nicht passiert, die irreparable Schäden hinterlassen haben“, heißt es in dem vom früheren Schlagzeuger Peter Schorowsky und Stephan Weidner, dem Bassisten und Kopf der Band, unterzeichneten Brief.
Damit ist nun klar, was jahrelang gemunkelt wurde, aber nicht zum Bild der Böhsen Onkelz passte: Die Fassade fing schon an zu bröckeln, als Gonzo mit seinem Buch „Meine letzten 48 Stunden mit den Böhsen Onkelz“ (2006) seine persönliche Schlammschlacht in den Medien startete. Erschüttert wurde dies nun um so mehr, als Kevin Russell im Drogenrausch den verheerenden Autounfall verursachte. Und die Onkelz-Fans vergeblich auf ein paar klärende Worte und vor allem eine Entschuldigung ihres Idols warteten. Und so schreiben nun die anderen: „Es obliegt uns nicht, über Recht und Unrecht zu urteilen und schon gar nicht wollen wir hier dem vorgreifen, was heraus kommt, was in der Silvesternacht 2009 geschehen ist. Dafür gibt es Richter, Staatsanwälte und Ermittler und letztendlich liegt es auch an Kevin, Aufklärung zu leisten … Ohne alte Klischeevorstellungen bedienen zu wollen: Die Wahrnehmung der Onkelz in der Öffentlichkeit war uns immer egal und veranlasst uns auch jetzt nicht, die Artikel zu kommentieren, zumal wir die Berichterstattung in der Breite als gar nicht mal unfair empfunden haben. Dass wir, ausgelöst durch Kevins Verhalten, zur Zielscheibe der Presse wurden, müssen wir uns wohl gefallen lassen. Wer wie wir die Morallatte dermaßen hoch gelegt hat, darf sich jetzt nicht wundern, wenn nun Spott und Häme allgegenwärtig sind. Dass aber auch ihr durch alles, was gerade vor unser aller Augen passiert, unsere Glaubwürdigkeit und unser Lebenswerk in Frage stellt, darüber gilt es zu reden.“ Die Ex-Onkelz sprechen von Tragik und Tragweite dessen, was rund um Kevin passiert, und reinem Wein, den sie ihren Anhängern nun einschenken müssten. „Kevins Krankheit und Drogenproblematik war schon immer allgegenwärtig und wurde nicht durch das Ende der Onkelz ausgelöst, sondern war maßgeblich dafür verantwortlich, dass es zur Trennung kam.“ Denn: „Wir haben uns damals konsequent für das Ansehen der Band entschieden und gegen eine damals schon absehbare mögliche Demontage. 25 Jahre ehrliche und glaubwürdige Arbeit an und mit den Onkelz sollten nicht in einem Desaster enden. Wir wollten erhobenen Hauptes das Schlachtfeld verlassen.“ Und sie betonen weiter: „Wir wollten Kevin schützen – vor sich selbst und davor, die Öffentlichkeit an seinem Zerfall teilhaben zu lassen.“ Von Herzblut, Widerständen und Größe reden sie wie in den besten Zeiten der umstrittenen Rockband. Und wie immer von den wahren Werten mit der Illusion, diese reflektieren zu können. Mit Sätzen wie diesen: „Habt ihr euch schon einmal gefragt, ob die Menschen, die ihr so verehrt, allen voran Kevin, nicht einfach nur eine Projektion eurer Vorstellungen und Idealisierungen sind?“ Und dann geht’s um Stärken, Schwächen und Ängste. Um Probleme, Dämonen, Zerrissenheit, die Hölle und Auseinandersetzungen. Eben ums Kerngeschäft von Bands wie den Böhsen Onkelz. Und ein bisschen auch um Selbstbeweihräucherung: „Stephans Texte waren auch immer Therapie und Durchhalteparolen, für Kevin und uns selbst. Leider wenden sich die Dinge nicht immer zum Besten und sind nicht immer ganz Ideal.“ Und am Ende die Einsicht: „Dass man beste Freunde war, ist leider keine Garantie, dass es immer so bleibt. Freundschaften und Beziehungen sind keine Einbahnstraßen, und wenn die gegenseitigen Bedürfnisse nicht mehr erfüllt werden, die Ansichten und Werte nicht mehr übereinstimmen, hilft auch das ganze gemeinsam Erlebte nicht weiter.“
Der Brief endet mit den Sätzen: „Unsere Gedanken sind nach wie vor bei den Opfern. Wir wünschen den Beiden von ganzem Herzen alles erdenklich Gute.“ Und die Anhänger können endlich wieder jubeln: „Hochachtung an Stephan und Pe, dass sie jetzt noch einmal Größe bewiesen und die Karten auf den Tisch legten. Das zeugt von Respekt und das war eines der Dinge, die die Onkelz jahrelang vermittelt haben. Schön, dass immerhin zwei der Onkelz noch für all die Werte einstehen, die wir Fans über Jahrzehnte in Stephans Texten für wertvoll empfanden.“
Auch an den folgenden Verhandlungstagen entschuldigt sich Russell nicht. Mittags gibt’s ein Stück Kuchen in der gerichtsnahen Bäckerei. Da wirkt dann auch der drogenkranke Angeklagte etwas lebendiger. Danach stiert er aber wieder vor sich hin. Und lässt die anderen reden. Oder schneidet Grimassen, wenn morgens vor Aufruf seines Falles die ortsansässige Presse da ist. Nur einmal, da redet er für alle überraschend. Oder grunzt eher. „Ich will nur noch für meinen Sohn da sein“, sagt er plötzlich, als es im Prozess um seine Drogensucht und den sichtlichen körperlichen Verfall des 46-Jährigen geht. Phasenweise lallend, mit heiserer Stimme spricht er. Sein Verteidiger muss Übersetzungshilfe leisten. Er will nun braver Papa werden, lässt der ehemalige Böhse Onkel mitteilen und krächzt: „Ich habe aus meinen Fehlern gelernt.“ Er wolle sich eine Wohnung im Taunus, im Speckgürtel Frankfurts, nehmen, um dort mit seinem elfjährigen Sohn zusammenzuleben. Schließlich die Gretchenfrage für Russell: Wie steht es mit der Drogen- und Alkoholsucht, fragt ihn der Vorsitzende Richter. „Ich war vor 25 Jahren heroinabhängig, dreimal“, sagt Russell. „Aber nicht in der Silvesternacht, das schwöre ich beim Leben meines Sohnes.“ Auch zum Thema Medikamente, von denen etliche im Unfall-Audi R8 gefunden wurden, sagt Russell etwas. Medikamente nehme er nie vor dem Autofahren. Alkohol trinke er auch nicht mehr, wiederholt Russells Anwalt einen der kaum verständlichen Sätze des Angeklagten.
Dem Rechtsmediziner fallen zu diesem Thema ganz andere Sachen ein. Er hat die Blutprobe untersucht, die Kevin Russell am Nachmittag des Neujahrstages 2010, 19 Stunden nach dem Unfall auf der Autobahn, entnommen wurde. Gefunden hat er beachtlich viel in zum Teil beachtlichen Konzentrationen: Kokain, Methadon, Diazepam, Paracetamol, und das sind nur die wichtigsten Substanzen. Vor allem Diazepam. Jeder, der nicht an diesen Stoff gewöhnt ist, wäre bei der Dosis, die bei Russell nachgewiesen wurde, tot umgefallen, mindestens aber auf der Stelle eingeschlafen, sagt der Toxikologe. Schon ein Jahr zuvor war ihm Blut entnommen worden und er hatte denselben Cocktail intus. „Russell hat sein Drogenkonsumverhalten beibehalten“, sagt der Rechtsmediziner. Die Steuerungs- und Schuldfähigkeit des Angeklagten zum Zeitpunkt des Unfalls hält er für gering eingeschränkt.
Und dann kommt der Tag der Entscheidung. Auch darüber, ob Kevin Russell die Chance erhält, dem Sohn nun – wie angekündigt – der gute Vater zu werden. Erstmal nicht, sagen die Richter und verhängen zwei Jahre und drei Monate. Wegen fahrlässiger Körperverletzung, fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Vortäuschen einer Straftat. Das bewegt sich durchaus im Rahmen dessen, was Gerichte in ähnlichen Fällen verhängen. Und doch war in diesem Prozess alles anders.
Das liegt an der Persönlichkeit des Angeklagten, dem ehemaligen Sänger einer Rock-Band, deren Mitglieder nach frühen Kontakten zur Skinhead-Szene ständig gegen den schlechten Ruf kämpfen mussten, Nazi-Rocker zu sein. Auch der Vorsitzende Richter macht keinen Hehl aus seinem desaströsen Eindruck, den er in nur wenigen Tagen von Kevin Russell gewonnen hat, dem Mann, der sich so weit runtergerockt hat, wie das einem Menschen nur möglich ist. Russell führe im Grunde das Leben eines obdachlosen Trinkers, das aber auf höchstem Niveau. Statt zwischen Brücken pendelt er zwischen seiner Suite in einem Nobelhotel im Taunus und seiner Dubliner Wahladresse, statt mit Fusel richtet er sich mit Kokain zugrunde.
„Wie ein dunkler Blitz“ – so schilderte es eine Zeugin und so zitierte es der Vorsitzende im Urteil – raste Russell in der Silvesternacht 2009 in den Kleinwagen der beiden jungen Männer. Die nur dank Helfern überlebten, während Russell zu Fuß flüchtete, im Nacken eine Bewährungsstrafe wegen Drogenschmuggels.
Er leugnet bis zuletzt. Auf sein letztes Wort vor dem Urteil hat er verzichtet. Und die Chance nicht genutzt. Seine ehemaligen Band-Kollegen haben sich längst von ihm distanziert – aber Freunde kann er sich kaufen. Der Frührentner, wie er sich vor Gericht bezeichnet hat, verfügt immer noch über monatliche Einkünfte aus Tantiemen und Merchandising von rund 10.000 Euro.
Die Indizien sprechen gegen Russell. Seine Zahnprothese im Beifahrerraum, die Videokamera an der Tankstelle, an der Russell kurz vor dem Unfall eingekauft hatte und deren Aufnahmen beweisen, dass er allein mit dem Wagen unterwegs war. Die einschlägigen Verletzungen, die er hatte, vor allem aber die Blut- und Speichelreste, die von der Polizei am Fahrer-Airbag gefunden wurden, identifizieren Russell als Täter. Zumindest mit einer Wahrscheinlichkeit von „zehn Milliarden zu eins“, was dem Vorsitzenden Richter und seinen Kollegen genügt.
Zwei Jahre, drei Monate. Den Opfern und ihren Angehörigen dürfte das zu wenig sein. Einigen Fans der Böhsen Onkelz dürfte es zu viel sein, obwohl sich diese – im Gerichtssaal und auch im Internet – erstaunlich reflektiert zeigen und mit einer Bande pöbelnder Rechtsradikaler (diese Befürchtung gab es vor dem Prozess) offenbar so wenig gemein haben wie Russell mit den Wiener Sängerknaben.
Gegen Russell sprach viel. Für ihn fast nichts. Bis auf die Tatsache, dass er ob seines Gesundheitszustandes unter der Haft, die wegen der vergeigten Bewährung länger als das Strafmaß sein wird, mehr leiden dürfte als ein gesunder Gleichaltriger. „Mit Verlaub, Herr Russell, Sie scheinen ein Stück weit vorzeitig gealtert“, drückte der Vorsitzende Richter das euphemistisch aus. Und wer Russell erlebt hat, kann nur bestätigen, dass dies wohl tatsächlich des Sängers Fluch ist. Auch das kann man als Strafe sehen.
Kevin Russell wehrt sich zunächst dagegen, ins Gefängnis zu gehen. Er sei zu krank. Der Kompromiss: Nach einer amtsärztlichen Untersuchung muss er ins Gefängniskrankenhaus nach Kassel. Es folgen vier Monate im Knast, danach Therapie. Denn die hat Vorrang vor der Bestrafung. Dies ist die Chance für Kevin Russell. Wenn er die Therapie packt, bleiben ihm die restlichen Monate im Gefängnis erspart. Und er packt es. Er schreibt sogar einen Brief an die Opfer des von ihm verursachten Unfalls. Zum ersten Mal bekennt er sich dazu.
Zwei Jahre nach seiner Verurteilung und dem verheerenden Eindruck, den er in Frankfurt vor Gericht hinterlassen hat, schreibt Kevin Russell zudem einen „Brief an Euch“, in dem es um brennende Luft, einen tobenden Bären und eine neue Ära gehen soll. Die soll ihn zurück auf die Bühne bringen. Ein „kleines Wunder“, wie Russell schreibt, nach 30 Jahren Drogenkarriere. Mit den früheren Onkelz-Kollegen rechnet er ab. Die seien offenbar „satt mit Gott und der Welt“ und nicht bereit zu einem „versöhnlichen, wohlbemerkt nüchternen Abschied“. Und dann geht es um das „Thema Unfall“, um die „alleswissenden Besserwisser“ bei den Medien, die ihn, Kevin Russell, als „ehrloses und feiges Arschloch an den Pranger“ stellten. Er schreibt: „Tatsache ist, ich habe mich keinesfalls einfach von der Unfallstelle verpisst, sondern mich überzeugt, dass die beiden ‚Opfer’ aus ihrem brennenden Fahrzeug draußen waren! Das wurde im Gericht bestätigt, sonst wäre ich noch ein paar Jahre im Knast. Als ich dann im Knast war, bemühte ich mich ehrlich und leidenschaftlich ,Kontakt’ mit den Opfern und ihren Familien aufzunehmen.“
Doch die Sozialarbeiter und die Leitung des Gefängnisses hätten das verhindert, sagt er. Russell schreibt von der Zivilklage eines Knebelanwalts auf Schmerzensgeld und Journalisten, die ihn in der Therapie aufsuchten. Dennoch wolle er keinesfalls etwas schönreden und bietet an, sich „aus eigenem Bestreben, mit meiner exzessiven Vergangenheit und Erfahrung, Drogensüchtigen, kranken Menschen zu widmen.“ Außerdem liege ihm viel daran, sich um „Schwerstunfallbeteiligte jeglicher Art“ zu kümmern.
Zweieinhalb Jahre nach dem Urteil gibt Kevin Russell auch wieder Interviews. Darin erzählt er vom Loch, in das er nach dem Abschiedskonzert der Onkelz gefallen sei. Gewaltig sei es gewesen. Und er ohne Perspektive, ohne Zukunft. Noch exzessiver zerstörte er sich selbst. Kevin Russell spricht vom schicksalhaften Unfall, der ihm half, den Weg aus dem permanenten Rausch zu finden. Dennoch: Eine Wiedervereinigung der alten Böhsen Onkelz schließt er aus. Von Dissonanzen spricht er. Und davon, dass er beim Abschied auf dem Lausitzring so zugedröhnt war, dass er nichts mitbekommen hat.
30 Jahre Drogensucht haben ein Drittel der rechten Hirnhälfte zerstört. Das ist ihm 2006 rausgenommen worden. Vier Wochen lag er im künstlichen Koma. Seitdem hat er Titanplatten und Nieten im Kopf. Das Kokain hat die Nebenhöhlen zerschossen. Er kann nicht mehr riechen und auch nicht mehr schmecken. Außerdem leidet er mit knapp 50 an chronischer Lungenentzündung und Bronchitis. Seine Nervenstränge sind so kaputt, dass er jeden Tag Krämpfe hat.
Im Knast will er aufgewacht sein. Von Selbstreinigung spricht der exzentrische Sänger. Und wie damals werden Kalendersprüche zu Merkversen und Leitbildern in seinem Leben. Nur ein bisschen anders interpretiert als früher. „Der Wille ist der Weg“ ist so einer. Oder: „Wenn du an etwas glaubst, kannst du es auch schaffen.“ Nein, sagt Russell, religiös sei er nicht geworden, aber tief gläubig. Und von der riesengroßen Ehrfurcht vor dem Leben spricht der Mann, der fast zwei Leben ausgelöscht hat und das nicht zugeben konnte. Der zwanzigste Entzug in seinem Leben hat zu diesen Weisheiten geführt. Mit dem letzten Geld seiner Lebensgefährtin hat er ein Haus mit elf Katzen, zwei Hasen und zwei Ratten gekauft. Ein Haus, in dem auch der 13-jährige Sohn lebt. Die neue Freundin war der Briefkontakt aus dem Gefängnis nach draußen. Sie kannte ihn aus den Artikeln über seinen Prozess. Ist kein Onkelz-Fan gewesen. Sie hat ihn im Bau oft besucht. Da ist es passiert. Mit den alten Songs der Onkelz steht er wieder auf der Bühne und sagt: „Ich bin das Gesicht der Onkelz gewesen.“ Das will er jetzt genießen. Nicht im Nebel. Sondern bei klarem Verstand.
Der tödliche Stich des Höllen-Engels (Westend)
Die Nacht ist eigentlich schon rum. Der Morgen graut. Es ist Spätsommer im Jahr 2006, zwanzig nach fünf. Lars und Thorsten wollen noch nicht schlafen gehen. Warum auch? Die Stimmung ist noch gut. Und wozu jetzt Schluss machen? Thorsten geht sowieso keiner sinnvollen Beschäftigung nach. Jedenfalls nicht im bürgerlichen Sinne. Ein bisschen Randale machen am Rande von Eintracht-Spielen. Aber das ist eher ein Wochenend-Job. Für Lars sind Vorlesungen allenfalls Kür. Pflicht jedenfalls nicht. Lars studiert Volkswirtschaft. Die Eltern sind stolz darauf. Oder zumindest erleichtert. Der Weg bis zum Abitur war mühsam. Er ist ein paar Mal sitzen geblieben. Er war nie fleißig. Und der Hellsten einer auch nicht. Interessiert sowieso nicht. Jedenfalls nicht an der Schule. Feiern, die Kumpels, Partys zählten mehr in seinem Leben. Sein Sport: das Boxen. Vier bis fünf Mal in der Woche stand er im Ring. Ansonsten trieb er sich bei den Bones, einer stadtbekannten Rockergang, rum. Täglich auf dem Weg zur Schule kam er an ihrem Clubhaus vorbei. Die Motorräder gefielen ihm. Das Rotlichtmilieu sowieso. Er knüpfte Kontakt und hing viel hier herum.
Mit 18 bekommt er endlich ein eigenes Motorrad und macht sogar noch das Abitur. Ein durchschnittliches, aber es reicht, um sich für Volkswirtschaftslehre einzuschreiben. In seinem Leben zählen aber andere Werte: Ehre, Respekt, Treue und kollektive Freiheit, die des Clubs eben. Bis zur Fusion der Bones mit den Hells Angels 1999 verbringt er seine Freizeit vor allem bei den Jungs. Solche wie ihn brauchen sie. Er fragt nicht, macht, was man ihn heißt. Längst hat Lars für sich entdeckt, was wirklich zählt – jedenfalls für ihn: echte Kameradschaft. Alte Männerrituale.
Wie schicksalhaft diese Werte an diesem frühen Morgen vor dem Club für ihn werden würden, ahnt er noch nicht. Die Vorlesung am gerade beginnenden Tag jedenfalls ist weit weg. Viel näher ist – wenn überhaupt in dieser schönen Nacht – der Job als Sicherheitsmann im FKK-Club. So nennt er sich offiziell. Tatsächlich ist er viel mehr, er, das jüngste Vollmitglied der Hells Angels, das zwar noch immer als kleines Licht gilt, aber die Kutte tragen darf. Lars hat früh den Weg ins Rotlicht gefunden. Als Wirtschafter: Rausschmeißer, Hausmeister und Chef in einer Person. Schon vor dem Abitur war er dort angekommen, wonach er immer gesucht hatte.
In dieser Nacht zieht es Lars und seinen Kumpel in eine ihrer Stamm-Diskotheken. Der Club galt in den 90er Jahren mal als ganz besonders angesagt. Weniger bei den harten Jungs in Kutte mit Hang zum Halbseidenen. Hier tanzte vielmehr ein Szene-Publikum, das sich für die Avantgarde hielt. Der Club in der Nähe des Frankfurter Goethe-Hauses hat aber spätestens seit dem Einzug der Hells Angels mehr durch Drogen, Schlägereien und Größen aus der Halbwelt als durch ein progressives Publikum auf sich aufmerksam gemacht. An diesem Abend würde das wieder so werden. Das aber ahnen Lars und sein Kumpel noch nicht.
Lars, der seit zwei Jahren mit einer rumänischen Prostituierten verheiratet ist, hat seine derzeitige Gespielin mit dabei: Tänzerin Irina aus einer Table Dance Bar, die den Hells Angels gehört. Offiziell betreibt den Laden seit 2009 der Pforzheimer Metzger Marcus Eberhard, der sich Dank Adoption Prinz Marcus Eberhard Edward von Anhalt, Herzog zu Sachsen und Westfalen, Graf von Askanien nennt. Ein Mann, dessen Lebensmotto Klotzen statt Kleckern ist, der häufig Bekanntschaft mit der Justiz macht, weil er etwa aus Versehen zu viel Bargeld auf dem Weg nach Dubai einstecken hat oder weil er nicht ordentlich Steuern zahlt oder weil er als Zuhälter auffällt. Ihm jedenfalls wird eine gewisse Nähe zu den Hells Angels schon lange nachgesagt. Er war mit ihnen gut im Geschäft. Doch dann bekam er Ärger mit den Rot-Weißen, wie Ermittler die Hells Angels gern wegen ihrer Farben nennen. Ärger bekam der Prinz, weil die ewige Hotel-Erbin Paris Hilton trotz Einladung und großer Ankündigung nicht in seiner Table Dance Bar erschienen war, obwohl dort schon der rote Teppich für sie auslag und das Publikum ihrer harrte. Weil sie nicht wusste, dass ihr Auftrittsort in Frankfurts gleißendstem Rotlicht liegen sollte, sagen die einen. Weil sie rotzbesoffen im Bett ihres Hotelzimmers lag, rechtfertigte sich dagegen der Prinz. Ein Mann, der eigentlich nichts gegen Frauen in Betten hat. Im Gegenteil. Ihnen verdankt er sein umfangreiches Vermögen, seine Sportwagen-Sammlung und den gekauften Titel. Diverse Bordelle im Bahnhofsviertel gehören ihm. 19 insgesamt in ganz Deutschland. Aber als die Hilton nicht wie angekündigt kam, die Presse lachte statt jubelte, da machte er keinen Stich mehr bei den Hells Angels. Es gab ordentlich Ärger. Denn in dem Laden, aus dem auch Lars an jenem Abend seine Begleitung rekrutiert hat, mengt ganz ordentlich der einstige Seargent at Arms – der Mann, der im Verein für die Club-Disziplin zuständig ist – des mächtigen Hells-Angels-Charters Westend mit. Er ist gut vernetzt, ist der Verbindungsmann der Rocker zur Polizei und zum Ordnungsamt. Er regelt es, wenn die Hells Angels zum Crime City Run, ihrer traditionellen Ausfahrt, laden, wenn gefeiert wird und Absperrungen nötig sind. Er gilt als Macher und derjenige, zu dem die Ermittler gehen, wenn es mal wieder eine sogenannte Gefährdetenansprache gibt und die Polizei mitteilt, wen sie im Auge hat. Der Kontakt zur Polizei ist wichtig für die Hells Angels, denn eine frühe Warnung hilft, Ärger zu vermeiden. Und davon gibt’s traditionell zuhauf. Probleme mit den Rockern hat seit jenem verkorksten Paris-Hilton-Auftritt auch der Prinz. Denn die waren nicht amüsiert ob des lachenden Publikums.
Aber das passiert lange, nachdem Lars vor der Discotür den Aufstand probt. Wie ein Gockel benimmt er sich, wird später eine Zeugin über ihn sagen. Der Sohn eines Niederländers und einer Deutschen haut an diesem Abend ziemlich auf den Putz. Wohl auch, weil er Thorsten beeindrucken will. Und Irina, die schöne Tänzerin an seiner Seite. Thorsten hätte besser auf den Putz hauen können, denn der ist Lars körperlich weit überlegen – wie die meisten. Der Mann ist einer von denen, die von der Polizei als „Gewalttäter Sport“ bezeichnet werden. Er gehört zur Brigade Nassau 1996. Ist Fußballschläger in der berüchtigten Hooligan-Truppe, gewalttätige Anhänger von Eintracht Frankfurt, die in der sogenannten Kategorie C laufen. Freundschaft mit den Hells Angels wird ihnen nachgesagt. Seinerzeit werden die ersten zarten Bande geknüpft. Für Thorsten lohnt sich das, er wird später selbst Mitglied im Charter Frankfurt. Da passt er gut hin, denn hier tummeln sich gescheiterte Existenzen, zählen Muskeln mehr als Hirn. Aber zu dieser Zeit ist der Junge aus schwierigen Verhältnissen noch nicht so weit. Eine Voraussetzung jedoch hat er längst: häufige Begegnungen mit der Justiz. Das gehört zum Geschäft. Wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Rauschgifthandels gab es zweimal Bewährungsstrafen.
In der Disco, in der Lars an diesem Abend Einlass begehrt, ist er bekannt. Weil er ein Hells Angel ist. Und weil er der Hells Angel mit den blonden Locken ist. Sie lassen ihn ein wenig weich aussehen. Das hört er nicht gerne, aber die Mädels stehen drauf. An diesem Abend geht’s allerdings weniger um seine Locken. Heute ist er Rocker. Dass er das ist, steht auf seinem Sweatshirt, das er in jener Nacht trägt. AFFA heißt es da (Angels forever, forever Angels). Daran glaubt er auch. Das wird in den nächsten Stunden für ihn noch wichtig werden. Denn Lars und Thorsten kommen heute in den Club nicht rein. Die Türsteher Danyel und Anrij weisen sie ab. Vor allem Danyel ist auf die Hells Angels nicht gut zu sprechen. Erst kürzlich hat er sich mit dem „Schweden“ geprügelt. Der kam von Nordhessen nach Frankfurt, als sich die Hells Angels dort oben auflösten. Auch er ist Wirtschafter im Bordell. Auch ihn ließ Danyel nicht rein, das führte zu Ärger. Das hat sich Danyel gemerkt. Auch er war sichtbar ein Mitglied der Rockergruppe.
Es mag auch am Sweatshirt von Lars liegen, das so deutlich zeigt, wo er hingehört. Denn in vielen Clubs sind zwar Mitglieder der Hells Angels präsent, dürfen aber nur rein, wenn sie ihre Insignien nicht tragen. Die Kutten und Abzeichen schüchtern Gäste ein und ramponieren den Ruf. Danyel sagt nicht, ob das der Grund dafür ist, dass Lars und Thorsten heute draußen bleiben müssen. Oder ob es noch die Wut auf den Schweden ist. Danyel ist furchtlos. Und hat einen harten Schlag. Er kennt die Jungs. Heute redet er nicht lange. Mit einem Stoß gegen die Brust weist er Lars ab.
In dem kocht die Wut. Er lässt sich nicht abweisen. Er nicht. Und schon gar nicht vor Irina. Lars und Thorsten tauschen sich kurz aus. Dann gibt es einen kurzen Disput mit Danyel. Der nennt Lars einen Rassisten. Auch der Türsteher lässt sich nicht lumpen. Der Mann ist schon zweimal wegen Körperverletzung verurteilt worden. Berufsrisiko auch in seinem Job. Die Berufung gegen die zweite Verurteilung läuft noch. Sorgen macht ihm das nicht. Das gehört zum Geschäft. Und mit einem Würstchen wie Lars wird er locker fertig. Ebenso wie Kollege Andrij, der Mann mit dem unbeweglichen Gesicht, der blassen Haut und den harten Zügen. Auch er ist schon einschlägig verurteilt worden. Natürlich wegen Körperverletzung.
Lars, Vollmitglied der Hells Angels, trollt sich erst einmal. Aber dann besinnt er sich, greift zum Mobiltelefon. Er ruft Eddy an. Den Mann kennt jeder in der Frankfurter Szene. Ein Lebemann, dessen Interesse vor allem dem Geld, Frauen und Kokain gilt. Viele fürchten Eddy. Jedenfalls in der Subkultur. Denn Eddy war mal Chef der Bones und später, als es die nicht mehr gab, kam er in den Vorstand des einflussreichen Charters im Westend. Bis ihm die heftige Kokserei die Karriere etwas ruinierte. Eddy saß früher gerne an den Theken der Frankfurter Clubs und spendierte viel Champagner. Schon früh machte er sich einen Namen im Nachtleben der Stadt. Auch wenn Eddy heute nicht mehr ganz das ist, was er mal war, so ist er immer noch einflussreich, beliebt, aber auch gefürchtet. Er gilt als Größe im Frankfurter Rotlicht, das sich der Charter Westend weitgehend unbehelligt einverleibt hat, als Polizei und Staatsanwaltschaft noch damit beschäftigt waren, jugoslawische Hütchenspieler zu vertreiben. Und mit ihnen die Jugo-Banden, die ohne lange zu fackeln aufeinander schossen. In deren Windschatten etablierten sich die Hells Angels, auf die keiner so recht achtete. Sie übernahmen die Clubs, die Bordelle und die Türen. Sie schickten Strohleute in die Verkaufsverhandlungen, um unbehelligt zu bleiben. Denn wer die Tür hat, der hat auch die Macht. Darüber, wer reinkommt, wer die Drogengeschäfte macht. Hier war Eddy dick dabei. Der stets schwarz gekleidete Rocker mit der goldumrandeten Sonnenbrille, der immer ein Bündel größerer Scheine in der Hosentasche stecken hat, war einer der maßgeblichen Männer, als die Hells Angels in der Nacht zum 7. November 1999 mit den Bones fusionierten. Er ebnete den Weg. Und sorgte dafür, dass die Skeletthand der Bones von den Jacken verschwunden war, noch bevor die Sonne am nächsten Morgen wieder aufging. Ersetzt vom geflügelten Totenkopf, dem Symbol der Hells Angels. Für die Polizei- und Sicherheitsbehörden bedeutete die Fusion der beiden Rocker-Vereine Alarm. Denn sie fürchteten, dass die rund 600 Mann starke, bewaffnete Truppe der Hells Angels in Deutschland nun die Macht im kriminellen Milieu der Städte übernehmen wolle. Für die Polizei sind die Rocker nichts anderes als eine Räuberbande. An ihrem Expansionsdrang lassen die Hells Angels auch keinen Zweifel. Ihr Motto: The world is not enough (die Welt ist nicht genug) – wie der gleichnamige James-Bond-Film. Im deutschen Szeneblatt „Bikers News“ haben sie kurz nach der Fusion ihr Motto klargestellt: „When in doubt knock them out“ (Im Zweifel zuschlagen).
Seit Bomberpiloten der US Air Force 1948 die Hells Angels in Kalifornien gegründet haben, leben sie nach ihren eigenen Regeln. Obwohl die heutigen Angels damit nichts zu tun haben wollen: Ihr Name geht auf die 303. Bombardment Group der amerikanischen Luftwaffe zurück. Diese Einheit nannte sich Hells Angels. Ihre Maschinen hatten Hells-Angels-Symbole auf der Nase. Die berühmteste war die B-17 Flying Fortress. Am 13. Mai 1943 war sie zum ersten Mal alle 25 Einsätze, die sogenannte Tour geflogen. An diesem Tag bombardierte die 8. US-Luftflotte deutsche Ziele in Frankreich: Meaulte, St. Omer/Longuenesse und St. Omer/Ft. Rouge. Die B-17 mit dem Namen Hells Angels flog diese Tour erfolgreich, wird es später heißen, obwohl die meisten Soldaten die Tour nicht überlebt haben. Diejenigen, die überlebten, waren anschließend schwer gestört. Heute würden sie wegen posttraumatischen Belastungsstörungen behandelt. Damals fragte danach noch niemand.