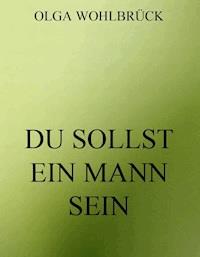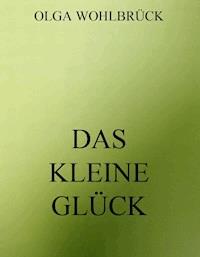
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieser Sehnsuchtsroman der österreichischen Autorin erzählt die Geschichte der jungen Iduna, die immer wieder erkennt, dass ihre Ehe nicht das ist, was sie sich gewünscht hat. Aber dann tritt ein junger Mann aus Düsseldorf in ihr Leben ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das kleine Glück
Olga Wohlbrück
Inhalt:
Olga Wohlbrück – Biografie und Bibliografie
Das kleine Glück
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
Das kleine Glück, O. Wohlbrück
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849640231
www.jazzybee-verlag.de
Olga Wohlbrück – Biografie und Bibliografie
Am 5. Juli 1867 in Wien geboren, verbrachte aber Kindheit und erste Jugend in Russland und schrieb schon als zehnjähriges Kind kleine Erzählungen in deutscher, französischer und russischer Sprache, deren Erfolg in ihr den Wunsch wach rief, Schriftstellerin zu werden. Durch einen Hauslehrer vorgebildet, bezog sie das Kiewer Mädchengymnasium und absolvierte es nach vollendetem 15. Lebensjahre. Ihre lebhafte Phantasie und der sich schon früh geltend machende Gestaltungsdrang zogen sie unwiderstehlich zur Bühne, der schon viele ihrer Familie seit über ein Jahrhundert angehörten. Sie erlangte auch die Erlaubnis ihrer Eltern, sich bei der in Paris lebenden Großmutter zur Bühne vorzubereiten. Nach drei Jahren angestrengten Studiums, trat sie ihr erstes Engagement am Théâtre National de l'Odéon an, siedelte aber nach ihrer Verheiratung mit dem deutschen Schriftsteller Maximilian Berg nach Berlin über, wo bei fortgesetzter schauspielerischer Tätigkeit ihr schriftstellerisches Talent voll zur Entwickelung gelangte. Durch ein Buch gesammelter Novellen und Skizzen führte sie sich in die deutsche Literatur ein, und 1894 erblickte ihre erste dramatische Schöpfung am »Berliner Theater« das Licht der Rampe: sie selbst kreierte die Hauptrolle ihres Schauspiels »Das Recht auf Glück«. Außerdem fungiert sie in dem unter dem Protektorate des Kultusministers stehenden Neusprachlichen Vereine als französische Vorleserin. Wohlbrück verstarb am 20. Juli 1933 in Berlin.
Wichtige Werke:
Aus drei Ländern, novellistische Sittenbilder, Novellen,Carriere, Roman.Du sollst ein Mann sein!, Roman,Der Roman der XII, Roman,Die Boyersen. Neue NovellenDas goldene Bett, RomanDes Ratsherrn Leinius Tochter, NovelleDas kleine Glück, RomanAus den Memoiren der Prinzessin ArnulfDie neue Rasse, RomanSonnenbrut, RomanBarbaren..., RomanDas ist RusslandDer große Rachen, RomanDie goldene Krone, RomanRomantik, RomanDie Primadonna, RomanDer König von Troplowitz, RomanAthletenRomanVor der Tat, RomanDie rote Glut, RomanHerr und Frau Wiedemann, RomanDie Frau des Schullehrers Tarnow, RomanDie Sukoffs. Ein sibirischer RomanDie Frau ohne MannRomanSchloß Borowitzky, RomanDas kleine Glück
Motto:
Im Reiche der Intelligenz waltet kein Schmerz, sondern alles ist Erkenntnis.Schopenhauer.
I.
... Endlich ward die kleine Seele bezwungen, so sehr sie sich auch wehrte, so sehr sie auch entfliehen wollte aus dem kleinen, gebrechlichen Körper... Und dann wurde sie schließlich still ... so still und ruhig, daß man ihrer fast vergaß.
Aber der kleine Körper wurde gehegt und gepflegt ... Den vergaß man nicht ... Nie. Und so wuchs und gedieh er zur Freude der Eltern. Das kleine Neutrum wurde ein Femininum – nicht mehr »es«, sondern »sie«, und man nannte sie jetzt »Püppchen«.
Püppchen lernte Papa und Mama sagen, aber erst nach vieler Quälerei. Püppchen bekam weiße, schauderhaft gestärkte Kleidchen mit grellblauen oder grellrosa Achselbändchen, die sie mutwillig immer wieder aufband, vielleicht aus unbewußter Opposition eines angeborenen Geschmacks. Püppchen lernte »bitte, bitte« sagen und Knixe machen.
Gar bald lernte Püppchen noch etwas, was durchaus nicht im elterlichen Programm vorgesehen war: Püppchen lernte das Wörtchen »Ich will«.
Pädagogisch hieß es darauf: Kinder dürfen wünschen, nicht aber wollen.
Und Püppchen sagte von nun ab ganz artig:
»Ich wünsche will...«
Dabei blieb sie sehr lange, und weil es drollig klang, ließ man es dabei bewenden.
Mit Kinderpsychologie befaßte man sich nicht. Die Eltern gehörten ja zum Teil noch der alten guten Schule an: Ordnung, warme Füße, kühler Kopf. Dies waren die Grundprinzipien gedeihlicher physischer und psychischer Entwicklung. Püppchen war sieben Jahre alt, da wurde sie umgetauft. Es war ein lächerlicher Name: Iduna! In der Schule machte man sich lustig über ihn. Denn sie war klein und beweglich, wie mit schillernden, zitternden Flügeln ausgestattet, im Namen aber lag Ruhe, vornehme Abgeschlossenheit. Es fror sie beinahe, wenn ihre englische Gouvernante sie so nannte und dann das ewige: »go on« hinzufügte. Go on! Wie eine geistige Rute war es.
Mit großen, abgezählten Schritten ging die governess auf ein ganz bestimmtes Ziel zu – es war einfach eine mathematische Unmöglichkeit dies Ziel zu verfehlen. Die Spaziergänge sogar waren für Iduna eine Qual. Bis da oder dorthin in so und so viel Zeit. Die Zeit wechselte nach dem Stande des Thermometers. Go on, sagte die Miß und schleppte ihren Zögling durch Wald und Flur, blind für Licht- und Farbenstimmungen, taub für das Rauschen und Flüstern rings herum. Die Blumen waren da – allenfalls für die Botanisiertrommel.
» Go on«, hieß es bei jedem längeren traumverlorenen Verweilen, bei jedem sehnsuchtsvollen Aufblick ins dämmernde, silberne Grau...
Wenn Iduna die lange, stets in schwarz gekleidete Gestalt des Morgens an ihrem Bett erblickte, so zog sie das Bettlaken über den Kopf, als fürchte sie sich vor einem Strahl kalten Wassers über das Gesicht. Das ging so Jahre lang fort, bis eines Morgens ohne anderen Anlaß als das ewige » go on«, das Kind sich plötzlich im Bette aufrichtete und mit beiden hysterisch geballten Händen über die Gouvernante herfiel: » Well, now i will do it, i am going on!«
Am anderen Tage verließ die Engländerin das Haus, Iduna aber streifte ziellos im nahen Wäldchen umher, mit ausgebreiteten, emporgehobenen Armen, wie um jeden Sonnenstrahl aufzufangen, der sich durch die Zweige stahl.
Dann kam die Verliebtheit... ziel- und uferlos.
Ein phantasievolles Träumen, zu dem keine wirkliche Gestalt aus dem Leben recht passen wollte. Der längere, freundliche Blick eines Lehrers, der Händedruck eines Gymnasiasten, Bruders einer Schulfreundin, und der Roman war fertig. Ekstatische Anbetung, leidenschaftliche Liebe mit glühender Eifersucht, schlaflose Nächte, Tränen, todestrauriges Sehnen – all die zehrenden Qualen der Leidenschaft – bis zum zweiten oder dritten Wiedersehen. Dann plötzliche Ernüchterung, ja oft mehr als das: beinahe physischer Widerwille. Oft lag es an einem ungeschickt gebundenen Schlips, einem zufälligen schwarzen Rand unter dem Nagel, einem schiefgetretenen Absatz – und sie, die sich wenige Stunden vorher in Gedanken hätte töten lassen für ihren Romanhelden, zitterte nun vor Ekel bei dem Gedanken, ihm die Hand reichen oder ihm Rede und Antwort stehen zu müssen.
Und es kam einer, der sie »Dudi« nannte. Nur um weniges älter war er als sie. Von makelloser, durchgeistigter Schönheit, die harmonische Vollendung des Schönen, ohne Gegensätze und schroffe Übergänge. Wie ein weißer Marmor von Sonnenstrahlen durchglüht– die lebendig gewordene Sehnsucht, stand er vor ihr in seiner knabenhaften Weiche und Unreife.
Daß er einen Namen hatte wie andere Menschen auch – war ihr ein Wunder. Georg Stauff. Er war ihr zu hart, der Name, und sie nannte ihn Georgy, mit englisch weichem Sing-Sang.
Es war eine zarte, subtile Kinderliebe, ein Verweichlichen der Empfindung bis zur Erschlaffung des Willens, ein Kranken der Seele an heißem, unbefriedigtem Zueinanderstreben. Wenn sie – was selten geschah – einander die Hand gaben, so legten sich die beiden Flächen zusammen wie zwei Magnete. Sie mußten mit aller Willensstärke die Hände losreißen, und dann standen sie einander gegenüber, blaß und zitternd, keines Lautes fähig. Lange, lange sprachen sie kein Wort, und das schwüle Schweigen hüllte sie ein und drückte sie nieder, wie gewitterschwere Luft.
Die Großen verstanden das nicht, nur daß man sie trennen mußte, war ihnen klar. Und sie wurden getrennt. Rein Wort der Klage kam über ihre Lippen. Der Knabe wurde weit fortgeschickt, in eine andere Stadt, ins Gymnasium. Iduna blieb in ihrer alten Umgebung.
In einem großen finsteren Hause war sie aufgewachsen; von außen sah es verwittert aus und innen war es nach provinziellen Begriffen des Komforts eingerichtet. Keine weichen Linien und schillernden Flächen, keine seltenen Formen noch abgetönte Farben, nichts, woran das Auge genießend hängen blieb – alles für den täglichen Gebrauch, praktisch, nüchtern.
Nur ein wundervolles: ein Kamin. Ein mächtiger lombardischer Kamin mit weitvorspringendem, pyramidenförmigem Mantel. Im Winter wurden riesengroße Holzscheite darin aufgeschichtet und in Brand gesetzt. Sie stand daneben mit gefalteten Händen und andächtigen Gefühlen. Eine heilige Handlung war es für sie, dieses Feueranmachen. Der alte weißhaarige Knecht, zu dessen Obliegenheiten es gehörte, zu heizen, erschien ihr wie ein Priester.
Und wenn dann die Flammen züngelten, die rote Glut sich ausbreitete und stiebende Funken emporprasselten, dann kauerte sie sich zusammen auf dem dünnen Teppich, den Blick in sehnsuchtsvoller Trunkenheit in das Feuermeer getaucht, wie magnetisch angezogen von den ausgreifenden Stichflammen, erschauernd in Angst vor dem geheimnisvollen Zauber des rotglühenden Lichtes.
Stundenlang konnte sie so sitzen, ohne Gedanken, ohne Wunsch, wie aufgelöst in erfüllter Sehnsucht –
Man gab ihr einen Necknamen: Feueranbeterin. Erst später verstand sie seine Bedeutung, und da begriff sie auch, warum sie eine so schlechte Schülerin in der Katechismusstunde war – Formeln sagten ihr nichts, nur als von den züngelnden Flammen des heiligen Geistes die Rede war, leuchtete es verständnisvoll in ihren Augen auf.
Auch Georgy hatte manche Stunde mit ihr vor dem rotglühenden Kaminfeuer gesessen, vielleicht nur, weil er überhaupt gerne mit ihr zusammen war, unbekümmert um den Ort. Aber für sie verband sich die Vorstellung von ihm mit der Vorstellung vom Feuer, und als er fort war – da fand sie ihn wieder in den züngelnden Flammen, den stiebenden Funken, der roten Glut...
Und nur das war das Wesentliche ihrer Kinderzeit: das innere, phantastische Leben. Vater, Mutter, Onkel und Cousinen – es waren Scheinwesen für sie. Sie hatte kein Familiengefühl. Kaum wußte sie, wie sie aussahen. Der Vater: der übliche Mann, die Mutter: die übliche Frau, um einen halben Kopf kleiner, um acht Jahre jünger als er. Sie hatte sagen hören, daß ihre Eltern gut zueinander paßten. Es mußte auch wohl so sein – Streit gab es nie. höchstens mal rotgeweinte Augen bei der Mutter – aber so selten!
Es wurde guter Tisch geführt im Hause: reiche, gesunde Kost. Ihr wurde oft ganz schlecht, wenn sie die großen Braten auftragen sah. Die schönste Zeit für sie war es, als sie nach einer Krankheit auf einem Sofa vor dem geliebten Kamin liegend, winzige Steaks und zartes Geflügel bekam, dazu goldgelben Wein in schön geschliffenem, feinem Glase...
Sie hatte verlangt, daß der weißhaarige Knecht ihr das Essen brächte – man willfahrte dem Wunsche der Rekonvaleszentin, aber als der Knecht ungeschickter Weise einmal das Tablett fallen ließ und das feine, geschliffene Glas in Scherben am Boden lag – da verbat man sich »die unsinnigen Launen«.
Der Vater war Ökonom, er bewirtschaftete drei große fürstliche Güter, die Mutter war eine Gelehrtentochter. Sie hatte einen jüngeren Bruder, von dem sie mit furchtsamer Verehrung sprach. Selten geschah das. Aber dann veränderte sich etwas in dem stillen, unbedeutenden Gesicht, ein seltsamer Glanz kam in die wasserblauen Augen, die gefurchte Stirn schien sich zu wölben, und der Wortschatz, sonst so armselig, wurde reicher...
Iduna bekam ihn nie zu sehen, nur alle Jahre eine Postkarte, auf der nichts stand, als: »Ich lebe und grüße Euch.«
So geheimnisvoll klang das...
Ich lebe! Alles, was ein Mensch tat, dachte und fühlte – in dem einen Ausdruck gipfelte es: ich lebe!
Sie fing an zu forschen nach ihm, aber der Vater zuckte die Achseln und antwortete: »Kümmere dich nicht um Dinge, die dich nichts angehen.«
Die Mutter sagte: »Das verstehst du nicht.«
»Dinge«, »das« ... Seltsame Ausdrücke für einen Menschen.
Und Iduna starrte in die Flamme des Kamins, als suche sie ihn dort, jenen rätselhaften Mann, der kein Mensch war für sie, nur ein abstrakter Begriff ...
Und die Flammen zauberten ihr ein wunderbares, märchenhaftes Leben vor, ein harmonisches Dahingleiten auf mondbeglänzten Bahnen, ohne Erdenstaub, ohne Erdenschmutz ...
Auch der Name, das einzige positive, was sie von ihm wußte, gefiel ihr: Julius Delten. Onkel Julius, Georgy – das waren die zwei Kardinalpunkte, um die sich ihr Empfindungsleben drehte.
Sie lernte viel – sie lernte, weil sie mußte. Ihre Mutter bestand darauf, ohne Erklärung dafür zu geben – vielleicht bloß, um sich an ihrem Kinde für die eigene geistige Vernachlässigung schadlos zu halten.
Lehrer gingen ein und aus: Sprachen wurden gepflegt, auf dem Programm standen neben Literatur und Geschichte – auch höhere Mathematik, Astronomie und Philosophie.
Sie erfaßte alles spielend und ließ es gleich wieder fallen. Keine Selbstdisziplin war in ihr, nur ein ewig ungestilltes Verlangen nach traumhaften unerreichbaren Sensationen, stiller Verliebtheit gleich, und dabei immer etwas Flatterndes, Hastendes, eine beständige Unruhe. Auch äußerlich – das zart eckige der Botticellischen Profile mit den dünnen, hochgewölbten Brauen und den hungrigen Augen, die weit aufgerissen nach Nahrung ausspähten – – –
Und es kam der Tag, da die Lehrer gingen und sie allein ließen mit ihrem ungestillten Hunger. Ihre Bildung aber galt für vollendet, und die Mutter schwang sich zu einer Phrase auf, wie sie deren selten in ihrem nüchternen Alltagsleben gebraucht:
»Äußere Glücksgüter werden wir dir nicht viele hinterlassen, die geistigen Schätze bleiben dir aber für immer unbenommen. Es sind die einzigen, die nicht enttäuschen.«
Fast schien es, als hätte die stille, einfache Frau nur diesen Moment abgewartet, um zu sterben: nach drei Tagen war sie eine Leiche – akute Lungenentzündung machte ihrem stillen, grauen Dasein ein Ende. Es war ihr gegangen, wie gewissen niedrig organisierten Insekten, die sterben, wenn sie ihre Eier gelegt, für die Fortpflanzung gesorgt: ihre einzige Bestimmung erfüllt haben.
Aber noch ein Vermächtnis hatte sie hinterlassen; einige Stunden vor dem Tode, in einem lichten Augenblick:
»Wenn du Hilfe brauchst, wende dich an meinen Bruder Julius.« Es erging Iduna bei diesen Worten wie einem Erben, der über dem Reichtum der Hinterlassenschaft kaum des Sterbenden gedenkt.
Die Mutter war noch nicht beerdigt, als sie ihren ersten Brief an ihren Oheim schrieb. Und als sie drei Handvoll Erde auf den Sarg der Mutter niederwarf, da fragte sie sich nur: wird er auch mir bloß schreiben: »ich lebe und grüße dich« oder wird er mehr sagen?
Noch stiller und finsterer wurde es im Hause. Zum prasselnden, glutroten Kaminfeuer flüchtete Iduna, wie zum einzigen, was ihr noch Leben, Licht und Wärme gab... Und vor dem Feuer, zusammengekauert wie früher als Kid, saß sie eines Tages und las einen Brief.
Kalte, gesunde Gletscherluft wehte aus diesem Briefe, die vornehme Stühle des vornehmen Gedankens.
Und es ward ihr zu warm, zum erstenmal zu warm vor dem Feuer. Das leise Knistern und Prasseln dünkte sie ein unerträglich lärmendes Geräusch, die züngelnden Flammen erschienen ihr wie böse Dämone, die ihren Geist verwirrten.
Sie lechzte nach dem Aufstieg in freie, kalte Regionen, Sehnsucht packte sie nach dem dünnen, reinen Äther, nach starrem, kühlem Frieden.
Und heiße glühende Worte waren es, in denen sie ihrem Sehnen nach Gletscherhöhen Ausdruck gab.
Die Liebe zu Georgy kam ihr jetzt unverständlich vor, wie ein Spuk ans Kindertagen – nur durch den Zauber eines mystisch verworrenen zu erklären. Es rang etwas in ihr nach Befreiung, nach Klarheit, und zugleich regte sich in ihr das Gefühl demütiger, tätiger Liebe.
Sie mußte anbeten können, es war ihr ein Bedürfnis... sich aufzulösen, ob in verzehrender Glut oder in erstarrender Kälte – gleichviel. Nur aufgehen ohne Rest und emporsteigen ins Unendliche...
Dann kam der letzte entscheidende Brief:
»Das Klügste für Dich wäre, Du heiratetest. Und da möchte ich Dir einen Rat geben: heirate mich. Es ist besser. Du gehst durch meine, als durch andere Hände. Ich weiß, Deine Ehe wird nur ein Übergangsstadium für Dich sein, ob zum Guten oder Bösen – wer kann es wissen. Jedenfalls wäre sie eine momentan sehr wünschenswerte Begrenzung Deiner geistigen Uferlosigkeit. Einen Romanhelden kann ich aus mir nicht machen. Dazu eigne ich mich weder äußerlich noch innerlich, wie Du aussiehst, kann ich mir beiläufig denken: klein, zart, mit gelblichem Teint. Gesunde Zähne, schöne Hände und Füße sind bei uns Deltens ja erblich. Auf weitere Details kommt es mir nicht an. Dir wohl auch kaum. Aber Dir nur aus dem Grunde, weil Du ja doch niemanden sehen wirst, wie er ist, sondern nur wie Du ihn Dir vorstellst.«
II.
Eine seltsame Aussprache war es – die erste zwischen Vater und Tochter, wie sie einander gegenüberstanden in dem nüchtern-kahlen Arbeitsraum, zwischen einem Stehpult und einem halb offenen Rassenschrank, da mochte man wohl meinen, der fürstliche Ökonom entlasse eine Untergebene; nun gar, wo er mit ruhiger Gebärde einige blaue Scheine auf den großen, zerkratzten Mitteltisch legte.
»Ich danke dir«, sagte Iduna.
Der alte Flössel zuckte die Achseln.
»Was ist da zu danken. Das bißchen Geld wird dich nicht glücklich machen, und deine hirnverbrannte Idee wird es noch weniger.«
»Nicht dafür allein, für alles danke ich dir, für all die stillen Jahre hier und auch daß ich gehen darf, wie andere – mir mein Leben suchen.«
»Närrin! Es ist ein Unterschied, ob man zur Palette greift, zum Fiedelbogen, zur Schulmappe – oder zur Ehe. Das erste wirft man fort, wenn's einem nicht mehr paßt, das zweite hält einen fest, bis zum Tode. Bis zum Tode, hörst du?« wiederholte er streng. »Ich nehme kein geschiedenes Frauenzimmer in mein Haus auf, verstanden?«
Daran hatte sie noch gar nicht gedacht, daß das möglich war. Aber es war ihr dabei wie eine Erleichterung und ganz leise atmete sie auf. Der Alte mißverstand sie.
»Ja, ja, ich weiß schon, in eurem Dusel glaubt ihr alle, die Ehe ist eitel Zuckerbrot, ewige Verliebtheit...«
Eine heiße Blutwelle stieg dem Mädchen ins Gesicht. »Nein, Papa, von dem Standpunkte...«
Derb legte er ihr die Hand auf die Schulter.
»Ach so, von dem Standpunkte nicht? Also geistige Ehe, philosophischer Krimskrams, Seelengemeinschaft, und tagsüber leerer Magen und nachts ein kaltes Bett ... siehst du, Kind, das kenne ich! Aber abgeschafft habe ich das alles, lang hat's nicht gedauert, kannst mir's glauben. Und darum durfte er mir nicht ins Haus, mein Schwager Julius. Nun, freilich, zieht er zu sich hinüber, was er kann.«
Schweratmend, in ungewöhnlicher Erregung, stand der Alte da, dann ließ er sich schwer auf die Drehbank vor seinem Pult nieder.
Idunas feine Gestalt überflog ein leises Zittern. Das also war's! Jetzt erst verstand sie ihre Mutter, verstand sich selbst in ihrer seltsamen Kindheit und ihrem Sehnen hinaus über die engen Grenzen der derb nüchternen Alltäglichkeit.
»Na, komm, Kind...«
Der Alte zog sie leise zu sich heran.
»Wir wollen im Guten voneinander gehen. Ich hab's der Mutter versprechen müssen, dich deinen Weg ziehen zu lassen, und wenn ich sie zwang mit meinem Willen, dann zeigte sie auf dich und sagte: »Aber ihr laß den Weg frei.« vielleicht hatte sie's damals schon abgekartet mit ihrem Bruder... na, das ist auch egal. Aber eines, Kind: klage nicht, hörst du? Wenn's nicht so ist, wie du dir's gewünscht, dann sage: »mea culpa«. Aber sag dir's im stillen Kämmerlein. Vor der Welt – 'runterschlucken. Wir beide haben auch nie geklagt, wenn's nicht klappen wollte... der große Ausgleich kommt ja doch!
Keine Briefe... alle paar Monate eine Depesche, daß ich weiß, ob du lebst... Auch von mir erwarte keine Nachricht. Sollte ich krank werden, wirst du's rechtzeitig erfahren. Daß sich auch in zwanzig Jahren hier nichts verändert, weißt du... und dein Leben, das würde ich doch nicht verstehen...«
Wie eine Zentnerlast fiel es ihr von der Seele. Es war ein Gefühl in ihr der absolutesten Freiheit und einem Jubelruf gleich klang ihr:
»Leb' wohl, Vater!«
Sie eilte in ihr Zimmer, um noch verschiedenes zu ordnen. Ohne Wehmut nahm sie Abschied von dem Raum, in dem sie neunzehn Jahre ihres Lebens verbracht hatte. Die kahlen Wände sagten ihr nichts, und die geschmacklosen Nippfiguren, die ihr Freundinnen, Tanten und Cousinen bei verschiedenen Gelegenheiten geschenkt, waren ihr von jeher ein Dorn im Auge gewesen, während sie die Koffer schloß, stieß sie aus Unachtsamkeit eine kleine Pagodenfigur aus billigem Porzellan um, so daß die Scherben klirrten. Das fratzenhafte kleine Köpfchen rollte ihr vor die Füße und schien sie mit der ausgestreckten roten Zunge zu verhöhnen.
Dann, eine Stunde später, stieg sie in den Wagen. Ein weicher, grauer Herbstnachmittag war es. Das zahlreiche Hausgesinde stand vollzählig versammelt im Hof, nicht aus Sympathie, mehr aus Respekt vor dem Herrn. Iduna war nicht gerade beliebt. Oft, wenn sie mit den Leuten sprach, blickte sie über deren Köpfe hinweg in die Luft. Man legte es mit Unrecht für Hochmut aus, aber es war nur das Zerstreute, unruhig Hastende ihres Wesens, das täuschte.
Daß sie nicht stolz war, sah man jetzt. Einem jeden gab sie die Hand, mit freundlichem Lächeln. Nur daß sie »Lieber« und »Liebe« sagte, weil sie die Namen nicht wußte. Aber das verzieh man ihr großmütig, und alle standen noch lange und blickten dem davonrollenden Gefährt nach.
plötzlich, was war's? Der Wagen kehrte um. Sollte das Fräulein was vergessen haben? Man sah sich gegenseitig vorwurfsvoll an und alles lief dem Wagen entgegen.
Iduna hatte sich zum offenen Fenster herausgebeugt:
»Wo ist Klaas, warum hat mir Klaas nicht Adieu gesagt?«
»Klaas, wo ist Klaas«, ging es geschäftig und erstaunt durch die Reihen.
Ein Abgesandter wurde ins Haus zurückgeschickt; er kam bald wieder, vom weißhaarigen Heizer gefolgt.
»Der Klaas ist genierlich, weil er gerade rußige Hände hat.«
Aber herzlich streckte Iduna ihm ihre Rechte entgegen:
»Ich wollte dir doch auch noch gerne Adieu sagen, Klaas, vergiß mich nicht, pflege den Kamin ... und überhaupt ... daß es warm bleibt im Hause ... hoffentlich sehe ich dich wieder.«
»Danke, gnädiges Fräulein, danke...«
Der alte Knecht verzog den zahnlosen Mund zu einem breiten Grinsen, und Iduna wendete sich zum erstenmal bewegt ab.
Der Kutscher trieb die Pferde zu doppelter Eile an, die Leute aber blieben noch zusammen und schwatzten voll Verwunderung über des Fräuleins seltsames Benehmen. Zum Schluß sagte die behäbige Wirtschafterin, die seit dem Tode der Frau Flößner das Hauswesen führte:
»Gut ist's nicht, daß das Fräulein wieder umgekehrt ist, das bringt Unglück ...«
Ein Fenster klirrte im Erdgeschoß. Das harte, verwitterte Gesicht des Ökonomen ward sichtbar.
»An die Arbeit, Leute, müßt ihr stundenlang Maulaffen feil halten ...«
Ein leiser, feiner Landregen sickerte nieder.
Iduna reiste – zum erstenmal in ihrem Leben. Eine große Ernüchterung war es für sie, als sie in dem ausgepolsterten Kasten eingeschlossen saß und nur flaches, graues Land und grauer Himmel an ihrem Coupéfenster vorbeizogen. Dazu das laute Rasseln des Zuges, die schrillen Pfiffe, die feisten Beamten... und auf den größeren Stationen die verschlafenen, verdrückten Gesichter, die nachlässig gekleideten Gestalten – alle denselben hastig unzufriedenen Ausdruck in den Zügen, ein reizloses Jagen und Hasten dem Ziel entgegen... Dann, in ihrem Coupé ein ekler Geruch von gebratenem Geflügel, Pfefferminze und Kölner Wasser, unästhetisch essende Menschen... fettige Papiere, die zum Fenster hinausflogen oder gar unter die Bank geschoben wurden.
Sie kauerte sich in ihrem Winkel zusammen und schloß die Augen. Nur nichts hören, nichts sehen von alledem. Endlich kam alles um sie herum zur Ruhe. Der grüne Schirm wurde über die Lampe gezogen und nun war es beinahe ganz dunkel. Jetzt klang etwas Geheimnisvolles in das Lärmen der Maschine hinein, und dies Durchschneiden der nächtlichen Landschaft, dies vorübergleiten an plötzlich gespenstisch aufragenden Formen, deren Umrisse sie nicht einmal erkennen konnte – das alles regte ihre Phantasie zu stetig wechselnden Vorstellungen an. Das war's endlich, das Reisen, ein Reisen, wie sie sich's erträumt hatte, ein drängendes, sehnsuchtsvolles Hinausjagen ins große Unbestimmte, in einen neuen Tag, in ein neues, fremdes Jeben, in ein neues, großes Glück.
Und sie lächelte mit weitgeöffneten, glänzenden Augen vor sich hin, wie Kinder im Schlaf lächeln, wenn ein Traum ihnen liebliche Bilder vorgaukelt...
Doch als es zu tagen anfing, zerrannen die Bilder, und nur ein Gefühl blieb bedrückend zurück: das Gefühl einer unaussprechlich großen Angst vor dem Wagnis, das sie unternommen.
Um acht Uhr morgens sollte der Zug in Berlin einlaufen. Sie schlang das weißseidene Tüchlein um den Hals, das als Erkennungszeichen dienen sollte. dann stapelte sie ihr Handgepäck ordentlich neben sich auf, faltete die Hände im Schoß und – wartete, wartete ganz brav und fromm, wie ein wohlerzogenes Kind vor der Bescherung.
Nur einmal flog noch ein Lächeln über ihre Lippen, als sie an ihre Sehnsucht dachte... War es wirklich schon vergangenes? Sie wünschte sich plötzlich weit zurück... zurück ins Unbestimmte, Ungewisse, das so Zauberhaftes für sie in sich geborgen ...
Nun hielt der Zug. Ein Gepäckträger nahm ihre Sachen, sie selbst stieg zaudernd aus, um sich spähend voll tödlicher Bangigkeit.
Eine Hand streckte sich ihr entgegen, eine hagere, lange, weiße Hand:
»Da bist du, Kind... ich grüße dich.«
»Julius ... Onkel Julius ...«
Sie stand zitternd vor dem schmalen, hageren Mann, dessen blasses Gesicht von einem kurzen, bläulich schwarzen Bart eingerahmt war. Keiner von ihnen sagte mehr ein Wort. Einige Augenblicke später saßen sie nebeneinander in der unförmigen Droschke.
»Du hast viel Gepäck mit«, sagte er endlich.
Sie schrak zusammen. Entschuldigend fragte sie:
»Findest du?«
Er sann eine weile nach.
»Besser ist's immer, nichts Altes in ein neues Leben mitzuschleppen.«
Schüchtern, beinahe undeutlich, murmelte sie: »So neu dachte ich mir's nicht, mehr eine Fortsetzung –«
»Deiner Träume?« ergänzte er fragend.
Und da sie nicht antwortete, schüttelte er langsam den Kopf.
»Nein, Kind, so war's nicht gemeint von mir. Denken sollst du lernen, nicht träumen!«
Sie schauerte leicht zusammen, als hätte sie ein leiser Hauch von Gletscherluft gestreift.
Kaum merkliches Lächeln huschte über seine schmalen, blassen Lippen.
»Ich habe in meiner unmittelbaren Nähe ein Zimmer für dich gemietet. Unsere gemeinsame Wohnung einzurichten, überlasse ich dir, klüger wär's freilich, wir nähmen für's erste möblierte Zimmer... Denn was du jetzt willst, weißt du noch nicht...«
»Aber was du willst...«
»Das habe ich, und das bleibt unverändert.«
»Wie glücklich bist du – –«
»Das kommt auch noch bei dir, Kind, bedenke, ich bin mehr als doppelt so alt wie du! In der Jugend ist man nicht glücklich.«
»Aber du versprichst mir ... ich werde es sein?... Ja?!«
Herausfordernd, angstvoll klang diese Frage.
Er sah sie an mit seinen tiefliegenden, dunklen Augen:
»Du verlangst viel von mir, Kind, und doch will ich dir's geben, das versprechen. Nur freilich mußt du nicht glauben, daß das Glück für dich von da kommt, von wo du es erwartest. Denn du erwartest es heute von dem, übers Jahr von jenem, heute von rechts, morgen von links. So läßt sich das Glück nicht einfangen. Still muß man werden, ganz still... Nicht rechts noch links ausblicken, sondern in sich hineinsehen, in das Wesen der Dinge dringen ... dann kommt es, das Glück. Auf leisen Sohlen ... es ist die Ruhe, die Erkenntnis...«
»Das verstehe ich nicht ganz...«
»Wie solltest du auch? Aber ich will dich's lehren – nur folgen mußt du mir. Nicht müde werden und stehen bleiben. Immer vorwärts!«
Sie zuckte zusammen und schlug die Augen wie in plötzlichem Schreck zu ihm empor.
Vorwärts! ... Sie hörte das go on aus ihren Kindertagen wieder, die Hetzpeitsche sauste an ihrem Ohr vorbei, und kalt wurde ihr auf einmal, so kalt, wie an den frühen, nebligen Morgen, wenn ihr die weiche, warme Decke erbarmungslos herabgezogen wurde...
Die Droschke stand.
»Da sind wir«, sagte Delten.
Er führte sie die mit dünnem Teppich belegte Stiege hinauf bis in den zweiten Stock. Auf dem Flur stand eine freundliche, noch junge Frau:
»Nur herein, die Herrschaften, das Zimmer ist in schönster Ordnung, ein paar Blumenstöcke hab' ich auf den Tisch gestellt, damit's netter aussieht, und das Fräulein nicht Heimweh kriegt nach dem Garten zu Hause.«
Es war ein viereckiger, heller Raum, nüchtern und unpersönlich, wie es alle zum Vermieten bestimmte Zimmer sind. Eine rote Ripsgarnitur, ein schmales Bett, ein unverhältnismäßig großer Schreibtisch, ein paar Öldrucke an den Wänden und eine, offenbar nach einer Photographie, steif und hölzern ausgeführte Zeichnung eines jungen Männerkopfes.
Die Wirtin fing Idunas Blick auf, der länger auf dem Bild haften geblieben war.
»Das ist ein Student, der bei uns gewohnt hat, im dritten Semester war er, Mediziner ... Meinen Mann hat er brav pflegen helfen, als er so krank war, da haben wir ihm aus Dankbarkeit das Bild machen lassen nach einer Photographie – er hat's nicht mitgenommen, wird ihm wohl nicht gefallen haben, was Besseres wußten wir aber nicht, und zehn Mark hat es gekostet...«
Sie stellte also sprechend das Gepäck recht handlich zum Auspacken hin und nickte dann freundlich:
»Die Herrschaften entschuldigen wohl, ich muß mal nach der Küche. Das Frühstück bringe ich gleich, werden gewiß hungrig sein! ...«
Iduna trat ans Fenster.
»Wie weit der Ausblick von hier ist, wir sind am äußersten Ende der Stadt –«
»Und doch mit der Straßenbahn in einer Viertelstunde mitten im pulsierenden Leben!«
Lebhaft und erleichtert atmete sie auf.
Er lächelte:
»Ich war schon lange nicht draußen. Heute, um dich an der Bahn abzuholen, seit Monaten zum erstenmal wieder. Und jetzt werde ich öfters wieder hinaustreten in den Lärm, um dir zu zeigen, was ich kenne. Später wird es dir so ergehen wie mir ... Mit den letzten Häusern bin ich gezogen, bis ich endlich, der ewigen Flucht müde, hier mein Heim aufschlug... siehst du – dort drüben das Haus, mit dem Garten ringsherum, der geschwärzten Mauer und den mittelalterlichen schmalen Bogenfenstern.«
»Wie eine Burg sieht es aus.«
»Ja... da wohne ich. Ein verrückter Bildhauer hat sich das Haus gebaut. Unten ist's Atelier, vielleicht war es Weltflucht, vielleicht auch nur Terrainspekulation – sobald aber kommt niemand in die Nähe. » Anima Sola« hat er seine Villa genannt ... schade! Denn nun bleiben die Leute stehen und gaffen die in Stein gehauene Inschrift an. Es können die wenigsten allein sein, ohne nicht auch zugleich der Welt zuzurufen: »Seht, ich bin allein.«
»Aber schön ist's doch: anima sola...«
Ihr Blick verlor sich traumverloren ins nebelhafte Grau, das sich über die kurzgemähte, feuchtbraune Wiese erhob, die durch niedere Holzzäune in Bauterrains parzelliert war. Er aber zog sie bei der Hand wieder in die Tiefe des Zimmers zurück.
»Nun laß dich einmal ansehen, Kind.«
Er löste mit geschickten Händen den Schleier und nahm ihr den Hut ab. Väterlich ruhte seine Hand einen Augenblick auf ihrem noch wirren Haar, aber wie er sich niederbeugte, um sie auf die Stirne zu küssen, da schrak sie zusammen, wand sich los in jäher Bewegung und starrte ihn an mit großen, entsetzten Augen.
»Ich dachte, du wolltest meine Frau werden«, sagte er einfach, aber er versuchte nicht nochmals, sie an sich zu ziehen.
»Ich lasse dich jetzt mit deiner Wirtin allein, packe aus, mach' dir's bequem. Frau Busse ist ein braver, tüchtiger Mensch. Gegen Abend hole ich dich ab. Wir essen dann irgendwo, ist dir's recht?«
Er nickte ihr zu und ging aus dem Zimmer, ohne ihr die Hand zu reichen.
Mechanisch trat sie wieder ans Fenster. Ein Sturm hatte sich erhoben, und der Regen prasselte in großen, schweren Tropfen gegen die Fensterscheiben. Sie sah, wie Delten aus dem Hause trat, den weichen, schwarzen Kalabreser tief in die Stirn gedrückt, jetzt spannte er den Regenschirm auf und stemmte ihn gegen den Wind. Seine hagere, schmale Gestalt war vornübergebeugt, seine bleichen, knochigen Hände hielten krampfhaft den Schirm, der von der Kraft des Windes hin und hergeschleudert wurde.