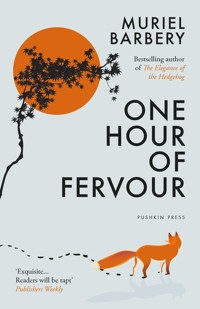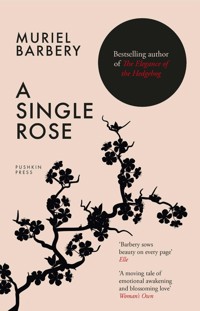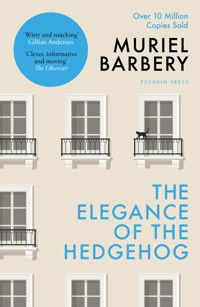8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Über die Schönheit der Welt – und ihre Bedrohung Maria, ein Findelkind, lebt in einem Dorf im Burgund, ist der Natur und den Tieren besonders verbunden, versteht deren Sprache. Clara, die als Waise im Haushalt eines Pfarrers in den Abruzzen aufgenommen wurde, spielt, einem Wunder gleich, bezaubernd Klavier. Sie wissen nichts voneinander – bis Elfen es bewirken, dass sie einander kennenlernen. Dank ihrer besonderen Talente könnte es gelingen, die Verbindung der Menschen mit den Elfen und die einstige Harmonie zwischen Himmel und Erde wiederherzustellen. Denn es droht Krieg und eine böse Macht rüstet sich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Muriel Barbery
Das Leben der Elfen
Roman
Aus dem Französischen von Gabriela Zehnder
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für Sébastien
–
Für Arty, Elena, Miguel, Pierre und Simona
DIE GEBURTEN
Die Kleine aus Spanien
Die Kleine verbrachte den größten Teil ihrer freien Stunden in den Bäumen. Wenn man sie suchte, ging man zuerst zur großen Buche, die den Schuppen im nördlichen Teil des Anwesens überragte und in deren Krone sie gerne träumte, während sie das Treiben auf dem Bauernhof beobachtete. War sie dort nicht zu finden, ging man weiter zur alten Linde im Pfarrgarten hinter dem bemoosten Mäuerchen, und schließlich, vor allem im Winter, zu den Eichen auf dem angrenzenden Feld, das nach Westen hin in einer Senke auslief und wo inmitten sanfter Hügel drei Exemplare wuchsen, wie es in der Gegend keine schöneren gab. Jede Minute, die die Kleine dem aus Lernen, Mahlzeiten und Gottesdiensten bestehenden Dorfleben abtrotzen konnte, nistete sie in den Baumkronen, und manchmal lud sie ausgewählte Kameraden ein, die über die luftigen Terrassen staunten, die sie angelegt hatte, und plaudernd und lachend wunderbare Tage dort oben verbrachten.
Eines Abends, als sie auf einem niedrigen Ast der mittleren Eiche saß, während die Senke sich mit Schatten füllte, beschloss sie, die Abkürzung über die Wiese zu nehmen und den Schafen des Nachbarn Gute Nacht zu sagen. Sie wusste, dass man bald kommen würde, um sie ins warme Haus zu holen. Im aufziehenden Dunst machte sie sich auf den Weg. Sie kannte jede Grasnarbe in einem Umkreis, der von den Stützmauern des Bauernhofs ihres Vaters bis zur Grenze von Marcelots Hof reichte; sie hätte sich mit geschlossenen Augen an den Unebenheiten des Geländes, den Teichbinsen, den Steinen auf dem Weg und am sanften Gefälle der Hügel wie an Sternen orientieren können; stattdessen, und aus einem ganz bestimmten Grund, hielt sie die Augen weit offen. Jemand ging im Dunst kaum ein paar Zentimeter neben ihr her, und seine Gegenwart versetzte ihr einen merkwürdigen Stich ins Herz und ließ seltsame Bilder in ihr aufsteigen – sie sah ein weißes Pferd in goldbraunem Unterholz und einen Weg, gepflastert mit schwarzen Steinen, die unter hohen Laubkronen glänzten.
Hier soll gesagt sein, was für ein Kind sie war am Tag dieses bemerkenswerten Ereignisses. Die sechs Erwachsenen, die auf dem Bauernhof lebten – der Vater, die Mutter, zwei Großtanten und zwei Großcousinen –, vergötterten die Kleine. Ein Zauber umgab sie, der anders war als der Zauber von Kindern, mit denen das Leben in ihren ersten Stunden gnädig war, anders als jene Anmut, die aus der richtigen Mischung von Unschuld und Glück hervorging. Wenn sich die Kleine bewegte, nahm man eher einen schillernden Lichtkreis wahr, den die vom Leben auf den Feldern und in den Wäldern geprägten Menschen dieser Gegend mit dem Flimmern der großen Bäume verglichen. Die älteste Tante, mit ihrem besonderen Gespür für jene Dinge, die nicht erklärt werden können, dachte insgeheim, die Kleine habe etwas Magisches an sich, doch auch die anderen Dorfbewohner erkannten, dass sie sich auf eine für ein Kind ihres Alters ungewöhnliche Weise bewegte, denn sie trug ein wenig vom Zittern der Luft mit sich, geradeso wie die Libellen oder die Zweige im Wind. Im Übrigen war sie dunkelhaarig und sehr lebhaft, etwas dünn, dabei aber äußerst anmutig. Ihre Augen funkelten wie Obsidiane, ihre Gesichtszüge mit den hohen Backenknochen hatten etwas Slawisches, die Wangen waren trotz des matten, dunklen Teints stets ein wenig gerötet und ihre schön geschwungenen Lippen von der Farbe frischen Blutes. Eine wahre Freude! Und welches Temperament! Immerzu lief sie über Felder und Wiesen, ließ sich ins Gras fallen, um den übergroßen Himmel zu betrachten, watete barfuß durch den Bach, sogar im Winter, um die beißende Kälte zu spüren, und mit dem Ernst eines Bischofs erzählte sie schließlich jedermann die großen und kleinen Ereignisse ihrer Tage im Freien. Dazu kam eine leise Traurigkeit, wie sie jenen Geistern eigen ist, deren Intelligenz die Wahrnehmung übersteigt und die aufgrund der zarten Hinweise, die sich selbst an jenen behüteten, wenn auch sehr armen Orten finden, wo die Kleine aufwuchs, schon die Tragödien der Welt erahnen. Diese strahlende, geheimnisvolle junge Knospe spürte also im Dunst des Spätnachmittags die Gegenwart eines unsichtbaren Wesens. Mit größerer Gewissheit als der Pfarrer, wenn er die Existenz Gottes predigte, erkannte die Kleine, dass es freundlich und zugleich übernatürlich war. Sie hatte keine Angst. Stattdessen ging sie auf das Wesen zu, in dieselbe Richtung, die sie vorher zu nehmen beschlossen hatte, in Richtung der Schafe.
Etwas ergriff ihre Hand. Es fühlte sich an wie eine mit einem weichen, warmen Wolltuch umwickelte große Pranke, in deren sanftem Griff ihre eigene Hand verschwand und die der Kleinen durch den seidigen Ballen hindurch wie die Klaue eines riesigen Wildschweins vorkam. In diesem Augenblick bogen sie beinahe rechtwinklig nach links ab, und sie begriff, dass sie die Schafe und den Hof von Marcelot umgingen und auf das Wäldchen zuhielten. Vor ihnen erstreckte sich ein mit dichtem, saftigem Gras bewachsenes, sanft ansteigendes Brachfeld, von dem aus ein gewundener Pfad den Hügel hinan zu einem hübschen Pappelwald voll Erdbeeren und ganzen Teppichen von Immergrün führte. Noch vor Kurzem verfügte jede Familie über ein Holzungsrecht und schlug dort beim ersten Schnee ihr Holz. Diese Zeiten sind leider vorbei, doch darüber werden wir heute nicht sprechen, aus Bedauern oder aus Nachlässigkeit, und weil die Kleine zu dieser Stunde ihrem Schicksal entgegenläuft, ihre Hand fest in der Klaue eines riesigen Wildschweins.
Das alles ereignete sich an einem Abend im Herbst, der so mild war, wie man es schon lange nicht mehr erlebt hatte. Man hatte damit gewartet, die Äpfel und Birnen zum Schrumpeln auf die Holzhorden im Keller zu legen, und es regnete den ganzen Tag lang Insekten, die trunken waren vom edlen Tropfen der Obstgärten. In der Luft lag eine Art Mattigkeit, ein träges Seufzen, eine ruhige Gewissheit, dass die Dinge nie enden würden. Und wenn die Menschen auch wie gewohnt arbeiteten, ohne Unterlass und Klage, so genossen sie doch insgeheim diesen unerschöpflichen Herbst, der sie gemahnte, die Liebe nicht zu vergessen.
Doch da geht die Kleine auf die Lichtung des Ostwaldes zu, und wieder geschieht etwas Unerwartetes. Es beginnt zu schneien. Es beginnt aus heiterem Himmel zu schneien, und nicht etwa in jenen zaghaften kleinen Flocken, die im trüben Grau fusseln und kaum am Boden ankommen. Nein, es beginnt in dicken Flocken zu schneien, die so groß sind wie Magnolienknospen und sich so dicht aneinanderdrängen, dass sie eine undurchdringliche Wand bilden. Im Dorf wurden gegen sechs Uhr alle überrascht – der Vater, der im bloßen Drillichhemd Holz hackte, Marcelot, der beim Weiher die Jagdhunde laufen ließ, Jeannette, die ihren Brotteig knetete, und andere, die an diesem Tag im Spätherbst, erfüllt vom Nachklang eines verlorenen Glücks, kamen und gingen und mit Leder, Mehl und Stroh hantierten. Ja, alle waren sie überrumpelt worden und schoben jetzt an den Stalltüren die Riegel vor, trieben die Schafe und Hunde ins Trockene und stimmten sich ein auf etwas, das fast genauso wohltuend ist wie die schöne herbstliche Mattigkeit: den ersten gemütlichen Abend am Kaminfeuer, wenn draußen ein Schneesturm wütet.
Man stimmte sich ein, und man dachte nach.
Jene, die sich daran erinnerten, dachten an einen Spätnachmittag im Herbst vor zehn Jahren, an dem ebenfalls unerwartet Schnee gefallen war, als wäre der Himmel mit einem Schlag in strahlend weiße Hobelspäne zerbröselt. Insbesondere auf dem Hof der Kleinen dachte man daran. Soeben hatte man nämlich entdeckt, dass sie nicht nach Hause gekommen war, und der Vater setzte seine Pelzmütze auf und zog eine Jagdjacke über, die auf hundert Meter nach Mottenpulver stank.
»Die sollen sie uns ja nicht wieder wegnehmen«, brummte er, bevor er in der Nacht verschwand.
Er klopfte an die Türen von ein paar Häusern im Dorf, wo andere Bauern, der Sattlermeister und Geschirrmacher, der Gemeindevorsteher (der auch die Wegewärter unter sich hatte), der Waldhüter und noch einige andere wohnten. Er brauchte überall nur einen Satz zu sagen, Die Kleine ist nicht zurückgekehrt, bevor er zur nächsten Tür ging, und schon rief der Mann im Flur nach seiner Jagdjacke oder seinem dicken Mantel, hängte sein Gewehr um und stürzte in den Schneesturm hinaus zum Nachbarhaus. So fand man sich zu fünfzehnt bei Marcelot ein, dessen Frau schon eine Pfanne Speck und einen Krug Glühwein vorbereitet hatte. Man leerte alles in zehn Minuten und entwarf dabei einen Schlachtplan, und es klang ganz ähnlich wie am Morgen eines Jagdtags, allerdings mit dem Unterschied, dass man die Routen der Wildschweine kannte, während die Kleine unberechenbarer als ein Wichtel war. Der Vater hatte jedoch wie alle übrigen Männer eine Vermutung, denn man glaubt nicht an Zufälle in solchen Gegenden, wo der liebe Gott und die Legende sich bestens vertragen und man beide stets im Verdacht hat, mit Schachzügen und Tricks aufzuwarten, die der Stadtmensch schon lange vergessen hat. Hierzulande, müsst ihr wissen, ruft man zur Rettung Schiffbrüchiger nur selten den Verstand zu Hilfe, sondern eher Auge, Fuß, Bauchgefühl und Beharrlichkeit. Das taten die Männer auch an diesem Abend, denn sie erinnerten sich an eine ähnliche Nacht vor genau zehn Jahren, in der sie den Weg zum Berg eingeschlagen hatten auf der Suche nach jemandem, dessen Spuren direkt auf die Lichtung des Ostwaldes führten. Nun fürchtete der Vater aber nichts mehr, als dass sie, wenn sie dort ankämen, nur die Augen aufreißen, sich bekreuzigen und den Kopf schütteln könnten, genau wie damals. Die Spuren hatten plötzlich aufgehört, und sie hatten dagestanden und die Schneedecke betrachtet, die so glatt war wie die Haut eines Neugeborenen. Diesen unberührten, stillen Ort – alle Jäger hätten es schwören können – hatte seit zwei Tagen keine Menschenseele mehr betreten.
Lassen wir sie also im Schneesturm bergan steigen.
Die Kleine ist inzwischen auf der Lichtung angekommen. Es schneit. Sie friert nicht. Das Wesen, das sie hierhergeführt hat, spricht zu ihr. Es ist ein großes, schönes Pferd, dessen Fell in der Abendluft dampft und in alle Himmelsrichtungen einen hellen Dunst verbreitet – nach Westen, wo die Berghänge des Morvan blauen, nach Osten, wo man die Ernte ohne einen Tropfen Regen eingebracht hat, nach Norden, wo sich die Ebene ausbreitet, und nach Süden, wo sich die Männer den Berg hinaufkämpfen, bis zu den Oberschenkeln im Schnee, die Brust vor Angst wie zugeschnürt. Ja, ein schönes, großes Pferd mit Armen und Beinen, und auch Hufen, das aber weder ein Pferd noch ein Mensch noch ein Wildschwein ist, sondern eine Synthese der drei – der Pferdekopf wird zeitweise zu dem eines Menschen, während der Körper sich streckt und die Füße in Hufe übergehen, die sich dann zu den Klauen eines Frischlings zusammenziehen, bevor sie wachsen und zu denen eines Wildschweins werden. Diese Verwandlung setzt sich unaufhörlich fort, und die Kleine wohnt voller Andacht diesem Tanz der Wesenheiten bei, die sich gegenseitig herbeirufen und ineinander übergehen und dabei den Weg des Wissens und des Glaubens vorzeichnen. Das Tier spricht sanft zu ihr, und der Dunst verändert sich. Da sieht sie. Sie versteht nicht, was das Wesen sagt, aber sie sieht einen verschneiten Abend wie diesen in ihrem Dorf, sie sieht ihren Bauernhof, und auf der Außentreppe sieht sie ein weißes Bündel im Weiß des Schnees. Und dieses Bündel ist sie selbst.
Es gibt niemanden im Dorf, der sich nicht an das Ereignis erinnert, wenn er dieser Kleinen begegnet, die so munter ist wie ein Vögelchen, dessen pulsierendes Leben man bis in die Fingerspitzen spürt. Tante Angèle fand das unglückliche kleine Wesen, als sie die Hühner in den Schuppen sperren ging. Es sah sie aus seinem bernsteinfarbenen Gesichtchen mit so offensichtlich menschlichen, übergroßen schwarzen Augen an, dass sie mitten in der Bewegung innehielt, einen Fuß noch in der Luft. Dann fasste sie sich wieder und rief: Ein Kind in der Nacht!, bevor sie das Bündel, das keine Flocke berührt hatte, obschon es noch immer fürchterlich schneite, aufhob, um es ins Haus zu bringen. Etwas später in jener Nacht sollte die Tante erklären: Ich habe fast geglaubt, der liebe Gott rede mich an, und dann schwieg sie, weil sie undeutlich spürte, dass es unmöglich war, die überwältigende Veränderung auszudrücken, die sich mit der Entdeckung des Neugeborenen in seinem weißen Wickeltuch in der Welt vollzogen hatte. Es kam ihr vor, als habe sich in dieser Schneenacht ein strahlendes Spektrum unbekannter Möglichkeiten und Wege aufgefächert und als würden Zeit und Raum sich verdichten. Das alles hätte Angèle nicht in Worte fassen können, doch wenigstens hatte sie es gespürt. Diese Dinge zu verstehen, überließ sie dem lieben Gott.
Eine Stunde, nachdem Angèle die Kleine entdeckt hatte, war das Bauernhaus bevölkert von Dorfbewohnern, die Rat hielten, und das Gelände von Männern, die einer Spur nachgingen. Sie folgten den einsamen Fußstapfen, die vom Hof zum Ostwald hinaufführten und im Schnee kaum eine Vertiefung hinterlassen hatten, obwohl sie nun bis zur Hüfte darin einsanken. Was folgte, ist bekannt: Auf der Lichtung angekommen, brachen sie die Verfolgung ab und kehrten mit düsteren Gedanken ins Dorf zurück.
»Wenn sie nur nicht …«, sagte der Vater.
Niemand erwiderte etwas, doch alle dachten an die Unglückliche, die womöglich …; und man bekreuzigte sich.
Die Kleine beobachtete das alles aus ihrem feinen, mit fremdartiger Spitze besetzten Wickeltuch heraus. Der weiße Batiststoff war mit einem Kreuz bestickt, das die Herzen der alten Frauen erwärmte, und mit zwei Wörtern in einer unbekannten Sprache, die ihnen Angst einjagten. Zwei Wörter, über deren Bedeutung man sich vergeblich den Kopf zerbrach, bis Jeannot, der Postbeamte, den Raum betrat. Er war im letzten Krieg, aus dem einundzwanzig Männer nicht zurückgekehrt waren – wovon ein Denkmal gegenüber dem Gemeindeamt und der Kirche zeugte –, bis weit hinunter in das Gebiet gekommen, das man Europa nannte, das jedoch in den Köpfen der Retter nicht viel mehr war als die rosa, blauen, grünen und roten Flecken auf der Landkarte im Gemeindesaal. Denn was ist schon Europa, wenn strenge Grenzen Dörfer trennen, die nur drei Meilen voneinander entfernt liegen?
Doch Jeannot, der eben mit einer weißen Flockenmütze auf dem Kopf hereingekommen war und dem die Mutter den Kaffee mit einem großen Schluck Schnaps serviert hatte, warf einen Blick auf die aus seidig glänzendem Baumwollgarn gestickte Inschrift und sagte:
»Bei Gott, das ist Spanisch.«
»Bist du sicher?«, fragte der Vater.
Der Bursche, vom Schnaps schon ganz benebelt, nickte energisch.
»Und will heißen?«, fragte der Vater weiter.
»Woher soll ich das wissen?«, antwortete Jeannot, der die Sprache der Barbaren nicht verstand.
Alle nickten dazu und verdauten die Neuigkeit mithilfe einer weiteren Runde Schnaps. Die Kleine kam also aus Spanien? Nicht zu fassen.
Während die Männer tranken, waren die Frauen Lucette holen gegangen, die aus dem Wochenbett kam und ihre Milch nun also zwei Kleinen gab. Die Säuglinge drängten sich an ihre Brüste, so weiß wie der Schnee dort draußen und so schön wie Zuckerhüte. Völlig arglos betrachtete man diese Brüste, an denen man auch gerne genuckelt hätte, und alle spürten, dass in diesem Moment eine Art Frieden einkehrte in der Welt. Nachdem sie kräftig getrunken hatte, machte die Kleine ein hübsches kleines Bäuerchen, rund wie eine Murmel und klangvoll wie ein Glockenspiel, und alle brachen in Lachen aus und schlugen einander brüderlich auf die Schulter. Man entspannte sich, Lucette richtete ihre Bluse, und die Frauen servierten Hasenpastete auf dicken, in Gänsefett gerösteten Brotscheiben, denn sie wussten, dass der Pfarrer eine Schwäche dafür hatte, und man wollte das Fräulein schließlich in einem christlichen Haus aufziehen. Übrigens ergaben sich hier nicht jene Probleme, mit denen man anderswo zu tun hätte, wenn eine kleine Spanierin einfach so bei diesem oder jenem auf die Vordertreppe geschneit käme.
»Na«, sagte der Vater, »mir scheint, die Kleine fühlt sich hier zu Hause«, und er sah die Mutter an, die ihm zulächelte, und er sah reihum die Gäste an, deren gesättigte Blicke auf dem Säugling ruhten, der in eine Decke gewickelt neben dem großen Ofen lag, und schließlich sah er den Herrn Pfarrer an, der, von Hasenpastete und Gänsefett beglückt, sich erhob und zum Ofen hinüberging.
Alle standen auf.
Wir wollen hier die Segnung eines Landpfarrers nicht wiederholen; das ganze Latein, wo man doch lieber ein bisschen Spanisch verstünde, würde uns nur verwirren. Sie standen also auf, der Pfarrer segnete die Kleine, und jeder wusste, dass diese Schneenacht eine Gnadennacht war. Sie erinnerten sich an den Bericht eines Ahnen, der ihnen von einem zum Fürchten und Sterben kalten Frost erzählt hatte. Es war zur Zeit des letzten Feldzugs gewesen, aus dem sie siegreich und auf ewig zur Erinnerung an ihre Toten verdammt hervorgehen sollten. Die Kolonnen rückten in einem gespenstischen Dämmerlicht vor, das ihn daran zweifeln ließ, ob es die Pfade seiner Kindheit je gegeben hatte, und jenen Haselstrauch an der Wegbiegung, und die Bienenschwärme am Johannistag, nein, er wusste nichts mehr, und die anderen Männer auch nicht, denn es war so kalt, so bitterkalt … Doch im Morgengrauen, nach einer unseligen Nacht, in der die Kälte die tapferen Krieger, die der Feind nicht hatte bezwingen können, reihenweise niederstreckte, hatte es plötzlich zu schneien begonnen, und dieser Schnee … dieser Schnee bedeutete die Erlösung der Welt, denn nun würde es keinen Frost mehr geben, und bald würde man auf der Stirn jene besondere, wunderbare Milde der Schneeflocken spüren, die Tauwetter ankündigen.
Die Kleine fror nicht, genauso wenig wie die Soldaten des letzten Feldzugs oder unsere Männer, die inzwischen die Lichtung erreicht hatten und reglos wie Vorstehhunde die Szene betrachteten, die sich ihnen darbot. Sie würden sich später nicht mehr klar erinnern an das, was sie in diesem Moment so deutlich sahen wie am helllichten Tag, und auf alle Fragen nur vage antworten, während sie eine verworrene Erinnerung zu fassen suchten. Alles, was sie sagen würden, war:
»Die Kleine stand mitten in einem grässlichen Schneesturm, aber sie war quicklebendig und redete mit einem Tier, das danach fortging.«
»Was für ein Tier?«, würden die Frauen fragen.
»Na, ein Tier eben«, würden sie antworten.
Und da wir in einer Gegend sind, wo der liebe Gott und die Legende undsoweiterundsofort, würde man sich an diese Antwort halten und einfach weiterhin über das Kind wachen wie über das Heilige Grab.
Ein Tier, das merkwürdig menschlich war, wie jeder der Männer spürte. Sie nahmen Wellen wahr, die um die Kleine kreisten und die genauso sichtbar waren wie Materie. Bei diesem ungewohnten Anblick erfasste die Männer ein eigentümlicher Schauer. Sie hatten das Gefühl, das Leben würde plötzlich auseinandergeklappt und sie könnten endlich hineinsehen. Doch was sieht man im Inneren des Lebens? Man sieht Bäume, Holz, Schnee, eine Brücke vielleicht und Landschaften, die vorüberziehen, ohne dass das Auge sie festzuhalten vermag. Man sieht die tägliche Arbeit und den Wind, die Jahreszeiten und die Sorgen, und man sieht auch ein Bild, das nur dem eigenen Herzen gehört, einen Lederriemen in einer Blechdose, ein Stück Feld, auf dem üppig der Weißdorn wächst, das faltige Gesicht einer geliebten Frau und das Lächeln der Kleinen, die eine Geschichte von einem Laubfrosch erzählt. Und dann sieht man nichts mehr. Die Männer würden sich später erinnern, dass die Welt in einer markerschütternden Explosion plötzlich wieder ins Lot kam. Kurz darauf sahen sie, dass sich der Dunst verzogen hatte und es gotterbärmlich schneite, und sie sahen die Kleine, die allein in der Mitte der Lichtung stand, auf der keine anderen Spuren als ihre eigenen zu sehen waren. Da kehrten sie gemeinsam zum Bauernhof zurück, wo man dem Kind eine Schale kochend heiße Milch vorsetzte und die Männer eilig ihre Gewehre ablegten, denn es gab Steinpilzfrikassee mit Schweinskopfpastete und zehn Flaschen Lagerwein.
Das ist die Geschichte des kleinen Mädchens, das die Klaue eines riesigen Wildschweins festhielt. In Wirklichkeit vermag sie wohl niemand ganz zu deuten. Doch etwas sei hier noch hinzugefügt, nämlich jene beiden Wörter, die auf den weißen Batist gestickt waren, in schönem Spanisch, ohne Kommentar und Logik, und deren Bedeutung die Kleine erfahren wird, nachdem sie das Dorf verlassen und das Räderwerk des Schicksals in Gang gesetzt hat – und vorab sei noch etwas anderes gesagt: Jeder Mensch hat das Recht, das Geheimnis seiner Geburt zu kennen. So betet man denn in Kirchen und Wäldern und macht sich auf in die weite Welt, weil man in einer Schneenacht geboren wurde und zwei Wörter geerbt hat, die aus Spanien kommen.
Mantendré siempre.[1]
Die Kleine aus Italien
Diejenigen, die nicht zwischen den Zeilen des Lebens zu lesen vermögen, werden sich lediglich merken, dass die Kleine in einem abgelegenen Dorf in den Abruzzen bei einem Landpfarrer und seiner ungebildeten alten Magd aufwuchs.
Das Haus von Don Centi war ein hohes Gebäude am Hang, mit einem Pflaumengarten, wo man in den kühlen Stunden die Wäsche aufhängte, damit sie im Wind, der von den Bergen kam, langsam trocknete. Es lag auf halber Höhe des Dorfs, das steil himmelwärts anstieg und dessen Straßen sich wie die Fäden eines festen Knäuels um einen Hügel wanden, auf den man eine Kirche und ein Wirtshaus gesetzt hatte und alles Übrige aus Stein, was es brauchte, um sechzig Seelen Schutz zu bieten. Nachdem sie den ganzen Tag draußen umhergestreift war, kehrte Clara nie nach Hause zurück, ohne den eingefriedeten Obstgarten zu durchqueren, wo sie die Geister des Ortes bat, sie auf die Rückkehr ins Innere der Mauern vorzubereiten. Dann betrat sie das Haus durch die Küche, einen langgestreckten, niedrigen Raum, an den eine Vorratskammer anschloss, die nach Pflaumen, altem Marmeladenschrank und dem ehrwürdigen Staub der Keller roch.
Von frühmorgens bis spätabends erzählte die Magd in der Küche ihre Geschichten. Dem Pfarrer gegenüber behauptete sie, sie habe sie von ihrer Großmutter, Clara hingegen verriet sie, dass die Geister des Sasso sie ihr im Schlaf zuflüsterten, und die Kleine fand dies durchaus glaubhaft, hatte sie doch den Erzählungen Paolos gelauscht, der sie seinerseits von den Berggeistern gehört hatte. Doch sie schätzte deren Figuren und Handlungen einzig wegen der samtenen, singenden Stimme der Erzählerin, denn diese plumpe Frau, die nur zwei Wörter vor dem Analphabetismus retteten – sie konnte lediglich ihren Namen und den ihres Dorfes schreiben, und bei der Messe las sie die Gebete nicht, sondern sagte sie auswendig her –, sprach in einer Art und Weise, die nichts mit der Einfachheit dieser abgelegenen Pfarrei an den Ausläufern des Sasso gemein hatte. Man muss sich vergegenwärtigen, was es damals bedeutete, im gebirgigen Teil der Abruzzen zu leben, wo das Dorf von Claras Beschützern lag: acht Monate Schnee, unterbrochen von Stürmen, die über das zwischen zwei Meeren eingeschlossene Gebirgsmassiv hinwegfegten und die nicht selten auch im Sommer ein paar Schneeflocken brachten. Dazu kam eine echte Armut, jene Armut der Landstriche, wo man nur den Boden bestellen und Schafherden aufziehen kann, die man in der warmen Jahreszeit bis auf den höchsten Punkt der Berghänge treibt. Nur wenige Menschen harrten hier aus, und noch weniger waren es in den Schneemonaten, wenn man fortging, um die Tiere an die Sonne Apuliens zu bringen. Im Dorf blieben dann nur Bauern zurück, die unermüdlich arbeiteten und jene nur auf kargem Boden gedeihenden, dunklen Linsen anbauten, und beherzte Frauen, die sich in der Kälte um die Kinder und die Höfe kümmerten und dafür Sorge trugen, dass die Andachtsübungen nicht vergessen wurden. Doch die Menschen dieser rauen, zerklüfteten Gegend waren nicht nur von Wind und Schnee, sondern auch von der Poesie ihrer Landschaft geprägt. So verfassten die Hirten in den eisigen Nebeln der Almen Reime, und die Stürme schufen wie auf die Himmelsleinwand hingepinselte Wolkengebilde.
Die Stimme der alten Frau, deren Leben sich zwischen den Gemäuern dieses rückständigen Dorfs abgespielt hatte, besaß also einen seidenen Klang, der von der Pracht dieser Landschaften herrührte. Die Kleine war überzeugt: Der Klang dieser Stimme war es, der ihr die Welt erschlossen hatte, auch wenn man ihr versicherte, dass sie damals nur ein hungriger Säugling auf der obersten Stufe der Kirchentreppe gewesen war. Sie spürte eine große Leere, einen Raum ohne Empfindungen, eine von Weiß und Wind gesäumte Abwesenheit; und dann den melodischen Redefluss, der das Nichts durchdrang und der ihr jeden Morgen entgegenströmte, wenn die alte Magd ihr einen guten Tag wünschte. Tatsächlich hatte die Kleine wunderbar schnell Italienisch gelernt. Den Hauch von Wunder, den sie auf ihren Wegen hinterließ, hatte der Hirte Paolo jedoch noch auf eine andere Weise gedeutet, und so hatte er ihr an einem Abend, als alle zusammensaßen, verstohlen zugeflüstert: Es ist die Musik, Kleine, nicht wahr, du hörst die Musik? Darauf hatte sie mit ihren Augen so blau wie ein Gletscherbach zu ihm aufgesehen und mit einem Blick geantwortet, der so geheimnisvoll war wie der Gesang der Engel. Und an den Hängen des Sasso floss das Leben mit der Langsamkeit und Intensität jener Landstriche dahin, wo alles Mühe abverlangt und seine Zeit braucht, wie einstmals, in jenem längst vergangenen Traum, als die Menschen die Rauheit der Welt und die mit ihr verflochtene Trägheit gekannt haben. Man arbeitete viel, man betete ebenso viel und man beschützte eine Kleine, die sprach, als ob sie sänge und sich mit den Geistern der Felsen und Täler unterhielt.
An einem Spätnachmittag im Juni klopfte es an die Tür des Pfarrhauses. Zwei Männer betraten die Küche und wischten sich den Schweiß von der Stirn. Einer der beiden war der jüngere Bruder des Pfarrers, der andere der Lenker des großen zweispännigen Fuhrwerks, mit dem sie einen mit Decken umwickelten und mit Gurten umschnürten Gegenstand aus L’Aquila hierhergebracht hatten. Clara, die sich nach dem Mittagessen am Steilhang oberhalb des Dorfes aufgehalten hatte, von wo aus man die beiden Täler und an klaren Tagen Pescara und das Meer überblicken konnte, war dem Gefährt, das sich auf der Nordstraße näherte, mit den Augen gefolgt. Kurz bevor das Fuhrwerk die letzte Steigung erreicht hatte, war sie den Hang hinuntergerannt und mit leuchtendem Gesicht im Pfarrhaus angekommen. Die beiden Männer hatten den Wagen vor dem Kirchenportal abgestellt und waren zum Pflaumengarten hinaufgestiegen, wo man sich umarmt und ein Glas des kühlen, süßen Weißweins hinuntergespült hatte, den man an warmen Tagen servierte, und dazu einen kleinen Imbiss zur Stärkung zu sich genommen hatte. Dann war man übereingekommen, das Abendessen auf später zu verschieben, und nachdem man sich am Ärmel den Mund abgewischt hatte, war man zur Kirche hinübergegangen, wo Don Centi wartete. Man musste zwei Männer zur Verstärkung holen, um den sperrigen Gegenstand ins Kirchenschiff zu schaffen und auszupacken. Unterdessen füllten sich die Bänke der kleinen Kirche langsam mit Dorfbewohnern. Seit der Ankunft dieses unerwarteten Legats aus der Stadt lag eine ungewöhnliche Milde in der Luft. Clara hatte sich, reglos und stumm, in den Schatten einer Säule zurückgezogen. Es war ihre Stunde – das hatte sie bereits gespürt, als sie den sich auf der Nordstraße nähernden Punkt erspäht hatte, und wenn die alte Magd in Claras Gesicht nun die leidenschaftliche Erregung einer Braut bemerkte, dann deshalb, weil Clara fühlte, dass ihr tatsächlich eine Vermählung bevorstand, die etwas Fremdes und zugleich etwas Vertrautes hatte. Als die letzten Gurte gelöst waren und man den Gegenstand endlich sehen konnte, ging ein bewunderndes Raunen durch die Reihen, gefolgt von einem Beifallssturm. Es war ein schönes, schwarzes Klavier, so glatt wie ein Kiesel und fast ohne Kratzer, obwohl es schon viel gereist war und einiges erlebt hatte.
Und das war seine Geschichte: Don Centi stammte aus einer wohlhabenden Familie aus L’Aquila, deren Nachkommenschaft verkümmerte, da er selbst Priester geworden war, zwei seiner Brüder früh verstorben waren und der dritte, Alessandro, der bei seiner Tante die Irrungen eines ausschweifenden Lebens in Rom abbüßte, sich nie zur Heirat entschlossen hatte. Der Vater der Brüder war vor dem Krieg gestorben. Seiner Witwe hinterließ er eine unerwartete Schuldenlast sowie ein Haus, das zu stattlich war für die arme Frau, die sie innerhalb eines einzigen Tages geworden war. Sie verkaufte ihr ganzes Hab und Gut, und als die Gläubiger aufhörten, an ihre Tür zu klopfen, zog sie sich in ein Kloster zurück. Dort starb sie einige Jahre später, lange vor der Nacht, in der Clara ins Dorf kam. Doch bevor sie das weltliche Leben gegen die endgültige Abgeschiedenheit des Klosters eintauschte, hatte sie das einzige Relikt aus glücklicheren Tagen, das sie vor den Aasgeiern hatte retten können, zu ihrer Schwester bringen lassen, einer alten Jungfer, die nahe der Stadtmauern wohnte. Sie hatte sie gebeten, es für die Enkel aufzubewahren, die ihr vielleicht auf dieser Erde beschieden wären. Ich werde sie nicht kennenlernen, aber sie werden es von mir erhalten, und jetzt gehe ich und wünsche Dir ein gutes Leben, hatte diese den Wunsch in ihrem Testament getreu wiedergegeben und das Klavier demjenigen ihrer Neffen vermacht, der am Tag, da sie ihrerseits sterben würde, Nachkommen hätte. Und sie hatte hinzugefügt: Befolgt ihren Willen. Genau das gedachte der Notar zu tun, als er Wind von der Ankunft einer Waise im Pfarrhaus bekommen hatte. Und so bat er Alessandro, das Erbstück bis zum Haus seines Bruders zu begleiten. Da das Klavier während des Krieges auf dem Dachboden gestanden und man danach vergessen hatte, es wieder herunterzuholen, ließ derselbe Notar in einem Brief wissen, man müsse das Instrument stimmen lassen, wenn es ankäme. Der Pfarrer antwortete, man habe den Klavierstimmer, der einmal pro Jahr die umliegenden Ortschaften besuchte, gebeten, an einem der ersten Tage des Sommers einen Abstecher ins Dorf zu machen.
Man betrachtete das schöne Klavier, das im Licht der bunten Kirchenfenster glänzte, und man lachte und gab sich der Fröhlichkeit dieses schönen Abends im ausklingenden Frühling hin. Clara aber schwieg. Bei Beerdigungen in der Kirche des Nachbardorfs hatte sie schon Orgelmusik gehört, doch wurden die geistlichen Lieder dort von einer Betschwester gespielt, die nicht nur schwerhörig, sondern auch eine miserable Musikerin war – wobei auch die Akkorde, die sie anschlug, ohne sie zu hören, vermutlich nicht gerade erhebend waren. Clara mochte hundertmal lieber den Singsang, den Paolo seiner Bergflöte entlockte und den sie wahrhaftiger und machtvoller fand als das dem Allerhöchsten geweihte Gedröhne der Orgel. Als sie aber weiter unten im Tal den Wagen erspäht hatte, der den Serpentinen der langen Straße folgte, hatte ihr Herz einen Satz gemacht, ein Hinweis darauf, dass ein besonderes Ereignis bevorstand. Nun, da das Klavier vor ihr stand, verstärkte sich dieses Gefühl auf schwindelerregende Weise. Clara fragte sich, wie sie das Warten ertragen sollte, denn zum Leidwesen all jener, die sich einen Vorgeschmack auf das musikalische Vergnügen gewünscht hätten, wurde beschlossen, das Instrument nicht anzurühren, bevor es gestimmt war. Man respektierte jedoch die Anordnung des Pfarrers und bereitete sich auf einen schönen Abend vor, an dem man im milden Sternenschein den Wein genießen würde.
Und es war ein prächtiger Abend. Im Obstgarten wurde unter den Pflaumenbäumen der Tisch gedeckt, und Alessandros alte Freunde kamen zum Abendessen. Er war früher einmal sehr schön gewesen, und obschon die Zeit und sein ausschweifendes Leben Spuren hinterlassen hatten, waren die feinen Züge und die stolzen Konturen seines Gesichts noch immer erkennbar. Zudem sprach er ein außergewöhnlich gleichmäßiges, melodiöses Italienisch, und die Geschichten, die er zum Besten gab, handelten stets von schönen Frauen und endlosen Nachmittagen, an denen man unter einer Pergola rauchte und sich dabei mit Dichtern und Weisen unterhielt. An diesem Abend hatte er eine Erzählung begonnen, die sich in erlesenen Salons abspielte, wo edle Zigarren und goldfarbene Liköre gereicht wurden. Clara verstand sie nicht so recht, denn eine solche Umgebung und solche Sitten waren ihr völlig unbekannt. Doch gerade in dem Moment, als er anhob, von einer geheimnisvollen Sache namens Konzert zu sprechen, unterbrach ihn die alte Magd: Sandro, al vino ci pensi tu?[2] Und der liebenswürdige Mann, dessen ganzes Leben sich in ein paar glanzvollen, glühenden Jugendjahren verzehrt hatte, ging in den Keller und holte einige Flaschen Wein, die er mit der gleichen Eleganz öffnete, mit der er sein Leben verwüstet hatte, das gleiche Lächeln auf den Lippen, das er stets dem Unglück entgegensetzte. In diesem Augenblick erhellte das warme Mondlicht einen Teil der festlichen Tafel im Pfarrgarten, und Alessandro wurde für Sekunden wieder zu dem feurigen jungen Mann, der er einmal gewesen war. Dann überdeckte die Asche der Nacht diesen Ausdruck wieder, der alle verblüfft hatte. In der Ferne waren im leeren Raum aufgehängte Lichter zu sehen, die anzeigten, dass auch andere den Wein des Sommers einschenkten und dem Herrn für den milden Abend dankten. Überall auf dem Berg war frischer Klatschmohn, und da war ein kleines Mädchen, blonder als die zarten Kräutlein, das der Pfarrer bald im Klavierspiel unterrichten würde, wie es bei den jungen Damen in der Stadt üblich ist. Ah, wie wohltuend war dieser Abend … ein Moment des Innehaltens und Atemschöpfens im stetig sich drehenden Rad der Arbeit. Diese Nacht war eine große Nacht, und alle hier wussten es.
Nach der Ankunft des Klaviers blieb Alessandro Centi noch einige Tage im Pfarrhaus, wo er an einem der ersten heißen Julitage den Klavierstimmer empfing. Clara folgte den beiden zur Kirche und beobachtete schweigend den Mann, der seine Werkzeuge auspackte. Der Klang der ersten Anschläge auf den verstimmten Saiten erschien ihr scharf wie die Klinge eines Messers, und zugleich empfand sie einen lustvollen Schwindel. Während Alessandro und der Klavierstimmer plauderten und scherzten, nahm ihr Leben mit den ersten vorsichtigen Bewegungen von Elfenbein und Filz eine neue Wendung. Dann setzte sich Alessandro vor die Klaviatur, legte eine Partitur vor sich auf den Notenständer und spielte ziemlich gut, trotz der vergangenen Jahre. Nachdem der letzte Ton verklungen war, ging Clara zu ihm, zeigte auf die Partitur und bedeutete ihm, die Seiten zu wenden. Er lächelte ihr belustigt zu, doch etwas in ihrem Blick ließ ihn aufmerken, und er wendete die Seiten, wie sie es gewünscht hatte, langsam, eine nach der anderen, und dann begann er wieder von vorn. Als er fertig war, sagte sie: »Spiel noch einmal«, und er spielte das Stück erneut. Danach sprach niemand ein Wort. Alessandro stand auf und ging in die Sakristei, um ein großes rotes Kissen zu holen, das er auf den mit Samt bezogenen Hocker legte. »Möchtest du spielen?«, fragte er, und seine Stimme klang rau.
Die Hände der Kleinen waren zart und anmutig, eher groß für ein Kind, das im November erst zehn geworden war, und äußerst beweglich. Während sie diese Hände einen Moment über der Klaviatur schweben ließ, bereit, mit dem Stück zu beginnen, kam es den beiden Männern so vor, als streiche ein unerklärlicher Wind durch das Kirchenschiff. Dann setzte die Kleine die Finger auf die Tasten. Im selben Moment kam in der Kirche ein Sturm auf, ein richtiger Sturm, der wie eine Welle toste, die sich an den Klippen bricht. Schließlich glättete sich die Woge wieder, und die Kleine begann zu spielen.
Sie spielte langsam, ohne auf ihre Hände zu blicken und ohne einen einzigen Fehler. Alessandro wendete für sie die Seiten der Partitur, und sie spielte das Stück mit der gleichen unerschütterlichen Perfektion, im gleichen Tempo und mit der gleichen Reinheit zu Ende. Im verzauberten Kirchenraum kehrte Stille ein.
»Liest du, was du spielst?«, fragte Alessandro nach einem langen Moment des Schweigens.
Sie antwortete:
»Ich sehe hin.«
»Kannst du spielen, ohne hinzusehen?«
Sie nickte.
»Siehst du nur hin, um zu lernen?«
Sie nickte wieder, und die beiden blickten einander unschlüssig an, als hätte man ihnen einen Kristall gereicht, der so empfindlich war, dass sie nicht wussten, wie sie ihn halten sollten. Alessandro Centi war früher mit der Zartheit und der atemberaubenden Reinheit des Kristalls vertraut gewesen, und er kannte die Freuden genauso wie die Erschöpfung, die mit ihm verbunden waren. Doch in seinem jetzigen Leben fand der Sinnentaumel der Vergangenheit nur noch ein Echo in den Trillern der Vögel in der Morgendämmerung oder in den großen Kalligraphien der Wolken. So hatte der Schmerz, den er spürte, als die Kleine zu spielen begann, an einen Kummer gerührt, von dem er nicht einmal mehr wusste, dass er ihn in sich trug … ein kurzer Anklang an die Grausamkeit der Freuden … und im selben Moment, da er fragte: Siehst du nur hin, um zu lernen?, kannte Alessandro bereits die Antwort, die Clara ihm geben würde.
Man rief Don Centi und seine Magd und holte alle Partituren, die Alessandro aus der Stadt mitgebracht hatte. Der Pfarrer und die Magd nahmen in der vordersten Kirchenbank Platz, und Alessandro bat Clara, das Stück nochmals auswendig zu spielen. Als sie begann, sanken die zwei Ankömmlinge wie unter einem Hammerschlag in sich zusammen. Dann bekreuzigte sich die alte Magd ein ums andere Mal, während Clara immer schneller spielte, denn erst jetzt vollzog sich die Vermählung wahrhaftig, und nacheinander las sie alle Partituren, die Alessandro ihr reichte. Wir werden später berichten, auf welche Weise Clara spielte und weshalb die Präzision ihres Spiels nicht das eigentliche Wunder war. An dieser Stelle sei lediglich gesagt, dass Clara tief Atem holte, als sie ihre Augen über eine blaue Partitur schweifen ließ, die Alessandro feierlich vor sie hingelegt hatte, was den Anwesenden das Gefühl gab, ein leichter Bergwind habe sich unter das Bogengewölbe verirrt. Dann spielte sie. Alessandro rannen Tränen über die Wangen, und er versuchte nicht, sie zurückzuhalten. Ein Bild zog vor seinem inneren Auge vorbei, so kostbar, dass er es, auch wenn es gleich wieder verblasste, nicht mehr vergaß. Beim Anblick dieses Gesichts, das flüchtig vor dem Hintergrund eines Gemäldes auftauchte, auf dem eine schluchzende Frau Christus an ihre Brust drückte, wurde ihm bewusst, dass er seit zehn Jahren nicht mehr geweint hatte.
Am nächsten Tag verließ Alessandro das Dorf mit dem Versprechen, in den ersten Augusttagen wiederzukommen. Er ging fort und kam zurück, wie er gesagt hatte. Eine Woche nach seiner Rückkehr klopfte ein großer, leicht gebeugter Mann an die Tür des Pfarrhauses. Alessandro empfing ihn in der Küche, und sie umarmten sich wie Brüder.
»Sandro, endlich«, sagte der Mann.
Clara war reglos auf der Schwelle der Hintertür stehen geblieben. Alessandro nahm sie bei der Hand und führte sie zu dem großen, gebeugten Mann.
»Ich stelle dir Pietro vor«, sagte er.
Clara und der Mann blickten einander mit dem gleichen Maß an Neugier an, wenn auch aus entgegengesetzten Gründen, denn er hatte schon von ihr gehört, während sie nichts über ihn wusste. Ohne sie aus den Augen zu lassen, fragte Pietro Alessandro:
»Wirst du es mir jetzt erklären?«
Es war ein schöner Spätnachmittag, und viele Dorfbewohner saßen vor ihren Häusern, als das Trio die Straße zur Kirche hinunterging. Die beiden Männer, von denen man einen kannte, wirkten sowohl in ihrer Kleidung als auch in ihrer Art befremdlich, und als sie vorübergegangen waren, stand man auf, um ihnen nachdenklich mit den Augen zu folgen. Dann spielte Clara, und Pietro begriff, warum er den weiten Weg von Rom bis in dieses ärmliche Dorf an den schroffen Hängen des Sasso unternommen hatte. Als die letzte Note verklungen war, überfiel ihn ein Schwindelgefühl, das ihn schwanken ließ. Vor seinem inneren Auge tauchten Bilder auf, die wie in einem Kaleidoskop zerfielen, sich neu zusammensetzten und sogleich wieder verschwanden – allein das letzte Bild prägte sich so tief in sein Gedächtnis ein, dass er es noch vor sich sehen sollte, als er das Dorf schon lange verlassen hatte. Voller Ehrfurcht blickte er die zierliche Kleine an, die dieses Wunder einer Wiederkehr hatte geschehen lassen und deren Gesicht nun vom Antlitz einer Frau überlagert wurde, die im Dämmerlicht eines vergessenen Gartens lachte.
Clara spielte bis zum Einbruch der Dunkelheit. Danach breitete sich eine große Stille aus unter dem Gewölbe der Kirche, in diesem Sommer vor ihrem elften Geburtstag, in dem ein Klavier bei ihr gestrandet war. Natürlich ist das ein Märchen, aber es ist auch die Wahrheit. Wer kann diese Dinge schon auseinanderhalten? Gewiss ist nur, dass jenes Mädchen, das man in einem abgelegenen Dorf in den Abruzzen bei einem Landpfarrer und seiner ungebildeten alten Magd gefunden hatte, Clara Centi hieß und dass die Geschichte nicht hier endete. Pietro war nicht von so weit hergekommen, um ein etwas wildes kleines Mädchen spielen zu hören und dann gleichgültig wieder nach Rom zurückzukehren. So werden wir zum Schluss nur noch eines sagen, bevor wir ihnen in die große Stadt folgen, wo schon der Krieg heraufzieht – nämlich das, was Pietro in der Abgeschiedenheit der Kirche zu Clara sagte, nachdem sie die letzte Partitur gespielt hatte:
Alle orfane la grazia.[3]
BOGENSCHÜTZEN
die Wurzellosen, das letzte Bündnis
– Angèle –
Die schwarzen Pfeile
Die Kleine wurde auf den Namen Maria getauft, zu Ehren der Heiligen Jungfrau, aber auch um die beiden Wörter aus Spanien zu würdigen. Sie wuchs auf dem Bauernhof unter der Obhut von vier bemerkenswerten alten Frauen auf, die stets den Rosenkranz zur Hand hatten und zudem über das Auge des Herrn verfügten, das man jenen Alten nachsagt, denen im Umkreis von zwanzig Meilen nichts entgeht, obwohl sie ihr Haus nur für das Begräbnis eines Vetters oder die Hochzeit einer Patentochter verlassen – Ereignisse, die, soweit man sich erinnern kann, selten jenseits dieses Landstrichs stattfanden.
Ja, es waren beeindruckende Frauen. Die jüngste war noch in ihrem 81