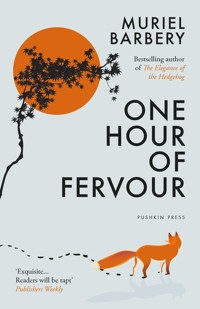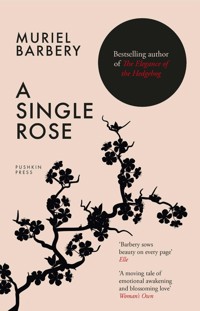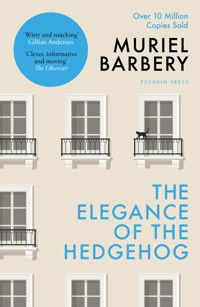Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hörbuch Hamburg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Bestseller jetzt endlich auch als eBook! Renée ist 54 Jahre alt und lebt seit 27 Jahren als Concierge in der Rue de Grenelle in Paris. Sie ist klein, hässlich, hat Hühneraugen an den Füßen und ist seit längerem Witwe. Paloma ist 12, hat reiche Eltern und wohnt in demselben Stadtpalais. Hinreißend komisch und zuweilen bitterböse erzählen die beiden sehr sympathischen Figuren von ihrem Leben, ihren Nachbarn, von Musik und Mangas, Kunst und Philosophie. Die höchst unterhaltsame und anrührende Geschichte zweier Außenseiter, ein wunderbarer Roman über die Suche nach der Schönheit in der Welt.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Renée ist vierundfünfzig Jahre alt und lebt schon seit Jahrzehnten als Concierge in der Rue de Grenelle 7 in Paris. Sie ist klein, hässlich, hat Hühneraugen und ist seit längerem Witwe. Paloma ist zwölf, hat reiche Eltern und wohnt in demselben Stadtpalais.
Renée führt ein Doppelleben: Sie spielt die einfältige Concierge, in Wirklichkeit aber ist sie ungemein gebildet. Sie kennt die großen Werke der Literatur und Philosophie und blickt höchst wachsam auf die Welt und das oft eigenartige Treiben ihrer reichen Nachbarn.
Und Paloma? Altklug, wie sie ist, hat sie beschlossen, erst gar nicht in die verlogene Welt der Erwachsenen einzutauchen. Sie will sich noch ein paar grundlegende Gedanken über die Welt machen – und sich an ihrem dreizehnten Geburtstag umbringen. Als jedoch Monsieur Ozu, ein japanischer Geschäftsmann, einzieht, verändert sich das Leben in dem Stadtpalais ganz überraschend. Hinreißend komisch, bitterböse und sehr berührend erzählen Paloma und Renée von ihrem Leben, von Büchern, Filmen, Mangas und ihrer Suche nach der Schönheit in der Welt.
Muriel Barbery
Die Eleganz des Igels
Roman
Aus dem Französischen von Gabriela Zehnder
Für Stéphane, mit dem ich dieses Buch geschrieben habe
Marx
(Einleitung)
1 Wer Begehrlichkeit sät
»Marx verändert mein Weltbild total«, erklärte mir heute morgen der kleine Pallières, der mich sonst nie anspricht.
Antoine Pallières, prosperierender Erbe einer alten Industriellendynastie, ist der Sohn einer meiner acht Arbeitgeber. Dieser letzte Aufstoßer der großen Unternehmerbourgeoisie – welche sich nur durch saubere und sittliche Schluckaufs fortzupflanzen pflegt – strahlte über seine Entdeckung und berichtete mir aus einem Reflex heraus davon, ohne auch nur zu erwägen, daß ich etwas verstehen könnte. Was sollen die arbeitenden Massen denn schon von Marx’ Werk verstehen? Seine Lektüre ist schwierig, die Sprache gehoben, die Prosa subtil, die These komplex.
Und da verrate ich mich doch beinahe auf törichte Weise.
»Sollten ›Die deutsche Ideologie‹ lesen«, sage ich zu ihm, diesem Idioten im tannengrünen Dufflecoat.
Um Marx zu verstehen und zu verstehen, warum er unrecht hat, muß man ›Die deutsche Ideologie‹ lesen. Das Werk ist ein anthropologischer Sockel, auf dem später alle Ermahnungen an eine neue Welt aufgebaut wurden und auf den eine entscheidende Gewißheit geschraubt ist: Die Menschen, die sich vor lauter Begehren verlieren, täten gut daran, sich an ihre Bedürfnisse zu halten. In einer Welt, in der die Hybris der Begehrlichkeit geknebelt wird, kann eine neue gesellschaftliche Organisation entstehen, reingewaschen von den Kämpfen, den Unterdrückungen und den verderblichen Hierarchien.
»Wer Begehrlichkeit sät, erntet Unterdrückung«, bin ich ganz nahe daran zu murmeln, als hörte mir nur meine Katze zu.
Doch Antoine Pallières, dessen widerwärtiger, kümmerlicher Schnurrbart nichts Katzenhaftes an sich hat, schaut mich an, unschlüssig, wie er meine befremdenden Worte aufnehmen soll. Wie immer rettet mich die Unfähigkeit der Menschen zu glauben, was den Rahmen ihrer kleinen geistigen Gewohnheiten sprengt. Eine Concierge liest nicht ›Die deutsche Ideologie‹ und wäre demzufolge gar nicht imstande, die elfte These über Feuerbach zu zitieren. Überdies liebäugelt eine Concierge, die Marx liest, zwangsläufig mit der Subversion, die sich einem Teufel namens CGT1 verschrieben hat. Daß sie es zur Erhebung des Geistes lesen könnte, ist eine Ungehörigkeit, auf die kein Bürger verfällt.
»Schönen Gruß an Ihre Frau Mutter«, brumme ich, während ich ihm die Tür vor der Nase zumache und hoffe, daß die Dysphonie der beiden Sätze von der Kraft jahrtausendealter Vorurteile überdeckt werde.
2 Die Wunder der Kunst
Ich heiße Renée. Ich bin vierundfünfzig Jahre alt. Seit siebenundzwanzig Jahren bin ich Concierge in der Rue de Grenelle 7, einem schönen herrschaftlichen Stadthaus mit Innenhof und Innengarten, aufgeteilt in acht exquisite Luxuswohnungen, alle bewohnt, alle gigantisch. Ich bin Witwe, klein, häßlich, mollig, ich habe Hühneraugen und, gewissen Morgenstunden zufolge, in denen er mich selbst stört, einen Mundgeruch wie ein Mammut. Ich habe nicht studiert, ich war immer arm, unauffällig und unbedeutend. Ich lebe allein mit meiner Katze, einem großen faulen Kater, dessen einzige nennenswerte Eigenheit darin besteht, an den Pfoten zu stinken, wenn er verstimmt ist. Weder er noch ich unternehmen große Anstrengungen, uns in die Reihe unserer Artgenossen einzugliedern. Da ich selten liebenswürdig, jedoch immer höflich bin, liebt man mich nicht, toleriert mich aber gleichwohl, weil ich dem, was sich in der gesellschaftlichen Überzeugung zum Paradigma der Concierge zusammengeballt hat, so genau entspreche, daß ich eines der mannigfaltigen Rädchen im Getriebe bin, das die große universelle Illusion in Bewegung hält, der zufolge das Leben einen leicht durchschaubaren Sinn hat. Und dann steht irgendwo geschrieben, daß Conciergen alt, häßlich und kratzbürstig sind, es steht ebenfalls in Flammenschrift am Frontispitz des gleichen einfältigen Firmaments eingraviert, daß besagte Conciergen fette, wankelmütige Katzen haben, die den lieben langen Tag auf Kissen mit Häkelbezügen vor sich hin dösen.
Im gleichen Kapitel heißt es, daß Conciergen endlos fernsehen, während ihre fetten Katzen schlummern, und daß es im Eingang des Hauses nach Kohlsuppe oder Eintopf riechen muß. Ich habe das ungeheure Glück, Concierge in einer Luxusresidenz zu sein. Es war für mich derart erniedrigend, diese abstoßenden Gerichte kochen zu müssen, daß das Veto von Monsieur de Broglie, dem Ministerialrat vom ersten Stock, das er seiner Frau gegenüber wohl als »höflich, aber entschieden« bezeichnet hat und das bezweckte, diese plebejischen Gerüche aus der gemeinsamen Existenz zu verbannen, eine unendliche Erleichterung für mich bedeutete, die ich hinter einem scheinbar gezwungenen Gehorsam so gut wie möglich verbarg.
Das war vor siebenundzwanzig Jahren. Seither gehe ich jeden Tag zum Metzger und kaufe eine Scheibe Schinken oder eine Schnitte Kalbsleber, die ich in meinem Einkaufsnetz zwischen das Paket Nudeln und den Bund Karotten klemme. Willfährig stelle ich diese Lebensmittel der Armen zur Schau, die sich durch das schätzenswerte Merkmal auszeichnen, daß sie nicht riechen, da ich arm bin in einem Haus von Reichen. Mit ihnen nähre ich das gängige Klischee und gleichzeitig Leo, meinen Kater, der einzig von diesen Mahlzeiten fett ist, die eigentlich mir zugedacht wären, und der sich den Bauch geräuschvoll mit Schweinernem und Buttermakkaroni vollschlägt, während ich, ohne olfaktorische Beeinträchtigung und ohne jemandes Verdacht zu erregen, meine eigenen kulinarischen Neigungen befriedigen kann.
Verzwickter war die Sache mit dem Fernsehen. Zur Zeit meines verstorbenen Mannes nahm ich es hin, weil die Ausdauer, mit der er sich dieser Beschäftigung widmete, mir selbst die lästige Aufgabe ersparte. In die Eingangshalle gelangten entsprechende Geräusche, und das reichte aus, um das Spiel der gesellschaftlichen Hierarchien aufrechtzuerhalten, über dessen – zumindest scheinbare – Fortführung ich mir nach Luciens Hinscheiden das Hirn zermartern mußte. Lebend enthob er mich der unbilligen Verpflichtung; tot entzog er mir seine Unbildung, unerläßliches Bollwerk gegen den Argwohn der andern.
Ich fand die Lösung dank einem unsichtbaren Klingelknopf.
Eine mit einem Infrarot-Mechanismus verbundene Klingel kündigt mir hinfort an, wenn jemand die Eingangshalle betritt, und unterrichtet mich von seiner Anwesenheit, obschon uns eine beträchtliche Distanz trennt. Bei solchen Gelegenheiten halte ich mich nämlich im hinteren Zimmer auf, demjenigen, in dem ich den Großteil meiner freien Zeit verbringe, und wo ich, abgeschirmt gegen die Geräusche und Gerüche, die mir meine Stellung aufzwingt, nach meinem Herzen leben kann, ohne daß mir die für jeden Wachposten unabdinglichen Informationen entgehen: wer kommt herein, wer geht hinaus, mit wem und zu welcher Zeit.
So hörten die Hausbewohner beim Durchqueren der Eingangshalle die gedämpften Töne, an denen man erkennt, daß ein Fernseher läuft, und reimten sich, mehr aus Phantasiemangel denn aus Phantasieüberschuß, das Bild einer Concierge zusammen, die sich behaglich vor dem Gerät räkelt. Abgeschieden in meinem Refugium hörte ich nichts, erfuhr aber, wenn jemand vorbeiging. Im Nebenzimmer, verborgen hinter dem weißen Musselin, informierte ich mich alsdann durch das der Treppe gegenüberliegende Bullauge diskret über die Identität des Vorbeigehenden.
Das Aufkommen der Videokassetten und später der Gott DVD veränderten die Dinge noch radikaler in Richtung meiner Glückseligkeit. Da es nicht sehr üblich ist, daß eine Concierge sich an ›Tod in Venedig‹ delektiert oder daß aus der Loge Musik von Mahler dringt, habe ich tief in die so mühevoll zusammengebrachten ehelichen Ersparnisse gegriffen und ein weiteres Gerät erworben, das ich in meinem Versteck installierte. Während der Fernseher der Loge als Garant für mein klandestines Leben sinnloses Zeug für Molluskenhirne plärrte, ohne daß ich ihn hörte, schwelgte ich mit Tränen in den Augen in den Wundern der Kunst.
Tiefgründiger Gedanke Nr. 1
Die Sterne verfolgenUnd dann im GoldfischglasEnden
Von Zeit zu Zeit nehmen sich die Erwachsenen offenbar Zeit, sich hinzusetzen und die Katastrophe zu betrachten, die ihr Leben ist. Sie jammern dann, ohne zu verstehen, und wie Fliegen, die immer gegen die gleiche Scheibe stoßen, werden sie unruhig, sie leiden, verkümmern, sind deprimiert und fragen sich, welches Räderwerk sie dorthin geführt hat, wohin sie gar nicht wollten. Die intelligentesten machen sogar eine Religion daraus: ja, die verachtenswerte Leere der bürgerlichen Existenz! Es gibt Zyniker dieser Sorte, die an Papas Tisch speisen: »Unsere Jugendträume, wo sind sie geblieben?«, fragen sie mit ernüchterter und zufriedener Miene. »Sie sind verflogen, und das Leben ist ein Hundeleben.« Ich hasse diese falsche Klarsicht der Reife. In Wahrheit sind sie wie die anderen, Kinder, die nicht verstehen, was mit ihnen passiert ist, und die den Abgebrühten herauskehren, obschon sie eigentlich Lust haben zu weinen.
Dabei ist es ganz einfach zu verstehen. Was schiefläuft, ist, daß die Kinder an die Reden der Erwachsenen glauben und daß sie sich, wenn sie selbst erwachsen sind, rächen, indem sie ihre eigenen Kinder irreführen. »Das Leben hat einen Sinn, den die Erwachsenen gepachtet haben«, ist die universelle Lüge, an die alle glauben müssen. Wenn man im Erwachsenenalter merkt, daß das nicht stimmt, ist es zu spät. Das Rätsel bleibt bestehen, doch die ganze verfügbare Energie ist seit langem mit stupiden Aktivitäten verpufft. Es bleibt einem nur noch, sich so gut wie möglich zu betäuben, indem man versucht, vor sich selbst die Tatsache zu vertuschen, daß man in seinem Leben keinen Sinn sieht, und man macht seinen Kindern etwas vor im Versuch, sich selbst wirkungsvoller zu überzeugen.
Von den Personen, mit denen meine Familie Umgang pflegt, haben alle den gleichen Weg beschritten: eine Jugend, in der man seine Intelligenz gewinnbringend anzulegen versucht, in der man das Studienpotential wie eine Zitrone auspreßt und sich eine Spitzenposition sichert, und dann ein ganzes Leben, in dem man sich verblüfft fragt, warum derartige Hoffungen in einer so leeren Existenz gemündet haben. Die Leute meinen, sie verfolgen die Sterne, und dann enden sie wie Goldfische in einem Glas. Ich frage mich, ob es nicht einfacher wäre, den Kindern von Anfang an beizubringen, daß das Leben absurd ist. Das würde zwar die Kindheit um ein paar schöne Momente bringen, doch für den Erwachsenen wäre es ein beträchtlicher Zeitgewinn – ganz abgesehen davon, daß man sich mindestens ein Trauma ersparen würde, dasjenige des Goldfischglases.
Ich bin zwölf Jahre alt, ich wohne in der Rue de Grenelle 7 in einer Wohnung für Reiche. Meine Eltern sind reich, meine Familie ist reich, und meine Schwester und ich sind folglich potentiell reich. Mein Vater ist Abgeordneter, nachdem er Minister war, und er wird vermutlich als Präsident der Nationalversammlung enden und den Weinkeller des »Hôtel de Lassay« leeren. Meine Mutter … Nun, meine Mutter ist nicht gerade eine Leuchte, aber sie ist gebildet. Sie ist Doktor der Sprach- und Literaturwissenschaft. Sie schreibt die Einladungen für ihre Abendgesellschaften fehlerfrei und verbringt ihre Zeit damit, uns mit literarischen Verweisen auf die Nerven zu gehen (»Colombe, spiel nicht die Guermantes«, »Mäuschen, du bist eine echte Sanseverina«).
Trotz alldem, trotz dieses ganzen Glücks und dieses ganzen Reichtums, weiß ich schon lange, daß die Endstation das Goldfischglas ist. Warum ich das weiß? Der Zufall will, daß ich sehr intelligent bin. Außergewöhnlich intelligent sogar. Im Vergleich mit den Kindern meines Alters besteht ein Abgrund. Da ich keine große Lust habe, daß man auf mich aufmerksam wird, und da in einer Familie, in der die Intelligenz das Höchste ist, ein hochbegabtes Kind nie seine Ruhe hätte, versuche ich, meine Leistungen im Collège einzuschränken, doch selbst so bin ich immer noch Klassenbeste. Man könnte meinen, es sei ein leichtes, eine normale Intelligenz vorzuspielen, wenn man wie ich mit zwölf Jahren das Niveau einer Khâgneuse2 hat. Weit gefehlt! Man muß sich ganz schön anstrengen, um sich dümmer zu stellen, als man ist. Aber in gewisser Weise hindert es mich nicht daran, vor Langeweile umzukommen: Die ganze Zeit, die ich nicht damit zubringen muß, zu lernen und zu verstehen, verwende ich darauf, den Stil, die Antworten, die Vorgehensweisen, die Sorgen und die kleinen Fehler der normalguten Schüler nachzuahmen. Ich lese alles, was Constance Baret, die Zweite der Klasse, in Mathe, Französisch und Geschichte schreibt, und so lerne ich, was ich machen muß: in Französisch eine Folge von zusammenhängenden und richtig geschriebenen Wörtern, in Mathe die mechanische Wiedergabe von Operationen ohne Sinn und in Geschichte eine Folge von Tatsachen, die durch logische Elemente miteinander verbunden sind. Doch selbst verglichen mit den Erwachsenen bin ich viel schlauer als die meisten von ihnen. Das ist einfach so. Ich bin nicht sonderlich stolz darauf, denn es ist nicht mein Verdienst. Doch eines ist sicher, ins Goldfischglas gehe ich nicht. Das ist ein wohlüberlegter Entschluß. Selbst für jemanden, der so intelligent ist wie ich, so begabt fürs Lernen, so anders als die andern und den meisten auch so haushoch überlegen, ist das Leben schon vollständig vorgezeichnet, und es ist zum Weinen traurig: Niemand scheint an die Tatsache gedacht zu haben, daß, wenn die Existenz absurd ist, darin zu glänzen und Erfolg zu haben keinen höheren Wert hat, als darin zu scheitern. Es ist nur angenehmer. Wenn überhaupt: Ich glaube, der Scharfblick macht den Erfolg bitter, während die Mittelmäßigkeit immer noch auf etwas hoffen läßt.
Ich habe also meinen Entschluß gefaßt. Ich werde die Kindheit bald verlassen, und wenn ich auch genau weiß, daß das Leben eine Farce ist, glaube ich nicht, daß ich bis zum Schluß standhalten könnte. Im Grunde sind wir programmiert, an das zu glauben, was nicht existiert, weil wir Lebewesen sind, die nicht leiden wollen. So wenden wir unsere ganze Kraft auf, uns zu überzeugen, daß es Dinge gibt, die es wert sind, und daß das Leben daher einen Sinn hat. Ich mag noch so intelligent sein, ich weiß nicht, wie lange ich gegen diese biologische Tendenz werde ankämpfen können. Werde ich, wenn ich einmal in das Rennen der Erwachsenen eingestiegen bin, noch fähig sein, dem Gefühl der Absurdität die Stirn zu bieten? Ich glaube nicht. Daher habe ich meinen Entschluß gefaßt: Am Ende dieses Schuljahres, an meinem dreizehnten Geburtstag, am 16. Juni, werde ich Selbstmord begehen. Achtung, ich habe nicht vor, viel Aufhebens davon zu machen, als wäre es eine mutige Tat oder eine Herausforderung. Es liegt übrigens ganz in meinem Interesse, daß niemand Verdacht schöpft. Die Erwachsenen haben eine hysterische Beziehung zum Tod, das nimmt riesige Ausmaße an, man macht viel Theater darum, und dabei ist es doch das banalste Ereignis der Welt. Worauf es mir im Grunde ankommt, ist nicht die Sache an sich, sondern ihr Wie. Meine japanische Seite neigt natürlich zu Seppuku. Wenn ich sage meine japanische Seite, dann meine ich meine Liebe zu Japan. Ich bin in der vierten Klasse am Collège und habe natürlich Japanisch als zweite Sprache genommen. Der Japanischlehrer ist nicht gerade eine Offenbarung, er verschluckt die Wörter auf französisch und kratzt sich die ganze Zeit mit ratloser Miene den Kopf, aber wir haben ein Lehrbuch, das gar nicht so übel ist, und seit Beginn des Schuljahrs habe ich große Fortschritte gemacht. Ich hoffe, daß ich in ein paar Monaten meine Lieblingsmangas im Original lesen kann. Mama versteht nicht, daß ein so-begabtes-kleines-Mädchen-wie-du Mangas lesen kann. Ich habe mir nicht einmal die Mühe gemacht, ihr zu erklären, daß »Manga« auf japanisch lediglich »Comic« heißt. Sie glaubt, daß ich mich mit Subkultur vollsauge, und ich lasse sie in ihrem Glauben. Kurz, in ein paar Monaten kann ich Taniguchi vielleicht auf japanisch lesen. Doch das führt uns wieder zurück zur Sache: Es muß vor dem 16. Juni geschehen, denn am 16. Juni werde ich Selbstmord begehen. Aber kein Seppuku. Das wäre zwar voller Sinn und Schönheit, aber … nun … ich habe nicht die geringste Lust zu leiden. Ja, ich würde es geradezu verabscheuen zu leiden; ich finde, wenn man den Entschluß faßt zu sterben, gerade weil man der Meinung ist, daß es völlig normal ist, muß man das auf sanfte Art tun. Sterben soll ein behutsamer Übergang sein, ein gedämpftes Hinübergleiten in die Ruhe. Es gibt Leute, die begehen Selbstmord, indem sie sich aus dem Fenster des vierten Stocks stürzen oder Javelwasser trinken oder sich erhängen! Das ist völlig unsinnig! Ich finde es sogar obszön. Wozu dient sterben denn, wenn nicht dazu, nicht zu leiden? Ich habe meinen Abgang wohl geplant: Seit einem Jahr nehme ich jeden Monat eine Schlaftablette aus der Schachtel auf Mamas Nachttisch. Sie konsumiert so viele, daß sie es nicht einmal merken würde, wenn ich jeden Tag eine nähme, aber ich habe beschlossen, äußerst vorsichtig zu sein. Man soll nichts dem Zufall überlassen, wenn man einen Entschluß faßt, der wenig Aussichten hat, verstanden zu werden. Man macht sich keine Vorstellung, wie schnell die Leute die Pläne durchkreuzen, die einem am wichtigsten sind, im Namen von abgeschmackten Phrasen wie »der Sinn des Lebens« oder »die Liebe zum Menschen«. Ah ja, und dann: »die Heiligkeit der Kindheit«.
Ich gehe also ruhig auf das Datum des 16. Juni zu, und ich habe keine Angst. Es gibt höchstens ein paar Dinge, um die es mir leid tut, vielleicht. Aber so, wie die Welt ist, ist sie nicht für die Prinzessinnen gemacht. Doch nur weil man plant zu sterben, heißt das noch lange nicht, daß man dahinvegetieren soll wie ein schon angefaultes Gemüse. Ganz im Gegenteil. Wichtig ist nicht, daß man stirbt oder in welchem Alter man stirbt, sondern was man tut in dem Moment, wo man stirbt. Bei Taniguchi sterben die Helden beim Erklimmen des Everest. Da ich nicht die geringste Chance habe, mich vor dem 16. Juni am K2 oder an den Grandes Jorasses zu versuchen, ist mein persönlicher Everest eine intellektuelle Herausforderung. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, mir möglichst viele tiefgründige Gedanken zu machen und sie in dieses Heft zu schreiben: Wenn schon nichts einen Sinn hat, soll der Geist sich wenigstens damit auseinandersetzen, oder? Doch da ich eine ausgeprägte japanische Seite besitze, habe ich eine Beschränkung hinzugefügt: Der tiefgründige Gedanke muß in Form eines kleinen Gedichts nach japanischer Art abgefaßt sein: in Form eines Haiku (Dreizeiler) oder eines Tanka (Fünfzeiler).
Mein Lieblingshaiku stammt von Basho.
Hütten der Fischer Mit den Garnelen vermischt Grillen!
Das ist kein Goldfischglas, nein, das ist Poesie!
Doch in der Welt, in der ich lebe, gibt es weniger Poesie als in einer japanischen Fischerhütte. Finden Sie es normal, daß vier Personen auf vierhundert Quadratmetern leben, während ganz viele andere, und unter ihnen vielleicht verwünschte Poeten, nicht einmal eine anständige Unterkunft haben und zu fünfzehnt eingepfercht auf zwanzig Quadratmetern hausen? Als diesen Sommer in den Nachrichten kam, daß Afrikaner umgekommen sind, weil in ihrem baufälligen Haus ein Treppenbrand ausgebrochen war, hat mich das auf eine Idee gebracht. Leute wie sie haben ihr Goldfischglas den ganzen Tag direkt vor der Nase, sie können ihm nicht entfliehen, indem sie sich etwas vormachen. Meine Eltern und Colombe hingegen stellen sich vor, daß sie im Ozean schwimmen, weil sie in ihren mit Möbeln und Bildern angefüllten vierhundert Quadratmetern leben.
Und so will ich am 16. Juni ihr Sardinengedächtnis ein wenig auffrischen: Ich werde die Wohnung anzünden (mit Zündwürfeln für den Barbecue). Achtung, ich bin keine Kriminelle: Ich mache es, wenn niemand zu Hause ist (der 16. Juni ist ein Samstag, und am Samstag nachmittag geht Colombe zu Tibère, Mama ins Yoga, Papa in seinen Club, und ich bleibe da), ich werde die Katzen durchs Fenster evakuieren, und ich werde die Feuerwehr frühzeitig genug benachrichtigen, damit es keine Opfer gibt. Dann gehe ich in aller Ruhe mit meinen Schlaftabletten zu Oma schlafen.
Ohne Wohnung und ohne Tochter denken sie vielleicht an all die toten Afrikaner, oder?
Kamelien
1 Eine Aristokratin
Am Dienstag und Donnerstag kommt Manuela, meine einzige Freundin, in meine Loge zum Tee. Manuela ist eine einfache Frau, deren Eleganz die zwanzig Jahre, die sie damit vertan hat, bei anderen Leuten dem Staub nachzustellen, nichts anhaben konnten. Dem Staub nachstellen ist übrigens eine recht schamhafte Raffung. Doch bei den Reichen nennt man die Dinge nicht beim Namen.
»Ich leere Abfalleimer voll Damenbinden«, sagt sie mir mit ihrer weichen Aussprache voller Sch-Laute, »ich wische vom Hund das Erbrochene auf, ich putze den Vogelkäfig, man würde nicht glauben, daß so kleine Vögel so viel Kaka machen, ich scheure die Toiletten. Der Staub? Wenns weiter nichts ist!«
Man muß sich vergegenwärtigen, daß Manuela, wenn sie um zwei Uhr zu mir herunterkommt, am Dienstag von den Arthens, am Donnerstag von den de Broglies, mit dem Wattestäbchen das blattvergoldete Klo poliert hat, das dessen ungeachtet genauso schmutzig und stinkend ist wie alle Lokusse der Welt, denn wenn es etwas gibt, was die Reichen widerwillig mit den Armen teilen, dann sind es die ekelerregenden Gedärme, die das, was sie verpestet, schließlich immer irgendwo ausscheiden.
So kann man vor Manuela den Hut ziehen. Mag sie auch geopfert werden auf dem Altar einer Welt, in der die undankbaren Aufgaben gewissen Leuten zugedacht sind, während andere die Nase rümpfen, ohne etwas zu tun, so läßt sie sich gleichwohl nicht von einer Neigung zur Raffiniertheit abhalten, die bei weitem alle Blattvergoldungen übertrifft, erst recht die sanitären.
»Um eine Nuß zu essen, muß man ein Tischtuch auflegen«, sagt Manuela, die aus ihrer alten Einkaufstasche ein helles Holzkörbchen hervorholt, aus dem karminrote Seidenpapierspiralen hervorgucken und aus dem sie, eingebettet wie in einer Schatulle, ein paar Mandelplätzchen befreit. Ich mache einen Kaffee, den wir nicht trinken werden, dessen Duft wir jedoch beide leidenschaftlich lieben, und schweigend schlürfen wir eine Tasse Grüntee und knabbern unsere Plätzchen dazu.
So, wie ich ein ständiger Verrat meines Archetypen bin, ist Manuela, ohne es zu wissen, eine Renegatin der portugiesischen Putzfrau. Denn die Tochter aus Faro, unter einem Feigenbaum geboren, nach sieben anderen und vor sechs weiteren, schon früh aufs Feld geschickt und genauso rasch mit einem bald ausgewanderten Maurer verheiratet, Mutter von vier Kindern, die dem Recht des Bodens nach französisch, dem Blick der Gesellschaft nach jedoch portugiesisch sind, die Tochter aus Faro also, einschließlich schwarzer Stützstrümpfe und Kopftuch, ist eine Aristokratin, eine echte, eine große, von der Art, die keine Abrede duldet, da ihre Aristokratie, direkt aufs Herz geprägt, aller Etiketten und Prädikate spottet. Was ist eine Aristokratin? Eine Frau, der die Vulgarität nichts anhaben kann, obschon sie von ihr umgeben ist.
Die Vulgarität ihrer angeheirateten Familie, die den Schmerz, schwach und ohne Zukunft geboren zu sein, in lautem, ordinärem Lachen erstickt; die Vulgarität einer Umgebung, die von der gleichen fahlen Trostlosigkeit geprägt ist wie das Neonlicht der Fabrik, zu der sich die Männer jeden Morgen aufmachen, so, wie man in die Hölle hinuntersteigt; die Vulgarität der Arbeitgeberinnen, deren ganzes Geld nicht die Nichtswürdigkeit zu verbergen vermag und die mit ihr reden wie mit einem grindigen, haarenden Hund. Doch man muß gesehen haben, wie Manuela mir wie einer Königin die Früchte ihrer Feinbäckerkunst darbietet, um die ganze Anmut zu erfassen, die in dieser Frau wohnt. Ja, wie einer Königin. Wenn Manuela erscheint, verwandeln sich meine Loge in einen Palast und unsere Naschereien der Parias in den Festschmaus von Monarchen. So, wie der Märchendichter das Leben in einen schillernden Fluß verwandelt, in dem Kummer und Öde versinken, verzaubert Manuela unser Leben in ein freundliches, heiteres Epos.
»Der junge Pallières hat mich auf der Treppe gegrüßt«, sagt sie plötzlich in das Schweigen hinein.
Ich brumme verachtungsvoll.
»Er liest Marx«, sage ich und zucke die Schultern.
»Marx?«, fragt sie, wobei sie das »X« wie ein »Sch« ausspricht, ein leicht feuchtes »Sch«, dem der Charme des klaren Himmels anhaftet.
»Den Vater des Kommunismus«, antworte ich.
Manuela stößt ein geringschätziges Geräusch aus.
»Die Politik«, sagt sie. »Ein Spielzeug für die kleinen Reichen, das sie niemandem ausleihen.«
Sie überlegt einen Moment mit gerunzelter Stirn.
»Nicht die gleiche Sorte Bücher wie sonst«, sagt sie.
Die Illustrierten, die die Jugendlichen unter ihrer Matratze versteckt halten, entgehen Manuelas Scharfblick nicht, und der junge Pallières schien eine Zeitlang eifrigen, wenn auch selektiven Gebrauch von ihnen zu machen, wie eine abgegriffene Seite mit dem unzweideutigen Titel »Die schalkhaften Marquisen« bewies.
Wir lachen und plaudern noch eine Weile über dieses und jenes, in der Seelenruhe alter Freundschaften. Diese Augenblicke sind mir teuer, und es schnürt mir das Herz zusammen, wenn ich an den Tag denke, da Manuela ihren Traum verwirklichen und für immer in ihr Land zurückkehren wird und mich hier zurückläßt, einsam und hinfällig, ohne Gefährtin, die zweimal die Woche eine geheime Königin aus mir macht. Ich frage mich auch mit Besorgnis, was geschehen wird, wenn die einzige Freundin, die ich je hatte, und die einzige, die alles weiß, ohne je etwas gefragt zu haben, eine von allen verkannte Frau hinter sich läßt und diese mit ihrem Weggang in ein Leichentuch des Vergessens hüllt.
Schritte ertönen in der Eingangshalle, und dann hören wir deutlich das sybillinische Geräusch, das die Hand eines Mannes auf dem Knopf des Aufzugs macht, eines alten Aufzugs mit schwarzem Gitter und Pendeltüren, verkleidet mit Polster und Holz, in dem, wäre Platz dafür gewesen, früher ein Groom gestanden hätte. Ich kenne diesen Schritt; es ist der von Pierre Arthens, dem Gastronomiekritiker vom vierten Stock, einem Oligarchen der schlimmsten Sorte, der, aus der Art zu schließen, wie er die Augen zusammenkneift, wenn er auf der Schwelle meiner Behausung steht, wohl glaubt, daß ich in einer dunklen Höhle lebe, obschon ihn das, was er sieht, das Gegenteil lehrt.
Nun, ich habe sie gelesen, seine berühmten Kritiken.
»Davon verstehe ich nichts«, hat Manuela zu mir gesagt, für die ein guter Braten ein guter Braten ist und Schluß.
Da gibt es nichts zu verstehen. Es ist ein Jammer zu sehen, wie eine solche Feder aus lauter Blindheit vergeudet wird. In einer sprühenden Erzählweise – denn Pierre Arthens schreibt seine Kritiken, wie man eine Geschichte erzählt, und das allein hätte aus ihm ein Genie machen sollen – über eine Tomate zu schreiben, ohne die Tomate je zu sehen oder zu erfassen, ist ein gar klägliches Bravourstück. Kann man so begabt sein und gleichzeitig so blind, was die Ausstrahlungskraft der Dinge angeht?, habe ich mich oft gefragt, wenn ich ihn mit seiner großen, arroganten Nase an mir vorbeigehen sah. Es scheint so. Gewisse Leute sind unfähig zu erfassen, was das wahre Leben und der eigentliche Odem dessen ist, was sie betrachten, und verbringen eine ganze Existenz damit, über die Menschen zu harangieren, als wären es Automaten, und über die Dinge, als hätten sie keine Seele und ließen sich zusammenfassen in dem, was im Laufe von subjektiven Einfällen über sie gesagt werden kann.
Wie angezogen durch meine Gedanken, kehren die Schritte zurück, und Arthens klingelt an der Loge.
Ich stehe auf und achte darauf, mit den Füßen zu schlurfen, die in so standesgemäßen Hausschuhen stecken, daß einzig die Allianz von Baguette und Béret es in Sachen gängiger Klischees mit ihnen aufnehmen könnte. Ich weiß sehr wohl, daß ich damit den Meister, diese lebende Ode an die Ungeduld der großen Raubtiere, aufs äußerste reize, und das trägt bei zum Eifer, mit dem ich die Türe ganz langsam einen Spalt weit öffne, um eine Nase hinauszustrecken, die, so hoffe ich, rot ist und glänzt.
»Ich erwarte ein Paket vom Boten«, sagt er zu mir, Augen und Nasenlöcher zusammengekniffen. »Könnten Sie es mir sofort bringen, wenn es kommt?«
Heute nachmittag trägt Monsieur Arthens eine locker gebundene, getüpfelte Künstlerschleife, die um seinen Hals eines Adligen wallt und ihm überhaupt nicht steht, weil die Üppigkeit seiner Löwenmähne und die ätherische Bauschigkeit des Seidenstücks in ihrer Verbindung eine Art duftigen Tutu bilden, in dem die Virilität untergeht, mit welcher der Mann sich zu schmücken pflegt. Und Teufel, diese Künstlerschleife erinnert mich an etwas. Ich lächle beinahe, als es mir einfällt. Es ist diejenige von Legrandin. In ›Auf der Suche nach der verlorenen Zeit‹, dem Werk eines gewissen Marcel, eines anderen notorischen Conciergen, ist Legrandin ein Snob, der hin- und hergerissen wird zwischen zwei Welten, der Welt, in der er verkehrt, und derjenigen, zu der er sich Zutritt verschaffen möchte, ein pathetischer Snob, dessen Künstlerschleife von der Hoffnung bis zur Bitterkeit und von der Unterwürfigkeit bis zur Verachtung die intimsten Schwankungen des Trägers ausdrückt. So überläßt er es auf der Place de Combray, da er die Eltern des Erzählers nicht zu grüßen wünscht, aber dennoch an ihnen vorbeigehen muß, dem Schal, indem er ihn im Wind fliegen läßt, eine melancholische Stimmung anzuzeigen, die ihn der üblichen Grußworte enthebt.
Pierre Arthens, der seinen Proust kennt, den Conciergen gegenüber jedoch keinerlei besondere Nachsicht daraus geschöpft hat, räuspert sich ungeduldig.
Ich rufe Ihnen seine Frage in Erinnerung:
»Könnten Sie es mir sofort bringen?« (Das Paket vom Boten – die Pakete der Reichen nehmen nicht den üblichen Postweg.)
»Ja«, sage ich und schlage den Rekord der Knappheit, dazu ermutigt durch die seine sowie durch das Fehlen eines Bitteschön, was die Frageform im Konditional meiner Meinung nach nicht ganz zu entschuldigen vermag.
»Es ist äußerst zerbrechlich«, fügt er hinzu, »haben Sie die Güte und geben Sie acht«.
Die Verbindung des Imperativs und des »Haben Sie die Güte« ist auch nicht dazu angetan, mir zu gefallen, um so mehr, als er mich solcher syntaktischer Subtilitäten für unfähig hält und sie nur aus geschmäcklerischer Manier verwendet, ohne die Höflichkeit zu vermuten, daß ich mich dadurch beleidigt fühlen könnte. Es heißt, den Grund des sozialen Sumpfs zu berühren, wenn man aus der Stimme eines Reichen heraushört, daß er sich nur an sein eigenes Ego wendet und, obschon die Wörter, die er ausspricht, technisch gesehen einem selbst gelten, gar nicht auf die Idee kommt, daß man sie verstehen könnte. »Wie zerbrechlich?«, frage ich also in einem wenig gewinnenden Ton.
Er seufzt ostentativ, und ich nehme in seinem Atem eine ganz leichte Note von Ingwer wahr.
»Es handelt sich um eine Inkunabel«, sagt er zu mir und durchbohrt meine Augen, die ich glasig werden zu lassen versuche, mit seinem Blick des stolzen Besitzers.
»Na dann, viel Vergnügen«, sage ich und setze eine angewiderte Miene auf. »Ich bringe es Ihnen, sobald der Bote da ist.«
Und ich schlage ihm die Tür vor der Nase zu.
Die Aussicht, daß Pierre Arthens heute abend an seiner Tafel als Bonmot die Entrüstung seiner Concierge zum besten gibt, weil er vor ihr eine Inkunabel erwähnt und sie vermutlich etwas Anstößiges darin gesehen hat, erheitert mich außerordentlich.
Gott weiß genau, wer von uns beiden sich mehr erniedrigt.
Tagebuch der Bewegung der Welt Nr.1
In sich gesammelt bleiben Ohne seine Shorts zu verlieren
Es ist sehr gut, regelmäßig einen tiefgründigen Gedanken zu haben, aber ich denke, das genügt nicht. Also, ich will sagen: Ich werde in ein paar Monaten Selbstmord begehen und das Haus anzünden, und so kann ich natürlich nicht davon ausgehen, daß ich Zeit habe, ich muß in der Frist, die mir bleibt, etwas Handfestes tun. Und vor allem habe ich mich einer kleinen Herausforderung gestellt: Wenn man Selbstmord begeht, muß man sicher sein, was man tut, und man kann die Wohnung nicht »für die Katz« anzünden. Wenn es also auf dieser Welt etwas gibt, das es wert ist zu leben, darf ich es nicht verpassen, denn wenn man einmal tot ist, ist es zu spät zur Reue, und zu sterben, weil man sich getäuscht hat, ist wirklich zu dumm.
Also, natürlich habe ich meine tiefgründigen Gedanken. Aber in meinen tiefgründigen Gedanken spiele ich schließlich die, die ich bin, nicht wahr, eine Intellektuelle (die sich über die anderen Intellektuellen lustig macht). Nicht immer sehr glorreich, aber sehr unterhaltend. Ich habe mir also gedacht, daß man diesen Aspekt »Ruhm des Geistes« mit einem anderen Tagebuch ausgleichen müßte, in dem vom Körper oder den Dingen die Rede wäre. Nicht die tiefgründigen Gedanken des Geistes, sondern die Meisterwerke der Materie. Etwas Körperliches, Greifbares. Aber auch etwas Schönes oder Ästhetisches. Außer der Liebe, der Freundschaft und der Schönheit der Kunst sehe ich nicht viel anderes, was das menschliche Leben nähren könnte. Die Liebe und die Freundschaft, da bin ich noch zu jung, um wirklich Anspruch darauf zu erheben. Aber die Kunst … wenn ich hätte leben sollen, wäre sie mein ganzes Leben gewesen. Also, wenn ich sage die Kunst, muß man mich recht verstehen: Ich spreche nicht nur von den Meisterwerken der Großen. Nicht einmal für Vermeer hänge ich am Leben. Das alles ist erhaben, aber es ist tot. Nein, ich denke an die Schönheit in der Welt, an das, was uns in der Bewegung des Lebens erheben kann. Das ›Tagebuch der Bewegung der Welt‹ wird also der Bewegung der Leute, der Körper oder, wenn es wirklich nichts zu sagen gibt, sogar der Dinge gewidmet sein, um darin etwas zu finden, was genügend ästhetisch ist, um dem Leben einen Wert zu geben. Anmut, Schönheit, Harmonie, Intensität. Wenn ich etwas finde, werde ich den Entschluß vielleicht nochmals überdenken: Wenn ich in Ermangelung eines schönen Gedankens für den Geist eine schöne Bewegung des Körpers finde, dann werde ich vielleicht denken, daß das Leben lebenswert ist.
In Wirklichkeit ist mir die Idee eines doppelten Tagebuchs (eines für den Geist, das andere für den Körper) gestern gekommen, weil Papa im Fernsehen ein Rugbymatch anschaute. Bisher schaute ich in solchen Fällen vor allem Papa an. Ich mag es, ihn anzusehen, wenn er die Hemdsärmel hochgekrempelt und die Schuhe ausgezogen hat und es sich auf dem Sofa bequem macht, mit einem Bier und Wurst, und wenn er das Match anschaut und vermittelt: »Seht nur, welcher Mann ich auch sein kann.« Es kommt ihm natürlich nicht in den Sinn, daß ein Stereotyp (sehr seriöser Herr Minister der Republik) plus ein anderes Stereotyp (netter Kerl dazu, der kaltes Bier mag) ein Stereotyp hoch zwei ergibt. Kurz, am Samstag ist Papa früher als sonst nach Hause gekommen, hat seine Mappe hingeschmissen, die Schuhe ausgezogen, die Hemdsärmel hochgekrempelt, in der Küche ein Bier geholt und sich in einen Sessel vor dem Fernseher sinken lassen, worauf er zu mir gesagt hat: »Bring mir bitte ein bißchen Wurst, mein Spatz, ich möchte den Haka nicht verpassen.« Den Haka verpassen, von wegen! Ich hatte reichlich Zeit, die Wurst in Scheiben zu schneiden und sie ihm zu bringen, und noch immer kam Werbung. Mama saß in prekärem Gleichgewicht auf einer Armlehne des Sofas, um deutlich zu machen, daß sie nichts mit der Sache anfangen konnte (von der stereotypen Familie möchte ich bitte die Karte der Betschwester-Linksintellektuellen), und lag Papa mit einer komplizierten Geschichte eines Abendessens in den Ohren, in der es darum ging, zwei zerstrittene Paare einzuladen, um sie wieder zu versöhnen. Wenn man Mamas psychologische Subtilität kennt, kann einen das Vorhaben zum Lachen bringen. Kurz, ich habe Papa seine Wurst gebracht, und da ich wußte, daß Colombe in ihrem Zimmer war und angeblich aufgeklärte Musik aus dem 5. Arrondissement hörte, habe ich mir gesagt: Na ja, warum auch nicht, sehen wir uns einen kleinen Haka an. In meiner Erinnerung war der Haka ein leicht grotesker Tanz, den die Spieler der neuseeländischen Mannschaft vor dem Match aufführen. So eine Art Einschüchterungsgehabe wie bei den großen Affen. Ebenso ist in meiner Erinnerung das Rugby ein plumpes Spiel, mit Burschen, die sich dauernd ins Gras werfen und wieder aufstehen, um ein paar Schritte weiter erneut hinzufallen und sich ineinander zu verkeilen.
Die Werbung ist schließlich zu Ende gegangen, und nach einem Vorspann mit lauter auf dem Rasen hingelümmelten dicken Kerlen kam das Stadion mit der Offstimme der Kommentatoren ins Bild und dann eine Großaufnahme der Kommentatoren (Sklaven des Eintopfs) und dann wieder das Stadion. Die Spieler erschienen auf dem Spielfeld, und da hat es mich langsam gepackt. Ich habe am Anfang nicht recht verstanden, es waren die gleichen Bilder wie sonst, aber sie hatten eine neue Wirkung auf mich, es war wie eine Art Prickeln, eine Erwartung, ein »Ich-halte-den-Atem-an«. Papa, der neben mir saß, hatte schon sein erstes Bier gekippt und schickte sich an, in der deftigen Manier fortzufahren, indem er Mama, die eben von ihrer Armlehne herabgestiegen war, bat, ihm ein neues zu bringen. Ich hielt den Atem an. Was ist los?, fragte ich mich, während ich auf den Bildschirm schaute und nicht wußte, was ich sah und was mir ein solches Prickeln verursachte.
Ich habe es begriffen, als die neuseeländischen Spieler mit ihrem Haka begannen. Unter ihnen war ein sehr großer Maori, ein ganz junger. An ihm war mein Blick von Anfang an hängengeblieben, zunächst vermutlich wegen seiner Größe, aber dann wegen seiner Art, sich zu bewegen. Eine äußerst merkwürdige Art von Bewegung, sehr flüssig, aber vor allem sehr konzentriert, das heißt sehr auf sich selbst konzentriert. Wenn sich die Leute bewegen, bewegen sich die meisten von ihnen in Abhängigkeit von dem, was um sie herum ist. Genau in dem Moment, da ich das schreibe, kommt Constitution vorbei, mit dem Bauch, der am Boden nachschleift. Diese Katze hat keinen festen Plan im Leben, und doch geht sie auf etwas zu, einen Sessel vermutlich. Und das sieht man an ihrer Art, sich zu bewegen: Sie geht auf etwas zu. Mama ging eben vorbei in Richtung Eingangstür, sie geht einkaufen, und tatsächlich ist sie schon draußen, ihre Bewegung nimmt sich selbst vorweg. Ich weiß nicht genau, wie ich es erklären soll, aber wenn wir uns fortbewegen, werden wir durch diese Bewegung auf etwas zu gewissermaßen aufgelöst: Man ist gleichzeitig da und wiederum nicht da, weil man schon dabei ist, anderswohin zu gehen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Wenn man sich nicht weiter auflösen will, darf man sich überhaupt nicht mehr bewegen. Entweder du bewegst dich und bist nicht mehr ganz oder du bist ganz und kannst dich nicht mehr bewegen. Doch schon als ich ihn aufs Spielfeld kommen sah, hatte ich bei diesem Spieler etwas anderes gespürt. Das Gefühl zu sehen, wie er sich bewegte, ja, aber daß er gleichzeitig stehenblieb. Verrückt, wie? Als der Haka begann, habe ich vor allem ihm zugeschaut. Es war klar, daß er nicht wie die anderen war. Übrigens hat Eintopf Nr. 1 gesagt: »Und Somu, der gefährliche Schlußspieler der Neuseeländer, beeindruckt uns immer wieder gleichermaßen durch seine hünenhafte Gestalt. Zwei Meter null sieben, hundertachtzehn Kilo, elf Sekunden auf hundert Meter, ein schönes Baby, wahrhaftig, Madame!« Alle waren wie hypnotisiert von ihm, aber niemand schien wirklich zu wissen warum. Dabei ist es während dem Haka ganz offenkundig geworden: Er bewegte sich, er machte die gleichen Bewegungen wie die anderen (sich mit den Handflächen auf die Schenkel schlagen, rhythmisch auf den Boden hämmern, die Ellbogen berühren und dabei die ganze Zeit dem Gegner mit der Miene eines gereizten Kriegers in die Augen sehen), doch während die Bewegungen der anderen auf ihre Gegner ausgerichtet waren und auf das ganze Stadion, das ihnen zuschaute, blieben die Bewegungen dieses Spielers auf ihn selbst gerichtet, blieben konzentriert auf ihn, und das verlieh ihm eine unglaubliche Präsenz und Intensität. Daraus bezog der Haka, der ein Kriegsgesang ist, seine ganze Kraft. Was die Kraft des Soldaten ausmacht, ist nicht die Energie, die er aufbietet, um den anderen einzuschüchtern, indem er ihm jede Menge Signale übermittelt, sondern die Kraft, die er in sich zu konzentrieren vermag, während er ganz bei sich selbst bleibt. Der Maori-Spieler wurde zu einem Baum, zu einer großen, unzerstörbaren Eiche mit tiefen Wurzeln, mit einer mächtigen Ausstrahlung, und alle spürten es. Und doch hatte man die Gewißheit, daß die große Eiche Somu auch fliegen konnte, daß sie genauso schnell wäre wie der Wind, trotz oder dank ihrer großen Wurzeln.
Ich habe das Match daraufhin sehr aufmerksam angeschaut, wobei ich immer das gleiche suchte: verdichtete Momente, in denen ein Spieler zu seiner eigenen Bewegung wurde, ohne sich auflösen zu müssen, indem er auf etwas zu ging. Und ich habe solche Momente gesehen! In allen Spielphasen habe ich sie gesehen: im Gedränge, mit einem deutlich erkennbaren Zentrum, einen Spieler, der zu seinen Wurzeln fand und zu einem soliden kleinen Anker wurde, welcher der Gruppe seine Kraft gab; in den Entwicklungsphasen, mit einem Spieler, der die richtige Geschwindigkeit fand, indem er nicht länger ans Ziel dachte, sondern sich auf seine eigene Bewegung konzentrierte, und der wie im Stand der Gnade lief, mit dem Ball dicht am Körper; in der Trance der Torjäger, die sich vom Rest der Welt absonderten, um die perfekte Bewegung des Fußes zu finden. Doch keiner erreichte die Perfektion des großen Maori-Spielers. Als dieser den ersten neuseeländischen Versuch erzielte, ist Papa mit offenem Mund ganz benommen dagesessen und hat sein Bier vergessen. Er hätte ärgerlich sein müssen, weil er doch die französische Mannschaft unterstützte, doch statt dessen sagte er: »Was für ein Spieler!«, während er sich mit einer Hand über die Stirne fuhr. Die Kommentatoren hatten eine leicht trockene Kehle, aber sie konnten nicht verbergen, daß man da wirklich etwas Schönes gesehen hatte: einen Spieler, der lief, ohne sich zu bewegen, und der dabei alle hinter sich ließ. Es waren die anderen, die wilde und ungeschickte Bewegungen zu machen schienen und die trotzdem unfähig waren, ihn einzuholen.
Da habe ich mir gesagt: Siehe da, ich war fähig, unbewegte Bewegungen in der Welt zu erkennen; lohnt es sich, dafür weiterzumachen? In diesem Moment hat ein französischer Spieler in einem sogenannten Paket seine Shorts verloren, und plötzlich fühlte ich mich völlig deprimiert, weil dabei alle Tränen lachten, einschließlich Papa, der sich ein weiteres kleines Bier genehmigte, und das trotz zwei Jahrhunderten Protestantismus in der Familie. Für mich war es wie eine Entwürdigung.
Das heißt also nein, es reicht nicht. Es würde schon andere Bewegungen brauchen, um mich zu überzeugen. Aber zumindest hat es mich auf den Gedanken gebracht.
2 Von Kriegen und Kolonien
Ich habe nicht studiert, sagte ich als Einleitung zu diesen Zeilen. Das stimmt nicht ganz. Doch meine jugendliche Lernzeit endete mit dem Volksschulabschluß, vor dem ich darauf geachtet hatte, daß man nicht auf mich aufmerksam wurde – geängstigt durch den Verdacht, den Monsieur Servant, der Lehrer, hegte, wie ich wußte, seit er mich ertappt hatte, als ich, noch keine zehn Jahre alt, gierig seine Zeitung verschlang, in der nur von Kriegen und Kolonien die Rede war.
Warum? Meinen Sie wirklich, es hätte anders kommen können? Ich weiß es nicht. Diese Frage ist etwas für die Seher vergangener Zeiten. Sagen wir, daß mich der Gedanke, in einer Welt von Wohlhabenden zu kämpfen, ich, das mittellose Mädchen ohne Schönheit und ohne Reiz, ohne Vergangenheit und ohne Ehrgeiz, ohne Lebensart und ohne Glanz, ermüdet hat, bevor ich es auch nur versucht hatte. Ich wünschte mir nur eines: daß man mich in Ruhe lasse, ohne allzuviel von mir zu verlangen, und daß mir ein paar Augenblicke pro Tag die Freiheit vergönnt sei, meinen Hunger zu stillen.
Dem, der den Appetit nicht kennt, erscheint das erste Nagen des Hungers wie ein Schmerz und eine Erleuchtung zugleich. Ich war ein apathisches und nahezu verkrüppeltes Kind, mit einem Rücken so krumm, daß er fast einem Buckel glich, und das dem Leben nur durch die Unkenntnis standhielt, daß es einen anderen Weg geben könnte. Meine Interesse- und Lustlosigkeit war fast grenzenlos; nichts sprach mich an, nichts regte mich an, und wie ein schwacher Strohhalm im unergründlichen Spiel der Wellen kannte ich nicht einmal den Wunsch, dem ein Ende zu setzen.
Bei uns zu Hause wurde nicht geredet. Die Kinder schrien, und die Erwachsenen gingen ihren Beschäftigungen nach, wie sie es in der Einsamkeit getan hätten. Wir aßen uns satt, wenn die Kost auch einfach war, wir wurden nicht mißhandelt, und unsere Armeleutekleider waren sauber, so daß wir, mochten wir uns ihrer auch schämen, nicht unter der Kälte litten. Aber wir sprachen nicht miteinander.
Die Offenbarung fand statt, als ich mit fünf Jahren zum ersten Mal zur Schule ging und die Überraschung und den Schrecken erlebte, eine Stimme zu hören, die sich an mich richtete und meinen Vornamen aussprach.
»Renée?«, fragte die Stimme, während ich eine freundliche Hand spürte, die sich auf die meine legte.
Es war im Korridor, wo man die Kinder, für den ersten Schultag und weil es regnete, zusammengepfercht hatte.
»Renée?«, modulierte die Stimme, die von oben kam, und die freundliche Hand fuhr fort, meinen Arm in einer mir unverständlichen Sprache leicht und zärtlich zu drücken.
Ich hob den Kopf, in einer ungewohnten Bewegung, die mich fast schwindlig machte, und begegnete einem Blick.
Renée. Es handelte sich um mich. Zum ersten Mal wandte sich jemand mit meinem Vornamen an mich. Dort, wo meine Eltern Gesten oder Brummen gebrauchten, bahnte sich eine Frau, deren helle Augen und lächelnden Mund ich jetzt betrachtete, einen Weg zu meinem Herzen, und indem sie meinen Namen aussprach, trat sie in eine Nähe zu mir, die ich mir bis dahin nicht einmal hatte vorstellen können. Ich schaute um mich herum auf eine Welt, die plötzlich in Farben getaucht war. In einem schmerzhaften Aufblitzen nahm ich den Regen wahr, der draußen fiel, die Fenster, an denen das Wasser herunterlief, den Geruch der nassen Kleider, die Enge des Korridors, ein dünner Schlauch, in dem die Kinderschar vibrierte, die Patina der Garderobe mit den Messingknöpfen, an denen übereinandergeschichtet Pelerinen aus schlechtem Tuch aufgehängt waren – und die Höhe der Decken, so hoch wie der Himmel für einen Kinderblick.
Meine trübsinnigen Augen auf die ihren gerichtet, klammerte ich mich an die Frau, die mir eben zur Geburt verholfen hatte.
»Renée«, hob die Stimme wieder an, »willst du deine Jacke ausziehen?«
Und mit festem Griff, damit ich nicht hinfiel, zog sie mich mit der Flinkheit langer Erfahrung aus.
Man glaubt zu Unrecht, daß das Erwachen des Bewußtseins mit der Stunde unserer ersten Geburt zusammenfällt, vielleicht deshalb, weil wir uns keinen anderen Zustand des Lebendigseins als diesen vorzustellen vermögen. Uns scheint, daß wir immer gesehen und gefühlt haben, und aufgrund dieses Glaubens betrachten wir die Geburt als den entscheidenden Moment, in dem auch das Bewußtsein geboren wird. Daß ein kleines Mädchen namens Renée, ein funktionstüchtiger perzeptiver Mechanismus, ausgestattet mit dem Sehvermögen, dem Hörvermögen, dem Geruchssinn, dem Geschmacks- und dem Tastsinn, fünf Jahre lang in der völligen Unbewußtheit seiner selbst und des Universums leben konnte, widerlegt diese vorschnelle Theorie. Denn damit das Bewußtsein entstehen kann, braucht es einen Namen.