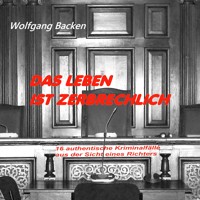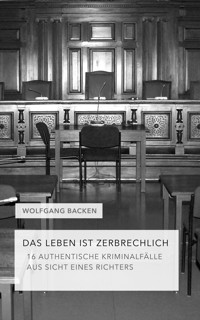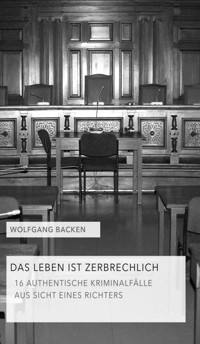
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch ist von dem ehemaligen Strafrichter Wolfgang Backen geschrieben, der viele Jahre u.a. über Totschläger sowie Mörder geurteilt hat und der dabei zwangsläufig immer wieder in menschliche Abgründe blicken musste. Dabei begegneten dem Juristen höchst unterschiedliche Charaktere und äußerst facettenreiche Verbrechen. Anhand der hier geschilderten 16 Fälle werden verschiedene Straftaten und Täter portraitiert. Erklärt wird, wie ein Schwurgericht auf die Besonderheiten der Täter und ihrer Taten reagiert. Bei jeder Entscheidung über die Schuld und die Sanktion trägt das Gericht eine hohe Verantwortung, denn ein Urteil ist ein sehr nachhaltiger Eingriff in das Leben eines Menschen. Eine lebenslange Strafe oder eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus bedeutet das Aus von Freiheit und Selbstbestimmung. Der Autor möchte seine Leserinnen und Leser an seinen Erinnerungen teilhaben lassen. Mögen diese selbst einen Blick auf die Menschen, denen schwerste Verbrechen zur Last gelegt wurden, und die anschließenden Urteile werfen und sich eine eigene Meinung über Gerechtigkeit und Sühne bilden. Der Autor zeigt, nach welchen Kriterien ein Gericht urteilt und bestraft und auf welche Schwierigkeiten es dabei stößt. In seinem Buch beschreibt der Autor Wolfgang Backen, ein ehemaliger Strafrichter, 16 authentische Kapitalverbrechen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
© 2021 Wolfgang Backen
Umschlaggestaltung: Tobias Backen
Fotos: Wolfgang Backen, dpa
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-32897-6
e-Book:
978-3-347-32899-0
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Wolfgang Backen
Das Leben ist zerbrechlich
16 authentische Kriminalfälle aus Sicht eines Richters
Dieses Buch ist den vielen Opfern von Gewaltverbrechen gewidmet
Inhalt
Prolog
16 Jahre unschuldig in Santa Fu
Der grausame Dealer
Späte Gerechtigkeit
Zerstörende Eifersucht
Der Ehrenmord
Das Kind, das seine Mutter sterben sah
Die letzte Fahrt des Taxifahrers
Der kranke Sadist
Der verzweifelte Pensionär
Am Ende eines schönen Tages
Blutige Hochzeit
Die Macht der Drogen
Die Leichensägerin
Lebendig verwest
Die Hinrichtung
Für etwas Geld
Prolog
Dies ist kein Roman. Dieses Buch hat nichts mit den mehr oder weniger an der Wirklichkeit orientierten Kriminalromanen oder Kriminalfilmen zu tun, die spannende Unterhaltung bieten wollen. Den Trost, dass Grausamkeit und Tote nur erfunden seien, kann ich Ihnen leider nicht spenden. Die hier zusammengestellten Fälle haben sich alle so tatsächlich abgespielt. Vielleicht wird der eine oder andere das Buch schnell wieder aus der Hand legen, weil er angewidert denkt, der Verfasser habe eine zu schmutzige Fantasie, so etwas könne unmöglich geschehen sein, denn so böse könne keiner handeln. Leider weit gefehlt! Der Mensch kann zu Unvorstellbarem fähig sein, wenn er Gelegenheit dazu bekommt und entsprechende Anlagen hat. Beispiele in der Geschichte gibt es davon genug. Die Motive sind vielseitig, und es sind keineswegs immer nur die psychisch kranken Mitmenschen, die widerliche Straftaten begehen.
Die folgenden sechzehn Fälle demonstrieren beispielhaft die große Bandbreite menschlicher Schwächen und Abgründe. Ich begegnete im Laufe meiner Tätigkeit als Strafrichter aber nicht nur hart gesottenen Tätern, sondern auch vielen geistig Kranken, Bemitleidenswerten und auch Unschuldigen. So tötete ein Pensionär seine Frau aus lauter Verzweiflung (s. Fall 9) und ein junger Mann saß 16 Jahre lang im Gefängnis, obgleich er die ihm vorgeworfene Straftat gar nicht begangen hatte (dazu Fall 1). Justizirrtum. Lebenszeit, die nie mehr zurückgeholt werden kann. Trotz aller Sorgfalt und Bemühungen der Polizei und Justiz kommt es bedauerlicherweise auch in einem Rechtsstaat hin und wieder zu solchen Fehlurteilen. Ein Super-GAU für die Betroffenen, in deren Leben durch ein derartiges Urteil fatal eingegriffen wird.
Ich möchte den Lesern Einblicke in die Tätigkeit eines Strafrichters verschaffen, die ich viele Jahre lang ausgeübt habe, und den Leser mit in eine Welt nehmen, die vielen fremd sein dürfte.
Wie bin ich zu diesem Beruf gekommen? Die Wurzeln dafür sind in meiner Familie zu suchen. Mein Vater Heinrich Backen war in Hamburg Staatsanwalt, Zivil – und Strafrichter, dann Vizepräsident des Amtsgerichts und beendete seine Karriere mit 65 Jahren 1985 als Generalstaatsanwalt in Hamburg. Natürlich erzählte er oft über die Fälle, die ihn gerade beschäftigten, wenn unsere Familie beim Essen zusammensaß. Manchmal nahm er uns Kinder mit ins Gericht. Mir erschien seine Tätigkeit – abgesehen von den eher langweiligen Ehescheidungen - spannend und interessant, sodass ich mich nach dem Abitur 1970 zum Jurastudium entschloss. Ich wollte unbedingt Richter werden.
Abgesehen vom Vorbild meines Vaters hatte auch die damalige Zeitströmung einen nicht unerheblichen Einfluss auf meine Berufswahl. Es herrschte an den Schulen und Universitäten der Geist der „Achtundsechziger“, repräsentiert durch politisch deutlich nach links tendierende Schüler und Studenten, die das Streben ihrer aus der Kriegsgeneration stammenden Eltern nach Bequemlichkeit und Wohlstand abgrundtief verachteten und andere Ideale zum Maß aller Dinge machten, um sich von ihren spießigen Eltern, Lehrern und Professoren strikt abzugrenzen. Die Bewegung wurde wohlwollend von großen Teilen der Presse begleitet. Wir wollten unser Land formen und hielten uns angesichts der im „Dritten Reich“ begangenen Gräueltaten für die moralisch besseren Menschen. Das war natürlich naiv, weil wir unter ganz anderen Verhältnissen aufgewachsen waren und keiner unsere Einstellung je ernsthaft auf die Probe stellte.
Ich war zwar eher konservativ ausgerichtet, fand aber wie viele der idealistisch geprägten Studenten, dass jeder etwas zum Bestand, zur Weiterentwicklung und Optimierung der demokratischen Gesellschaft beitragen müsse und ein Beruf nicht nur dem Geldverdienen dienen dürfe. Eine unabhängige Rechtsprechung im Rahmen der Gewaltenteilung war mir wichtig.
Es gelang mir tatsächlich nach vielen, meistens praxisfernen Vorlesungen an der Universität sowie nach zweijährigem Referendariat und zwei nervenaufreibenden Staatsexamen 1979 eine Stelle als Richter beim Landgericht Hamburg zu ergattern. Bis 2016 arbeitete ich dort hauptsächlich als Strafrichter. Zunächst als beisitzender Richter, später als Vorsitzender Richter u. a. in Strafvollstreckungs-, Jugend- und Schwurgerichtskammern.
Die hier geschilderten 16 Fälle wurden fast alle vor einem Schwurgericht verhandelt. Die Schwurgerichtskammern, die in Deutschland bei den Landgerichten angesiedelt sind, sind zuständig für die Verhandlung vorsätzlicher Tötungsdelikte – hauptsächlich also für Mord (§ 211 StGB) oder für Totschlag (§ 212 StGB), aber auch für andere Verbrechen mit tödlichem Ausgang (beispielsweise bei einer Vergewaltigung oder Körperverletzung).
Da viele Leser möglicherweise nicht den Unterschied zwischen Totschlag und Mord kennen, möchte ich ihn kurz erklären: In beiden Fällen tötet der Täter vorsätzlich und nicht fahrlässig. Als Mörder bezeichnet das Gesetz denjenigen, der bei der Tötung bestimmte Merkmale erfüllt, die der Gesetzgeber für besonders verwerflich hält. Beispielsweise eine Tötung aus Habgier oder bei einer heimtückischen oder grausamen Vorgehensweise. Den Mörder erwartet grundsätzlich eine lebenslange Freiheitsstrafe, während andere, die töten, ohne dabei ein Mordmerkmal zu verwirklichen, wegen Totschlags mit einer zeitigen Freiheitsstrafe zwischen fünf und fünfzehn Jahren rechnen müssen. Nur in besonders schweren Fällen ist auch beim Totschlag die Verhängung einer lebenslangen Freiheitsstrafe möglich. Für minder schwere Fälle sieht der Gesetzgeber in § 213 StGB Strafen zwischen einem Jahr und zehn Jahren vor. Auf nur fahrlässig begangene Tötungen (§ 222 StGB) stehen Geldstrafen oder Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren. Über solche Vergehen entscheidet i. d. R. das Amtsgericht.
Eine Schwurgerichtskammer ist mit drei Berufsrichtern – einem Vorsitzenden, zwei Beisitzern sowie zwei Laienrichtern (Schöffen) - besetzt. Sie werden nur bei Anklagen der Staatsanwaltschaft tätig. Die Anklagen werden vom Gericht geprüft und zugelassen, wenn ein hinreichender Tatverdacht gegen die Angeklagten besteht. Wird ein solcher Tatverdacht bejaht, folgt eine Hauptverhandlung unter der Leitung des Vorsitzenden, in der – nach Verlesung der Anklageschrift - zunächst die Angeklagten Gelegenheit haben, etwas zum Vorwurf zu sagen. Sie müssen aber nicht. Es folgt das Kernstück der Hauptverhandlung: Die Beweisaufnahme. In diesem Abschnitt können beispielsweise Zeugen und Sachverständige vernommen, Urkunden verlesen sowie Fotos und Videos in Augenschein genommen werden. Es soll dadurch für die Richter ein Bild vom Tatgeschehen entstehen. Nachdem die Beweisaufnahme geschlossen worden ist, halten Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Plädoyers und der Angeklagte bekommt die Gelegenheit zu einem „letzten Wort“.
Danach ziehen sich die fünf Richter zur Beratung zurück. Sie ist geheim – kein Wort darf nach außen dringen. Einer der Berufsrichter beginnt und schlägt den anderen die Feststellung eines Sachverhalts vor. Seinen Vorschlag zum Tatgeschehen begründet er unter Würdigung der in der Hauptverhandlung erhobenen Beweise. Dies ist oft eine äußerst komplizierte Aufgabe, denn es reicht natürlich nicht aus, sich kritiklos auf die Angaben der Zeugen zu stützen, vielmehr muss sehr sorgfältig geprüft werden, ob diese auch glaubhaft sind. Neben bewussten Falschaussagen kommt es nämlich immer wieder vor, dass das Gedächtnis den Menschen einen Streich spielt. Erlebtes wird teilweise oder ganz vergessen oder die Erinnerung wird durch andere Einflüsse verfälscht. Manchmal füllt ein Zeuge die Lücken, die in seiner Erinnerung entstanden sind, mit Schlussfolgerungen, was er aber vor Gericht nicht zum Ausdruck bringt. Meistens ist er sich darüber nicht einmal bewusst. Zeugen sollen aber wertungsfrei vor Gericht nur das berichten, was sie nach ihrer gegenwärtigen Erinnerung gesehen und gehört haben. Nicht mehr und nicht weniger. Aber auch andere Beweismittel können ihre Tücken haben. Möglicherweise sind Fotos und Videos geschickt manipuliert worden oder Gutachten weisen Fehler auf.
Der Vorschlag zum Tatablauf und zur Täterschaft wird während der Beratung diskutiert. Wenn er nicht von allen akzeptiert wird, weil auch eine andere Variante möglich erscheint, muss abgestimmt werden. Steht der Sachverhalt fest, wird geprüft, ob die Angeklagten durch ihr Verhalten rechtswidrig und schuldhaft gegen ein oder mehrere Strafgesetze verstoßen haben. Falls ja, folgen die Überlegungen zur Bestrafung. Dabei ist der sog. Strafrahmen des Gesetzes Grundlage für die Festlegung der konkreten Strafe. Nehmen wir einmal den Strafrahmen für Totschlag (§ 212 Abs. StGB), der von 5 bis zu 15 Jahren reicht. Welche Strafe ist innerhalb dieser sehr großen Spannbreite individuell gerecht?
So etwas ist für das Gericht natürlich mathematisch nicht berechenbar. Die Strafe ist das Ergebnis einer Abwägung von strafmildernden und strafschärfenden Aspekten auf der Grundlage der Schuld des Täters. Die Grundsätze der Strafzumessung sind in § 46 StGB enthalten. Zu berücksichtigen sind danach die Beweggründe und Ziele des Täters, seine Gesinnung, die aus der Tat spricht, seine kriminelle Energie, die Art der Ausführung sowie die verschuldeten Auswirkungen der Tat. Aber auch das Vorleben des Täters, seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse sowie sein Verhalten nach der Tat fließen in die Bewertung ein. Ein Geständnis oder eine Provokation des Geschädigten können beispielsweise die Strafe mildern. Auf der anderen Seite heben einschlägige Vorstrafen oder schwere Tatfolgen die Strafe an. Aber nicht nur die Anzahl der einen oder anderen Art der Zumessungsgründe ist ausschlaggebend, sondern auch ihr Gewicht. Dabei haben die Richter durchaus unterschiedliche Ansichten darüber, wie ein Strafzumessungsgrund zu gewichten ist. Für den einen Richter mag die Biografie des Angeklagten eine große Rolle spielen, während sie für seinen Kollegen eher nebensächlich ist. Die Bildung der Strafe ist somit ein äußerst komplizierter Prozess, der viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl erfordert.
Jeder der fünf Richter hat eine Stimme – egal ob er Vorsitzender oder Schöffe ist. Kein Richter darf die Abstimmung verweigern. Zu jeder dem Angeklagten nachteiligen Entscheidung über die Schuldfrage und die Rechtsfolgen der Tat ist eine Mehrheit von Zweidritteln der Stimmen der Richter erforderlich. Also müssen im Schwurgericht mindestens vier Richter davon überzeugt sein, dass der Angeklagte die Tat begangen hat. Sonst muss freigesprochen werden. Nach der Beratung wird das Urteil im Namen des Volkes vom Vorsitzenden in der Sitzung verkündet und mündlich begründet.
Ob der Sachverhalt, von dem das Gericht ausgeht, dem tatsächlichen Geschehen zu 100 Prozent entspricht, ist keineswegs immer gesichert. Das gefundene Ergebnis kann trotz aller Sorgfalt immer nur eine Annäherung an die Wahrheit sein, selbst wenn das Gericht die Qualität der Beweismittel sorgfältig geprüft hat.
Es gibt leider eine Menge Fehlerquellen: Überzeugende Lügner, falsche Geständnisse, Dolmetscher, die unvollständig oder falsch übersetzen, sowie Sachverständige, die nicht erschöpfend alle Anknüpfungstatsachen beurteilen oder falsche Schlüsse aus ihnen ziehen. Nicht zuletzt hindert der Gesetzgeber selbst oft die Wahrheitsfindung, da er sich entschieden hat, einigen Personen ein Aussage- oder Auskunftsverweigerungsrecht einzuräumen. So habe ich es immer wieder als sehr unbefriedigend empfunden, wenn ein Kind vom Vater missbraucht oder gar getötet worden war, die Mutter des Kindes als Zeugin der Tat dies bei ihrer polizeilichen Vernehmung zwar auch beschrieben hatte, aber vor Gericht von ihrem Aussageverweigerungsrecht als Ehefrau Gebrauch machte, weil sie Angst vor ihrem Mann oder vor den wirtschaftlichen Folgen für die Familie bekommen hatte. Ist die Mutter das einzige Beweismittel, weil das Kind tot oder noch zu jung für eine Aussage ist, führt diese Situation zu einem Freispruch. Die polizeiliche Aussage der Mutter darf vor Gericht nicht verlesen werden, Vernehmungsbeamte der Polizei nicht vernommen werden. Der Gesetzgeber stellt hier den „Ehefrieden“ über die Gerechtigkeit–vielleicht mit der schrecklichen Folge, dass das Kind weiterhin vom Vater misshandelt wird. Den Gerichtsmedizinern ist es oft nicht möglich, eindeutig zu bestimmen, ob eine Verletzung Folge eines Unfalls oder einer Misshandlung ist. Selbst wenn, bleibt meistens die Frage, wer für die Misshandlung verantwortlich ist, offen.
Ein weiteres Beispiel für die begrenzte Gerechtigkeit findet sich in den Verjährungsvorschriften des Strafgesetzbuchs: Nach einiger Zeit wird zugunsten des Rechtsfriedens auf die Ahndung einer Straftat verzichtet (dazu siehe den dritten Fall). Selbst beim Totschlag gilt dies – nur Mord verjährt nicht.
Manchmal scheitert die Wahrheitsfindung auch an den Verteidigern. Sie haben ein legitimes Interesse, ihren Mandanten vor einer Strafe zu schützen oder eine möglichst geringe Strafe für sie zu erkämpfen. Das ist in Ordnung, solange nicht mit unfairen Mitteln gekämpft wird. So hat der Verteidiger z. B. das Recht, Zeugen zu befragen, wenn sie zuvor vom Gericht vernommen und von der Staatsanwaltschaft befragt worden sind. Es gelingt einigen Verteidigern, Zeugen stunden- bzw. sogar tagelang zu vernehmen in der nicht unberechtigten Hoffnung, die Zeugen würden sich irgendwann nicht mehr konzentrieren können und sich dann hier und dort in ihrer Aussage widersprechen. Die Hoffnung erfüllt sich oft, wenn der Zeuge entnervt anfängt, dem Rechtsanwalt nach dem Mund zu reden, weil seine Zeitplanung aus den Fugen gerät, er nach einer Zigarette giert oder er schlicht und ergreifend nach einigen Stunden psychisch am Ende ist. Ich habe sogar Zeugen erlebt, die nach einer solchen Tortur den Gerichtssaal mit der ernst gemeinten Ankündigung verließen, sie würden sich nie wieder in ihrem Leben als Zeugen zur Verfügung stellen. Nicht gut für unseren Rechtsstaat, aber aus der Sicht eines Geplagten eine durchaus nachvollziehbare Entscheidung.
Oft werden Zeugen durch viele Fragen, deren Sinn sie nicht mehr verstehen, provoziert. Die Gereizten reagieren aggressiv. Dieser Zustand ist äußerst gefährlich, weil er leicht zu unüberlegten Antworten führt. Triumphierend ruft dann der Verteidiger, der Zeuge sei unglaubwürdig und nicht als Beweismittel zu gebrauchen. Greift das Gericht nach einiger Zeit ein und weist Fragen zurück, weil sie keinen erkennbaren Zusammenhang zum Anklagevorwurf mehr haben, entgegnet der Verteidiger, er müsse mit diesen Fragen unbedingt die allgemeine Glaubwürdigkeit des Zeugen prüfen. Das sei sein gutes Recht! Ein Argument, das nicht ohne Weiteres zurückgewiesen werden kann, will der Vorsitzende sich nicht dem Verdacht der Parteilichkeit aussetzen. Beliebt ist auch der Versuch, das Gericht mit vielen Beweisanträgen und Ablehnungsanträgen zu bombardieren, was die Hauptverhandlungen verlängert und den richterlichen Terminkalender durcheinanderbringt. Der Anwalt hofft auf Verfahrensfehler, die er in der Revisionsinstanz rügen kann, auf die Zermürbung der Richter oder auf ein Entgegenkommen des Gerichts beim Strafmaß. Mit der Strafprozessordnung ist so ein Verhalten vom Gericht kaum zu stoppen. Das Gesetz stammt aus einer Zeit, in der es selbstverständlich war, dass ein Verteidiger als Organ der Rechtspflege an der Wahrheitsfindung mitarbeitet und diese nicht torpediert. Heute verstehen sich viele Verteidiger nur noch als verlängerter Arm ihrer Mandanten. Das veränderte Verhalten sollte Gesetzesänderungen nach sich ziehen, was angesichts der mächtigen Lobby der Rechtsanwälte kaum Aussicht auf Erfolg hat.
Wie die Beweismittel letztlich bewertet werden, hängt nicht zuletzt auch von den Persönlichkeiten der Richter ab. Einige glauben Zeugen eher als der andere. Richter, die zu vorsichtig sind und oft Angeklagte freisprechen, werden intern etwas abschätzig als Bedenkenträger bezeichnet. Aber jeder Richter muss schließlich auf sein Gewissen hören.
Die kurze Beschreibung macht vielleicht schon deutlich, welche riesige Verantwortung der Richterberuf mit sich bringt. Er ist nichts für schwache Nerven. Richter müssen neben der Wahrheitsfindung versuchen, verschiedene Interessen zu berücksichtigen und unter einen Hut zu bringen, die Gesellschaft vor Straftätern zu schützen, aber auch danach streben, dem Straftäter das Leben nach Möglichkeit nicht bis zu seinem Lebensende zu verbauen, sondern ihm eine Chance zum Neuanfang einzuräumen.
Mich faszinierten während meiner Berufstätigkeit immer wieder die unterschiedlichen Verhaltensweisen und Beweggründe der Täter. Sehr oft entstehen Straftaten aus gescheiterter Sozialisation, weil das Elternhaus versagt hat oder gar nicht vorhanden war, sodass soziale Normen und Wertvorstellungen nicht verinnerlicht werden konnten (s. z.B. Fälle 12 und 16). Das Beste, was man seinem Kind mitgeben kann, sind daher Liebe, gute Erziehung und Bildung. Aber selbst bei gelungener Sozialisation kann es zu folgenschweren Gesetzesübertretungen kommen, wenn anerzogene archaische Wertvorstellungen, z. B. aufgrund religiöser und kultureller Einflüsse, dominieren, die unserer Kultur und dem hiesigen Recht fremd sind (Fälle 5, 7 und 11).
Straftaten können sogar aus inniger Liebe entstehen (siehe Fall 10). Vor allem dann, wenn die Liebe einseitig ist. In der ersten Hälfte der Achtzigerjahre kam in unsere Hauptverhandlungen oft eine junge sympathische Staatsanwältin als Sitzungsvertreterin, von welcher der Buschfunk behauptete, sie lebe nur für ihre Karriere, Liebe habe es in ihrem Leben noch nie gegeben. Diese Staatsanwältin hatte in ihrem 32. Lebensjahr beruflich bei der Aufklärung einiger Einbrüche mit einem jungen vorbestraften Mann zu tun, in den sie sich schon nach kurzer Zeit unsterblich verliebte. Ihr Freund sah die Beziehung eher geschäftsmäßig und als hervorragende Gelegenheit, die Frau für seine dunklen Machenschaften auszunutzen, was er auch tat. Aus Angst, ihr Freund könne sie verlassen, wechselte die Beamtin die Seiten und gab ihm unter anderem einen Tipp für einen Einbruch bei ihrer Nachbarin, den er daraufhin ausführte. Ihr Amt als Staatsanwältin war sie daraufhin natürlich los. Aber auch ihren Freund, der es sich nicht nehmen ließ, die Lovestory an die Presse zu verkaufen. Eine Zeitung druckte sie im September 1985 unter der Überschrift: „Meine Staatsanwältin war noch Jungfrau“ ab.
Das wohl größte Rätsel im Hinblick auf ihre Absichten gab mir eine Strafverteidigerin auf, die bei unserer Kammer wegen Beihilfe zum Mord angeklagt worden war. Sie hatte den Mörder Pinzner aus dem St. Pauli – Milieu verteidigt, nachdem dieser im Auftrag rivalisierender Zuhälterbanden in den 1980 ger Jahren fünf Menschen kaltblütig erschossen hatte. Nach seiner Festnahme wurde er von der Polizei und der Staatsanwaltschaft mehrmals vernommen. Während der Untersuchungshaft versorgte die Rechtsanwältin ihn mit Kokain und schmuggelte – unter Umgehung der gerichtlichen Postkontrolle – Briefe an und von seiner Ehefrau. Die unkontrollierte Post ermöglichte die Planung des Finales. Am 29. Juli 1986 sollte Pinzner erneut und ein letztes Mal im Polizeipräsidium vernommen werden. Bei dieser Vernehmung waren außer dem Beschuldigten und seiner Ehefrau eine Protokollführerin, Kriminalbeamte und der zuständige Staatsanwalt B. sowie die Verteidigerin anwesend. Auf Anweisung ihres Mandanten hatte Letztere, die als Rechtsanwältin im Präsidium nicht oder nur unzulänglich kontrolliert worden war, eine Schusswaffe nebst fünf Schuss Munition in den Vernehmungsraum eingeschmuggelt und unterhalb der Tischplatte in die Hände ihres Mandanten gespielt. Pinzner erschoss daraufhin den Staatsanwalt, schob dann den Revolver seiner vor ihm knienden Ehefrau in den Mund, drückte ab und tötete sich anschließend selbst.
Im Zusammenhang mit diesem Skandal mussten die Hamburger Justizsenatorin Eva Leithäuser und der Innensenator Volker Lange zurücktreten.
Klar ist, dass die Rechtsanwältin den Tod ihres Mandanten und seiner Frau wollte. Sie hatte ein vitales Interesse am Exitus des Ehepaares. Solange die beiden lebten, bestand die große Gefahr, dass der Rauschgift- und Briefschmuggel auffliegen, sie bestraft und ihre Zulassung als Anwältin verlieren würde. Aber ohne Zweifel hatte die Rechtsanwältin auch für den Tod des Staatsanwalts Ursachen gesetzt: Ohne ihr Zutun hätte Pinzner nicht auf ihn schießen können. Aber warum tat sie das? Warum ging sie das hohe Risiko ein und gefährdete noch alle anderen im Vernehmungszimmer? Warum lieferte sie fünf und nicht nur zwei Patronen, die für den Tod des im Waffengebrauch geübten Auftragskillers und seiner Frau ausgereicht hätten? Vertraute sie etwa tatsächlich naiv darauf, der Killer werde sich mit dem eigenen und dem Tod seiner Frau zufriedengeben? Das war nach der Sachlage und der Persönlichkeitsstruktur des Beschuldigten Pinzner vollkommen unwahrscheinlich. Vielleicht war ihr das Hauptziel so wichtig, dass es alle Bedenken überwog, weil sie sich unbedingt retten wollte und dabei sogar den Tod anderer billigend in Kauf nahm. Oder spielten bei ihr inzwischen auch Hass auf Polizei und Staatsanwaltschaft eine Rolle? War vielleicht eine totale Hörigkeit, die alle Bedenken ausschloss, ausschlaggebend?
Nicht selten bleiben die Motive von Straftätern unklar. Sie lassen sich oft in der Hauptverhandlung nicht aufklären, zumal wenn der Angeklagte schweigt. Manchmal aber geben Zeugen oder Indizien einen Wink. Immer häufiger beruht strafrechtlich relevantes Fehlverhalten auf psychischen Erkrankungen (dazu Fälle 2 sowie 8). Daneben begünstigen noch viele andere Faktoren - wie eine geringe Empathiefähigkeit oder Alkohol- und Drogenkonsum hochkriminelles Verhalten (Fall 12).
Während meiner Tätigkeit beobachteten meine Kollegen und ich, wie sich die Hemmschwelle bei Gewaltdelikten (bei Eigentumsdelikten ohnehin) allmählich immer weiter absenkte und die Aggressivität der Täter deutlich zunahm. Extreme Gewalt wird oft ohne nachvollziehbaren Anlass ausgeübt (Fall 15). Während man sich früher schlug und trat, ist heute ein Messer immer schnell zur Hand, weil viele es ständig bei sich tragen. Dementsprechend sind die Tatfolgen gravierend.
In einigen Fällen bringt aber bereits bloße Passivität Leute mit einer Anklage wegen Totschlags durch Unterlassen vor das Schwurgericht. Dazu mehr im Fall 14.
Was führt zur Tötung eines Menschen? Wie viel kriminelle Energie ist zur Überschreitung der hohen Hemmschwelle, die wir alle haben sollten, erforderlich, um Leben zu vernichten? Darauf gibt es keine pauschale Antwort. Oft entsteht der Tötungsvorsatz spontan aus einer Situation heraus, die nicht vorhersehbar war. Plötzlich aufkeimende heftige Gefühle - wie Wut und Eifersucht - lenken die Täter. Langfristig geplante Tötungen sind eher selten.
Aus meiner langjährigen Tätigkeit als Richter einer Schwurgerichtskammer habe ich einige typische Fälle ausgewählt, die zeigen, wie vielschichtig menschliches Denken und Handeln sind. Sie lassen vielleicht erahnen, wie spannend und interessant, aber auch überaus verantwortungsvoll der Richterberuf ist.
Meine Quellen sind Erinnerungen und Notizen, die im Zuge öffentlich zugänglicher Beweisaufnahmen entstanden, sowie meine Entwürfe für die mündlichen Urteilsbegründungen. Über die folgenden Fälle wurde auch ausnahmslos in der Presse berichtet. Geändert oder abgekürzt habe ich aus rechtlichen Gründen in den Kapiteln die Namen der Betroffenen. Eine eventuelle Namensgleichheit mit noch lebenden oder bereits gestorbenen Personen ist rein zufällig.
16 Jahre unschuldig in Santa Fu
Nachdem ich einige Jahre schon als Strafrichter gearbeitet hatte, musste ich mich mit einem Fall befassen, der mir sehr deutlich klarmachte, dass auch die Justiz nicht unfehlbar ist. Ich war damals 36 Jahre alt und beisitzender Richter einer Großen Strafkammer des Hamburger Landgerichts.
Alles fing damit an, dass ein Strafverteidiger 1986 auf 247 Seiten einen sogenannten Wiederaufnahmeantrag bei uns einreichte. Der Verteidiger vertrat den wegen Mordes rechtskräftig verurteilten Otto G., der schon seit 16 Jahren in der Hamburger Strafanstalt Fuhlsbüttel eine lebenslange Freiheitsstrafe verbüßte. In dem Antrag wurde behauptet, das damalige Geständnis des Verurteilten sei falsch gewesen und er sei freizusprechen, weil er ein Alibi für die Tatzeit habe.
Der Erfolg von Wiederaufnahmeanträgen zugunsten rechtskräftig Verurteilter ist nicht besonders groß. Die meisten Anträge scheitern bereits, weil sie nicht zulässig sind. Der häufigste Grund für eine Wiederaufnahme ist das Auftauchen von neuen Beweismitteln, die geeignet sind, einen Freispruch zu erzielen oder wenigstens die Strafe des Verurteilten durch die Anwendung eines milderen Strafgesetzes zu verringern.
Was war passiert?
Ein Schwurgericht hatte Otto G. am 31. März 1971 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, weil er zur Überzeugung des Gerichts im April 1970 die sechsjährige Birgit, Tochter eines Polizeibeamten, in Hamburg-Rahlstedt getötet habe, nachdem er das Mädchen in ein Wäldchen gelockt und sich dort unter grausamen Umständen an ihm vergangen habe.
Die Revision von Otto G. gegen das Urteil wurde im September 1971 vom Bundesgerichtshof verworfen. Die Entscheidung war damit rechtskräftig geworden. Hinter Otto G. schlossen sich die schweren Türen der Strafanstalt Santa Fu, nachdem er vorher schon in Untersuchungshaft gewesen war. Im Gefängnis beteuerte er immer wieder seine Unschuld und beantragte mehrmals vergeblich die Wiederaufnahme seines Verfahrens.
Es ging um Folgendes: Sexuelle Attacken auf Kinder und junge Frauen verunsicherten damals viele Menschen im Hamburger Osten. Die Presse berichtete mehrfach darüber und kritisierte heftig Hamburgs Polizei, die sie für unfähig hielt, den oder die Täter zu fassen.
Die Empörung erreichte ihren Höhepunkt, nachdem zwei Schüler am 3. April 1970 gegen 12 Uhr das kleine Mädchen mit Spuren ärgster Misshandlungen im Scheidenbereich in einem Wassergraben gefunden hatten. Die Bevölkerung war äußerst alarmiert und besorgt. Die Polizei setzte auf Druck der Presse und Politiker alles in Bewegung, um den Täter zu fassen. Es wurden mehrere Ermittlungsgruppen gebildet, die bereits bekannte Sexualstraftäter überprüfen sollten. Jede Gruppe erhielt etwa zehn Karten aus der Kartei für Sexualtäter.
Bereits einen Tag nach dem Mord wurde auch Otto G. überprüft. Dieser erklärte, er habe die Tat gar nicht begehen können, da er zur fraglichen Tat beim Zahnarzt und Friseur gewesen sei. Diese Behauptung überprüften mehrere Kriminalbeamte. Sie befragten Zeugen und stellten fest, dass G. am Tattag tatsächlich gegen 11: 00 Uhr einen Zahnarzt in Wandsbek aufgesucht hatte, bei dem ihm nach einer Wartezeit zwei Zähne unter Betäubung gezogen worden waren. Gegen 11: 45 Uhr hatte er die Zahnarztpraxis in der Tonndorfer Hauptstraße verlassen. Dann war er zu einem Friseur in der Jenfelder Straße gegangen. Hier hatte er sich zwischen 12: 00 Uhr und 12: 30 Uhr die Haare schneiden lassen. Gegen 13: 00 Uhr war Otto G. in seine Wohnung nach Barsbüttel zurückgekehrt. Nach Überprüfung des Alibis fertigten und unterschrieben drei Kriminalbeamte am 8. April einen Vermerk, in dem es hieß, Otto G. habe ein einwandfreies Alibi für die Tatzeit und es bestehe kein Tatverdacht gegen ihn.
Damit war der Beschuldigte aus dem Schneider – sollte man jedenfalls denken.
Eine weitere Ermittlungsgruppe befasste sich mit einem anderen Verdächtigen, nämlich Horst L.. Dieser gestand sehr bald, das Mädchen getötet zu haben, wobei er sogar Einzelheiten nennen konnte, die noch nicht von der Presse veröffentlicht worden waren. L. wurde daraufhin festgenommen und das Amtsgericht erließ einen Haftbefehl gegen ihn.
Die Überfälle im Hamburger Osten ließen jedoch nicht nach. Daher gingen Polizei und Justiz schließlich davon aus, dass das Geständnis von L. falsch sei. Er wurde aus der Untersuchungshaft entlassen.
Die Polizei ermittelte weiter. Nun wurden sogar einige Ehefrauen von Polizeibeamten bei der Fahndung als „Lockvögel“ eingesetzt.
Otto G. geriet im Zuge der Observationen bald wieder in Verdacht und wurde festgenommen. Er gestand sechs Sexualdelikte, bestritt jedoch, das Kind getötet zu haben. Die Vernehmungsbeamten hielten ihm nun Einzelheiten des Falles sowie eine Skizze des Tatortes und Fotos vor. G. bestand immer noch auf seiner Unschuld. Nach ca. einer Stunde schrie er aber entnervt: „Ja, ich habe es gemacht!“
Am 13. August 1970 wurde er von der Polizei zum Tatort ausgeführt. Dabei war es ihm nicht möglich, die Stelle zu bezeichnen, an der die Leiche gefunden worden war. Während einer richterlichen Vernehmung am 27. November 1970 wiederholte er sein Geständnis.
Der Staatsanwaltschaft klagte G. u. wegen Mordes an Birgit beim Schwurgericht unter Beifügung der Ermittlungsakte an. Allerdings fehlte in dieser Akte der wichtige Vermerk über das Alibi des Otto G.. Er blieb – warum auch immer - im Besitz der Polizei, obgleich er unbedingt in die Ermittlungsakte gehört hätte.
In der Hauptverhandlung vor dem Schwurgericht, das damals noch mit drei Berufsrichtern und sechs Geschworenen besetzt war, in der Zeit vom 29. bis zum 31. März 1971 (die Hauptverhandlungen waren damals selbst bei Tötungsdelikten erheblich kürzer), bestritt G. zunächst wieder, das Mädchen getötet zu haben. Er behauptete, den Vorfall nur aus der Akte zu kennen. Nachdem er sich bei der Polizei eine halbe Stunde lang die schrecklichen Fotos des misshandelten Mädchens habe ansehen müssen, sei er fix und fertig gewesen und habe alles gestanden, um endlich seine Ruhe zu haben. Er habe das Verhör nicht mehr ausgehalten.
Bei einem Ortstermin des Gerichts am Fundort der Leiche erklärte er dann auf Befragen jedoch wiederum: „Ich will jetzt alles zugeben.“
Während der Hauptverhandlung wurden die Zeugen nicht vernommen, die Otto G. einen Tag nach der Tat ein Alibi gegeben hatten. Das Gericht wusste zwar von den Besuchen beim Zahnarzt und Friseur; kümmerte sich aber offenbar nicht um die Uhrzeiten, weil der Angeklagte geständig war und ihm das Ergebnis der polizeilichen Befragung der Alibizeugen nicht vorlag. Auch der Verteidiger des Angeklagten problematisierte diesen Punkt nicht.
Nach seiner Verurteilung behauptete Otto G. dann im Gefängnis immer wieder, er habe mit dem Tod des Mädchens nichts zu tun. Die Polizei habe ihn hereingelegt. Aber diese Vorstellung war ungeheuerlich - keiner glaubte ihm.
Erst nachdem sein neuer Verteidiger den Alibi–Vermerk vom 8. April 1970 in der Polizeiakte gefunden hatte, waren die Weichen für ein Wiederaufnahmeverfahren gestellt, für das nun unsere Schwurgerichtskammer zuständig war. Der Prozess endete am 15. Dezember 1987 mit einem Freispruch, denn wir waren davon überzeugt, dass unser Angeklagter den Mord nicht begangen haben konnte:
Die Mutter der kleinen Birgit sowie Nachbarn hatten das Kind noch zwischen 10 und 10.45 Uhr in der Nähe seines Elternhauses spielen sehen. Da seine Leiche kurz nach 12 Uhr in der Feldmark entdeckt worden war, musste die schreckliche Tat in der Zeit dazwischen begangen worden sein. Bei einer Ortsbegehung am 3. Dezember 1987 schritten wir im ungefähren Tempo einer Sechsjährigen den Weg vom Elternhaus bis zum Fundort der Leiche, der nach der Spurenlage zugleich der Tatort war, ab und stellten fest, dass der Täter mit dem Mädchen rund 19 Minuten gebraucht hatte. Die Tat musste also in der Zeitspanne von kurz nach 11: 00 Uhr bis ca. 12: 00 Uhr geschehen sein.