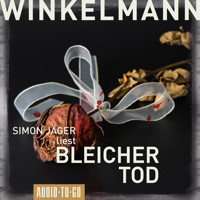9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Podcast, der Tausende begeistert. Der süchtig macht. Der den Tod bringt … Lehn dich zurück. Höre diese Stimme. Vergiss deinen Alltag, den Job, den Ärger, die Sorgen. Vertrau dich den Worten an. Sie sind nur für dich. Aber Vorsicht: Wenn du einmal gefangen bist in dieser Welt, kommst du nicht mehr hinaus. Diese Stimme – sie ist das Letzte, was du hörst. Sarah ist süchtig nach dem Podcast «Hörgefühlt». Die Stimme von Podcaster Marc Maria Hagen ist wie ein seidiges Kissen, seine Worte sind Trost für die Seele. Doch Sarah ahnt nicht, was hinter den Kulissen vor sich geht. Dass hinter den weichen Worten der Tod lauert. Nr.-1-Bestsellerautor Andreas Winkelmann mit einem neuen Thriller, der dem Bösen eine Stimme gibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Andreas Winkelmann
Das Letzte, was du hörst
Thriller
Über dieses Buch
Ein Podcast, der Tausende begeistert. Der süchtig macht. Der den Tod bringt …
Lehn dich zurück. Höre diese Stimme. Vergiss den Alltag, deinen Job, den Ärger, die Sorgen. Vertrau dich den Worten an. Sie sind nur für dich. Aber Vorsicht: Wenn du einmal gefangen bist in dieser Welt, kommst du nicht mehr hinaus. Diese Stimme – sie ist das Letzte, was du hörst.
Sarah ist süchtig nach dem Podcast «Hörgefühlt». Die Stimme von Podcaster Marc Maria Hagen ist wie ein seidiges Kissen, seine Worte sind Trost für die Seele. Doch Sarah ahnt nicht, was hinter den Kulissen vor sich geht. Dass hinter den weichen Worten der Tod lauert …
Nr.-1-Bestsellerautor Andreas Winkelmann mit einem neuen Thriller, der dem Bösen eine Stimme gibt.
Vita
Andreas Winkelmann, geboren 1968 in Niedersachsen, ist verheiratet und hat eine Tochter. Er lebt mit seiner Familie in einem einsamen Haus am Waldrand nahe Bremen. Wenn er nicht gerade in menschliche Abgründe abtaucht, überquert er zu Fuß die Alpen, steigt dort auf die höchsten Berge oder fischt und jagt mit Pfeil und Bogen in der Wildnis Kanadas.
Sie möchten regelmäßig über Neuerscheinungen, Veranstaltungen und aktuelle Gewinnspiele von Andreas Winkelmann informiert werden? Dann abonnieren Sie den Newsletter unter www.rowohlt.de/andreas, besuchen die Website www.andreaswinkelmann.com oder folgen dem Autor auf www.facebook.com/andreas.winkelmann.schriftsteller oder www.instagram.com/winkelmann.andreas.autor.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juli 2022
Copyright © 2022 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung Hafen Werbeagentur, Hamburg
Coverabbildung natrot/shutterstock
ISBN 978-3-644-01142-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Die Lüge der Vergangenheit ist die Wahrheit der Zukunft.
Kapitel 1
1
Damals
Wenn sich das Monster unter dem Bett verbirgt, wo kann ich mich dann noch verstecken?
Der Junge wusste, dass es ein Monster unter seinem Bett gab, aber es kam nicht heraus, nie, deshalb war das bisher kein Problem gewesen. Er hatte den dunklen, staubigen Raum unter dem Bett so gut es ging ignoriert, und wenn er abends zu Bett gegangen und morgens aufgestanden war, hatte er das mit einem ausreichend großen Sprung getan, um nicht Gefahr zu laufen, von dem Monster, das er Groll nannte, am Knöchel gepackt zu werden.
Jetzt stand der Junge in seinem Zimmer im Obergeschoss des Hauses und starrte den schwarzen Spalt unter dem Bett an. Gleichzeitig drangen Schreie zu ihm herauf, entsetzliche, furchterregende Schreie, und das schon seit einiger Zeit. Sie wollten nicht aufhören, und es nützte gar nichts, wenn er sich die Ohren zuhielt, das hatte er schon probiert. Die Schreie waren laut genug, um seine Hände mit Leichtigkeit zu durchdringen.
Der Junge wusste, er musste sich verstecken.
Denn heute war der Tag gekommen, vor dem sie alle sich immer gefürchtet hatten.
In den Schrank konnte er nicht, darin war kein Platz für ihn, alles war voller Regalbretter, nirgends ein Spalt, in den er sich hätte quetschen können. Das hatte er einmal erfolglos versucht, als es auch schlimm gewesen war. Aber damals hatten die Schreie wieder aufgehört.
Es gab kein weiteres Versteck in seinem kleinen Zimmer unter dem Dach. Nur das dunkle Königreich unter dem Bett. Die Angst davor ließ den Jungen zittern. Tränen traten ihm in die Augen und liefen über seine erhitzten Wangen. In dieser Familie weinten die Männer nicht, das war ihm oft genug gesagt worden, und meistens schaffte er es auch, die Tränen zu unterdrücken, aber nicht heute, nicht jetzt, da seine Mama so furchtbar schrie.
Aber weil die Angst vor Groll zu groß war, entschied der Junge sich für die Flucht nach vorn. Raus aus seinem Zimmer. Hinunter in den Flur. Vielleicht würde er es hinausschaffen, dann rüber zu den Nachbarn, die immer so nett waren und ihm Süßigkeiten gaben, vor allem die blauen Schlümpfe, die er so gern mochte. Die würden ihm bestimmt helfen, ihn irgendwo verstecken, wo es keine Monster gab – und keine Papas, die irgendwann durchdrehten.
Barfüßig trat der Junge an die Tür und drückte die Klinke hinunter. Er musste tief Luft holen und den Rotz in seinem Hals hinunterschlucken, bevor er es schaffte, die Tür zu öffnen. Unten schabte sie ein wenig über den blauen Teppichboden, aber das Geräusch wurde von Mamas Schreien übertönt.
Durch den geöffneten Spalt schaute er auf den Gang hinaus. Er war leer. Durch das schräge Fenster im Dach fiel ein helles Lichtquadrat auf den Teppich. Draußen schien die Sonne, es war ein schöner Tag, warm und hell und freundlich. Er hätte hinausgehen und in dem Sandhaufen hinter der Garage mit seinem Bagger spielen sollen, als er die Chance dazu gehabt hatte. Zu spät.
Das ganze Haus war schon voll von den Schreien, sie wussten nicht mehr wohin, und so wie Wasser nach einem Dammbruch in die Freiheit schoss, schossen sie nun in sein Zimmer. Kurz fragte der Junge sich, ob er sein Fenster öffnen sollte, damit sie hinauskonnten.
Er tat es nicht. Setzte stattdessen seine nackten Füße so vorsichtig auf, dass er meinte, jede einzelne Schlinge des Teppichs spüren zu können.
Und dann hörten die Schreie plötzlich auf.
Zwischen zwei Schritten.
Der eine Fuß des Jungen schwebte nur Zentimeter über dem Boden, er traute sich nicht, ihn in die Stille hinein aufzusetzen. Unten erklang ein sirrendes Geräusch. Das kannte er schon. Es entstand, wenn Stahl durch die Luft schwirrte. Als der Stahl auf Widerstand traf, veränderte sich das Geräusch.
Wieder Tränen. Wieder zitterte er. Konnte sich nicht länger halten, musste den Fuß aufsetzen, tat es aber rückwärtsgewandt, weil er ahnte, dass er nicht entkommen konnte. Jetzt nicht mehr, da Mama schwieg.
Schritte. Schwere Schritte unten auf dem Flur.
Er kam!
Der Junge huschte in sein Zimmer zurück und drückte behutsam die Tür zu. Jetzt, da er keine Wahl mehr hatte, erschien ihm das dunkle Königreich wie ein verheißenes Land. Vor dem Bett ließ er sich bäuchlings zu Boden fallen, presste die Wange an den Teppich und schaute in die Schwärze.
Nichts bewegte sich darin. Aber es lagen Gegenstände unter dem Bett, von denen er nicht wusste, worum es sich handelte. Sie waren alle schwarz und wirkten tot. Vielleicht waren es die Opfer von Groll.
Trotz seines Alters wusste der Junge genau, was Mut war.
Mut war, den Blick nicht zu senken, wenn Tobi, der Schäferhund unten an der Straße, wie ein Verrückter auf der anderen Seite des Maschendrahtzauns bellte.
Mut war, Melanie in der Schule abschreiben zu lassen, obwohl Frau Hundertmark, ihre Deutschlehrerin, es verboten hatte.
Mut war, nicht zu heulen, wenn Papa die Hand hob.
Aber nichts von alledem hatte ihn je so viel Mut gekostet wie diese Entscheidung. Es war fast mehr, als er schaffen konnte, und vielleicht hätte er es gar nicht geschafft, hätte er nicht die Schritte auf der Treppe gehört und das Schaben von Metall auf dem Eisengeländer.
Er robbte unters Bett.
Ganz tief in den schwarzen Spalt. Bis in die Mitte, wo es besonders dunkel und er ganz weit entfernt war von der Welt da draußen. Es roch hier unangenehm, und der Junge spürte, wie ihm etwas in die Nase stieg, winzig klein, vielleicht Staub, vielleicht aber auch die Hautschuppen des Monsters. Jedenfalls kitzelte es sofort in der Nase, und weil er nicht niesen durfte, quetschte er sich die Nasenflügel mit den Fingern zusammen und atmete nur noch durch den Mund. Immer nur ganz kurz und wenig, damit es nicht so laut war.
Wo war Groll? Warum regte er sich nicht? Lauerte er ganz oben, am Kopfende, fletschte er bereits die Zähne? Oder streckte er seine klauenbewehrte, mit ekligen Schuppen überzogene Hand nach ihm aus? Der Junge glaubte, eine leichte Bewegung an seinem Kopf zu spüren, sodass sich sein blondes Haar aufstellte, wie wenn er an einem Wintertag in der Schule die Mütze absetzte. Dafür war der Strom verantwortlich, das wusste der Junge. Aber nicht jetzt. Jetzt lag es an Groll.
Nicht schreien.
Du darfst nicht schreien.
Du musst noch stiller sein als auf der Beerdigung von Oma.
Er riss sich zusammen, trotzte seiner Furcht, atmete kaum noch, und trotzdem ging die Tür zu seinem Zimmer auf, und es kam ein Geruch herein, der alles andere überlagerte. Es roch wie die kleine Pfütze auf dem rostigen Blech hinter der Garage. Braunes Wasser, das Stahl fraß.
Schritte näherten sich.
Der Junge drehte den Kopf, weil er sehen wollte, was passierte, und da entdeckte er mit Entsetzen, dass er seinen nackten linken Fuß nicht unter das Bett gezogen hatte.
Die scharfe Grenze zwischen Licht und Dunkelheit lag über dem Knöchel, sein Fuß schien hell zu leuchten. Er wollte das Bein anwinkeln, den Fuß in Sicherheit bringen, doch seine Muskeln ließen sich nicht mehr bewegen. In diesem Moment wurde dem Jungen klar, dass das Monster gar nicht unter dem Bett war.
Es stand davor.
2
«Tu das nicht! Ich bitte dich, tu das nicht! Ich …»!
Roya Mayer, die selten um Worte verlegen war, wusste nicht, was sie sagen sollte. Panik stieg in ihr auf. Das durfte nicht passieren, nicht schon wieder. So etwas wiederholte sich doch nicht.
Ihr Blick glitt zwischen dem Display des Handys in der Halterung am Lüftungsgitter der Mittelkonsole und der engen Landstraße hin und her, die sich wie ein Tunnel durch die Dunkelheit über den Wäldern und Wiesen zog. Sie hielt sich für eine gute Fahrerin – auch wenn ihr Vater immer das Gegenteil behauptet hatte –, aber in diesem Moment war sie heilfroh über den schwachen Verkehr hier draußen auf dem Lande.
«Martina? Bist du noch da? Bitte, sag doch was?»
Von vorn näherten sich Scheinwerfer und erweckten die Schatten der mächtigen Eichen an den Rändern der Straße zum Leben. Uralte, vernarbte Stämme, die einen Zusammenprall schadlos wegstecken würden, ganz im Gegensatz zu Royas in die Jahre gekommenem Suzuki. Denn der hatte lediglich zwei Airbags, einen im Lenkrad, einen über dem Handschuhfach, und das war es dann auch schon mit der Sicherheit. Seine Knautschzone war lächerlich, das Blech dünn. Mit diesem Wagen hatte man besser keinen Frontalzusammenstoß – weder mit einem Baum noch mit einem Fahrzeug. Deshalb nahm Roya den Blick vom Handy und konzentrierte sich auf die Fahrbahn, folgte dem weißen Strich am rechten Rand, der außerhalb der Scheinwerfer in der Dunkelheit verschwand und sie dorthin zu locken schien.
Die Scheinwerfer wurden groß und größer, blendeten Roya, sie kniff die Augen zusammen, klammerte sich ans Lenkrad und fragte sich, ob es nicht doch besser wäre, an den Straßenrand zu fahren, die Warnblinkanlage einzuschalten und die Polizei anzurufen.
Aber was sollte sie sagen? Hallo, ich glaube, da will sich jemand umbringen? Es wäre eine Möglichkeit, und vielleicht würde man ihr glauben, aber es gab mehr als nur einen Grund, der sie davon abhielt.
Als der entgegenkommende Wagen vorbeigefahren war, traute sie sich, wieder auf ihr Handy zu schauen. Immer noch standen lediglich die sechs Worte im Display.
«Hilf mir … ich bin am Baum …»
Mit einer flinken Bewegung tippte Roya auf das Lautsprechersymbol für eine Sprachaufnahme.
«Martina! Sprich mit mir, bitte. Ich möchte deine Stimme hören!»
Doch Martina wollte oder konnte nicht sprechen. Vor einer Viertelstunde war diese kurze Textnachricht eingegangen, unverständlich für Außenstehende, doch Roya ahnte, was Sache war. Martina ging es schlecht. Und Roya hatte das Gefühl, an dieser Entwicklung eine gewisse Mitschuld zu tragen. Vielleicht hatten ihre Fragen sie zu sehr aufgerüttelt, vielleicht hatte Roya auch zu vehement nachgefragt und zu tief gebohrt, aber wie hätte sie auch wissen können, dass Martina Spiekermann so instabil war. Vor einer Woche hatte sie noch einen gefestigten Eindruck auf Roya gemacht. Zwar alles andere als selbstbewusst, aber doch mit einer Perspektive und einem guten Blick auf die Dinge, die sie beschäftigten. Was hatte sich seitdem geändert? Und warum wandte sich Martina in dieser verzweifelten Situation ausgerechnet an Roya? Sie war doch nur eine Journalistin, die für einen Artikel recherchierte, und kannte die Frau kaum. Zugegeben, sie hatten von Beginn an einen besonderen Draht zueinander gehabt. Die Chemie stimmte zwischen ihnen, und zu einer anderen Zeit oder in einem anderen Leben wären sie vielleicht sogar Freundinnen geworden.
Roya setzte eine weitere Sprachnachricht ab.
«Martina, ich bin sicher, wir kriegen das wieder hin. Lass uns einfach miteinander reden, ja. Ich fand unser Gespräch neulich wirklich schön und … ganz ehrlich, ich habe selten mit so sympathischen Menschen zu tun, wie du es bist. Magst du mich nicht anrufen, jetzt gleich?»
Roya hatte ihrerseits mehrfach versucht, Martina zu erreichen. Zwecklos. Sie nahm nicht ab. Und auf die Aufforderung zu telefonieren, reagierte Martina nicht. Das Display blieb leer, und Royas Herz schlug noch schneller, als es das ohnehin schon tat. Sie musste Martina in der Leitung behalten, durfte die Kommunikation auf keinen Fall abbrechen lassen. Gleichzeitig durfte sie aber auch nicht anhalten. Niemand sonst wusste, wo Martina sich befand, und selbst wenn Roya einen Notruf absetzte, würden die Helfer auch nicht eher vor Ort sein als sie selbst. Es hing alles an ihr. Sie war die Einzige, die Martina in diesem Moment helfen konnte.
«Sag was, sag irgendwas», forderte Roya sich selbst auf, während ihr Daumen über dem Lautsprechersymbol schwebte. Doch ihr fielen die richtigen Worte nicht ein. Was sagte man einem Menschen, um ihn davon abzuhalten, sich umzubringen?
Roya versuchte es mit der Wahrheit.
«Martina, wir haben doch einen Plan! Du und ich, zusammen sorgen wir dafür, dass nicht noch mehr Menschen auf ihn hereinfallen. Aber ich brauche deine Hilfe, hörst du. Ohne dich schaffe ich es nicht.»
Eine Antwort blieb aus. Die Stille am anderen Ende der Leitung ließ Roya verzweifeln. Sie dachte an das Gespräch von vor zwei Wochen zurück.
Martina hatte an der Buche gelehnt, den Blick auf die Wiese hinaus gerichtet. Obwohl Martina beinahe genauso alt war wie Roya, wirkte sie in ihrer unschuldig-kindlichen Art jünger. Die Haut in ihrem Gesicht war glatt und rein, das dunkelblonde Haar fiel ihr auf die Schultern und schimmerte im Sonnenlicht. Martina war eine hübsche Frau, einzig die tief liegenden und dadurch stets dunkel wirkenden Augen wollten nicht so recht zu den sonst symmetrischen Formen ihres Gesichts passen. Sie sprach zögerlich, immer darauf bedacht, nichts zu sagen, was andere verletzen oder zu einer Diskussion führen könnte, in der sie sich würde behaupten müssen. Sich zu behaupten, das konnte sie nicht. Sie trug den tiefen Wunsch nach Harmonie in sich, nach einer Welt ohne Streit, ohne laute Worte oder gar Gewalt.
«Wir finden einen Weg, Martina. Weißt du …»
Roya war kurz davor, Martina die ganze Wahrheit zu erzählen, tat es aber doch nicht. Die Wahrheit war zu verwirrend, und Roya war sich nicht einmal sicher, ob sie auf der richtigen Fährte war. Was, wenn sie sich täuschte?
Das Kreischen der Hupe kam wie aus dem Nichts. Ohrenbetäubend und schrill riss es Roya in die Realität einer Landstraße abends um neunzehn Uhr zurück, auf der ihr erneut Scheinwerfer entgegenkamen. Doch diesmal waren sie riesig – und verdammt nah dran! Roya war unbemerkt auf die Gegenfahrbahn geraten, eine Hälfte ihres Suzukis befand sich links der durchgezogenen Linie, die hier wegen der schlechten Einsehbarkeit der Kurve ein Überholverbot markierte.
Roya riss das Steuer herum. Zu heftig. Sofort steuerte sie gegen, dann gleich noch einmal, trat dabei zu fest auf die Bremse, sodass sie binnen Sekunden die Kontrolle über den kleinen Wagen verlor, der wie die Kugel in einem Flipperautomaten von rechts nach links über die Fahrbahn schoss. Ihr Wagen rammte zuerst mit der rechten vorderen Seite gegen die Leitplanke. Dann folgte ein Zusammenprall mit den nächsten Leitplanken. Glas barst, Blech zerbeulte, der Wagen kreischte herzzerreißend. Nach dem dritten Zusammenprall hob er ab und überschlug sich. Roya klammerte sich mit aller Kraft ans Lenkrad, aus dem ihr plötzlich der Airbag ins Gesicht sprang. Die Schwerkraft war aufgehoben, oben war unten und unten oben, sie verlor vollkommen die Orientierung, schrie ihre Panik in die weiße Kunststoffhülle, bekam einen heftigen Schlag gegen den Kopf und dann noch einen und verlor die Besinnung.
Als sie ihre Umgebung wieder wahrnahm, lag der Wagen still. Kopfüber hing Roya in ihrem Gurt, die Halswirbelsäule abgeknickt, Blut tropfte von einer Wunde an ihrer Stirn auf den Wagenhimmel. Sie spürte keine Schmerzen, spürte nicht einmal ihren Körper, hatte vielmehr das Gefühl, daraus entwichen zu sein.
War sie tot?
Ihr Blick fiel auf das Handy. Es war aus der Halterung gefallen und lag neben dem rasch größer werdenden Blutfleck am Dachhimmel. Ein großer Riss zog sich über die Glasfront.
Roya nahm ihre ganze Kraft zusammen und streckte ihre rechte Hand danach aus. Sie konnte sie bewegen, war also nicht tot, immerhin. Sie tippte auf das Display, und das Handy leuchtete auf. Die Messenger-App, über die sie mit Martina Spiekermann kommuniziert hatte, war noch geöffnet. Ihre letzte Nachricht lag sechs Minuten zurück. Sie war länger bewusstlos gewesen als vermutet.
Sechs Minuten Schweigen musste sich für einen Menschen, der sich das Leben nehmen wollte, wie eine Ewigkeit anfühlen.
Roya wollte auf das Mikrofon-Symbol drücken, um eine weitere Sprachnachricht aufzunehmen, doch das Symbol war so klein, viel zu klein, um es mit ihren zitternden Fingern treffen zu können, zudem löste sich das Handy immer wieder vor ihren Augen auf. Ihre Lider flatterten, ihr Schädel pochte, als wolle er zerbersten. Roya spürte, sie würde abermals die Besinnung verlieren.
In einer halbwegs klaren Sekunde erkannte Roya das Mikro-Symbol und drückte drauf.
«Martina … ich bin da … ich komme zu dir, hörst du. Und dann finden wir eine Lösung, bitte … tu das nicht.»
Keine Reaktion.
Blut tropfte in die Stille hinein. Ihre Sinne schwanden. Bevor Roya abdriftete, nahm sie ein Klopfen an der Seitenscheibe wahr und blickte in das Gesicht eines Mannes.
«Keine Angst, ich hole Sie da raus!», sagte er mit einer Stimme, die ganz dumpf klang, und das war das Letzte, was sie hörte.
3
«Ist das dein Ernst? Da habe ich mal pünktlich Feierabend, und du servierst mich ab? So langsam bekomme ich Lust, den Typen umzubringen und in Einzelteilen …»
Sarah Henschel riss die Kopfhörer aus ihren Ohren. Da ihr Auto seit gestern in der Werkstatt war, musste sie den Bus nehmen, und Sarah hasste das Busfahren. Wenigstens konnte sie sich während der Fahrt mit Musik ein wenig von der Welt abschotten, doch dann war die Sprachnachricht ihres Freundes Björn eingegangen und hatte alles verdorben.
Sarah liebte Björn, und die allermeiste Zeit trug er sie auf Händen und erfüllte ihr jeden Wunsch, aber wenn er nicht ganz oben auf ihrer Prioritätenliste stand, war er schnell beleidigt. Dabei wusste er genau, was sie heute Abend vorhatte, dass diese zwei Stunden für sie allein reserviert waren. Jetzt war er auch noch eifersüchtig auf einen Podcaster und haute so einen kindischen Satz raus.
Sarah steckte das Handy in ihren Rucksack. Sie wollte sich nicht zwingen lassen, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Björn musste einfach lernen, dass zu einer Beziehung auch Auszeiten gehörten. Vielleicht sollte Sarah das mit der gemeinsamen Wohnung, in die sie demnächst ziehen wollten, noch einmal überdenken.
Mit einem Blick durch den Bus lenkte Sarah sich ab. Sie hatte Spätschicht im Pflegeheim gehabt, und der Bus war um diese Zeit dünn besetzt. Lediglich fünf weitere Fahrgäste saßen darin. Sarah suchte nach einem Lächeln, einem fröhlichen Ausdruck, einer besonderen Farbe, sah aber nur Missmut, Gleichgültigkeit und Verschlossenheit.
Björn hätte sich keinen besseren Tag für seine Aktion aussuchen können als den heutigen. Ihr neuer Chef war mal wieder besonders nervig gewesen, nichts hatte man ihm recht machen können. Seit Jahren wurde der Druck immer höher, die Anforderungen stiegen, ständig musste Sarah sich rechtfertigen, warum sie mit den vorgegebenen Zeiten nicht auskam – unmenschliche Zeitvorgaben in einem Beruf, der doch dem Menschen dienen sollte. Und der neue Chef hatte tatsächlich begonnen, die Angestellten mit der Stoppuhr zu kontrollieren. Sporadisch nur, aber immerhin, und er schien Sarah dabei besonders ins Visier genommen zu haben. Er war ein Kostenoptimierer, ein Erbsenzähler. Sie hingegen hielt gern Hände, wenn es jemandem schlecht ging. Wie sollten sie jemals mit diesem Kerl klarkommen?
Immer häufiger fragte Sarah sich, wie lange sie dem Druck noch standhalten würde. Eigentlich liebte sie ihren Beruf, daran zerbrechen wollte sie aber nicht. Mit Björn Kinder zu bekommen und eine Weile ins Familienleben auszuweichen, erschien ihr eine gute, sinnvolle Alternative zu sein. Björn sprach dauernd von Kindern. Eine große Familie zu haben, war ihm sehr wichtig.
Zum Glück gab es am Ende dieses nervigen Tages einen Lichtblick.
Heute Abend. Punkt zwanzig Uhr.
Ihr Lieblingspodcast!
Wenn sie die Augen schloss, konnte sie die Stimme schon hören. Es war wie in einem Film, in dem aus dem Off jemand zu den Zuschauern und Zuschauerinnen sprach. Mit einer charismatischen, tiefen Stimme, dunkel eingefärbt, gleichzeitig aber mit weichem Timbre. Eine Stimme, die einen sofort in den Bann schlug. Gelassen wie ein großer Strom, der sich seiner Ewigkeit bewusst durch die Landschaft strömte. Stundenlang konnte Sarah sich dieser Stimme hingeben, und das würde sie heute Abend auch tun, ganz gleich, was Björn davon hielt. Einmal die Woche stand dieser Termin unverrückbar fest, Björn wusste das. Klar, Sarah hätte sich die Aufzeichnung des Podcasts auch an einem anderen Tag anhören können, aber immer montags kam die neue Folge heraus, und sie war nun mal nur an diesem Abend neu.
Warum nur verstand Björn das nicht? Bei seinem geliebten Fußball war es doch genauso! Da schaute er sich auch keine Aufzeichnung an.
Warum also diese kindische Eifersucht? Hatte sie ihm zu oft von dieser Stimme vorgeschwärmt?
Der Bus näherte sich ihrer Haltestelle. Sarah stand auf und positionierte sich an der hinteren Tür. Regentropfen schlugen dagegen. Schon seit Tagen herrschte dieses deprimierende Novemberwetter, nasskalt, grau, unangenehm. Sarah war lange genug im Job, um zu wissen, dass dieser Monat und dieses Wetter Einfluss auf die Menschen hatten. In den Pflegeheimen stieg dann die Sterbequote. Wer ohnehin keine Kraft mehr hatte, gab jetzt leichter auf als noch im Sommer.
Sarah bemerkte eine Gestalt, die ebenfalls an der nächsten Haltestelle aussteigen wollte. Aufgrund der Statur und Kleidung hielt sie sie für einen Mann, sein Gesicht blieb im Schatten der Regenkapuze seiner grauen Outdoorjacke verborgen. Er trug Jeans und schwarze Stiefel. Am Hals schaute ein dünnes weißes Kabel hervor, das zum Smartphone in seiner Hand führte. Wahrscheinlich steckten in seinen Ohren Kopfhörer, man sah die Dinger heutzutage ja überall. Die Menschen hörten einander nicht mehr zu, alles war ihnen wichtiger als die Person, die ihnen gegenüberstand. Der Mann hielt den Kopf gesenkt und schien vollkommen in die Welt abgetaucht zu sein, die ihm sein Gehör bot.
Der Bus hielt, und Sarah stieg aus. Hinein in die kalte Luft und den Nieselregen. Sie zog die Schultern hoch, den Schal fester um den Hals, stülpte die Kapuze ihrer Jacke über ihren Kopf, packte die Schulterriemen ihres Rucksacks und lief nach links den Bürgersteig entlang. Sie schritt kräftig aus, wollte schnell nach Hause, um sich in Ruhe auf den Podcast vorbereiten zu können, doch nach zehn Schritten drehte sie sich um, weil sie das Gefühl hatte, beobachtet zu werden.
Der Mann aus dem Bus stand noch da.
In ihre Richtung gewandt, stocksteif, mit hängenden Schultern, schaute er ihr hinterher. Regenschleier fielen durch den Lichtkegel der Straßenlaterne auf ihn nieder. Erst jetzt fiel Sarah auf, wie ausgelatscht die Stiefel waren, die er trug. Zu den Außenkanten hin waren die Sohlen so stark abgelaufen, dass er leicht o-beinig dastand.
Sarah Henschel machte, dass sie fortkam.
In ihrer Tasche brummte aggressiv ihr Handy.
4
Das grobe Seil rieb sich mit jedem Schwung in die feuchte Rinde des Baumes – und am anderen Ende in die zarte Haut am Hals der jungen Frau. Die mechanische Gleichgültigkeit der Bewegung glich der eines Metronoms. Vor und zurück, vor und zurück, den Rhythmus gab der Wind vor, der den toten Körper zum Schwingen brachte.
Und dann riss die junge Frau am Seil Augen und Mund weit auf, ein stummer Schrei entrang sich ihr, eine schreiende Anklage im Blick: Warum bist du nicht gekommen? Warum hast du mich nicht gerettet?
Roya Mayer schlug die Augen auf.
Grelle, wild zuckende Lichter, ungewohnte Geräusche und fremde Stimmen um sie herum. Über alledem ein merkwürdiger Geruch, eine Mischung aus Rost und Gummi und Benzin.
Die Welt da draußen war beängstigend, und Roya wollte mit ihr nichts zu tun haben, aber noch weniger wollte sie in diesen Traum zurückkehren, diesen entsetzlichen Traum von eben. Noch immer befand sie sich in seinen Fängen, konnte spüren, wie er versuchte, sie zurück in die Dunkelheit zu zerren, dorthin, wo Bilder und Schreie sich zu einem Horrorszenario vermischten, dem sie nur zuschauen konnte.
Das zuckende Licht verwandelte sich hinter ihrer Stirn zu Schmerz, doch sie unterdrückte den ersten Impuls, die Augen rasch wieder zu schließen, riss sie stattdessen weit auf, konnte aber trotzdem kaum etwas erkennen.
Dafür hörte Roya Stimmen, ganz nah bei sich. Konzentrier dich darauf. Du musst wissen, was sie sagen, sie sind deine Rettung, denn sie gehören nicht zu dem Albtraum.
«…hat wohl telefoniert … Handy gefunden … ist bei den Rettungsarbeiten aber zerstört worden … keine Funktion … typischer Handyunfall … immer wieder dasselbe, die Leute lernen nicht dazu …»
Sie hörte die Worte, verstand auch deren Sinn, sah aber die Personen nicht, die die Unterhaltung führten. Um sie herum flackerte weiterhin blaues Licht in schnellem Rhythmus, irgendwo darin war auch Bewegung, aber Royas Blickfeld war zu eng, um den Bewegungen folgen zu können. Es war, als trüge sie Scheuklappen.
«Martina!», stieß Roya hervor, und in ihrem Kopf klang es, als schrie sie den Namen hinaus. In Wirklichkeit war es aber wohl nicht mehr als ein Krächzen – das sorgte aber immerhin für Aufmerksamkeit.
«Sie ist bei Bewusstsein!», rief jemand. Eine Frau mit einer Polizeimütze auf dem Kopf beugte sich über Roya und schirmte das zuckende blaue Licht ab. Royas Blick war zu verschwommen, um mehr als die diffuse helle Fläche des Gesichts mit den Augen darin erkennen zu können.
«Können Sie mich verstehen?», fragte die Polizistin.
Noch bevor Roya antworten konnte, beugte sich eine weitere Person über sie und legte ihr eine Hand an die Wange. Was für ein schönes, warmes Gefühl das war, mächtig genug, die Tentakeln des Traumes zurückzuschlagen.
«Alles wird gut», sagte diese Person mit einer angenehmen Stimme. «Sie sind in Sicherheit. Sie hatten einen Unfall, aber keine Sorge, es wird alles gut. Mein Name ist Stefan, ich bin der Notarzt, ich bringe sie sofort ins Krankenhaus, und bis wir dort ankommen, kümmere ich mich um Sie. Können Sie mir sagen, wie Sie heißen?»
«Martina …», stieß Roya abermals aus.
«Also, Martina, bleiben Sie bitte ganz ruhig und …»
«Nein, nein, nein, ich heiße Roya … Martina … Ich muss ihr helfen.»
«Das muss warten, jetzt müssen wir erst einmal Ihnen helfen.»
«Wer ist Martina?», mischte sich die Polizistin ein. «War noch jemand im Wagen?»
«Nein, da war niemand», antwortete eine männliche Stimme, die bisher noch nicht gesprochen hatte. «Im Wagen gibt es keine Anzeichen für einen weiteren Insassen. Wir haben alles abgesucht, da ist niemand hinausgeschleudert worden …»
Roya bekam jedes Wort der Unterhaltung mit und ärgerte sich darüber, dass die Menschen um sie herum nicht verstanden, worum es ging.
«Sie … sie wartet an ihrem Baum … sie will sich umbringen», stammelte Roya verzweifelt. Warum nur brachte sie es nicht fertig, klar und deutlich zu formulieren? In ihrem Kopf waren all die dringlichen Informationen vorhanden und abrufbar, doch auf dem Weg bis zu ihren Lippen kam irgendwie alles durcheinander.
«Wir müssen jetzt abfahren», sagte der Notarzt.
«Nein, warten Sie mal …»
Die Polizistin beugte sich tiefer über Roya.
«Roya, mein Name ist Katja … können Sie mir sagen, ob Sie mit Martina telefoniert haben, als der Unfall passierte?», fragte sie.
Roya wollte nicken, konnte aber ihren Kopf nicht bewegen, er schien fixiert zu sein.
«Ich muss zu ihr … können Sie mir helfen, bitte!»
«Aber sicher, ich helfe Ihnen. Können Sie mir sagen, wo ich Martina finde?»
Natürlich konnte Roya es ihr sagen, was für eine dumme Frage. Martina war … Martina war … an ihrem Lieblingsbaum, ihrem Seelenort, dorthin ging sie, wenn sie nachdenken musste, wenn sie allein sein wollte, wenn es ihr schlecht ging. Von diesem geheimen Ort, von dem nicht einmal ihr Partner wusste, aber Martina hatte Roya für das Interview dorthin geführt. Nur dort war es ihr möglich gewesen, sich zu öffnen.
«Ich … ich …»
Roya strengte sich an, doch ihre Gedanken entzogen sich ihrem Willen, lösten sich auf, verschwammen, und dann war da plötzlich wieder dieses furchtbare Geräusch.
Das Knarzen des groben Seiles am Ast des Baumes im Rhythmus des schwingenden Körpers.
Hin und her und hin und her …
5
Eine Stimme kann wie ein Gesicht sein.
Du erkennst darin den Charakter, die Eigenschaften und Emotionen eines Menschen. Jede Nuance Veränderung in der Stimme spiegelt sich in ausdrucksstarker Mimik. Mit einem Zusammenführen der Augenbrauen senkt sich die Farbe der Stimme ins Dunkle, mit einem Lächeln hebt sie sich wieder. Eine Lüge ist oft begleitet von einem suchenden, unsteten Blick, und dann geht die Stimme auf Wanderschaft, mäandert in den Tonlagen, ist sich nicht sicher, wohin der Weg führt, lässt sich von spontanen Einfällen in wechselnde Richtungen lenken.
Die Stimme von Marc Maria Hagen hatte für Sarah Henschel ein Gesicht. Sein reales Gesicht musste sie gar nicht sehen, das kannte ohnehin kaum jemand, und vielleicht wäre das sogar kontraproduktiv. Sarah genügte die Vorstellung. Wenn sie seine Stimme hörte, sah sie ein Gesicht mit erdiger Hautfarbe, eingerahmt von dunklem, vollem Haar. Sie sah braune Augen mit einer Tiefe, die niemand wirklich ermessen konnte. Dieses Gesicht hatte Lachfalten in den Augen- und Mundwinkeln. Wenn Marc lachte, steckte er jeden mit seiner unbändigen Energie an. Zugleich zeichneten sich darin aber traurige Erfahrungen und beeindruckende Erlebnisse ab, die es brauchte, um eine virtuose Melodie auf der Klaviatur menschlicher Emotionen spielen zu können. Dieser Mann hatte viel gesehen und viel erlebt, aber egal, wie schlimm es auch war, sein Optimismus war ungebrochen, seine Zuversicht und sein Vertrauen tief und unerschütterlich.
Sarah Henschel liebte diese Stimme.
Sie liebte den Podcast «Hörgefühlt», den Marc Maria Hagen seit zwei Jahren betrieb. Mittlerweile war es der beliebteste und erfolgreichste Podcast im Bereich Mental Coaching, viele rissen sich darum, einmal als Gast in den Podcast oder zu den Seminaren und Live-Events eingeladen zu werden, die Hagen regelmäßig veranstaltete. Jeder konnte sich darum bewerben, und Sarah Henschel hatte schon vor Monaten damit begonnen, Bewerbungen an diese merkwürdige Mailadresse des Podcasts zu schicken: [email protected]. Das war alles andere als einfach, denn sie musste Fragen dazu beantworten. Fragen wie: Wie definierst du Glück? Woher stammt deine tiefste Verletzung? Wie leicht oder schwer fällt es dir, dich Fremden gegenüber zu öffnen? Mit welchen Gedanken richtest du dich auf, wenn du niedergeschlagen bist?
Bisher waren nur Eingangsbestätigungen zurückgekommen, aber vielleicht würde sie irgendwann das große Los ziehen und mit Marc Maria Hagen über die wirklich wichtigen Dinge des Lebens sprechen können. Bis dahin lauschte sie jeden Montagabend dem Podcast Hörgefühlt. Diese eine Stunde hatte für sie die gleiche Wirkung wie ein Wellness-Wochenende; danach fühlte Sarah sich besser, ganz gleich, wie beschissen der Tag war, und immer nahm sie ein paar besondere Sätze daraus mit in den Alltag hinüber. Worte, die sie beschäftigten, aus denen sich Lehren ziehen ließen, die den Blickwinkel veränderten und die eigenen kreisenden Gedanken in neue Richtungen lenkten.
Zu Hause angekommen, fütterte sie zuallererst ihren Kater Mavi. Mavi war das türkische Wort für Blau, und Sarah, die den Menschen, Tieren, Dingen und Erlebnissen eine Farbe zuordnete, fand, dass ihre Katze blau war. Blau wie ein ruhiger See oder wie ein klarer Sommerhimmel.
Marc Maria Hagen war erdfarben. Also eine Mischung aus Braun, Beige, Schwarz, Grün und Ocker. Ein Mensch wie er konnte niemals nur eine einzige Farbe sein, dafür war er zu vielschichtig.
Ihr Freund Björn war gelb, mit dunklen Flecken darin, von denen Sarah noch nicht wusste, wofür sie standen.
Mavi strich ihr um die nackten Unterschenkel, während Sarah ihm sein Futter zubereitete. Sie mochte das Gefühl seines seidigen Fells an ihrer Haut. Als sie ihm den Napf auf den Küchenboden stellte, nahm Mavi sich die Zeit, seine Nase an ihre zu stupsen, und bedankte sich mit einem wohligen Schnurren, bevor er sich hungrig über das Futter hermachte. Das hatte Mavi immer schon getan, und dafür liebte Sarah ihn.
Sie ließ ihn fressen, wusch sich Hände und Gesicht und zog sich gemütliche Couchklamotten an. Dann bereitete sie sich selbst ihren Lieblingssalat zu. Hinein gehörten Gurken, Tomaten, Radieschen, Walnüsse, Sonnenblumenkerne und ein paar Streifen Hähnchenbrust, bevor sie alles in kalt gepresstem Olivenöl aus Griechenland ertränkte. Nur ein Schuss reichte nicht, der Salat musste schwimmen!
Mit der Schüssel ließ Sarah sich in die Couch fallen und aß, während sie auf ihrem Handy nach Mails und Nachrichten bei Insta oder WhatsApp schaute.
Dort waren weitere Nachrichten von Björn eingegangen. Er machte auf beleidigte Leberwurst, behauptete, sich immer nach ihr richten zu müssen, seine Belange spielten keine Rolle, und das gehe so nicht weiter.
Sarah antwortete nicht darauf. Sie hatte die feste Absicht, sich ihren Podcast-Abend nicht von Björn kaputtmachen zu lassen.
Sie wechselte zum Mailordner. Was sie dort entdeckte, ließ sie im ersten Moment erstarren, dann verschluckte sie sich an einer Gurkenscheibe und musste schließlich in die Küche eilen, um sie mit einem Schluck Wasser aus der Speiseröhre zu spülen.
Sie hatte eine Nachricht mit dem Absender «[email protected]»! Um Gottes willen! War das etwa …?
Zusammen mit Mavi schlich Sarah barfuß ins Wohnzimmer zurück. Aus zwei Schritt Entfernung betrachtete sie das Handy auf der Couch. Ihr Herz wummerte in ihrer Brust. Vor Aufregung schoss ihr das Blut heiß in Ohren und Wangen.
«Mavi, wenn das meine Einladung ist, flipp ich aus.»
Sarah nahm das Handy auf, setzte sich aber nicht wieder auf die Couch, dafür war sie jetzt viel zu nervös. Im Stehen öffnete sie den Mailordner und rief die Nachricht auf. Statt eines Textes entdeckte sie eine Audiodatei.
Na klar, immerhin war der Absender ein Podcaster.
Sarah regelte die Lautstärke hoch und spielte die Datei ab.
«Hey hey, hier ist Brittany, die persönliche Assistentin von Marc Maria Hagen vom Podcast Hörgefühlt. Sarah, meine Liebe, es ist ein Platz im nächsten Hörgefühlt-Coaching freigeworden, und Marc hat dich dafür ausgewählt. Wir würden dich gern für den nächsten Dienstag um 17 Uhr zum Vorgespräch einladen. Die Adresse und weitere Infos findest du im Anhang. Ich weiß, das kommt jetzt kurzfristig, aber wenn du trotzdem möchtest, lass es mich wissen. Ich bin sicher, es wird toll werden!»
Viermal hintereinander spielte Sarah die Nachricht ab, stand dabei stocksteif mitten im Wohnzimmer, ignorierte den immer aufdringlicher um Aufmerksamkeit bettelnden Mavi und spürte, wie ihr flau im Magen wurde.
Sie würde mit Marc reden. Mit Marc Maria Hagen, dem Mental-Coach-Podcaster überhaupt. Er fand sie, eine 29-jährige Angestellte in der Altenpflege, interessant genug, um sie einzuladen.
«Mavi, sag mir, dass ich nicht träume», bat sie ihren Kater.
Als hätte er darauf gewartet, sprang er auf die Lehne der Couch und von dort aus auf ihre rechte Schulter, wo er ihr ins Ohr schnurrte. Sarah ließ sich auf die Couch sacken und nahm ihn herunter. Eben war ihr nur flau im Magen gewesen, jetzt wurde ihr regelrecht schlecht, als sie daran dachte, dass sie sich für das Vorgespräch würde freinehmen müssen. Vielleicht konnte sie Karen überreden, den Dienst mit ihr zu tauschen. Karen mochte den Podcast auch und würde ausflippen, wenn sie das hörte.
«Ich fasse es nicht», sagte Sarah leise zu sich selbst und Mavi. Sie hatte das Gefühl, als nähme ihr Leben gerade eine schicksalhafte Wendung.
6
Kommissarin Carola Barreis stoppte den Dienstwagen vor einer marode wirkenden Brücke aus Holz.
«Ich hab keine Zeit für diesen Mist», sagte sie zu sich selbst.
Sie war müde, hatte schlechte Laune, weil sie bei diesem Dreckswetter in die kalte Nacht hinausmusste, und sie würde nicht riskieren, den Wagen in diesem Bach zu versenken – ganz gleich, ob sich da drüben auf der anderen Seite gerade ein Drama zutrug oder nicht. Umdrehen und wegfahren kam aber auch nicht infrage, also stieß Kommissarin Barreis die Wagentür auf und stieg aus. Ihr Atem wurde zu einer Wolke. Für Anfang November war es bereits erstaunlich kalt. Wenn das so weiterging, würde sie früher auswandern müssen als geplant. Kälte vertrug Carola Barreis gar nicht gut, sie schlug ihr auf die Laune und kroch in ihre Knochen. In Momenten wie diesen erinnerte Carola sich an die Worte ihrer Mutter, die schon lange tot war: Kind, du musst essen, sonst bleibst du auf immer und ewig so spindeldürr und wirst dein Leben lang frieren. Tja, genau so war es gekommen. Carola hatte gegessen, was das Zeug hielt, war trotzdem immer spindeldürr geblieben, und heute, mit 59 Jahren, fror sie schneller und tiefer als je zuvor.
Carola Barreis zog zum Schutz vor der Kälte und dem fiesen Nieselregen die Jacke zu bis unters Kinn und ging vor zu der Brücke. Die dicken Eichenbohlen klangen hohl unter den Absätzen ihrer Stiefel. Sie wunderte sich darüber, dass es eine solche Brücke in Deutschland überhaupt noch gab. Aber dies war ein Wirtschaftsweg, der zwischen Ackerflächen hindurchführte, und wahrscheinlich hatte niemand Interesse daran, für einen Brückenersatz Geld in die Hand zu nehmen, solange es die alte noch tat. Und die Traktorspuren, die Carola entdeckte, sprachen für sich. Wenn das Gestell Traktoren trug, würde es ihren Dienst-Golf wohl auch tragen.
Carola ließ ihren Blick schweifen.
Jenseits der Brücke, die kaum zehn Meter lang war und über einen schmalen Bach mit wenig Wasser führte, verwandelte sich der geschotterte Weg in eine Fahrspur mit Grasnarbe in der Mitte, die zwischen Äckern hindurch eine Anhöhe erklomm. Es war zu dunkel, um zu erkennen, wohin der Weg führte, aber Carola glaubte, am Horizont die schwarze Wand eines Waldes ausmachen zu können. Das würde zu der Beschreibung passen, die sie von der Verkehrspolizei bekommen hatte. Eine Kollegin hatte Carola darüber informiert, eine bei einem Unfall verletzte Frau sei angeblich zu einem Suizid unterwegs gewesen, als sie verunglückte. Unter Mühen hatte sie den Ort beschreiben können, an dem sich eine Frau namens Martina angeblich das Leben nehmen wollte.
Und zwar genau hier. An der einzigen Erhebung weit und breit.
Eine Baumgruppe aus alten Buchen auf einer Kuppe. An der höchsten Stelle der Kuppe eine mächtige Buche, sehr auffällig, man kann sie nicht übersehen.
Carola hatte die Verkehrspolizistin gebeten, selbst nach dem Rechten zu schauen, aber die war an der Unfallstelle unabkömmlich, und da Carola Dienst hatte, war ihr nichts anderes übrig geblieben, als sich auf den Weg zu machen.
Sie ging davon aus, dass es sich hier um einen Irrtum oder eine Inszenierung handelte. Vielleicht hatte diese Martina, von der die verletzte Frau gesprochen hatte, sich nur einen dummen Scherz erlaubt, oder wenn nicht, dann ihr Vorhaben abgebrochen. Carola war lange genug bei der Polizei, um zu wissen, dass viele Suizidankündigungen nur ein Schrei nach Aufmerksamkeit und Hilfe waren und nicht mit dem Tod endeten.
Carola Barreis glaubte nicht, dass sie hier jemanden finden würde. Was auch immer hinter dieser merkwürdigen Geschichte steckte, wahrscheinlich war die verletzte Frau aus dem verunglückten Wagen einem üblen Scherz zum Opfer gefallen. Bisher wusste niemand etwas über die Hintergründe, da die Frau nicht mehr ansprechbar war und sich auf dem Weg in die Klinik befand. Natürlich konnte man es nicht einfach auf sich beruhen lassen, das sah Carola ein, aber es reichte aus, wenn sie zunächst allein nachschaute. Sollte es wider Erwarten Probleme geben, konnte sie immer noch Unterstützung rufen.
Vielleicht hatte die Verunglückte auch einfach nur eine wilde Story erfunden, um ihre Handynutzung während der Fahrt zu erklären. Was das anging, waren Männer und Frauen gleichermaßen kreativ, egal, wie lächerlich ihre Ausrede klingen mochte.
Carola stieg zurück in den Wagen und warf einen Blick in den Rückspiegel. «Scheiß dich nicht ein, da ist keine Leiche», sagte sie zu sich selbst.
Dann steuerte sie den Wagen vorsichtig über die Brücke. Die Holzbohlen dröhnten unter den Reifen. Carola mochte das Geräusch, es klang zuverlässig. Auf dem Sandweg kratzte das hohe Gras am Unterboden des Wagens. Dieses Geräusch mochte sie nicht, klang es doch so, als wollte irgendwas mit langen Krallen unbedingt in den Wagen eindringen. Der Feldweg wand sich den Hügel hinauf. Auf der einen Seite wuchs noch Mais, die Pflanzen waren gut und gerne zwei bis drei Meter hoch und total vertrocknet. Carola fand, dass sie im Licht der Scheinwerfer wie eine Armee von Untoten wirkten, manche Stängel winkten ihr sogar zu. Auf der anderen Seite erstreckte sich ein riesiges Feld, das längst abgeerntet war.
Gab es das? Dass Bauern ein Feld vergaßen?
«Ein Nachname wäre mir lieber, dann kann ich an einer Haustür klingeln», hatte Carola am Telefon zu der Verkehrspolizistin gesagt.
Doch mit mehr als «Martina» konnte sie nicht dienen. Die verletzte Frau war nicht mehr ansprechbar gewesen, und ohne Nachname keine Adresse, deshalb musste Carola mitten in der Nacht durch die Walachei kurven.
Zumindest war sie aber richtig abgebogen. Den Bach und die Brücke in der Nähe der Ortschaft Feldkirchen hatte die Frau explizit erwähnt. Als sie näher an die Kuppe herankam, entdeckte sie links eine Reihe hoher Bäume, die sich bis zum höchsten Punkt hinzog.
Direkt davor verzweigte sich der Feldweg nach rechts und links. Carola stoppte den Wagen, ließ den Motor aber noch laufen.
Sie griff nach dem Innenspiegel und verdrehte ihn ein Stück nach links.
War da nicht gerade etwas gewesen?
Das kurze Aufblitzen von Licht in der Dunkelheit hinter ihr, ungefähr dort, wo sie über die Brücke gefahren war? Carola drehte sich um, sah genauer hin, doch jetzt war dort nichts mehr zu sehen.
«Dann hast du dich wohl getäuscht», sagte sie laut zu sich selbst, stellte den Motor ab, nahm die Taschenlampe aus dem Handschuhfach, stieg aus, trat ein paar Schritte von dem Wagen fort, ließ die Taschenlampe aber noch ausgeschaltet, damit ihre Augen sich an die Dunkelheit gewöhnen konnten.
«Hallo? Ist da jemand?», rief Carola. «Martina?»
Stille. Unter den Bäumen tiefe Schwärze. Regen prasselte leise auf Blätter, riss viele davon zu Boden.
Carola leuchtete den Waldrand ab. Plötzlich schrie irgendwo vor ihr im Wald ein Reh auf. Erschrocken zuckte Carola zusammen.
Sie kämpfte gegen den starken Drang an, zurück in den Wagen zu steigen. Nicht wegen der Dunkelheit oder dem kreischenden Bellen des Rehs, dergleichen machte ihr keine Angst. In nächtlichen Wäldern trieb sich nichts herum, wovor sie sich fürchten musste, sehr wohl aber in ihrem Kopf. Dort war kein Platz mehr für eine mehr. Das Maß war voll, sie spürte es schon lange und hatte Angst vor den Folgen, wenn sie die Warnungen ignorierte. Und das tat sie. Weil es eben ihr Job war und man es von ihr verlangte. Alle gingen wie selbstverständlich davon aus, dass eine erfahrene, abgeklärte Beamtin wie sie, eine «alte» Beamtin, damit keine Probleme hatte.
Aber in ihrem Beruf war Erfahrung nichts anderes als eine Anhäufung schrecklicher Bilder und Erlebnisse. Und jeder Mensch hatte sein ganz individuelles Maß, wie viel davon er ertragen konnte.
«Da ist keine Leiche», sagte sich Carola. «Und selbst wenn, eine geht noch.»
Sie schritt voran. Folgte zuerst dem Sandweg nach rechts und wandte sich dann zum Hügel. Im Licht der Taschenlampe glaubte sie, einen Trampelpfad ausmachen zu können, der zwischen den Buchen hindurchführte.
Plötzlich glaubte sie, links von sich eine Bewegung im Unterholz wahrzunehmen. Abrupt blieb sie stehen und leuchtete dorthin.
Der Lichtkegel der Taschenlampe schnitt ein Loch in die Dunkelheit, doch da war nichts weiter als Bäume und Büsche. Irgendwo knackte es im Unterholz, einen Moment später rief ein Käuzchen. Waldgeräusche eben.
«Los, geh weiter», sagte Carola sich.
Es ging steil bergan, und sie begann zu schnaufen. Immerhin fror sie jetzt nicht mehr.
Auf dem Boden lag Totholz aus den Kronen der alten Buchen. Carola orientierte sich am Gelände. Die verletzte Frau hatte vom höchsten Punkt gesprochen, also ging sie einfach immer weiter, bis es nicht mehr höher ging.
Die mächtige Buche hob sich als Schattenriss vor dem helleren Nachthimmel ab. Zur Wiese streckten sich lange Äste, die selbst fast so dick wie Baumstämme waren.
Carola richtete den Lichtschein der Taschenlampe auf die Krone, suchte die einzelnen Äste ab …
Ihr Herz pochte dumpf in ihrem Brustkorb. Plötzlich fühlte sie sich leer und traurig.
Der Kopf der Leiche war nach vorn abgeknickt, das lange Haar verdeckte das Gesicht. Sie trug gelbe Sneaker mit weißer Sohle, dazu enge Jeans und einen Kapuzenpulli.
«Hallo!», rief Carola wider besseres Wissen.
Keine Reaktion.
Carola stieß ein merkwürdiges Geräusch aus. Irgendwas zwischen Knurren und Würgen. Sie wollte keinen Schritt näher tun, wusste aber, sie musste feststellen, ob die Frau tot war. Plötzlich wurde Carola richtiggehend wütend. Auf diese Frau, die den Unfall gebaut hatte. Auf die Verkehrspolizistin, die umsichtig genug gewesen war, sie anzurufen. Auf diese Frau am Baum. Weil sie alle ihr das antaten.
Die Wut loderte nur kurz auf, verging und machte erneut Leere und Traurigkeit Platz.
Carola Barreis fasste sich ein Herz, schritt voran, bis sie vor der Frau stand, und leuchtete ihr ins Gesicht.
Starre, weit geöffnete Augen.
In den Ohren steckten diese weißen EarPods, die man heutzutage überall sah und die Carola Gehirnstöpsel nannte. Wahrscheinlich hatte sich die Frau zu schöner Musik das Leben genommen.
Immerhin.
Carola wusste, sie durfte nichts anfassen, aber die Neugierde war zu groß. Mit spitzen Fingern klaubte sie den rechten Pod aus dem Ohr der Leiche und steckte ihn in ihr eigenes Ohr, um ihn zu aktivieren.
«…tu, was deine innere Stimme dir sagt, sie ist die einzige Stimme, die dich niemals anlügt …»
Ein Geräusch ließ Carola zusammenschrecken.
Irgendwo in der Dunkelheit des Waldes brach ein trockener Ast. Reflexhaft ließ sie den EarPod fallen und das Licht der Taschenlampe dorthin springen, konnte aber nichts entdecken. Als sie es wieder auf die Leiche richtete, hatte sie für den Bruchteil einer Sekunde den Eindruck, die Finger an der rechten Hand hätten sich bewegt.
Erst jetzt fiel ihr auf, dass beide Hände der Leiche blutbesudelt waren. Nicht nur einige Spritzer und Flecken, nein, die Hände sahen aus, als hätten sie in Blut gebadet.
Mit einem Geräusch voller Qual und Entsetzen wandte Carola sich von der Leiche ab, und obwohl sie in diesem Moment mit sich selbst beschäftigt war, hatte sie überdeutlich das Gefühl, jemand befinde sich in ihrer Nähe. Sie fuhr herum, leuchtete wieder in die Dunkelheit, doch da war niemand.
Plötzlich bekam sie es mit der Angst zu tun und wollte nur noch weg.
7
«Nur was du tief in dir hörst und fühlst, zählt. Immer und überall. Deine innere Stimme sollte stets das Letzte sein, was du hörst, sobald du eine Entscheidung treffen musst. Es gibt keine übergeordnete Instanz, niemanden, der es besser weiß.»
Sarah Henschel gab sich der Stimme von Marc Maria Hagen vollkommen hin, es war, als sänke sie nach einem stressigen Tag in ein weiches Kissen. Einfach nur zurücklehnen, die Welt ausblenden, in sich selbst eintauchen, wo Ruhe und Frieden herrschten.
«Ich habe hier eine Frage von Daniel auf dem Bildschirm», fuhr Marc fort. Während der Sendung konnte man Marc Fragen schicken, die dieser meistens auch sofort beantwortete.
«Aber was, wenn meine innere Stimme durcheinander ist, wenn sie heute dies und morgen das erzählt? Ich habe oft das Gefühl, ich kann ihr nicht trauen.»
«Dazu, mein lieber Daniel, kann ich dir Folgendes sagen: Deine innere Stimme ist niemals durcheinander. Sie ist immer klar und deutlich. Aber es gibt Situationen, in denen wir unter Stress oder Druck nicht auf die richtige Weise hinhören. Nun muss man natürlich wissen, was ist denn die richtige Art hinzuhören?»
Marc Maria Hagen legte eine Pause ein, und Sarah Henschel hielt den Atem an. Der Podcast Hörgefühlt neigte sich seinem Ende zu. Seit fast sechzig Minuten hörte sie zu und war vollkommen gebannt von Marcs charismatischer Stimme und seiner unfassbaren Empathie. Aber auch die Fragen der Gäste hätten von ihr selbst kommen können. Klar, die Probleme der Menschen glichen sich, und viele Themen waren bei Hörgefühlt schon mehrfach besprochen und analysiert worden, dennoch fühlte Sarah sich in dieser großen Community willkommen und aufgefangen. Sie war nicht allein, es gab viele andere da draußen, die von den gleichen Problemen gequält wurden, sich ähnliche Fragen stellten. Ein großes Alleinstellungsmerkmal des Podcasts Hörgefühlt war dabei, dass Marc Maria Hagen die Menschen miteinander verband. Wer wollte, konnte über ihn Kontaktdaten bekommen und sich außerhalb des Podcasts austauschen. Das hatte auch Sarah schon mehrfach getan und nur gute Erfahrungen gemacht. Die Community, die im Schatten des Podcasts heranwuchs, wurde immer größer, eine Schar von Menschen, die sich umeinander sorgte, sich unterstützte, Hilfe anbot. Was konnte es Schöneres geben!
Sarah wartete gespannt. Die Pause dauerte vielleicht etwas zu lang, aber gerade das mochte Sarah an Marc. Er nahm sich Zeit, posaunte nicht einfach irgendwas heraus, dachte lieber länger nach, und wenn er dann antwortete, tat er es mit Tiefe und Substanz.
«Mein lieber Daniel», begann Marc Maria Hagen, und für Sarah hatte seine Stimme in diesem Moment ein klares Gesicht. Ganz so, als schaute sie ihm in einer Talkshow im Fernsehen zu. Ein Gesicht voller Wärme und Klugheit, aber auch mit Zweifeln und Ängsten, denn Marc sagte immer wieder über sich selbst, dass kein Mensch unfehlbar oder allwissend sei, er schon gar nicht.
«Weißt du, ich habe lange nach einem passenden Namen für meinen Podcast gesucht», fuhr Marc nachdenklich fort. «Es durfte nicht irgendeiner sein, nur weil er vielleicht eingängig und gut zu merken ist. Nein, der Name sollte in einem einzigen Wort ausdrücken, worum es im Podcast geht. Er sollte die wichtige Botschaft, die ich euch allen da draußen und auch dir, Daniel, vermitteln will, mithilfe meiner Stimme transportieren. Und dann plötzlich, eines Nachts, als ich noch in meinem kleinen Kämmerchen unter dem Dach am Schreibtisch hockte und arbeitete, war der Name da. Stand vor meinem inneren Auge wie eine Manifestation, plastisch, schön und elegant, und ich wusste sofort, das ist es. Hörgefühlt. In diesem einen Wort steckt alles, was du wissen musst, mein lieber Daniel. Weißt du, warum?»
Wieder eine Pause.
«Hörgefühlt ist eine Abwandlung des Wortes ‹hergehört›. Hergehört meint, du sollst auf das hören, was andere dir sagen, und das ist nach meinem Dafürhalten das Schlechteste, was du tun kannst. Der Mensch, das muss man wissen, lieber Daniel, ist ein zutiefst eigennütziges Wesen. Er tut nichts ohne den Blick auf seinen Vorteil. Wenn dir also jemand einen Rat erteilt, dann spielst du in der Kosten-Nutzen-Rechnung nur die zweite Geige. Die Erste spielt er selbst. Und ich sage das ganz ohne Wertung, es ist einfach so, wie es ist, so sind wir Menschen gemacht. Es gibt nur einen Weg, dieser Ratschlag-Falle zu entgehen. Weißt du, unsere Nase kann nur riechen, was außerhalb von uns ist, unsere Augen nur sehen, was um uns herum stattfindet. Unsere Haut nimmt nur Berührungen von außen wahr. Unsere Sinne sind also auf die Außenwahrnehmung spezialisiert. Für das Überleben unserer Spezies ist das natürlich von großem Vorteil, denn die Welt ist voller Gefahren. Aber die Natur wäre nicht so perfekt, hätte sie uns nicht auch eine Innenwahrnehmung mitgegeben. Wir können in uns hineinhören, denn in uns gibt es eine Stimme, die immer schon zu uns gesprochen hat und der weiseste Ratgeber ist, den man sich nur denken kann. Nun kann man behaupten, das mache mich und meinen Podcast überflüssig, doch das ist zu kurz gedacht. Es geht mir nicht um Ratschläge, sondern darum, dich und alle anderen da draußen für das Hörfühlen zu sensibilisieren.»
Sarah Henschel hätte Marc am liebsten applaudiert. Sie nahm sich die Überzeugung heraus, Marc Maria Hagen zu verstehen wie kaum ein anderer oder eine andere, und es