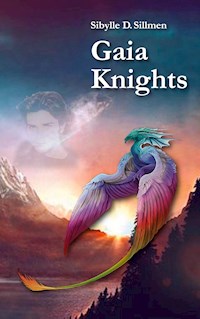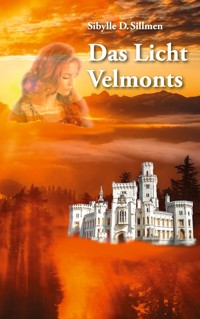
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: TWENTYSIX
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Gaya
- Sprache: Deutsch
Manchmal musst du deine Ängste verbergen und unter Tränen lächeln, um für andere ein Licht zu sein Sie sind kalt, gewissenlos, tödlich. Dunkle Mächte vom Anbeginn der Zeit bringen sich in Stellung und bedrohen das Leben in den Königreichen. LaDera will verhindern, in einen alten Konflikt zwischen den Gottheiten Gayas und den dunklen Mächten hineingezogen zu werden. Doch dann beginnen die Träume. Jede Nacht schreckt sie aus demselben Albtraum auf. Sierras Berichte wühlen sie auf und beunruhigen sie mehr, als sie sich eingestehen möchte. Ein Versprechen, das sie einst gegeben hat, und eine einzige Entscheidung bringen sie in eine scheinbar ausweglose Situation. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Autorin, Jahrgang 1982, entdeckt schon als Jugendliche ihre Liebe zur Fantasy-Literatur. Geprägt wird sie insbesondere durch die Romane von Marion Zimmer-Bradley und Wolfgang Hohlbein.
Aus einem gegebenen Versprechen entsteht ihr Debüt-Roman, Gaia Knights.
Das Licht Velmonts erzählt nun die Geschichte, die ihren Anfang in Gaia Knights nimmt, weiter.
Inhaltsverzeichnis
Staturos
Dunkelheit
Gladiators
Hochverrat!
Andere Wege
Für euch!
Die Zeichen des Weines
Begegnungen im Wald
Der Plan der Mächte!
Benimm dich!
Davarin
Aufbruch
Gefährliches Wasser
Nach Westen
Unicorns
Nicht der glücklichste Eurer Tage!
Still!
Feindesland
Stumme Botschaften
Nach Velmont
Verlassen
Familientreffen
Ferum
Ein Rettungshelikopter
Duell der Könige
Nachrichten aus dem Norden
Eine sich selbst erfüllende Prophezeiung
Stufen in der Dunkelheit
Das Leben ist eine Treppe, keine Tür!
Inmitten der Nacht
Wie ein Faden in der Dunkelheit
Der schnellste Lift Gayas!
Ein Schluck Wahrheit und ein Augenblick der Erkenntnis
Ungeduldig
Tario
Unsichtbar vor der Nase
Venyr
Aufbruch zur Morgenstunde
Lärmschutz
Der Zug der Feen
Die Aussicht auf ein Versprechen
Eine alte Bekannte
Die Macht des Schicksals
Weiß!
Der Schwur
Familie
Dicht über dem Boden
Die Zukunft naht
Das Ende der Nacht
Der schicksalhafte Morgen
Das Licht der Hoffnung
Das Danyr Soradum
Gemeinsamkeiten
LaD’era!
Glossar
Danksagung
Staturos
Ich sehe alles!
Ich sehe was war, was ist und was sein wird. Alles in einem Augenblick.
Ich sehe eine Zeit, in der Gier und Kälte in die Herzen des Großen Volkes Einzug hält.
Ich sehe eine Zeit, in der Angst und Ungewissheit in der Welt erstarken.
Ich sehe eine Zeit, in der Bande zerreißen.
Ich sehe eine Zeit, in der Misstrauen die Angst und den Hass nährt.
Ich sehe eine Zeit, in der auseinandertreibt was zusammengehört.
Ich sehe eine Zeit, in der sich der Himmel verdunkelt und die Welt, wie ihr sie kennt, in ihren Grundfesten erschüttert wird.
Ich sehe eine Zeit, in der fruchtbare Felder verdorren und das Leben erlischt.
Ich sehe eine schwarze Nacht in einen grauen Morgen übergehen, bar jeder Hoffnung.
Ich sehe, wie sich der Morgen in einen Tag wandelt, an dem sich das Schicksal des Großen Volkes entscheidet.
Doch ich sehe auch ein Kind, das ein altes Erbe in sich trägt.
Geboren unter Menschen, herangewachsen unter Mächten, wird es zurückkehren als Schild und Speer dieser Welt.
Ich sehe das Licht der Hoffnung die Stufen der Verdammnis erklimmen.
Ich sehe, wie es sich ausbreitet und die Dunkelheit erhellt.
Ich sehe, wie sich zusammenfügt was getrennt, heilt was gebrochen.
Ich sehe Liebe, die den Hass bezwingt.
Ich sehe das Leben und die Ewigkeit.
Staturos im Winter der einhundertfünfzigsten Sonne der Reiche, Beginn der achten Sonne unseres Königs Velas auf dem Thron von Velmont, Westliches Reich.
Seher von Ardan
Dunkelheit
»Wo bin ich? Es ist so kalt und dunkel. Ich kann meine Hand vor Augen nicht erkennen. Wände umgeben mich, doch sie sind so unnatürlich glatt, wie Glas. Ich fühle keine Risse, keine Fugen… Wie kam ich nur hierher?
Ich weiß, dass ich diesen Ort verlassen muss! Doch wie?
Wohin soll ich mich wenden? Woran soll ich mich orientieren? An diesem Lufthauch, den ich fühle? Wenn mir doch bloß nicht so kalt wäre! Meine Finger sind ganz klamm und meine Beine schmerzen.
Still! Was war das? Höre ich Schritte? Bin ich hier nicht alleine? Teilt etwas mit mir diese Dunkelheit?
Stolpernde Schritte. Ich höre sie deutlich. Sie kommen näher! Ich muss fort von hier! Wenn doch nur nicht meine Beine so schmerzen würden. So bewegt euch doch!
Sie werden lauter! Die Schritte folgen mir!
Wohin führt nur diese Wand? Führt sie geradeaus, oder stetig im Kreis? Entferne ich mich, oder kehre ich immer wieder zu meinem Ausgangspunkt zurück? Ich weiß es einfach nicht!
Was immer mich auch verfolgt, es bewegt sich schneller!
Die Schritte werden lauter! Sie sind schon ganz nah! Ich kann ihm nicht entkommen! Es gelingt mir nicht! Er holt mich ein! Er greift nach mir!
Nein! Loslassen! Lass mich los! Nicht! Lass mich…
Genug!«
»LaD’era! Hör doch! Wach auf! Hörst du mich?«
»Licht! Genug!«, LaD’era riss die Augen auf.
Gladiators
»Oh, Mann! Thoras! Das reicht jetzt! Ich hab’ echt genug für heute.«
Kirvas ließ Lenier sinken und schaute den Donnergott Gayas missmutig an. Seit er aus Gaya zurückgekehrt war, spielte er täglich eines der langweiligsten VR-Spiele, die wohl jemals entwickelt worden waren. Das Spiel trug den Namen Gladiators und die ganze Welt des Spiels bestand aus einem Sandplatz mit einer Treppe aus unebenen, unterschiedlich hohen Stufen, mehreren, an groben Seilen aufgehängten Sandsäcken und einem einzigen Gegner mit einem riesigen Hammer, der dem Donnergott Gayas zum Verwechseln ähnlich sah.
»Schon aus der Puste?«, fragte dieser und grinste, wie ein kleiner Schuljunge, der seinem Lehrer gerade einen Streich gespielt hatte, über das ganze Gesicht.
»Schon? Ich weiche gefühlt seit Stunden deinem Hammer aus. Du magst es nicht verstehen, aber es ist richtig anstrengend!«
»Das Ausweichen?«
»Das auch.«
»Was ist das andere?«
»Die zwei Leben, die ich gleichzeitig führe, vielleicht?
Schon mal daran gedacht, dass das ein bisschen zu viel sein könnte? In dem einen muss ich das Kämpfen lernen, und in dem anderen muss ich irgendwie den Schulstoff in meinen Kopf bekommen. Hey, Mann! Ich komm’ mir vor, als sei ich Superman.
In der Schule, darf ich den Unscheinbaren geben und niemand darf erfahren, was geschieht, wenn ich meine Zimmertür hinter mir schließe. Mist, Mann! Weißt du was?
Ich muss morgen Geschichte abgeben und hab’ mir das Material noch nicht einmal angeschaut! Das funktioniert so einfach nicht!«
Thoras hatte Kirvas geduldig zugehört, doch sein Grinsen hatte während Kirvas’ Schimpftirade deutlich zugenommen.
»Niemand sagte, dass es leicht wird. Bis morgen, in alter Frische, Hüter!«, sagte Thoras.
Kirvas traute seinen Augen nicht. Eben hatte er ihn noch deutlich vor sich stehen sehen, mit seinem bis unter die Brust aufgeknöpften Hemd und dem gewaltigen Hammer in der rechten Hand. Doch schon mit dem nächsten Wimpernschlag war der Donnergott – und mit ihm Lenier – verschwunden. Sie hatten sich einfach aufgelöst, als seien sie niemals da gewesen.
Deutlich fühlte Kirvas nun den Controller in seiner rechten Hand und zog sich den VR-Helm vom Kopf, als der Sandplatz verschwunden war und die Bildschirme vor seinen Augen schwarz geworden waren. Von der Last des Helmes befreit, atmete er tief durch, ehe er sich eine schweißnasse Strähne aus der Stirn strich und sein T-Shirt ergriff, um es etwas von der Haut anzuheben. Es war so durchgeschwitzt, dass es unangenehm nass an ihm klebte.
Kirvas roch den stechenden Geruch seines eigenen Schweißes und zog die Nase kraus.
»Muss dringend duschen«, dachte er und flüsterte leise, während er sich seines T-Shirts entledigte:
»Das gibt’s doch nicht! Der macht mich fertig.«
»Wer macht dich fertig?«
Kirvas stieg mit zitternden Knien von der Motionplattform herunter und drehte sich zur Küche um, aus deren Richtung Romars Stimme gekommen war. Sein Mitbewohner schloss soeben den Kühlschrank und schaute ihn aus seinen rehbraunen Augen fragend an.
»Wer soll mich schon fertig machen, Romar? Thoras natürlich! Hab’ das Gefühl, dass ich Stunden mit ihm auf diesem elenden Sandplatz verbracht hab’.«
»Mhm«, machte Romar und biss beherzt in sein Käsebrot ehe er mit vollem Mund weitersprach und einen Tsunami aus Brotkrümeln entfachte, »kommt hin.«
»Was? Was meinst du?«
Kirvas riss die Augen auf und schaute in Richtung des großen Fensters. Wo war denn das Tageslicht geblieben? Wie spät war es?
Sein Blick irrte zum Nachttisch und Kirvas fühlte, wie er beim Anblick seines Funkweckers bleich wurde. In roten Ziffern las er 21:35 Uhr.
»Mist! Mist! Mist! Mann!«
»Was denn?«, wollte Romar wissen.
»Siehst du, wie spät es ist?«
»Mhm«, antwortete Romar, »25 vor Toreschluss. Wenn du auch noch Käse haben willst, musst du dich beeilen.«
Kirvas schüttelte den Kopf:
»Mir geht es doch nicht um den Käse! Ich muss morgen meine Geschichtsarbeit abgeben. Die heiligen Bäume der Kelten! Ich hab’ mir das noch nicht mal angeschaut«, Kirvas atmete ein paar Mal tief durch, »das wird mal ’ne richtig lange Nacht.«
»Finde ich nicht«, sagte Romar und Kirvas lachte auf.
»Klar doch! Der Gayaner hier muss ja auch keine Hausaufgaben erledigen. Lass mich ins Bad! Ich brauch’ dringend ’ne Dusche.«
Hastig ergriff er die auf dem Bett bereitgelegte Wechselkleidung und war bereits im Begriff an Romar vorbeizueilen, als es plötzlich an der Tür klopfte.
»Es ist halb zehn! Wer kommt jetzt noch vorbei?«
Doch auf Romars Antwort wartete er vergebens. Kirvas sah, wie sein Mitbewohner rot anlief und krampfhaft zu husten begann, als er sich an seinem Bissen Käsebrot verschluckte. In seinen Augen stand Panik, als er Kirvas auf das Bett stieß und selbst in Richtung Badezimmer sprintete.
»Hey! Mann!«, rief ihm Kirvas nach und rappelte sich wieder auf, »Was soll das jetzt?«
»Wenn das Linda ist, ich bin nicht da!«, zischte Romar und schloss eilig die Badezimmertür, ehe er sie von innen sogar verriegelte.
»Du übertreibst, Mann! Wer ist überhaupt Linda?«
»Mädchen aus der Mittelstufe«, hörte er Romar gepresst durch die Tür hindurch antworten.
»Hieß sie nicht Nicole?«
»Das war letzte Woche.«
»Oh Mann! Romar!«, Kirvas schüttelte den Kopf und schaute an sich herab. Da stand er nun, in einer ausgebeulten Trainingshose, mit freiem Oberkörper, vollkommen verschwitzt und sollte Romar wieder einmal vor der Zuneigung eines Mädchens retten. Konnte sein Zimmergenosse nicht einfach seinen Charme weniger großzügig unter den Mädchen der Mittelstufe verteilen?
»Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Linda also«, flüsterte Kirvas und ging in Richtung der Eingangstür. Er hatte den kleinen Flur, in dem seine ausgetretenen Sportschuhe standen, noch nicht erreicht, als er erneut innehielt. Etwas war eigenartig. Kirvas fühlte, wie sich die feinen Haare auf seinen Unterarmen aufzustellen begannen. Er fühlte den Widerwillen, wie er sich seiner langsam bemächtigte. Alles in ihm schrie, er solle diese Tür nicht öffnen.
»Reiß dich zusammen, Mann!«, flüsterte er. »Ist doch nur wieder einmal ein Mädchen aus der Mittelstufe.«
Dennoch musste sich Kirvas einen Ruck geben, um den Flur, der ihn zur Eingangstür führen würde, zu betreten.
Doch mit jedem Schritt, den er sich der Tür näherte, wuchs seine Gewissheit, dass er sie nicht öffnen wollte.
Schließlich hatte er die Tür erreicht und streckte langsam seine Hand nach der Klinke aus, als es erneut, dieses Mal jedoch um einiges energischer, klopfte.
»Mist, Mann! Ich stell’ mich an, wie ein verschüchtertes Reh«, schalt er sich in Gedanken und setzte ein freundliches, jedoch, wie er hoffte, unverbindliches Lächeln auf, ehe er noch einmal tief durchatmete und die Tür öffnete.
Das Lächeln gefror auf seinen Lippen.
»Äääh, hi Kirvas.«
»Theresa. Was treibt dich denn hierher?«
Theresa ließ ihren Blick über seinen freien Oberkörper wandern und hob eine Augenbraue, als sie bei seinem Sixpack, das sich zwischenzeitlich deutlich unter seiner Haut abzeichnete, angekommen war. Noch nie hatte sich Kirvas so unwohl unter dem Blick eines Mädchens gefühlt. Nun, vielleicht lag es auch einfach daran, dass ihn noch nie ein Mädchen mit freiem Oberkörper gesehen hatte.
»Hätte die Tür nicht öffnen sollen«, dachte er.
»Ähm, willst du mich nicht rein lassen?«, fragte Theresa und löste endlich wieder ihren Blick von seinem Bauch, nur um sofort, an ihm vorbei, in den Wohnraum zu schauen. Hastig zog Kirvas das Türblatt etwas heran, so dass es Theresa den Blick versperrte.
»Sorry. Passt gerade nicht.«
Was war denn das? Hatte Theresa gerade tatsächlich die Zähne gefletscht? Doch der Augenblick war vorüber und Kirvas war sich anschließend nicht sicher, ob er Theresas gefletschte Zähne tatsächlich gesehen, oder sich das Ganze nur eingebildet hatte. Wenn sie die Zähne gefletscht hatte, so hatte sie sich nun wieder in der Gewalt.
»Ähm. Meine Eltern sind am Wochenende verreist und ich feiere eine Party. Wäre toll, wenn du auch kommen würdest. Kannst ja den Prisma mitbringen.«
Gab sie denn nie auf? Kirvas schüttelte den Kopf.
»Muss was für Geschichte nacharbeiten. Geht nicht, sorry«, antwortete er und das war nicht einmal gelogen.
Schon wollte er die Tür wieder schließen. Doch es gelang ihm nicht. Noch bevor er die Tür hatte schließen können, hatte Theresa bereits ihren Fuß zwischen das Türblatt und die Zarge gestellt.
»Dann ein andermal?«, fragte sie.
Sie stand nun ganz nah bei ihm. Viel zu nah und Kirvas fühlte, wie ihn sein Widerwille ansprang und kräftig schüttelte. Doch Theresa schien seine Antwort nicht abwarten zu wollen.
»Bis dann«, flötete sie und verzog ihr Gesicht zu einer Grimasse, die wohl ein Lächeln hätte darstellen sollen, ehe sie sich abwandte und den Gang vom Wohnkomplex in Richtung der Haupttreppe zurückeilte.
Kirvas war wie erstarrt. Er stand da und schaute ihr nach, bis sie die Treppe erreicht hatte und schloss erst wieder die Tür, nachdem sie außer Sichtweite war.
Warum hab’ ich nicht einfach »nein« gesagt?
Einen tiefen Seufzer ausstoßend, lehnte er sich mit dem Rücken gegen das Türblatt und schüttelte den Kopf.
»Wie ist die denn hier rein gekommen«, fragte er, immerhin war es bereits kurz vor 22:00 Uhr. Kirvas hörte das leise Schaben der Badezimmertür auf den geriffelten Fliesen, als Romar seinen persönlichen Panic-Room wieder verließ.
»Durch die Tür«, sagte er und lehnte sich neben Kirvas an die Wand.
»Hey, Mann! Ich weiß, dass sie nicht durch ein Fenster gestiegen ist. Aber das Gebäude wird um 19:00 Uhr abgeschlossen. Es ist kurz vor 22:00 Uhr. Also? Wie kam die mitten in der Nacht hier rein?«
»Ihr Papi hat viele Apparaturen der Sorte, die du da auf dem Tisch stehen hast, vorbei gebracht, damit sie eine gute Bewertung bekommt.«
»Apparaturen, wie die, die ich auf dem Tisch stehen hab’?«
Kirvas’ richtete seinen Blick auf seinen Schreibtisch und fixierte den Computer, der darauf stand. Sogleich fühlte er, wie ihn sein Widerwille erneut packte und kräftig schüttelte. »Computer? Der hat die Schule mit neuen Computern ausgestattet? Oh, Mann, ey! Das war ja so klar«, stieß er hervor. »Lernen ist ja zu viel verlangt. Offensichtlich muss man das ja gar nicht, wenn Papa viel Geld hat. Aber weißt du was so richtig übel ist? Die kommt damit auch noch durch!«
Kirvas fühlte, wie er vor Wut innerlich zu kochen begann.
Er ballte seine Hände zu Fäusten und wollte irgendwo dagegen schlagen, als Romar weitersprach:
»Sag mal, Hüter, warum gibst du ihr eigentlich diese Apparatur aus der Schublade nicht? Dann hast du sie doch los.«
»Du meinst, ich soll ihr den Prisma geben. Ihr? Keine Chance, Mann! Niemals!«
»Ist ja gut! Beruhige dich mal wieder. Aber warum nicht?«
Kirvas atmete tief durch und öffnete seine, zu Fäusten geballten, Hände wieder. Romar hatte ja Recht. Es nutzte ihm nicht, sich über Theresa aufzuregen, oder über den Umstand, dass es ihm einfach nicht gelingen wollte, ihr klarzumachen, dass sie bei ihm auf Granit biss. Dass ihm nichts an ihrer Gesellschaft lag und dass er nicht mehr zu den Jungen gehörte, die sie um den Finger wickeln konnte.
Kirvas drängte seine Wut soweit er konnte zurück, ehe er leise antwortete:
»Ich hab’ ihn auf Gaya gesehen. Wenn ich ihn irgendjemandem gebe, dann muss dieser Irgendjemand etwas ganz Besonderes sein. Sie«, er deutete mit dem Daumen über seine Schulter auf das Türblatt, hinter dem vor wenigen Minuten noch Theresa gestanden hatte, »sucht doch nur ein neues Souvenir für ihre Sammlung. Sie würde ihn niemals wertschätzen. Das kann sie ja überhaupt nicht, weil sie nicht einmal weiß, was Wertschätzung ist. Sie weiß nicht, was Loyalität bedeutet, oder Selbstaufopferung.
Denkst du, sie würde Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um ein Versprechen zu halten, das sie dir gegeben hat? Würde sie sich opfern, um dich vor unbekannten Gefahren zu schützen? Würde sie Schmerzen aushalten, nur, um dich an dein Ziel zu bringen?«
»Ähm, du redest gerade schon noch von Theresa, oder?«, fragte Romar und Kirvas stutzte.
»Sorry, Mann! Ich bin einfach fertig.«
»Ach so!«, sagte Romar und hielt Kirvas sein angebissenes Stück Brot unter die Nase. »Willst du wirklich kein Käsebrot?«
»Nee, Mann! Hab’ echt keinen Hunger.«
»Dann nicht!«, sagte Romar und zog das Käsebrot wieder zurück. Argwöhnisch roch er an der Käsescheibe, schnüffelte dann weiter und roch schließlich an Kirvas.
»Puh! Mann, Hüter, du solltest dich waschen! Ein Iltis riecht angenehmer«, rief er und rutschte etwas von Kirvas ab.
»Na, dann lass mich doch einfach vorbei. Ich hätte schon lange eine Dusche genommen, hätte sich Romar-Hasenfuß nicht vor einem Mädchen aus der Mittelstufe im Badezimmer verschanzt«, antwortete Kirvas lachend und fühlte zugleich, wie sich sein Ärger aufzulösen begann.
Mit zwei schnellen Schritten schob er sich an Romar und seinem Käsebrot vorbei, um die schon lange angedachte und dringend notwendige Dusche zu nehmen.
Während das heiße Wasser auf seine Schultern herab prasselte und in Rinnsalen seinen Rücken hinunterfloss, stand Kirvas einige Minuten einfach nur da und genoss das Gefühl, als sich seine verkrampften Muskeln zu lockern begannen. Doch erst, als er sich wieder entspannt fühlte, griff er zu einem Stück Seife.
Die Wut, die Theresas Besuch bei ihm ausgelöst hatte, hatte sich vollständig aufgelöst, doch etwas Anderes, das er in den letzten Monaten zu unterdrücken versucht hatte, war wieder an die Oberfläche getreten.
Das heiße Wasser traf auf das Seifenstück in seiner Hand und augenblicklich verbreitete sich der Geruch von frischer Minze im Badezimmer. Während Kirvas tief einatmete, lehnte er seine Stirn gegen eine Kachel und schloss die Augen.
Wenige Atemzüge später waren die Bilder zurück und dieses Mal ließ er es geschehen. Kirvas sah den Tümpel, in dem sich die Myraver spiegelte und er sah das blaue Leuchten eines Kampfstabes, der an den Büschen lehnte.
Er roch den Geruch einer Blumenwiese und hörte das Plätschern des Wassers, als es aus langen, gewellten, roten Haaren zurück in den Tümpel tropfte. Er sah die feine, silberne Linie auf blasser Haut, die vom Nacken bis unter das Schulterblatt reichte und die sich mitbewegte, als sie ihr Haar ergriff, um es auszuwringen.
»Warum konntest du nicht mit mir kommen?«, flüsterte er. »Und warum sagt mir Thoras nicht, wo du gerade bist und was du gerade tust? Ich will doch nur sicher sein, dass es dir gut geht und… Mist, Mann! Ich würde dich so gerne wiedersehen.«
Kirvas gab sich einen Ruck und drängte die Erinnerungen, die ihn zu übermannen drohten, schnell zurück. Hastig löste er seine Stirn von der Kachel um sich einzuseifen und die Seife wieder von seiner Haut zu spülen. Mit einem schnellen Ruck am Regler drehte er das Wasser ab und angelte nach dem Badetuch, das an einem Haken neben der Dusche hing, ehe er den Duschvorhang beiseite zog und stutzte.
»Wie lange habe ich denn das heiße Wasser laufen lassen«, fragte er sich, »offensichtlich zu lang!«
Als Kirvas die Dusche verließ, fand er das Badezimmer vollständig in Dampf gehüllt vor. Wie dichter Nebel breitete sich der Dampf in dem kleinen Raum aus und legte sich als feiner Wasserfilm über die Armaturen. Kirvas trocknete sich ab und überlegte, ob er sich auch noch rasieren sollte. Bevor er das Für und Wider einer Rasur abgewogen hatte, bewegte er bereits seine Hand langsam in Richtung des Nassrasierers. Er ergriff ihn, hielt dann jedoch wieder inne und löste seine Finger vom metallenen Griff. Der Rüffel, den ihm Rufers wegen eines nicht glatt rasierten Gesichtes erteilen würde, war sicherlich nicht so schlimm, wie die Strafe, die sein Geschichtslehrer aussprechen würde, wenn er ohne fertige Hausaufgaben in der nächsten Doppelstunde auftauchen würde.
»Mist, Mann! Warum musste das Kultusministerium auch das Jahr der Kelten ausrufen? Nur, weil die auf dem Bauplatz für das neue Forschungszentrum ein paar Tonscherben, die von den Kelten stammen KÖNNTEN, ausgebuddelt haben«, maulte Kirvas und schlüpfte schnell in seine frische Kleidung, ehe der Dampf, der sich wieder auf seine Haut legen wollte, das Ankleiden erschweren würde. Gerade wollte er das benutzte Badetuch auf den dafür vorgesehenen Ständer hängen, als sein Blick auf einen Schnellhefter, der auf dem Waschtisch abgelegt worden war, fiel. Kirvas stutzte.
Ein Badezimmer, das gerade vollständig in Dampf gehüllt war, war sicherlich nicht der richtige Ort für etwas, das einige Seiten Papier enthielt. Noch einmal trocknete er sich die Hände ab, ehe er den Ordner ergriff und die Badezimmertür öffnete.
»Romar«, fragte er, »was ist das?«
»Ach das!«, antwortete Romar nach einem kurzen Blick auf den Schnellhefter. »Das hat Ruferus vorbeigebracht, als du trainieren warst. Er meinte, dass du dir das bis morgen durchlesen solltest.«
»Aha«, erwiderte Kirvas und öffnete den Schnellhefter.
»Die heiligen Bäume der Kelten«, las er. »Hausarbeit ausgearbeitet von Kirvas Eiländer.«
Noch einmal las er die Überschrift und fühlte, wie ein Lachen in ihm aufzusteigen begann, das sich schließlich Bahn brach.
»Ich raff das einfach nicht! Mein Geschichtslehrer erledigt meine Hausaufgaben für mich.«
Kirvas blätterte den Aufschrieb durch und las einige Passagen der Hausarbeit:
»Oh«, sagte er. »Er schreibt aber packend.«
Hochverrat!
Wer hatte sie gepackt? Wer hielt sie fest? LaD’era blinzelte gegen das plötzlich so grell wirkende Licht des Mondes an und erkannte im Gegenlicht eine schmale Gestalt, die über ihr kniete, sie gepackt hatte und sie mit aller Kraft auf den Boden drückte. Langes, braunes Haar umrahmte das schmale Gesicht. LaD’era konnte den Bogen und den Pfeilköcher im fahlen Licht des Mondes erkennen.
Sierra!
»Bist du wach?«
Wie oft hatte Sierra sie das bereits gefragt? LaD’era versuchte zu antworten, doch ihre Stimme wollte ihr nicht gehorchen. Noch immer fühlte sie ihren eigenen Herzschlag in ihrer Schläfe pochen und hörte das Rauschen des Blutes in ihren Ohren. Die Eindrücke des Traumes hielten sie gefangen und ließen sie nur langsam wieder los.
LaD’era hörte, wie Sierra wieder und wieder die Luft einsog, ehe sie sie erneut ansprach:
»LaD’era! Bitte! So sag doch was!«
»Ich bin wach«, flüsterte LaD’era nicht fähig, ihre Stimme zu nutzen. Ihr Hals fühlte sich trocken und rau an. Warum nur? Hatte sie während des Traumes geschrien?
»Ich lass dich jetzt wieder los«, sagte Sierra, nachdem sie noch einmal prüfend die Luft eingesogen hatte, und lockerte den Griff um LaD’eras Handgelenke. Langsam rutschte Sierra etwas von ihr ab, so dass sich LaD’era aufrichten konnte. Doch noch immer beobachtete sie sie genau und sog in kurzen Abständen prüfend die Luft ein.
»Willst du etwas trinken?«, fragte sie schließlich. Jedoch wartete sie LaD’eras Antwort nicht ab, sondern stand bereits auf, um zu dem Wasserfass am anderen Ende des Raumes hinüberzugehen.
Sierras Schritte auf den alten Holzdielen hallten unnatürlich laut in der Stille des Waldes hier im Niemandsland, in den sie auf der Flucht vor den Schatten vor etwas mehr als sechs Monden gelangt war.
LaD’era fühlte die nächtliche Kühle des Waldes, die durch die Ritzen in den Holzwänden der Hütte drang. Doch diese Kälte war es nicht, die sie frösteln ließ.
Langsam richtete sie sich auf und tastete nach ihrem Cape, um es sich über die Schultern zu ziehen. Doch auch dem wärmenden Cape gelang es nicht, die Kälte zu vertreiben, die sich in ihrem Körper einzunisten versuchte. LaD’era fror erbärmlich und konnte nur mit Mühe das Klappern ihrer Zähne unterdrücken.
Was war nur los? Warum gelang es der Kälte aus ihrem Traum sie noch immer gefangen zu halten?
»Schon wieder so ein Albtraum«, fragte Sierra als sie langsam, einen bis zum Rand mit klarem Wasser, in dem sich das Mondlicht spiegelte, gefüllten Becher balancierend, auf sie zukam und sich schließlich neben sie auf die Decke setzte. »Nicht irgendein Albtraum«, sagte LaD’era und ergriff den ihr angebotenen Becher. »Es ist der gleiche Traum. Ich irre durch dunkle Gänge und flüchte vor etwas, das mich verfolgt und schließlich einholt. Egal, wie sehr ich mich anstrenge, egal, was ich auch tue, ich kann nicht entkommen. Es gelingt mir nicht.«
Sie versuchte den Becher an ihre Lippen zu führen, doch ihre Hand zitterte so sehr, dass das Wasser über den Rand des Bechers schwappte und als Rinnsal an ihm herablief.
Schnell griff LaD’era auch mit ihrer Linken zu und führte den Becher an ihre Lippen. Vorsichtig nahm sie einen kleinen Schluck des frischen Wassers.
Es war eiskalt und schmerzte, als es ihre ausgedörrte Kehle zu benetzen begann. Erst nach dem vierten Schluck wurde es etwas besser und LaD’era fühlte, wie sich ihr Herzschlag zu beruhigen begann.
Langsam verblassten die Eindrückte des Traumes, so dass sich die Prinzessin des Westlichen Reiches wieder der Gegenwart zuwenden konnte. LaD’era hob ihren Blick und kreuzte den Sierras. Deutlich konnte sie die Sorge, die darin lag, ablesen.
»Oh, bitte nicht! Warum nur sorgen sich alle, die ich treffe, um mich?«, fragte sich LaD’era.
Das war nun wirklich das Letzte, was sie wollte.
»Du warst lange weg«, sagte sie im Versuch, Sierras Gedanken auf etwas anderes, als sie und ihren Zustand zu lenken.
»Hattest du Schwierigkeiten, Velmont wieder zu verlassen?«
»Velmont zu verlassen? Du scherzt! Ich bin nicht einmal nach Velmont hineingekommen.«
»Nicht hineingekommen. Weshalb nicht? Es ist Markttag.
Wer hinderte dich? Die Torwachen?«
Sierra schnaubte abfällig:
»Iwo, doch nicht die Wachen! Hätten sie mich nicht durch die Tore gelassen, hätte ich den Tunnel gewählt. Aber selbst den konnte ich nicht nehmen?«
»Der Tunneleingang liegt versteckt, außerhalb Velmonts«, sagte LaD’era. »Weshalb konntest du ihn nicht wählen? Er ist nicht verschlossen und nur einige wenige kennen ihn.«
»Ja, das schon«, antwortete Sierra. »Aber vor dem Eingang zum Tunnel standen die gesamten Soldaten des Königs!
Keine Ahnung, was die da veranstaltet haben. Die standen in voller Montur da und trugen sogar die Zweihänder.
Also nicht die, die sie bei den Paraden tragen, sondern die echten, mit denen sie auch kämpfen. Dabei gab es da gar nichts, gegen das sie kämpfen mussten. Die standen also in voller Montur vor Velmont rum und schauten grimmig nach Osten. Ich versichere dir, so wahr ich hier… ähm… sitze! Wenn es einen Weg durch das Heer des Königs gegeben hätte, hätte ich ihn gefunden. Kannst du dir das vorstellen? Unter den Soldaten waren auch welche, die sicher noch nicht das Mannesalter erreicht haben. Die Schwerter, die sie trugen, waren zu groß für sie. Was will dein Vater denn damit erreichen? Das ist doch alles völlig unlogisch!«
Kaum hatte sie sich von ihr gelöst, kehrte sie auch schon mit voller Macht zurück. LaD’era fühlte, wie sie langsam aufstieg, ihren Brustkorbs ausfüllte und ihren Herzschlag erneut zu beschleunigen begann. Die Kälte!
Ihre Lippen begannen zu zittern, als sie leise sagte:
»Was du gesehen hast, ist ein zur Schau stellen des Heeres.
Es ist eine Machtdemonstration und zugleich eine letzte Drohung. Die letzte Warnung an einen Gegner. Er droht offen meinem Onkel, Sierra.«
Wie hatte es nur soweit kommen können? Ihre innere Stimme flüsterte LaD’era leise zu, dass die Reiche auf einem Pulverfass saßen, und dass es nur noch eines Funkens bedurfte, um dieses Pulverfass zur Explosion zu bringen. Was vermochte dieser Funke zu sein, der den Krieg zwischen den Reichen auslösen würde? Ein unbedachtes Wort? Ein falscher Blick? Konnte Angus etwas tun, um ihren Vater aufzuhalten?
Angus!
»Hast du Angus unter den Soldaten ausmachen können?«
»Nein«, antwortete Sierra. »Ich habe ihn nicht… ich habe ihn nicht dort gesehen.«
Nicht dort?
LaD’era beobachtete, wie sich Sierra auf die Lippe biss.
»Wo hast du ihn gesehen«, fragte sie, als Sierra nicht weitersprach.
»Ich habe ihn… Nun, ich habe ihn auf dem Weg hierher gesehen.«
»Er befand sich hier? Im Niemandsland?«
»Gerade noch.«
»Was bedeutet das, Sierra? Was meinst du mit ’gerade noch’?«
»Vielleicht hat es ja gar nichts zu bedeuten.«
LaD’era fixierte Sierra mit ihrem Blick.
»Was versuchst du mir zu verschweigen? Was ist es, was vielleicht nichts zu bedeuten hat? Wo genau sahst du ihn?
Sierra! Bitte! Wo hast du Angus gesehen?«
LaD’era fühlte, wie die Angst nach ihr griff und dafür sorgte, dass sich ihr Magen schmerzhaft zusammenzog, während sich ihr Zittern langsam von den Lippen in ihre Gliedmaßen auszubreiten begann. Sierra saß neben ihr und LaD’era konnte im fahlen Licht des Mondes erkennen, dass sie ihre Lippen fest zusammenpresste. Nein!
Sierra wollte ihr nicht sagen, wo sie Angus gesehen hatte.
»Er stand an einem Busch kurz vor der Grenze des Östlichen Reiches«, sagte sie schließlich und ihre Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. »Er hat sich mit jemandem hinter der Grenze unterhalten und sich dabei ständig umgeschaut. Schließlich ist er wieder auf Feylon gestiegen und in Richtung Velmont davongaloppiert.«
»Nein! Das ist nicht geschehen«, dachte LaD’era und fühlte, wie ihr Blut wieder in ihren Ohren zu pulsieren begann.
Ihr Herz schlug wild in ihrer Brust, als wollte es sich aus dem plötzlich zu eng gewordenen Brustkorb befreien, ehe es stolperte und schmerzhaft wieder in den jagenden Rhythmus zurückkehrte. LaD’era schnappte nach Luft.
»Das darf nicht geschehen!«, dachte sie. »Nicht du, Angus!
Nicht mein Bruder, der mich immer beschützt hat! Nicht mein Held! Warum?«
So sehr LaD’era auch hoffte, dass Sierra jemand anderes als Angus an der Grenze zum Östlichen Königreich gesehen hatte, so sicher wusste sie, dass sich ihre Hoffnung nicht erfüllen würde. Langsam schälte sich ein einziges Wort aus dem Wust ihrer Gedanken. Wie in Leuchtschrift, hob es sich von den anderen ab, trat weiter hervor, bis es ihr schließlich über die Lippen kam:
»Hochverrat«, flüsterte sie und sah, wie Sierra die Augen aufriss.
»So etwas darfst du nicht sagen, LaD’era! Bitte nicht! Vielleicht hat er ja mit einem Späher des Westlichen Königreiches gesprochen, oder es gibt eine harmlose Erklärung für sein Verhalten.«
Doch abermals wusste es LaD’era besser und schüttelte den Kopf.
»Wenn Velas von Velmont, König des Westlichen Reiches…« sie unterbrach sich und kämpfte gegen die Tränen an, die ihre Stimme zu belegen drohten, ehe sie erneut ansetzte: »Wenn mein Vater davon erfährt, dann hat mein Bruder seinen letzten Atemzug getan.«
LaD’eras Gedanken rasten: Was kann ich tun? Wie kann ich verhindern, dass mein Vater meinen Bruder wegen Hochverrates zum Tode verurteilte? Was ist nur in dich gefahren, Angus? Du bist nicht der Angus, den ich kannte!
Und wieder dachte LaD’era zurück, an ihre Zeit auf Velmont: Du warst es doch immer gewesen, der Vater zu beruhigen versuchte, wenn ich etwas getan hatte, das er mir nicht gestattet hatte? Du hattest doch stets versucht, die Schuld auf dich zu nehmen, wenn ich mir heimlich Feylon geliehen hatte, um ohne Wachen auszureiten.
Ist es nun an mir, dich, meinen Bruder zu schützen?
LaD’era stellte den Wasserbecher ab und stand von ihrem Lager auf. Mit wenigen Schritten hatte sie den kleinen Tisch erreicht und ihre Tasche, die darauf lag, ergriffen.
Schnell begann sie, ihre Utensilien hineinzuwerfen.
Dabei achtete sie nicht darauf, eine gewisse Ordnung herzustellen. Sie nahm einfach alles, das sie greifen konnte, und stopfte es in die Tasche. Sollten die Dinge darin selbst ihren Platz finden!
»Was hast du vor?«, fragte Sierra und stand ebenfalls auf.
LaD’era hörte das Rascheln ihrer Kleidung und schließlich wie Sierra wieder die Luft prüfend einsog. Deutlich fühlte sie den Blick ihrer Freundin auf sich ruhen, während sie hastig weiterpackte. Das Rascheln zu ihrer Rechten wurde lauter und LaD’era musste nicht hinschauen um zu wissen, dass Sierra ebenfalls zu packen begann.
»Diesen Weg werde ich alleine gehen, Sierra«, sagte LaD’era, ohne den Blick von dem ausgebreiteten Sammelsurium auf dem Tisch zu heben.
»Sag mir erst, welchen du gehen willst! Was hast du vor?«
Nun hielt LaD’era doch mit dem Packen inne und drehte sich zu Sierra um.
»Ich werde nach Velmont zurückkehren«, sagte sie und konnte selbst im fahlen Licht des Mondes erkennen, wie Sierra bei ihren Worten bleich wurde.
»Das kommt nicht in Frage!«, fuhr sie auf. Doch LaD’era schüttelte nur den Kopf.
»Ich habe keine Wahl!«
»Du hast immer eine Wahl! Du hast bloß nicht nachgedacht! Wenn du zurückgehst, wird er dich umbringen!
Er hat es doch schon einmal beinahe geschafft. Erinnerst du dich nicht mehr? Er hat dich in einen gläsernen Kerzenständer gestoßen und dich blutend in deiner Kammer eingesperrt! Er hat dir keinen Heiler geschickt…«
»Woher weißt du das«, unterbrach sie LaD’era, während Sierra noch etwas näher an sie herantrat.
»Ich habe es gesehen. In jener Nacht saß ich auf einem der steinernen Bögen, die die Kuppel über dem Thronsaal bilden. Ich habe gesehen, was er dir antat und ich habe deine Verletzung gesehen, als du versucht hast, die Blutung zu stillen. Ich war so froh, als du aus dem Fenster deiner Kammer gestiegen bist und dir über das Dach und den Tunnel einen Weg, raus aus Velmont, gesucht hast.
Und, ja, ich bin dir gefolgt.«
»Weswegen?«, flüsterte LaD’era. »Weshalb folgtest du mir?«
»Weil du die Erste warst, der ich nicht gleichgültig war.«
Was meinte sie?
LaD’era starrte Sierra an, die nun zitternd Luft holte und leise weitersprach:
»Du wirst dich nicht daran erinnern, doch ich habe niemals vergessen, was du für mich in jenem Winter vor acht Sonnen getan hast. Damals war ich alleine und erreichte Velmont, zusammen mit den Händlern, am Markttag.
Ich hatte schrecklichen Hunger und fror erbärmlich, doch ich hatte nichts bei mir, das ich gegen eine Decke und etwas Essbares eintauchen konnte. Also versuchte ich auf anderem Wege an etwas zum Essen und eine Decke zu kommen und wurde dabei erwischt, wie ich nach einem Krapfen griff. Mir gelang die Flucht, weil du plötzlich aufgetaucht bist und den Händler angesprochen hast. Ich rannte zu dem großen Silo, stieg die Leiter hinauf, die unter das Dach führte und beobachtete dich später von dort aus in deiner Kammer. An jenem Abend, hast du die Decke, die ich mir nehmen wollte, und viele von den Krapfen auf das Dach vor dein Kammerfenster gelegt und ich bildete mir ein, dass du zu mir herübergeschaut und mir zugenickt hast. Jedenfalls wartete ich bis Mitternacht zum Wachwechsel und stieg dann vom Silodach auf das Dach des Wehrgangs, wo die Bogenschützen postiert sind.
Ich kletterte das Rosengitter hinauf und gelangte so auf die Dachseite, auf der sich deine Kammer befand. Die Decke und die Krapfen nahm ich an mich und verschwand auf demselben Weg wieder. Am nächsten Tag sprach mich dann Bralla an und nahm mich mit in ihre Hütte. Nach drei Sonnen sagte sie mir schließlich, dass du es warst, die sie gefragt hatte, ob sie auf mich aufpassen kann. Sie hat auf mich aufgepasst, LaD’era. Dafür wollte ich dir danken, doch ich kam niemals nahe genug an dich heran. Deshalb schlich ich jede Nacht um das Schloss herum und kletterte über die Dächer. Ich hatte mir so häufig vorgenommen, dein Kammerfenster aufzusuchen, wenn du abends in deiner Kammer warst. Doch jedes Mal verließ mich der Mut.
Weil ich den Mut niemals gefunden hatte, habe ich geschworen, dass ich dir helfen werde, wenn du einmal nicht mehr weiter weißt und Hilfe brauchst. Und du bist nicht die Einzige, die ihre Versprechen hält.
Als du Velmont verließt, folgte ich dir über die Wiese und durch den Wald bis ich erkannte, dass du nach Osten gehst. Im Östlichen Königreich musste ich aber mehr Abstand zu dir lassen und so konnte ich nur noch sehen, wie du durch den Durchgang nach White Falls gestolpert bist.
Ich beeilte mich, dir zu folgen. Aber als ich am Durchgang ankam, hatte er sich bereits wieder geschlossen. Also versteckte ich mich und wartete darauf, dass der Durchgang wieder erscheinen würde. Doch er erschien nicht. Ich hatte die Hoffnung schon beinahe aufgegeben, als das Glitzern im Wald einsetzte. Mein Herz tat einen Satz, als das Glitzern zu einem Flimmern wurde. Ich dachte, dass ich dir jetzt folgen kann. Aber ich habe nicht erwartet, dass du wieder zurückkommst.
Was ich dir sagen will ist, dass nicht einmal du mich daran hindern wirst, dass ich mein Versprechen, das ich dir gegeben habe, halte. Dein Vater ist… böse, Prinzessin. Ich werde nicht zulassen, dass du dich einfach so opferst!«
Sierra stand vor ihr und LaD’era konnte in ihren Augen die Wut sehen, die sie mühsam zurückzuhalten versuchte.
Ihre Hände waren zu Fäusten geballt und sie zitterte.
LaD’era erinnerte sich gut an den Tag auf dem Markt und das Mädchen, dass so ausgezehrt gewirkt hatte. Damals hatte sie nicht verstanden, dass ihr der Mann nicht einfach die Decke und etwas zu essen überlassen hatte. Und, ja, sie hatte Bralla darum gebeten, auf das fremde Mädchen vom Markt aufzupassen, doch Bralla hatte niemals gesagt, dass sie Sierra gefunden hatte. Weshalb nicht? Und wie konnte sie nun Sierra erklären, dass sie nach Velmont zurückkehren musste?
»Sierra«, begann sie erneut, »so versteh doch! Wenn ich zurückgehe, wird sich seine Aufmerksamkeit auf mich richten. Nur so kann ich Angus Zeit verschaffen! Mein Vater droht offen meinem Onkel und Angus spricht mit jemandem aus dem Östlichen Königreich. In den Augen meines Vaters, hat sich Angus damit mit dem Feind verbündet.
Ich weiß, dass mein Bruder seinem Vater und König treu ergeben ist. Wie verzweifelt muss er sein, wenn er einen Hochverrat begeht? Der Prinz von Velmont hat aber auch dem Volk seines Vaters die Treue geschworen. Er würde nicht gegen sein Volk und seinen Vater handeln, wenn er dadurch nicht eine Möglichkeit sehen würde, den Frieden zwischen den Reichen zu bewahren und das Volk so zu schützen. Er benötigt Zeit und diese Zeit kann ich ihm verschaffen, indem ich zurückkehre.«
»Er wird dich töten!«, fuhr Sierra erneut auf und ballte die Hände noch fester, so dass ihre Knöchel nun weiß hervorstanden.
»Mein Tod ist ein geringes Opfer, wenn ich dadurch das Leben meines Bruders, das tausender Soldaten und das des Volkes retten kann. Auch ich habe dem Volk meines Vaters die Treue geschworen.«
Doch Sierra schüttelte den Kopf.
»Das ist nicht fair!«
»Vielleicht hat sie Recht«, dachte LaD’era und erwiderte Sierras Blick. Wie sehr sie der Anblick ihrer Freundin doch schmerzte! Deutlich konnte sie Tränen in Sierras Augen schimmern sehen.
»Vielleicht ist es ja mein… mein Schicksal«, sagte LaD’era und wandte sich wieder ihrer Tasche zu um Sierras Anblick nicht weiter ertragen zu müssen.
»Das kann einfach nicht sein! Niemand verdient so ein Schicksal. Schon gar nicht… du.«
Dieses Mal vermied es LaD’era ihren Blick zu heben, während ihre Finger vorsichtig über die, zu Verbandsmaterial zurechtgeschnittenen, Stoffbahnen strichen. Diesen Verbandsstoff hatte sie getragen, als sie Velmont, vor etwas mehr als einer Sonne, verlassen hatte und ohne ihr bewusstes Zutun hob sie ihre rechte Hand, um sie an die Stelle im Nacken zu führen, an der die schmale lange Narbe ihren Anfang nahm. Hatte sie jene Verletzung nur überlebt, um ihrem Bruder einen letzten Dienst erweisen zu können? Hatte sie deshalb White Falls wieder verlassen müssen? Waren die Schatten, die sie damals angegriffen hatten, vielleicht von den Gottheiten selbst entsandt worden, um sie durch den Durchgang und ins Niemandsland zu treiben, wo sie Zeugin des Hochverrates ihres Bruders wurde?
LaD’era atmete tief durch und hörte, dass Sierra noch immer auf sie einsprach. Doch ihre Worte hatte sie nicht verstanden.
»… wünschte bloß, der Hüter würde auftauchen und dem König mal so richtig in den… Dem König mal die Krone zurechtrücken!«, sagte Sierra in diesem Augenblick und erreichte damit, dass ihr LaD’era wieder ihre Aufmerksamkeit schenkte.
Rasch löste sie ihre Hand von der Narbe und schaute zu Sierra hinüber.
»Was sagtest du eben?«, fragte sie, während Sierra näher an sie herantrat.
»Er taucht doch immer dann auf, wenn alles schief zu laufen beginnt«, antwortete Sierra und ihre Stimme klang brüchig von den zurückgehaltenen Tränen, die ihr noch immer deutlich in den Augen standen. »Das wäre doch jetzt der passende Zeitpunkt. Wenn er das regelt, musst du nicht zurück nach Velmont. Du kannst weiter leben und Angus auch. Alles würde besser werden, wenn der Hüter das regeln würde. Ich will nicht, dass du gehst, LaD’era!
Ich will, dass du lebst. Der morgige Tag soll einfach nicht dein letzter sein. Ich will dich, wenn das alles vorüber ist und du dann irgendwann wieder nach Velmont zurückgehst, hoch oben auf dem Wehrturm stehen sehen.
Ich will dich frei sehen. Wie damals, als noch alles gut war. Auf keinen Fall möchte ich an deinem Grab stehen müssen und wissen, dass ich es verhindern hätte können, wenn ich dich nicht hätte gehen lassen.«
Andere Wege
Der Hüter! Waren das also die Wahlmöglichkeiten, die ihr zugestanden worden waren? LaD’era presste die Lippen zu blutleeren Strichen zusammen, als ein Bild vor ihrem inneren Auge erschien. Es zeigte ihr einen jungen Mann mit einem schmalen Gesicht, tiefblauen Augen und schwarzen, halblangen Haaren, den Mund zu einem schiefen Lächeln verzogen. Schon fühlte LaD’era, wie sich ihre Mundwinkel, ohne dass sie etwas dagegen tun konnte, zu heben begannen.
»Das Licht Gayas«, dachte sie. »Ist es möglich, dass du auch zu meinem Licht wirst? Doch, was bringst du, Hüter?
Schützt du das Leben, oder bringst du den Tod? Und, wenn du das Leben schützt, welches Leben schützt du? Meines, weil ich Velmont nicht rechtzeitig erreicht habe? Oder das Leben der Menschen in den Reichen, weil ich dich finde und du den aufziehenden Krieg verhindern wirst?
Soll ich dich tatsächlich suchen, Kirvas? Doch mit der Suche nach dir verliere ich wertvolle Zeit, die Angus und den Menschen in den Reichen vielleicht nicht bleibt? Wenn ich dich suche, wo soll ich dann mit meiner Suche beginnen? Was, wenn du noch nicht zurückgekehrt bist, oder die Gottheiten verhindern, dass ich dich finde? Ich wäre dann gerettet, doch die Zeit meines Bruders wäre abgelaufen.
Wenn ich dich finde, dann bin ich IHR nahe«.
LaD’era schloss die Augen und presste sie, im Versuch das Gedanken-Karussell zu unterbrechen, fest zusammen:
»Entscheide dich!«, befahl sie sich in Gedanken.
Weshalb fiel es ihr bloß so schwer, eine Entscheidung zu treffen? Harrte sie nicht hier in dieser Hütte aus, weil sie ihm versprochen hatte, da zu sein, wenn er zurückkehrte?
»Du hast deiner Herkunft entsagt«, rief sie sich ins Gedächtnis, »also nimm dich jetzt nicht so wichtig«.
»Ist es denn so wichtig, was mit mir geschieht?«, flüsterte sie schließlich. Doch sie hatte nicht leise genug geflüstert. LaD’era hörte, wie Sierra einen Schritt näher trat und fühlte, wie sie ihre Handgelenke ergriff, so wie sie es bereits während ihres Albtraums getan hatte. Mit diesem Griff zwang sie LaD’era, sich zu ihr herumzudrehen.
»Es ist wichtig, was mit dir geschieht«, sagte Sierra und LaD’era sah, wie sich eine einzelne, mühsam zurückgehaltene Träne aus dem Augenwinkel ihrer Freundin löste und über ihre Wange rann, wo sie, im fahlen Licht des erwachenden Morgens, eine silbern glänzende Spur hinterließ:
»Du bist wichtig, LaD’era von Velmont, Prinzessin des Westlichen Königreiches. Du magst es nicht wissen, oder vielleicht ist es dir auch egal, aber ich weiß, wie die Menschen im Westlichen Reich dich genannt haben.
Sie nannten dich das Licht Velmonts. Dieses Licht darf einfach niemals ausgelöscht werden.«
»Licht? Das Licht Velmonts? Aber weshalb? Was sieht das Volk in mir, das ich nicht sehen kann?« Welche Bedeutung hatte denn Licht?
Auch, wenn sie es zu verhindern versuchte, so dachte LaD’era dennoch zurück an den Albtraum, aus dem sie vor nicht einmal einer Stunde erwacht war. Sie selbst hatte in der Dunkelheit nach Licht gesucht. Das flackernde Licht eines Feuers hielt während der Nacht wilde Tiere fern. Es war das Licht, das der Dunkelheit den Schrecken nahm. Mit dem Licht verbanden die Granchores die Hoffnung. Und die Hoffnung lag in diesen Tagen bei…
LaD’era atmete tief durch. Sie hatte ihre Entscheidung getroffen.
Sanft löste sie sich aus Sierras Griff und wandte sich den wenigen Utensilien, die noch auf dem Tisch lagen, zu. Sie ergriff einige Nüsse und schlug sie in ein großes Tuch ein.
Schließlich glitt ihre Hand zu dem letzten verbliebenen Tuch, in das etwas Kleines, Hartes eingewickelt war.
»Wohin gehen wir?«, fragte Sierra, während LaD’era das Tuch mit dem Gegenstand darin unschlüssig in der Hand hielt.
Erneut atmete sie tief durch, ehe sie Sierra wieder anschaute.
»Du begibst dich nach Nordosten«, sagte sie. »Der Durchgang wird in wenigen Tagen dort…«
»Oh LaD’era! Hör endlich auf, mich ständig in Sicherheit bringen zu wollen! Ich habe dir schon so häufig gesagt, dass ich dort bin, wo du sein wirst. Jetzt weißt du auch, warum das so ist. Also, finde dich endlich damit ab und sage mir, wohin WIR gehen!«
Warum wollte es ihr nur nicht gelingen, zumindest Sierra aus den Spielen der Gottheiten herauszuhalten? LaD’era fühlte, wie die Resignation in ihr aufstieg und ließ die Schultern hängen. »Nach Eilantal«, antwortete sie schließlich und die Resignation, die von ihr Besitz ergriffen hatte, schwang deutlich in ihrer Stimme mit.
»Eilantal?«, fuhr Sierra auf. »Das liegt doch am A…«, sie räusperte sich, »… Das liegt doch weit im Süden des Westlichen Reiches. Was willst du denn da?«
»Ich folge einem Licht«, sagte LaD’era. »Und ich hoffe, dass dieses Licht bereits wieder zurückgekehrt ist.«
»Von was für einem Licht sprichst du denn jetzt?«
»Ich spreche von dem Licht Gayas, dem Hüter. Ich möchte ihn aufsuchen, um ihn um die Hilfe des Hüters zu bitten.«
»Bei den Stürmen Aeras! Du hast gerade gesagt, dass du weißt, wer der Hüter ist, oder? Du weißt wer der Hüter ist?«, fragte Sierra in einem Ton, in dem Überraschung und Entsetzen mitschwang.
»Ich weiß wer er ist.«
»Woher denn?«
»Ich habe ihn vor nicht allzu langer Zeit getroffen und bin mit ihm gereist.«
Sierras Blick veränderte sich. Es lag nun deutlich Ärger darin und LaD’era hörte sie schnauben, ehe sie sagte:
»Na toll! Und wann wolltest du mir davon erzählen?«
Wovon denn? Von der Reise?
LaD’era wandte sich vom Tisch ab und schaute Sierra an.
»Sierra! Ich habe dir von ihm erzählt.«
»Hast du nicht! Du hast mit mir nie über den Hüter, oder die Kleinigkeit, dass du ihn kennst, gesprochen.«
»Selbstverständlich habe ich dir von Kirvas erzählt.«
»Kirvas?«
LaD’era konnte sehen, wie die Wut aus Sierras Augen wich und ihr im nächsten Augenblick die Gesichtszüge entgleisten:
»Kirvas ist der Hüter?«
»Er ist der Hüter und heißt mit vollständigem Namen Kirvas von Eilantal. Was mein gewähltes Ziel zu erklären vermag.«
»Das pustet mich jetzt um«, sagte Sierra und wandte sich ihrem Gepäck zu, während LaD’era den noch eingewickelten Gegenstand, den sie noch immer in ihrer Hand hielt, sanft vom Tuch befreite. Zum Vorschein kam eine filigrane Schnitzerei, die die Myraver auf White Falls zeigte. War es tatsächlich nur eine halbe Sonne her?
Vorsichtig wickelte LaD’era die Schnitzerei wieder ein und legte sie auf das Sammelsurium in ihrer Umhängetasche.
Noch einmal schaute sie sich um. Hatte sie nun alles eingepackt? Ihr Blick wanderte durch die kleine Hütte und blieb am Besen in der entfernten Ecke der Hütte hängen.
Den Besen würde sie wohl nicht… Moment!
LaD’era stutzte. Deutlich konnte sie den Besen erkennen, was nur bedeuten konnte, dass die Sonne bereits aufgegangen war und ihre ersten Strahlen durch die kleinen Fenster in der Hüttenwand sandte. Wie hatte ihr das nur entgehen können?
Über dem Gespräch mit Sierra hatte sie die Zeit außer Acht gelassen. Zeit, die sie nicht hatte, wollte sie Angus vor der Wut seines Königs retten.
Schnell schloss sie ihre Tasche und eilte zur Tür um Cey, der dort lehnte, zu ergreifen. Auch Sierra hatte ihre Eile bemerkt und beeilte sich nun ihrerseits mit dem Packen, so dass sie binnen weniger Augenblicke neben ihr stand, bereit ihr zu folgen, wo auch immer sie sie hinführen würde.
»LaD’era?«, sprach sie sie erneut an, als LaD’era gerade über die Schwelle getreten war.
»Ja?«
»Diese Schnitzerei in deiner Tasche…«
»Was ist damit«, fragte sie, als Sierra nicht weiter sprach.
»Die hat dir Kirvas geschenkt, oder?«
»Er schnitzt«, antwortete LaD’era.
»Und Kirvas ist der Hüter.«
»Das sagte ich bereits. Ja, Kirvas ist der…«
Oh nein! Nicht doch!
Zu spät war ihr aufgefallen, in welche Richtung sich dieses Gespräch zu entwickeln begann.
»Der Hüter schnitzt für dich?«, fragte Sierra und ihre Augen glänzten vor unterdrückter Freude.
Was sollte sie nun antworten? Selbst, wenn LaD’era nichts sagte, hatte Sierra eine Antwort erhalten! LaD’era fühlte, wie ihre Wangen zu brennen begannen und wusste, dass ihr die Röte ins Gesicht stieg.
Selbst, wenn die Farben im Licht des Morgengrauens noch blass wirkten, wusste sie, dass Sierra diese Regung nicht verborgen blieb.
Nun, in diesem Augenblick, vor der kleinen Hütte im Niemandsland, als sie nach der Türverriegelung griff, um die Tür hinter sich zu schließen, und Sierra sagen hörte:
»Wie romantisch«, war er also gekommen, der denkwürdige Augenblick, in dem sich LaD’era das erste Mal einen Schluck des starken Rotweines aus den Kellern Velmonts wünschte.
Schnell wandte sie sich von Sierra ab und schaute in Richtung Osten, wo Uferus gerade noch sichtbar, über einem silbernen Streifen stand.
Für euch!
Wie lange konnte er den Blick vom Wehrturm hoch über Velmont noch genießen? Waren diese wenigen Minuten vor Sonnenaufgang vielleicht seine letzten in Freiheit?
Würden mit dem Wachwechsel diejenigen erscheinen, die ihn vor den König und, wenn er Glück hatte, nur in den Kerker führen würden? Hatte er das Richtige getan? Oder war es seine gestrige Tat gewesen, die den Untergang der Anchor besiegelt hatte?
Angus lehnte zwischen den Zinnen des Wehrturms und schaute in Richtung Osten, wo Uferus bereits im Verblassen begriffen war. Das fahle bläuliche Schimmern an seinen Rändern zeigte bereits an, dass er in wenigen Augenblicken für das menschliche Auge nicht mehr sichtbar sein würde. Bereits jetzt tauchten die ersten Sonnenstrahlen den Dunst über den fernen Felsen in goldenes Licht.
Während sich dieses Licht weiter auszubreiten begann und bereits die Zinnen des Wehrturms berührte, fragte er sich, wie schon so oft in den vergangenen Stunden der Nacht, welche Wahlmöglichkeiten er gehabt hätte? Konnte er treu dem Thron des Westlichen Reiches folgen, wenn auf diesem ein Dämon saß, der Ausschau nach ihm und seinen Waffenbrüdern hielt, um dieser Welt die letzte Hoffnung zu nehmen? Wäre er überhaupt in der Lage, jemandem zu folgen, dem ein Menschenleben nichts bedeutete? Seine Gedanken glitten zurück zum vergangenen Tag und zur Stunde des Sonnenunterganges.
Er hatte Velmont noch rechtzeitig erreicht, dessen war sich Angus sicher. Er hatte mit den letzten Soldaten die Tore der Stadt durchschritten.
Soldaten! Selbst in Gedanken war ihm dieses Wort zuwider. Die jungen Männer, die der König zu den Waffen gerufen hatte, waren doch gerade erst dem Knabenalter entwachsen. Manche von ihnen zeigten noch nicht einmal einen ordentlichen Bartwuchs. Sie waren kaum in der Lage, die Schwerter an ihren Hüften zu tragen, geschweige denn, sie in einem Kampf zu schwingen. Die Stiefel mit den eisenbeschlagenen Sohlen, die sie nun auf Anordnung ihres Königs zu tragen hatten, ermüdeten sie, so dass sie nicht lange marschieren konnten. Bei einer Auseinandersetzung würden sie die ersten Opfer sein. Eine ganze Generation Männer würde so ausgelöscht werden. Was würde der König wohl dann tun, wenn diese jungen Männer fielen? Würde er dann auch die Frauen zu den Waffen rufen? Angus fühlte, wie diese Vorstellung seine Wut, die er nur schwer verbergen konnte, weiter zu nähren begann.
Gerade, als er die Hände zu Fäusten ballte, um einmal kräftig gegen das Mauerwerk zu schlagen, riss ihn jedoch der Klang von eisenbeschlagenen Stiefeln aus seinen Gedanken. Angus lauschte. Weshalb erklommen Männer in den Stiefeln der Soldaten die Treppen zum Wehrturm? Die Zeit des Wachwechsels war noch nicht angebrochen. Hatte er sich geirrt? Spielten seine Nerven ihm in den frühen Morgenstunden einer durchwachten Nacht einen Streich?
Angus hielt den Atem an und lauschte auf die Geräusche des Morgens. Da war es! Deutlich hörte er es. Das Geräusch, das ihn frösteln ließ. Es unterschied sich so klar und deutlich von den natürlichen Geräuschen des Morgens, dass es keinen Raum für Interpretationen ließ.
Hinter ihm stieg ein Soldat die Treppen zum Turm empor. Bedrohlich hallten die Schritte durch die Stille der schlafenden Stadt zu seinen Füßen.
»Das Ende meiner Freiheit naht«, dachte Angus und straffte sich. Noch einmal ließ er seinen Blick in die Ferne gleiten.
Am Horizont war Uferus erloschen und die Sonnenstrahlen hatten ihren Weg bereits ins Tal hinunter gefunden.
Kein Lufthauch versetzte die Baumwipfel in Bewegung.
Als würde die Welt in diesem Augenblick den Atem anhalten.
Die Schritte waren bereits ganz nah und in wenigen Sekunden würde der Soldat die Tür erreichen, die ihn auf die zinnengesäumte Plattform entließ. Angus’ Blick glitt weiter über Velmont, der Stadt zu seinen Füßen. Er versuchte dieses Bild in sich aufzusaugen.
»So will ich dich in Erinnerung behalten, meine Heimstatt!«, dachte er. »Als einen friedlichen, sonnenbeschienenen Ort.«
Der Prinz fühlte, wie sich seine Schultermuskulatur zu verhärten begann, während sich der Klang der Schritte hinter ihm veränderte. Der Soldat hatte die hölzerne Treppe des Turms erklommen und schritt nun, über das steinerne Podest, auf die Tür zu, die ihn hinaus auf die Plattform entlassen würde.
»Ich habe es für euch getan«, flüsterte er, während der Soldat die Tür hinter ihm öffnete. Das metallene Kreischen der Scharniere hallte durch die Stille und ließ Angus frösteln. Noch einmal atmete er tief die klare Luft des Morgens ein, während sein Herz wild in seiner Brust zu hämmern begann und die Tür ins Schloss fiel. Noch immer schien der Soldat, der die Plattform erklommen hatte, es nicht eilig zu haben. Langsam bewegte er sich über den steinernen Grund auf die Zinnen, zwischen denen Angus stand, zu.
Angus blickte nach Osten, zu den schroffen Bergen hinüber, wo er meinte, einen Schatten ausmachen zu können, der tiefer als die anderen war.
»Ich habe eine Veränderung angestoßen«, dachte er. »Doch ob diese Veränderung zum Leben, oder in den Tod führen wird, das weiß ich heute nicht zu sagen. Vielleicht werde ich es nie erfahren. Die Entscheidung ist gefallen und in wenigen Tagen werden sich die Geschicke der Reiche neu ordnen.«
Die Zeichen des Weines
»Vielleicht hätte ich noch in den Kellern Velmonts vorbeischauen sollen, um mir etwas von dem schweren, roten Wein hierher mitzunehmen«, flüsterte er, während sich die Schritte hinter ihm weiter annäherten. »Ein Kelch Rotwein im Sonnenaufgang hoch über der Stadt, wäre ein angemessener Abschied von meiner Freiheit und von meinem Leben gewesen.«
Der Soldat war nun ganz nah. So nah, dass Angus den Seifengeruch, der den Mann umgab, deutlich wahrnehmen konnte. In gewisser Weise war er enttäuscht, dass der König nur einen Mann mit dem Auftrag, ihn zu verhaften, ausgesandt hatte. Traute er ihm nicht zu, dass er sich gegen seine Verhaftung wehren würde? Seine Linke glitt zu dem Schwert an seiner Hüfte. Sanft glitten seine Finger über den Knauf, in dem ein Relief des Falken von Velmont eingearbeitet worden war. Weiter glitten sie über den mit Leder umwickelten Griff und hinunter zu der Parierstange, die das Strahlen der Sonne mit dem Sternbild der Hohen Mächte darin zeigte.
»Es war mir eine Ehre, dieses Schwert tragen zu dürfen«, flüsterte er, als ihn der Soldat ansprach:
»Hoheit«, sagte er und Angus erstarrte.
»Nein! Nicht doch! Das darf nicht sein! Das hat er nicht getan! So grausam kann selbst ein Scherge der Dunkelheit nicht sein!
Martes! Dieser Dämon hat meinen Waffenbruder ausgesandt, um meinem Leben in Freiheit ein Ende zu setzen!«
Martes erreichte ihn, trat dann jedoch an ihm vorbei und lehnte sich gegen die Zinne zu seiner Rechten.
»Das war richtig knapp gewesen«, sagte er, nachdem er sich nochmals versichert hatte, dass sich tatsächlich nur der Prinz auf der Plattform des Wehrturms aufhielt und Angus schaute erstaunt auf.
»Was meinst du?«, fragte er und bemerkte, wie Martes seine schmalen Lippen zu einem leichten Lächeln verzog.
»Nun«, antwortete er, «fünf Minuten später und wir hätten uns eine Erklärung einfallen lassen müssen.«
Nur langsam beruhigte sich Angus’ Herzschlag wieder.
Krampfhaft schluckte er, doch noch hatte sich nicht so viel Speichel in seiner Mundhöhle gesammelt, dass er dem trockenen Gefühl in seiner Kehle entgegenwirken konnte.
»Bin ich tatsächlich noch einmal davongekommen?«
Angus fühlte den Funken, der das Licht einer schon verloren geglaubten Hoffnung wieder entfachte.
»Du bist nicht hier, um mich in den Kerker zu bringen?«, fragte er um sicher zu gehen, dass die Hoffnung nicht fehl am Platze war.
»Das nicht, Hoheit! Jedoch schickt mich der König nach Euch. Er erwartet Euch im Thronsaal.«
»Der König? Was will er?«
»Das sagte er nicht. Aus seinen Worten – soweit ich sie verstehen konnte – schloss ich, dass er dich sehen will.«
»Dann sollte ich ihn wohl besser nicht warten lassen«, sagte Angus und drückte sich von den Zinnen ab, während Martes seinen Platz zwischen den Zinnen einnahm und, wie er selbst vor wenigen Minuten, schaute nun auch der Hauptmann Velmonts über den nahen Wald und in Richtung Osten, wo am fernen Horizont, zwischen kargen Felsen und Moosflechten, der Ort lag, von dem schon bald etwas ausgehen würde, das die Geschicke der Granchores entscheidend verändern würde.
Angus hatte die schwere Tür, durch die zuvor Martes getreten war, erreicht und öffnete sie mit einem kräftigen Ruck. Das Kreischen des Metalls ließ ihn zusammenfahren während er augenblicklich von der düsteren Kühle des Wehrturms empfangen wurde. Sie umarmte ihn und ließ in schaudern. Angus fühlte, wie sein Unbehagen zunahm, während er die ersten Treppenstufen hinabstieg.
»Was ist nur los?«, fragte er sich, während sich seine Atmung zu beschleunigen begann und etwas sanft, wie Spinnenseide, über seine Haut strich.
»Etwas ist hier«, dachte er. »Etwas Böses lauert in diesem Turm. Es wartet in der Dunkelheit«.
Angus blieb abrupt stehen und schüttelte sich. Schnell fuhr er sich mit den Handflächen einmal über sein Gesicht.
»Ich bin übermüdet«, flüsterte er. »In diesen Zeiten ist das ein Zustand, den ich vermeiden muss. Ich muss wachsam sein!«
Langsam löste er seine Linke von seinem Schwertgriff, den er, seit er ihn auf der Plattform des Wehrturms ergriffen hatte, nicht mehr losgelassen hatte und griff nach dem eisernen Handlauf, um sich daran sicheren Halt zu verschaffen. Nicht auszudenken was geschehen würde, würde er auf den schmalen steinernen Treppenstufen der Wendeltreppe im Inneren des Turms den Halt verlieren.
Vorsichtig, jeden seiner Schritte sichernd, stieg er die Stufen hinunter und wendete sich, am Ende der Treppe, nach links, um sogleich seine rechte Hand auf Schulterhöhe über die Fugen gleiten zu lassen, bis seine Finger eine unscheinbare Kerbe im Mauerwerk ertasteten. Jemand, der diesen Gang nicht kannte, hätte diese unscheinbare Vertiefung im Mauerwerk nicht einmal bemerkt oder, falls doch, nicht die richtigen Schlüsse gezogen. Nicht so Angus! Ein kurzer Druck gegen die Kerbe löste einen Schnappverschluss und die Wand, die zunächst so massiv gewirkt hatte, schwang lautlos auf. Mit einem großen Schritt übertrat er die Schwelle und schloss die Tür sofort wieder hinter sich. Kühl und dunkel lag auch dieser Gang vor ihm und – wie so häufig in letzter Zeit – beschlich Angus das Gefühl, dass mit dem Erlöschen des Lichtes von Velmont auch die Wärme aus diesem Gebäude verschwunden war. Angus schüttelte diesen Gedanken ab und zwang sich nach vorn zu schauen. Doch seine Augen benötigten heute ungewöhnlich lange, um sich an die Lichtverhältnisse in diesem Gang anzupassen.
»Als wäre die Dunkelheit dichter, ja, stofflich geworden«, dachte er, während er darauf wartete, die Umrisse des Ganges schemenhaft erkennen zu können. Wieder fühlte er eine sanfte Berührung auf seiner Haut und wieder schüttelte er dieses Gefühl rasch ab, indem er sich erneut durch das Gesicht fuhr.
»Ich muss diesen Gang hinter mir lassen«, dachte er und endlich, Angus hatte sich schon beinahe dazu durchgerungen, dem Gang blind folgen zu wollen, erkannte er in einiger Entfernung den hellen Umriss der Tür, die ihn seitlich in den Thronsaal einlassen würde.