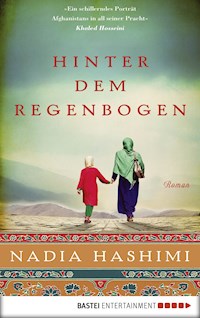9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Affäre, Ehebruch oder uneheliche Schwangerschaft - den meisten Insassinnen im Frauengefängnis von Kabul werden moralische Verbrechen zur Last gelegt. Doch bei Zeba ist das anders. Sie soll ihren Ehemann brutal erschlagen haben. Ist die dreifache Mutter wirklich eine kaltblütige Mörderin? Ihr Anwalt Yusuf, ein ehrgeiziger junger Mann mit amerikanischem Abschluss, ist von Zebas Unschuld überzeugt. Aber er kann diese nicht beweisen, solange Zeba ihm nicht anvertraut, was wirklich passiert ist ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 671
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungGedichtPrologKAPITEL 1KAPITEL 2KAPITEL 3KAPITEL 4KAPITEL 5KAPITEL 6KAPITEL 7KAPITEL 8KAPITEL 9KAPITEL 10KAPITEL 11KAPITEL 12KAPITEL 13KAPITEL 14KAPITEL 15KAPITEL 16KAPITEL 17KAPITEL 18KAPITEL 19KAPITEL 20KAPITEL 21KAPITEL 22KAPITEL 23KAPITEL 24KAPITEL 25KAPITEL 26KAPITEL 27KAPITEL 28KAPITEL 29KAPITEL 30KAPITEL 31KAPITEL 32KAPITEL 33KAPITEL 34KAPITEL 35KAPITEL 36KAPITEL 37KAPITEL 38KAPITEL 39KAPITEL 40KAPITEL 41KAPITEL 42KAPITEL 43KAPITEL 44KAPITEL 45KAPITEL 46KAPITEL 47KAPITEL 48KAPITEL 49KAPITEL 50KAPITEL 51KAPITEL 52KAPITEL 53KAPITEL 54DanksagungGlossarÜber dieses Buch
Affäre, Ehebruch oder uneheliche Schwangerschaft – den meisten Insassinnen im Frauengefängnis von Kabul werden moralische Verbrechen zur Last gelegt. Doch bei Zeba ist das anders. Sie soll ihren Ehemann brutal erschlagen haben. Ist die dreifache Mutter wirklich eine kaltblütige Mörderin? Ihr Anwalt Yusuf, ein ehrgeiziger junger Mann mit amerikanischem Abschluss, ist von Zebas Unschuld überzeugt. Aber er kann diese nicht beweisen, solange Zeba ihm nicht anvertraut, was wirklich passiert ist …
Über die Autorin
Nadia Hashimi wurde als Tochter afghanischer Auswanderer in New York geboren. Die afghanische Kultur ist ihr von klein auf vertraut, aber erst 2002 reiste sie zum ersten Mal selbst nach Afghanistan. In Massachusetts und New York hat sie Mittelost-Studien, Biologie und Medizin studiert. Nach Abschluss des Studiums fand sie endlich die Zeit, sich einen lange gehegten Wunsch zu erfüllen: einen Roman zu schreiben, der in der Heimat ihrer Eltern und Großeltern spielt. Nadia Hashimi lebt gemeinsam mit ihrem Mann, drei Kindern und einem Papagei in Maryland, wo sie als Kinderärztin arbeitet.
Besuchen Sie auch die Homepage der Autorin: http://nadiahashimi.com
NADIA HASHIMI
DAS LICHT VON VIERZIG MONDEN
Roman
Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch von Britta Evert
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
»A House without Windows«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2016 by Nadia Hashimi
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Anja Lademacher, Bonn
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Umschlagmotive: © Patrick Eckersley/gettyimages und © FinePic/shutterstock
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-5570-3
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Cyra, unser strahlendes Licht der Liebe
Die Botschaft, der Regen, das göttliche Licht,Sie kommen durch mein Fenster.Sie fallen herein, von meinem Ursprung her.Die Hölle ist dieses Haus ohne ein Fenster.Wahre Religion, oh Diener Gottes, erschafft ein Fenster.Hebe nicht deine Axt an jeden Winkel, komm,Hebe deine Axt, um ein Fenster zu öffnen.Weißt du nicht, dass SonnenlichtNur das Abbild der Sonne ist,Das hinter ihrem Schleier erscheint?
Rumi Masnavi III, 2403–2406
Wahrscheinlich ist diese ganze furchtbare Geschichte zum Teil auch meine Schuld. Wie könnte es anders sein? Ich habe mit diesem Mann zusammengelebt. Ich habe das Essen so gewürzt, wie er es mochte. Ich habe ihm die Hautschuppen vom Rücken geschrubbt. Ich habe alles für ihn getan, was eine Frau für ihren Ehemann tut.
Ein paar Dinge hat er auch für mich getan. Manchmal, wenn ich sehr aufgebracht war, hat er gesungen – eine gesungene Entschuldigung. Ich konnte ihm nie lange böse sein. Etwas an der Art, wie seine Augenbrauen zuckten oder sein Kopf hin und her wippte … Er kühlte die Hitze in meinem Inneren wie Eis, und dann schmiegte ich mich wieder an ihn, um zu fühlen, wie sein Atem meinen Nacken kitzelte.
Unglaublich, dass dies alles nur wenige Schritte von dem Lager, das wir als Mann und Frau geteilt haben, enden würde – nur wenige Schritte von der Stelle entfernt, wo zuvor unheiliges Blut vergossen wurde. In unserem kleinen Hof mit dem Rosenstrauch in der Ecke und der quer hinübergespannten Wäscheleine ist im vergangenen Jahr viel Blut geflossen. Ich kann es kaum fassen, dass die Rosen verrückt genug sind, dort zu blühen.
Die Rosen sind tiefrot und würden sich gut auf einem Grab machen. Ist das ein seltsamer Gedanke?
Ich glaube, die meisten Frauen malen sich den Tod ihrer Männer aus – entweder aus Furcht vor diesem Ereignis oder in freudiger Erwartung. Der Tod ist unausweichlich. Warum nicht darüber nachdenken, wann oder wie er eintreten wird?
Ich habe mir den Tod meines Mannes auf unzählige Arten vorgestellt: Als alter Mann im Kreis seiner Kinder, gefällt durch einen Kopfschuss im Kampf gegen Aufständische, wie er vornüberkippt mit auf die Brust gepressten Händen, vom Blitz erschlagen auf dem Weg zu irgendeinem Ort, den er nicht hätte aufsuchen sollen. Der Blitz hat mir immer am besten gefallen.
Allah, vergib mir meine lebhafte Phantasie. Ich gebe meiner Mutter die Schuld an diesem reizenden Erbe. Die Sache mit dem Blitz wäre für alle leichter zu ertragen gewesen – ein erschütternder und zugleich poetischer kleiner Stromstoß aus dem Himmel. Es hätte wehgetan, aber nur einen kurzen Augenblick.
Ich hasse es, andere leiden zu sehen.
Nein, dass mein Mann so sterben könnte, wie es letzten Endes geschah, habe ich mir wahrlich nie vorgestellt, aber was kann eine Frau da schon ausrichten? Gewitter kommen nicht einfach, nur weil man sie braucht.
Seit ich eine junge Frau war, kleidete ich Worte in Reime, denn es half mir, mich wieder zu fassen, Ordnung und Rhythmus in meinem Kopf zu erzeugen, wenn beides in der Welt, die mich umgab, nicht zu finden war. Selbst jetzt, in dieser elenden Verfassung, entspringt meinem Geist ein Vers.
Meine wahre Größe hat mein geliebter Mann nie erkannt,
Denn Narr, der er war, hat er sich von mir abgewandt.
KAPITEL 1
Wenn Zeba eine weniger gewöhnliche Frau gewesen wäre, hätte Kamal es vielleicht kommen sehen, ein nervöses Kribbeln oder ein paar Nackenhaare, die sich sträubten, hätten es ihm verraten. Aber sie lieferte ihm keinen Hinweis, keinen Grund zu der Annahme, sie könnte etwas anderes sein, als sie in den letzten zwei Jahrzehnten gewesen war: eine liebende Ehefrau, eine geduldige Mutter, eine friedfertige Nachbarin. Nichts von dem, was sie tat, hatte je Aufmerksamkeit erregt.
An jenem Tag, dem Tag, der ein Dorf, das sich niemals änderte, schließlich doch veränderte, gestaltete sich Zebas Nachmittag als eine farblose Wiederholung vieler vorangegangener Nachmittage. Die Wäsche hing draußen auf der Leine. In einem Aluminiumtopf dünstete Okra. Rima, deren Füße vom Herumkrabbeln im Haus geschwärzt waren, schlummerte ein paar Schritte entfernt. Auf dem Kissen, auf dem ihr unschuldiger Mund ruhte, hatte sich ein dunkler, feuchter Kreis gebildet. Zeba beobachtete, wie sich der Rücken ihrer Tochter im Schlaf hob und senkte, und lächelte beim Anblick der leicht aufgeworfenen Lippen. Sie zog einen Finger durch frisch gemahlenen Kardamom. Der Geruch blieb süß und tröstlich an ihrer Fingerspitze haften.
Zeba seufzte und warf das Ende des weißen Schals, der ihren Kopf bedeckte, über die Schulter. Sie versuchte, nicht darüber nachzudenken, wo Kamal war, denn das führte unweigerlich zu der Frage, was er dort gerade tat, und Zeba war heute nicht danach zumute, solchen Gedanken nachzuhängen. Sie wollte, dass es ein ganz normaler Tag blieb.
Basir und die Mädchen waren auf dem Heimweg von der Schule. Basir, Zebas ältester Sohn, war erst sechzehn, aber abgehärteter als andere Jungen seines Alters. Die Pubertät hatte ihm die unglückliche Gabe verliehen, seine Eltern so zu sehen, wie sie waren. Sein Zuhause war kein Zufluchtsort. Sein Zuhause war, seit Basir denken konnte, ein Ort voller Brüche – zerbrochenes Geschirr, gebrochene Rippen, gebrochene Seelen.
Kern des Problems war Kamal, Zebas Ehemann, ein Mann, der im Lauf der Jahre seelisch zerbrochen war. Inzwischen hielt ihn nur noch der Glaube am Leben, dass der Mann, der er manchmal für wenige Minuten war, den Mann vergessen machen konnte, der er ansonsten war.
Zeba beobachtete die glimmenden Holzscheite unter dem Topf. Vielleicht brachte Kamal ja heute ein Stück Fleisch mit nach Hause. Sie hatten seit einem halben Monat keines mehr gegessen. In der letzten Woche hatte er eine Tüte Zwiebeln mitgebracht, so frisch und süß, dass Zeba schon bei ihrem Anblick die Augen tränten. Und Tränen der Dankbarkeit waren in alles geflossen, was sie in den darauffolgenden Tagen gekocht hatte.
Rima bewegte sich träge, schob ihr blasses Bein unter die gestrickte Decke und zog ihren Arm an ihre Seite. Bald würde sie aufwachen. Zeba fegte die gemahlenen Kardamomsamen in eine leere kleine Dose. Bevor sie den Deckel versiegelte, holte sie tief Luft, um den Geruch in ihre Lungen aufzunehmen.
An manchen Tagen war es schwer. Nahrung war oft knapp, die Kinder wurden manchmal krank. Zeba hatte bereits zwei ihrer Kinder verloren und wusste, wie leicht Gott etwas nehmen konnte. Kamal litt an Stimmungsschwankungen, die sie nicht begriff, aber sie hatte gelernt, sich durch sie hindurchzumanövrieren wie ein Pilot sein Flugzeug durch Turbulenzen. Sie betäubte sich mit Hausarbeit. Sie konzentrierte sich auf die guten Dinge in ihrem Leben. Die Mädchen besuchten die Schule. Basir, ihr erster und einziger Sohn, war ein aufgeweckter Junge, und dass er ihr im Haus half, war eine Erleichterung für ihren schmerzenden Rücken. Rima, das Baby, hatte mehrere Krankheiten überstanden, die andere Kinder das Leben gekostet hatten, und ihre rosigen Wangen heiterten Zeba immer wieder auf.
Rima. Unglaublich, dass es die Jüngste im Haus war, die den Lauf der Geschichte veränderte. Die meisten Kinder mussten erst laufen lernen, bevor sie so etwas zustande brachten.
Hätte Rima nicht in diesem Moment ihr Bein bewegt, hätte der Geruch des Kardamoms nicht Zebas müde Lungen erfrischt, wäre irgendjemand in der Nähe gewesen, um sie aufzuhalten, hätte das Leben, das in ihrem bescheidenen Hinterhof und in der Abgeschiedenheit der Lehmmauern versiegte, vielleicht noch ein Jahr, ein Jahrzehnt oder ihr ganzes Leben gedauert. So aber wehte eine sanfte Brise zum offenen Fenster herein, und Zeba überlegte, ob es nicht besser wäre, die Wäsche abzunehmen, bevor Rima aufwachte und Basir und die Mädchen nach Hause kamen.
Zur Hintertür hinaus, auf den Hof und hinüber zur Wäscheleine, wo sie einige Augenblicke stehen blieb, bis sie etwas hörte, das sie nicht ignorieren konnte.
Es war ein Laut, den niemand hören wollte. Ein Laut von der Art, vor dem die Menschen lieber davonlaufen.
Zebas Brust zog sich schmerzhaft zusammen. Heiße Glut überflutete ihr Gesicht, und ihr Kiefer verkrampfte sich angesichts eines Tages, der so herrlich normal hätte sein können. Einen Moment lang ging sie mit sich zu Rate, bevor sie entschied, dass sie – die Ehefrau, die Frau, die Mutter – nachschauen musste, was los war.
Basir und seine Schwestern traten durch das Tor in der Lehmmauer, die ihr Zuhause und den Hof von der Straße und den Nachbarhäusern trennte. Als er Rima weinen hörte, das verzweifelte Plärren eines Kindes mit weit ausgestreckten Armen, schnürte sich Basirs Magen zusammen. Die Mädchen liefen ins Haus, und im Handumdrehen hatte Shabnam das Baby, dessen Gesicht vom Weinen nass und gerötet war, auf ihre Hüfte gesetzt. Kareema starrte ihre Schwester aus weit aufgerissenen Augen an. Der Geruch von verbranntem Okra hing unheilverkündend in der Luft, von Madar-jan war nichts zu sehen. Irgendetwas stimmte nicht.
Basir sagte nichts zu den Mädchen. Rasch schaute er sich in der Küche und den zwei Schlafzimmern um. Er fühlte, wie seine Hände zitterten, als er die Hintertür öffnete. Hosen, Schals und Hemden flatterten auf der Wäscheleine. Ein leises Wimmern lenkte Basirs Aufmerksamkeit auf den hintersten Winkel ihres Hofs, wo sich die Außentoilette an die Mauern des Nachbarhauses duckte.
Basir machte einen Schritt. Dann noch einen. Wie sehnte er sich danach, es wäre wieder früher Morgen, als alles noch ganz normal gewesen war. Wie sehnte er sich danach, ins Haus zurückzugehen und seine Mutter anzutreffen, wie sie in einem schweren Topf grüne Bohnen umrührte, voller Sorge, ob ihre Kinder auch genug zu essen bekämen.
Aber nichts würde je wieder normal sein. Das wusste Basir, als er auf die Ecke des Hofs zuging und das Leben, wie er es kannte, zu einer blutigen Masse zerfloss. Zeba, seine Mutter, blickte zu ihm auf, das Gesicht leer und ausgelaugt. Sie lehnte mit dem Rücken an der Mauer. Ihre Hände waren dunkel und blutbeschmiert, ihre Schultern bebten. Die Luft war wie mit Gift geschwängert.
»Madar-jan«, begann Basir. Ein paar Schritte von ihm entfernt lag eine zusammengekrümmte Gestalt auf dem Boden.
»Bachem.« Zebas Stimme brach. Ihre abgehackten Atemzüge gingen schneller. Sie ließ den Kopf zwischen ihre Knie sinken und fing an zu schluchzen.
»Geh wieder ins Haus, mein Sohn … geh wieder ins Haus zu deinen Schwestern, deinen Schwestern … geh wieder ins Haus.«
Basirs Brust zog sich zusammen. Genau wie sein Vater hatte er das nicht kommen sehen.
KAPITEL 2
Als Junge hätte Yusuf sich nie träumen lassen, dass er eines Tages Anwalt sein würde, schon gar nicht Anwalt in Amerika. Er war wie alle anderen Kinder und dachte kaum an die vielen Tage, die auf den nächsten Tag folgen würden.
Er konnte sich gut an die Nachmittage im Garten seines Großvaters erinnern, an das Rascheln der Blätter in den tief hängenden Ästen des Granatapfelbaums. Pralle rote Kugeln, die wie Schmuckstücke an ausgestreckten Armen hingen. Drei stolze Bäume trugen genug Früchte, um den Kindern und Enkelkinder von Boba-jan den ganzen Herbst hindurch die Finger rot zu färben. Yusuf pflückte gern die schwersten und rundesten Granatäpfel, die er erreichen konnte, und schlitzte mit einem Messer, das er aus der Küche seiner Großmutter stibitzt hatte, die ledrige Schale auf. Dann brach er die Kugel in der Mitte auseinander, ganz vorsichtig, damit keines der tiefroten Juwelen im Inneren entwischen konnte. Ein leichtes Schnippen des Fingers befreite jeden Kern von seiner dünnen weißen Hülle. Yusuf ging gewissenhaft, methodisch vor. Manchmal aß er die Perlen eine nach der anderen und ließ die Säure auf seiner Zunge zergehen, manchmal wiederum stopfte er sich eine Handvoll in den Mund und entlockte den faserigen Kernen den Saft, bevor er sie zwischen seinen Zähnen zermahlte.
Die Schalen warf Yusuf über die Lehmmauer, die den Hinterhof seines Großvaters von der Straße trennte, nicht weil es ihm verboten war, Granatäpfel zu essen, sondern weil er nicht wollte, dass seine Geschwister oder Cousins sahen, wie viele er verschlungen hatte.
Als jüngstes von vier Kindern vergötterte Yusuf seinen Bruder, der sechs Jahre älter als er war, ein hübscher und selbstbewusster Junge. Er liebte auch seine beiden Schwestern und setzte sich zu ihnen, wenn sie altbackenes Brot in ihren Händen zerkrümelten und es den dankbaren Spatzen und Tauben zuwarfen, die sich draußen vor ihrem Haus tummelten. Yusuf war ein Kind, das Geschichten liebte, ganz besonders solche, die ihn erschreckten oder überraschten. Wenn er schlief, träumte er davon, ein Held zu sein, der die Dschinn in den Dschungel jagte oder am Boden eines Brunnens einen Schatz fand. Manchmal war er in seinen Träumen sehr tapfer und rettete seine Familie vor schlimmen Bösewichten. Aber öfter, als ihm lieb war, wachte Yusuf auf einer Matratze auf, die feucht von Tränen der Angst war.
Als Yusuf elf war, entschied sein Vater, dass es an der Zeit wäre, Afghanistan zu verlassen. Die Raketen rückten immer näher an ihren Heimatort heran, ein Dorf, das die letzten zehn Jahre relativ unbeschadet überstanden hatte. Yusufs Mutter, die erst ein Jahr lang als Lehrerin gearbeitet hatte, bevor die Schulen geschlossen wurden, war froh über diese Entscheidung. Sie nahm einige wenige Gegenstände mit in ihr neues Leben: eine Handvoll Fotos, einen Pullover, den ihre Mutter gestrickt hatte, und einen kunstvoll gearbeiteten pfauenblauen Schal, den ihr Mann ihr am Anfang ihrer Ehe von einer seiner Reisen nach Indien mitgebracht hatte. Ihre Kupferkessel, ihre handgeknüpften purpurroten Teppiche und ihr silbernes Hochzeitstablett blieben zusammen mit einem Großteil ihrer Kleidung zurück. Yusufs Vater, ein Pilot, war seit Jahren nicht mehr geflogen, weil sämtliche Fluglinien eingestellt worden waren. Dennoch packte er all seine Diplome und Zertifikate ebenso ein wie die Zeugnisse seiner Kinder. Er war ein praktischer Mensch und klagte nicht darüber, dass alles andere zurückbleiben musste.
Die Reise von Afghanistan nach Pakistan war riskant. Die Familie überquerte Berge – manchmal im Dunkeln – und zahlte verdächtig wirkenden Männern hohe Summen Geld für ihre Hilfe. Alle vier Kinder, die im Alter nicht weit voneinander entfernt waren, duckten sich mit ihren Eltern in das Dunkel auf der Ladefläche eines Lastwagens, wenn sie felsige Anhöhen erklommen. Sie zitterten, wenn sie hörten, wie Schüsse in den Tälern widerhallten. Yusufs Mutter, die unter ihrer Burka stolperte, drängte sie zum Weitergehen und behauptete, die Gewehre wären zu weit entfernt, um ihnen etwas anhaben zu können. Und Yusuf hätte ihr vielleicht geglaubt, wenn ihre Stimme weniger gebebt hätte.
In Pakistan kam Yusufs Familie in einem Flüchtlingslager unter. Obwohl sie in Afghanistan alles andere als reich gewesen waren, stellte das Leben im Lager eine drastische Veränderung dar. Pakistanische Polizisten brüllten herum und wehrten jede Frage ab. Ständig mussten sie Schlange stehen, für Essen, Unterkunft und Dokumente, die in immer weitere Ferne zu rücken schienen. Sie lebten auf einem offenen Feld, einer Staubhalde voller Zelte und abgestumpfter Seelen. Sie schliefen Seite an Seite und versuchten, den Gestank von Armut, Scheitern und Verzweiflung zu ignorieren. »Müßiggang ist aller Laster Anfang«, ermahnte Yusufs Mutter ihre Kinder. Sie blieben für sich und sprachen mit niemandem im Lager über etwas anderes als die endlose Warterei und die unerträgliche Hitze. Im Flüchtlingslager würden sie nur vorübergehend bleiben, versicherten Yusufs Eltern. Schon bald würden sie bei ihren Verwandten in Amerika sein.
Wochen vergingen, und keine neuen Nachrichten erreichten sie. Yusufs Vater bemühte sich um Arbeit, aber die Fluglinien winkten verächtlich ab. Man wollte ihn weder als Mechaniker noch als Hilfsarbeiter einstellen. Entmutigt angesichts ihrer rapide schrumpfenden Mittel, nahm er einen Job als Ziegelmacher an.
»Würde hat nichts damit zu tun, welche Arbeit man macht«, erklärte er seiner Frau und seinen Kindern, die es nicht gewohnt waren, ihn in verdreckten, staubigen Sachen zu sehen. »Sondern damit, wie man sie macht.«
Aber als er sich den Lehm von den Händen wusch, ließ er die Schultern hängen. Yusufs Mutter biss sich auf die Lippen und legte in der kärglichen Privatsphäre ihres Zelts eine Hand auf seinen Arm. Die Würde war im Lager schwer aufrechtzuerhalten. Sie isolierten sich, so gut sie konnten, und hielten sich von allem, was vorging, fern: Hahnenkämpfe, Opiumrauch, der Mief ungewaschener Leiber und das Wehklagen um ein Kind, das einer Krankheit erlegen war.
Yusufs älterer Bruder arbeitete zusammen mit seinem Vater. Seine beiden Schwestern blieben bei ihrer Mutter, und Yusuf wurde in die Schule des Flüchtlingslagers geschickt, wo zwanzig Jungen unter einer Holzkonstruktion saßen, die auf drei Seiten offen war. Es gab eine verwitterte Tafel und einen Lehrer, der kleine geklammerte Hefte aus Dünndruckpapier verteilte. Yusufs Verwandte in Amerika beteuerten, sie würden alles tun, was nötig sei, um sie in die Vereinigten Staaten zu holen – sie mussten Formulare ausfüllen und Bankbelege vorweisen und engagierten sogar Anwälte, die sie sich eigentlich nicht leisten konnten. Die Beamten des örtlichen Konsulats teilten Yusufs Vater mit, dass sein Antrag noch geprüft werde.
»Padar-jan, ich kann mit dir und Fazil arbeiten. Ich bin kein Kind mehr. Ich kann auch Geld verdienen.« Sie saßen in der Abenddämmerung in ihrem Zelt und tranken aus Schalen dünne Suppe, die seine Mutter über dem offenen Feuer gekocht hatte.
Yusufs Vater starrte auf den Boden, als erwarte er, er würde unter ihm nachgeben.
»Padar?«
»Yusuf-jan«, fiel seine Mutter ihm leise ins Wort. »Lass deinen Vater in Ruhe essen.«
»Aber ich will auch helfen, Madar-jan. Die Schule ist so überfüllt, und die anderen Kinder sind …«
»Yusuf.« Die unüberhörbare Schärfe in ihrer Stimme ließ ihn verstummen.
Yusufs Vater legte sich an jenem Abend zu Bett, ohne ein weiteres Wort zu sagen.
Die Wochen wurden zu Monaten. Mit sinkendem Mut beobachteten sie, wie immer mehr Familien in das Lager strömten. Als sie endlich die Nachricht erhielten, dass sie Einreisevisa für die Vereinigten Staaten bekommen würden, vergrub Yusufs Mutter ihr Gesicht an der Brust ihres Mannes, um ihr Schluchzen zu ersticken. Die Hartnäckigkeit von Yusufs Onkel Rahim hatte sich ausgezahlt. Sie gehörten zu den wenigen Glücklichen, die das Lager hinter sich lassen konnten. Aber noch Jahre später lastete die Erinnerung auf ihnen, am schwersten auf Yusufs Vater, der nie mehr so aufrecht ging wie in der Zeit, als er in ihrem Dorf ein arbeitsloser Pilot gewesen war.
Yusufs Familie ließ sich in New York nieder, in Queens, der Zuflucht der in der Diaspora lebenden afghanischen Gemeinde. Alles wirkte überwältigend auf sie: die hohen Gebäude mit ihren Fahrstühlen, die Menschenmassen, die zur Arbeit strömten, das Wasser, das zuverlässig aus dem Hahn floss, die Lebensmittelgeschäfte mit einem Angebot so reich, dass Obst und Gemüse auf die Bürgersteige zu quellen schienen. Die Wiedervereinigung mit ihrer Familie war von unendlich vielen Umarmungen begleitet, von Tränen und üppigen Mahlzeiten mit viel Fleisch. Sie kamen in der Drei-Zimmer-Wohnung eines Onkels und seiner Familie unter, bis sie finanzielle Hilfsmittel beziehen, Arbeit finden und schließlich eine eigene Wohnung mieten konnten. Yusuf und seine Schwestern wurden bei einer Schule angemeldet. Sein Vater und Fazil arbeiteten im Pizzaladen von Kaka Rahim.
Sitara, Yusufs älteste Schwester, verliebte sich direkt nach ihrem Highschool-Abschluss, in einen jungen Afghanen, der im selben Haus wohnte. Blickkontakte im stickigen Fahrstuhl wurden zum Flirt und in weiterer Folge zu gestohlenen Augenblicken im feuchten Waschraum im Keller. Yusufs Eltern schärften ihrer Tochter ein, sich von dem Jungen fernzuhalten, der einen Teilzeitjob als Kassierer in einer Bank hatte und dessen Eltern einer anderen ethnischen Gruppe angehörten. Türen wurden zugeknallt, Telefonate abgefangen, böse Blicke gewechselt. Wie nicht anders zu erwarten, steigerte das nur noch das Verlangen der jungen Liebenden nacheinander. Sie umarmten sich in aller Öffentlichkeit und scherten sich immer weniger darum, ob ihre Eltern von ihrem unschicklichen Benehmen erfuhren.
Um jedes Gerede zu vermeiden, erklärten sich die Familien schließlich einverstanden, die beiden heiraten zu lassen, und nach einer schlichten Zeremonie zog Sitara bei ihrem Bräutigam und seiner Familie ein und begann ihr neues Leben in der Wohnung, in der der junge Mann und seine Familie seit Jahren lebten, nur zwei Stockwerke über der ihrer Eltern und Geschwister. Yusufs andere Schwester, Sadaf, entschied sich dafür, weiter die Schule zu besuchen und an einer Volkshochschule Kurse für Buchhaltung zu belegen. Sein Bruder, dem Lernen und der Schule schon zu lange entwöhnt, verbesserte sein Englisch, indem er ganze Dialoge aus Fernsehserien auswendig lernte. Er stieg in der Hierarchie des Restaurants schnell auf und wurde Barkeeper. Yusufs Mutter nahm an der städtischen Bücherei ihres Viertels Englischunterricht und fand in einem Warenhaus eine Stelle als Verkäuferin. Yusufs Vater, der Kaka Rahim sehr dankbar dafür war, seiner Familie zu einem Neubeginn verholfen zu haben, entschied, dass es besser wäre, Arbeit und Familie nicht zu vermischen, fand sich mit einer Zukunft, in der das Fliegen keinen Platz mehr hatte, ab und wurde Taxifahrer. Yusuf selbst wurde praktisch über Nacht zu einem jungen Mann, der die Nuancen der englischen Sprache perfekt beherrschte und sich in überfüllten U-Bahnen zurechtfand. Er war ein ausgezeichneter Schüler und wurde von seinen Lehrern gedrängt, sich um Stipendien zu bemühen und aufs College zu gehen.
Tagsüber kam er gut zurecht, aber nachts wachte er mindestens einmal in der Woche schweißgebadet auf. Es gelang ihm einfach nicht, sieben Nächte hintereinander durchzuschlafen, ohne im Dunkeln geräuschlos seine von Angstschweiß getränkten T-Shirts und Kissenbezüge zu wechseln und dabei darauf zu achten, seine Geschwister nicht zu wecken.
Die Familie lebte bescheiden, aber angenehm. Sie hatten erst einen, dann zwei Fernseher. Ihre Schränke füllten sich mit neuen Sachen, ihre verlorenen Habseligkeiten wurden durch neue ersetzt. Yusufs Mutter brach in Freudentränen aus, als sein Vater eines Tages ein Silbertablett mitbrachte, das fast genauso aussah wie das Hochzeitstablett, das sie in Afghanistan zurückgelassen hatten. Sie schauten zusammen fern, wobei einer von ihnen stets einen Finger auf der Fernbedienung hatte – für den Fall, dass eine Liebesszene zu sehen war. Yusufs Vater verfolgte das Geschehen in Afghanistan in den Zeitungen und den Nachrichten. Nach dem elften September wappneten sie sich innerlich, empfanden es aber dennoch als Schock, in den Wochen nach der Katastrophe von Fremden auf der Straße wütend angebrüllt zu werden. Yusufs Vater begrüßte die Invasion der Vereinigten Staaten in Afghanistan, obwohl er weder hoffte noch wünschte, in seine Heimat zurückzukehren.
»Nur ein Narr läuft in ein brennendes Haus«, pflegte er zu scherzen.
Als Yusuf sein Studium an der NYU begann, war Afghanistan in aller Munde. Es war ermüdend. Afghanistan stand für Selbstmordattentate, unterdrückte und misshandelte Frauen und Korruption. Im zweiten Studienjahr hatte Yusuf sich aus einer Laune heraus für einen Kursus über Menschenrechte eingeschrieben, weil er dachte, es wäre eine einfache Möglichkeit, seinen Notendurchschnitt zu verbessern. Schon bei der zweiten Vorlesung wurde in seinem Inneren ein Feuer entzündet. Eine Flut von Erinnerungen stürmte auf Yusuf ein, und er war schlagartig wieder in Afghanistan. Blutzoll. Opferzahlen. Kleine Jungen, die als Grobschmiede arbeiteten. Ein vielversprechender Journalist, der zusammen mit seiner Frau und seinen Kindern ermordet worden war. Menschenunwürdige Flüchtlingslager. Ein junges Mädchen, das verkauft wurde, um die Schulden für eine Mohnernte zu begleichen. Unantastbare Warlords.
Wie konnte er all dem den Rücken zukehren?
Andere taten es nicht. Andere bewiesen Mut. Andere setzten sich für die Sache der Entrechteten ein.
Yusuf hatte die amerikanische Überzeugung, dass schon ein Einzelner etwas bewirken konnte, eingeatmet und gelebt. Flugblätter von Studentenvereinigungen und die optimistische Rhetorik der Professoren brachten etwas in ihm zum Keimen. Er nahm an seiner ersten Demonstration teil, und es gefiel ihm, mit der Menge zu skandieren. Er erhob seine Stimme. Er fand Gefallen am Kampf, an dem Zorn, der in ihm geweckt wurde. Wütend zu sein, fühlte sich besser an, als Angst zu haben.
Zwei Semester verstrichen, und Yusuf wurde bewusst, dass Wochen vergangen waren, seit er zum letzten Mal in kalten Schweiß gebadet aus dem Schlaf geschreckt war.
Yusuf entschied sich für Jura, weil es um den Unterschied zwischen Recht und Unrecht ging, weil das Gesetz die einzige Möglichkeit war, die Schwachen zu beschützen und die Aggressoren zu bestrafen. Er lernte wochenlang und arbeitete sich mit glühendem Eifer durch die Lehrbücher für die Aufnahmeprüfungen an der juristischen Fakultät. Dann machte er den Test und schnitt erstaunlich gut ab. Er füllte Bewerbungen für Dutzende Universitäten im Land aus, hoffte aber inständig, einen Studienplatz in New York zu bekommen. Voll nervöser Anspannung riss er schließlich einen dicken Umschlag von der Columbia University auf. Es waren gute Nachrichten, aber seine Eltern schüttelten enttäuscht den Kopf.
»Bist du sicher, dass du nicht lieber Arzt werden willst? Ärzte retten täglich Leben«, erinnerten sie ihn.
»Ich will mehr als ein Leben retten«, gab Yusuf zurück. »Es gibt bessere Möglichkeiten.«
Seine Eltern zuckten die Achseln und hofften das Beste. Wenigstens würde er als Akademiker eine wesentlich bessere Ausbildung haben als seine Geschwister, die wenig Interesse an einem Hochschulabschluss zeigten. Wenn sie geahnt hätten, worauf er letzten Endes hinauswollte, hätten sie sich noch mehr bemüht, ihn von seinem Entschluss abzubringen.
Yusuf belegte Vorlesungen über Menschenrechte und Einwanderungsgesetze. Er arbeitete ehrenamtlich als Dolmetscher und verfeinerte seine Muttersprache Dari. Er fand Professoren, die sich bereit erklärten, herumzutelefonieren, um ihm zu Praktika bei Menschenrechtsorganisationen zu verhelfen. Er war froh, dass sich seine Familie in New York angesiedelt hatte, wo es Möglichkeiten in Hülle und Fülle gab. Er vergrub sich ständig in Büchern.
»Du wirst noch vor deinem dreißigsten Lebensjahr erblinden«, jammerte seine Mutter. Sie war stolz auf ihren Sohn, aber sie machte sich auch Sorgen um ihn. In manchen Wochen schien er kaum zu schlafen.
Yusuf schloss sein Studium ab und bekam eine Stelle bei der Anwaltskanzlei, für die er zwei Jahre lang als Praktikant gearbeitet hatte. Sie waren von seinem Einsatz beeindruckt gewesen und hatten speziell für ihn eine Position geschaffen. Er verdiente nicht so viel wie diejenigen seiner Kommilitonen, die sich auf Wirtschaftsrecht verlegt hatten, aber es war mehr Geld, als er oder irgendjemand in seiner Familie je verdient hatte, und es faszinierte ihn, seinem Leben einen Sinn zu geben. Er arbeitete hart und lehnte kein Projekt ab.
Yusuf achtete darauf, auch unter Menschen zu kommen, obwohl er sich einredete, es ginge dabei nur darum, Netzwerke aufzubauen, damit er nicht das Gefühl hatte, seine Zeit zu verschwenden.
Es fing mit der Happy Hour an, einer netten Ausrede, nach dem Verlassen des klimatisierten Bürogebäudes noch etwas trinken zu gehen. Yusuf hatte im Lauf der Zeit eine Vorliebe für dunkles Lagerbier entwickelt. Ein kaltes Bierglas in der Hand gab ihm ein Gefühl der Verbundenheit mit seinen Kollegen. Diesen Teil seines Lebens verheimlichte er seinen Eltern und Geschwistern. Obwohl sie, seit er denken konnte, auf engstem Raum zusammenlebten, fühlte er sich verpflichtet, seine Sünden für sich zu behalten. In seinen Augen war es keine Täuschung, sondern ein Zeichen der Achtung für seine Eltern.
Die Happy Hour war auch die Zeit, in der Yusuf anfing, sich mit Frauen zu treffen. Es hatte all diese Jahre gedauert, bis er nicht mehr das Gefühl hatte, die Mädchen in seiner Umgebung würden ihn als fremdartig oder unterlegen betrachten. Als eine junge Asiatin namens Lin sich über die Theke lehnte und ihre Hand vertraulich auf seinen Unterarm legte, spürte Yusuf, wie sein Selbstvertrauen wuchs. Er ging mit ein paar Mädchen aus, ließ sich aber nie auf mehr als fünf oder sechs Dates ein. Wenn er den Eindruck hatte, dass sie mehr wollten, zog er sich zurück, indem er auf Anrufe nicht mehr reagierte oder offen aussprach, dass er an einer festen Bindung nicht interessiert war.
Sein Verhalten war unreif, das wusste er selbst, aber nachdem er oft genug gehört hatte, wie seine Eltern über die große Schar von Mädchen, mit denen sein Bruder ausging, herzogen, stand für ihn fest, dass er eine Frau finden wollte, von der sein Vater und seine Mutter hingerissen waren. Er wollte jemanden, der mit ihnen auf Dari sprechen konnte, der mit ihm zweisprachige Kinder aufzog, der sowohl die amerikanische wie die afghanische Kultur kannte. Denn das wäre nicht nur praktisch, sondern würde auch Respekt vor den Idealen seiner Eltern ausdrücken.
Dann hatte er Elena kennengelernt, die schöne und unwiderstehliche Elena, die in früher Kindheit mit ihrer Familie von Peru in die Vereinigten Staaten eingewandert war. Sie hatte schokoladebraunes Haar und Grübchen in den Wangen, wenn sie lächelte, und das tat sie oft. Sie war die Bekannte eines Kollegen und gesellte sich zu ihnen, als sie in einem Straßencafé saßen, wo sie ein Bier tranken. Sie war gerade auf dem Heimweg von ihrem Arbeitsplatz in einer Steuerberatungsfirma und trug modische marineblaue Bundfaltenhosen und ein weißes, tailliertes Top.
Sie war liebenswert und gescheit und, was fast noch wichtiger war, sie zuckte mit keiner Wimper, als Yusuf ihr erzählte, dass seine Familie aus Afghanistan stammte. Bei ihrem ersten Date besuchten sie ein Konzert peruanischer Musiker im Central Park. Bei ihrer zweiten Verabredung gingen sie im East Village Eis essen. Yusuf konnte nicht widerstehen, seine Arme um Elena zu legen und sie an sich zu ziehen. Sie war zwölf Zentimeter kleiner als er, und wenn sie einander umarmten, atmete Yusuf den schweren tropischen Duft ihres Shampoos ein. Sie schmiegte sich gerade so eng an ihn, das sie ihm das Gefühl gab, angehimmelt zu werden, aber nicht zu dicht, sodass er sich nicht eingeengt fühlte. Sie konnte in einem Atemzug über die Auswirkungen eines Handelsabkommens und den neuesten Song von The Direction reden. Yusufs Freunde hoben anerkennend die Augenbrauen und ihre Biergläser. Elena war ein guter Fang.
Als Yusuf sie kennenlernte, hatte er bereits Pläne gemacht, nach Washington zu ziehen, um dort für eine gemeinnützige Einrichtung zu arbeiten, die sich hauptsächlich mit Verbrechen gegen die Menschlichkeit beschäftigte. Er redete sich ein, dass sie beide die Beziehung als beendet betrachten würden, wenn er New York erst einmal verlassen hatte. Elena passte nicht in seine Pläne. Und doch empfand Yusuf Hunderte Kleinigkeiten an ihr als ungeheuer beglückend: wie ihre Nase sich krauste, wenn sie lachte, die Art, wie sie spielerisch einen Finger in seinen Kragen schob, der Drang, sie direkt nachdem sie einander Lebewohl gesagt hatten, anzurufen oder ihr eine SMS zu schicken.
Die Tatsache, dass sie sehr wenig gemeinsam hatten, schien ihre Verbindung eher zu stärken. Sprache, Religion, Beruf – sie erforschten einander mit nahezu wissenschaftlichem Interesse.
Elena hörte zu, wenn Yusuf über die Schlagzeilen sprach, die seine Aufmerksamkeit erregten: die Entdeckung eines Massengrabs mit Tausenden toten Moslems, Männern und Jungen, die während des Genozids in Bosnien massakriert worden waren, die Auspeitschung eines regimekritischen Journalisten in Saudi-Arabien, das spurlose Verschwinden eines malaysischen Flugzeugs. Die Ellbogen auf den Tisch gestützt, den Blick unverwandt auf ihn gerichtet, steuerte sie die Details bei, die sie in den Online-Nachrichten gelesen hatte. Sie brachte Yusufs Vorsätze ins Wanken. Vielleicht sollte er nicht so krampfhaft an der Idee festhalten, eine Frau zu finden, die denselben Hintergrund hatte wie er. Vielleicht waren eine gemeinsame Sprache und Kultur nicht alles.
Vielleicht war Elena alles.
Sie waren nach einem Abendessen bei Freunden auf dem Weg zur U-Bahn und mussten an einer Ampel warten. Er wandte sich zu ihr um und zog den Paisleyschal, den sie sich um den Hals geschlungen hatte, zurecht. Es war Herbst, und die Abende waren frisch.
»Dieses Wochenende ist die Taufe meiner Nichte. Du kommst doch mit, oder?«, fragte sie.
Die rote Ampel sprang auf Grün und forderte sie zum Weitergehen auf. Yusuf reagierte nicht sofort. Elena musste ihn am Ellbogen zupfen.
»Vielleicht«, sagte er. »Mal sehen, wie ich diese Woche mit der Arbeit vorankomme.«
Sie setzten sich auf zwei freie Plätze in der Linie 7, New Yorks Version der Seidenstraße. Elena würde aussteigen, kurz nachdem sie Queens erreicht hatten und bevor die Gegend eindeutig asiatisch wurde. Yusuf musste danach noch neun Stationen weiterfahren, ehe er Flushing erreichte.
»Weißt du, du fehlst mir jetzt schon, Schatz«, sagte Elena zu ihm, als das Schwanken des Waggons sie näher aneinanderrücken ließ. »Am liebsten würde ich dich jedes Wochenende in D.C. besuchen.«
Yusuf küsste sie auf den Mund, lange genug, um bei Elena den Eindruck zu erwecken, er würde sie genauso vermissen. Aber irgendetwas in Yusuf sträubte sich gegen den Gedanken, sie könnte von ihm erwarten, etwas so Fremdartiges wie eine Taufe zu besuchen, und als sich ihre Lippen voneinander lösten, zog er sich zurück. Als der Schaffner Elenas Station ausrief, lächelte sie Yusuf zu und stieg aus. Schon jetzt tat ihm leid, was er würde tun müssen, aber es gab keine andere Möglichkeit. Yusuf sah nicht mehr, was Elena war – er sah nur noch, was sie nicht war.
Ein reumütiger Yusuf zog nach Washington, D.C., und arbeitete ein Jahr lang mit einem Team von Anwälten an einer Klage gegen afrikanische Offiziere, die des Völkermords beschuldigt wurden. Er gab sich große Mühe, nicht an Elena zu denken. Wenn er sie vermisste, was oft vorkam, stürzte er sich in die Arbeit oder telefonierte mit seiner Mutter, weil ihn das daran erinnerte, wie schlecht Elena in ihre Familie gepasst hätte. Die Gespräche mit seiner Mutter waren im Grunde ziemlich vorhersehbar. Sie versorgte ihn mit den letzten Neuigkeiten über seine Geschwister und Klatsch über seine übrigen Verwandten. Aber irgendwann wandte sie ihre Aufmerksamkeit Yusuf zu.
»Du hast dein Studium abgeschlossen, du hast einen Job. Es wird Zeit, ans Heiraten zu denken. Willst du so lange warten, bis sich die anderen Burschen, die nicht einen Bruchteil deines guten Aussehens oder deiner Intelligenz haben, all die guten Mädchen geschnappt haben?«
Yusuf wich diesem Thema aus. Er vermisste es, jemanden an seiner Seite zu haben, aber er konnte sich zu diesem Zeitpunkt nicht vorstellen, sich eine Frau zu suchen. Er konnte sich nicht vorstellen, wie es war, wenn jemand jeden Abend auf ihn wartete und ihn fragte, warum er so lange arbeitete. Er wollte sich nicht mit einem zweiten Satz Eltern und Onkeln und Tanten belasten. Er verspürte nicht den Wunsch, Vater zu werden. Er schwindelte seinen Eltern vor, dass er sich im nächsten Jahr ernsthaft um eine feste Beziehung bemühen würde.
Aber Yusuf hatte andere Pläne. Er würde Opfer bringen müssen, glaubte er, um den Weg zu beschreiten, der ihm bestimmt war. Und ihm blieb nichts anderes übrig, als sich von Elena zu trennen.
Und das wäre ihm schwerer gefallen, wenn er nicht ein seltsames Stechen in seiner Brust gespürt hätte.
Das Land des Lehms und der Berge war der Grund. Denn es war, als wäre ihm im Traum eine Sirene erschienen und hätte ihn gebeten, sie vor sich selbst zu beschützen. Er hörte ihren Namen in den Nachrichten im Radio, er sah ihr Gesicht auf den Titelseiten der Zeitschriften. Das Internet schrie ihr Unglück heraus, wenn es die Geschichte von dem unrechtmäßig vergossenen Blut auf ihrem Boden, von den Gefangenen und den Verfolgten erzählte. Jedes Unrecht rief nach ihm, als wäre er die einzige Hoffnung.
Afghanistan.
Yusuf griff nach dem Telefon. Er verschickte sorgfältig abgefasste E-Mails. Wenn er nicht auf ihren Ruf reagierte, wer würde es dann tun? Seine Entscheidung stand fest.
Mitten in der hektischen Betriebsamkeit auf dem Bürgersteig wurde Yusuf bewusst, dass er sich nicht mehr erinnern konnte, wann er zum letzten Mal schweißgebadet aufgewacht war. Er lächelte in sich hinein. Er musste nur an sie denken, um sich stärker zu fühlen. Sie war schön und geschunden – sie war seine Heimat.
KAPITEL 3
»Ihr Mann ist ermordet worden! Es ist nicht die Zeit für unsinnige Fragen! Denkt an eure Ehre! Dieser Mann muss gewaschen und für die Beerdigung vorbereitet werden. Seine Eltern, seine Familie – hat schon jemand mit ihnen gesprochen?«
Zebas Hände verkrampften sich. Wenn sie nur aufhören würden zu zittern, könnte sie vielleicht verstehen, was passiert war. Könnte es vielleicht erklären. Ihr Kopf steckte in einem Schraubstock. Zu viele Stimmen redeten durcheinander. Kamals Leichnam lag immer noch bei der Außentoilette. Das musste doch irgendjemandem aufgefallen sein.
»Dieser Mann ist in seinem eigenen Zuhause getötet worden! Wir müssen wissen, was da passiert ist!«
Basir und die Mädchen waren im zweiten Schlafzimmer. Kareema und Shabnam, acht und neun Jahre alt, versuchten, tapfer zu sein. Sie waren zu ihrer Mutter gelaufen, als sie endlich ins Haus kam, aber der Ausdruck in ihren Augen und das Zittern ihrer krampfhaft ineinandergeschlungenen Hände hatte sie erschreckt. Sie wichen zurück und hielten sich an ihren Bruder Basir, der sie angewiesen hatte, auf Rima aufzupassen.
»Bitte, alle, die ihr hier seid, liebe Freunde und Nachbarn, versteht, dass meine Mutter, meine Familie, heute Schlimmes erlitten hat. Ich muss meine Onkel benachrichtigen, die restliche Familie.«
»Aber jemand muss die Polizei rufen!«
»Sie ist bereits unterwegs.«
»Wer hat sie verständigt?«
»Das ist doch egal. Der Polizeichef wird in Kürze hier sein. Er kann entscheiden, was zu tun ist.«
Die Schreie hatten die Türen der Nachbarhäuser geöffnet, eine nach der anderen. Ein Skandal war eine unwiderstehliche Versuchung. Man wusste nicht, wer geschrien hatte, und jetzt gaben weder Basir noch Zeba Informationen preis. Basir stand vor der Hintertür und biss sich auf die Lippe. Er kämpfte gegen Tränen an und starrte unverwandt auf den Boden. Die Neuigkeit hatte sich in der Nachbarschaft ausgebreitet wie ein Tropfen Tinte in Wasser, und Männer und Frauen waren herbeigeströmt. Basir warf einen verstohlenen Blick auf die Gesichter, die er schon sein Leben lang kannte. Die Frauen hielten ihre Kopftücher züchtig unter dem Kinn zusammen und schnalzten leise mit den Zungen. Die Männer schüttelten die Köpfe und zuckten mit den Schultern.
»Jemand sollte den Mullah holen.«
»Ja, holt den Mullah!«
»Und irgendwer muss seine Familie verständigen, um Himmels willen! Rafiqi-sahib, schick deinen Sohn!«
Basirs Blick flog zu seiner Mutter.
»Aber warum sagt sie nichts? Was ist hier passiert, Khanum? Hast du deinen Mann getötet?«
»Natürlich hat sie das! In seinem Genick steckt eine Axt! Glaubst du etwa, das hat er selbst gemacht?«
Zeba und Basir zuckten beide zusammen, als die Axt erwähnt wurde. Basir kauerte sich neben seine Mutter, die seitlich an der Lehmwand ihres Hauses lehnte.
Seine Stimme brach zu einem nervösen Flüstern.
»Madar, ich weiß nicht, was ich … Kannst du ihnen nicht sagen, was passiert ist? Ist jemand hier hereingekommen?«
Zebas Augen flehten ihren Sohn an. Sie sagte nichts.
Basir presste seine Handflächen auf seine geschlossenen Augen, und den Bruchteil einer Sekunde war alles schwarz. Er sah immer noch das Blut.
»Was sollen wir jetzt tun?«
Basir weinte leise. Zeba zog sich ihren Schal vor ihr Gesicht. Augen beobachteten sie, verdammten sie. In dem Zimmer hinter dieser Wand kauerten ihre drei Töchter. Zeba atmete tief ein.
»Basir, Bachem, schau bitte nach deinen Schwestern. Sie müssen große Angst haben.«
Augen wurden schmal, Ohren neigten sich in ihre Richtung. Die trauernde Witwe hatte gesprochen. Sie warteten auf ein Geständnis. Basir rührte sich nicht. Er blieb an der Seite seiner Mutter und rieb sich mit dem Handrücken zornig die Tränen aus den Augen.
Was wird sie sonst noch sagen, fragte er sich.
»Mein Gott, was hast du über uns gebracht? Womit haben wir diesen Schicksalsschlag verdient? Was sollen wir tun?« Zeba stöhnte laut genug, um mitfühlende Blicke zu ernten. »Wie konnte das nur geschehen … hier in unserem Zuhause?«
Die Frauen schauten zu den Männern. Sie sahen einander an. Zeba war dem Tod so nahe, wie es eine Frau nur sein konnte. Und dann fingen sie an, in ihre Klagen einzustimmen.
»Die arme Frau … sie hat keinen Mann mehr … möge Allah sie und ihre guten Kinder beschützen!«
Agha Hakimi, der Polizeichef, war Anfang vierzig. Er war der Enkel eines Warlords, der von einem anderen Warlord mit mehr Männern, mehr Waffen und mehr Geld unterworfen worden war. Hakimi war der lebende Beweis für Versagen und Machtlosigkeit, und so wurde er im Dorf auch behandelt.
Als Hakimi den Hof betrat, führte man ihn sofort nach hinten, wo immer noch Kamals Leiche lag. Beim Anblick des Toten schüttelte er den Kopf und kniff die Augen zusammen, in der Hoffnung, eher nachdenklich als angewidert zu erscheinen. Das Fleisch war bis hinunter zu Kamals Nacken aufgerissen worden. Hinter dem Toten war der Boden rot, weiß und rosa gesprenkelt – Blut, Knochensplitter und Hirnmasse.
Mehrere Personen gleichzeitig informierten den Polizeichef über den Stand der Dinge, ihre Berichte überschlugen sich. Seine Blicke schossen von den schaurigen Überresten des Opfers zu der Witwe, die sich an der Wand zusammengekauert hatte, zu den vielen Gesichtern, die ihn erwartungsvoll anstarrten.
Zeba stöhnte leise, wehklagend.
Hakimi sah die Frau durchdringend an. Ihre Augen waren glasig, ihre Hände zitterten. Als er sie ansprach, starrte sie ihn verständnislos an, als spreche er in einer fremden Sprache. Hakimi wandte sich gereizt an die Menge, die sich im Haus versammelt hatte.
»Und keiner weiß, was da draußen vorgefallen ist? Guter Gott! Was ist mit Kamal passiert? Ihr seid seine Nachbarn? Hat denn niemand etwas gehört?«
Er hob gebieterisch die Hand und wandte sich zu Rafiqi um. Von all den anwesenden Männern hatte Agha Rafiqi den grauesten Bart, und sein Haus grenzte an einer Seite an das von Zeba.
»Agha Rafiqi, du teilst eine Mauer mit dieser Familie. Du kennst sie seit Jahren. Was hast du gehört?«
Im Lauf der Jahre hatte Agha Rafiqi einiges gehört – nicht das Geräusch, das Zeba in den Hof geführt hatte, aber andere Geräusche, die leichter zu benennen waren. Er sah zu der Frau, die in sich zusammengesunken auf dem Boden hockte und zitterte wie ein Vogel, der sich im Netz verfangen hatte.
»Ich … ja, natürlich, ich kenne sie seit Jahren. Kamal-jan, Allah sei ihm gnädig, hat nie Probleme gemacht. Er hat für seine Familie gesorgt, er war … ach, was soll ich sagen? Seine Witwe sitzt jetzt hier. Sie hat vier Kinder, die sie großzieht. Meine Frau kennt sie gut. Ich kann nicht glauben, dass sie ein so abscheuliches Verbrechen begehen würde.«
Rufe wurden laut, Fäuste in der Luft geschwenkt.
»Ruhe!«, rief Hakimi, der spürte, wie ihm ein dünnes Rinnsal Schweiß den Nacken hinunterlief. Was auch immer er jetzt vorschlagen würde, bei der Vorstellung, wie die Leute darauf reagieren könnten, stockte ihm der Atem. Sie hassten ihn, das wusste er. Warum nur, warum hatte er sich darauf eingelassen, diesen Job zu übernehmen?
»Ich will hören, was Agha Rafiqi zu sagen hat.« Er wandte sich wieder an Agha Rafiqi, dem angesichts der Bedeutung, die ihm zugesprochen wurde, noch unbehaglicher zumute zu sein schien.
Agha Rafiqi räusperte sich. »Ich bin kein Richter«, begann er vorsichtig, »aber ich würde meinen, es wäre eine Sache des Anstands, ihr zu erlauben, hierzubleiben und sich um ihre Kinder zu kümmern, bis die Angelegenheit geklärt ist.«
Die Frauen murmelten zustimmende Worte.
Hakimi nickte bekräftigend. Die Menschen achteten Rafiqi und würden die Meinung des Ältesten ihres Viertels nicht in Frage stellen. Die unfreundlichen Stimmen senkten sich zu einem leisen Raunen. Hakimi räusperte sich, fummelte an seinem Uniformgürtel herum und trat einen Schritt von Zeba zurück.
»Nun, dann wäre da noch die Frage, was mit der Leiche geschehen soll …«
»Wir werden den Toten in Tücher hüllen und näher zur Hintertür tragen, damit seine Familie ihn dort waschen kann«, rief einer der Männer.
Basir spürte, wie sich sein verkrampfter Magen ein wenig entspannte. Hakimi schaute sich auf dem Anwesen um, spähte in jeden Winkel des Hauses und untersuchte ihren Hof Stück für Stück. Er hatte zwei Polizisten bei sich, junge Burschen, kaum älter als Basir, mit struppigen Haaren und glatten Gesichtern.
Jemand nahm ein Laken von der Wäscheleine. Hakimi stand da, die Hände in die Hüften gestemmt, und dankte mit einem Nicken. Er vermied es, Zeba anzuschauen.
Basir konnte sehen, dass die Nachbarn mehr als nur ein bisschen interessiert an der blutigen Szene waren. Die Frauen strömten aus Achtung vor dem Toten eine nach der anderen hinaus, fanden aber Gründe, auf der Straße stehen zu bleiben und sich in der Hoffnung auf einen flüchtigen Blick die Hälse zu verrenken. War es wirklich so schlimm, wie behauptet wurde?
Und so hätte alles enden können, wenn nicht Fareed, atemlos und rasend vor Wut, ins Haus gestürmt wäre. Fareed, Kamals junger Cousin. Ein Mann, der in einem Atemzug höfliche Worte wechseln und fluchen konnte. Fareeds Hemd klebte an seinem Körper, und sein Gesicht war gerötet. Hakimi erschrak so sehr, dass ihm beinahe sein Notizblock aus der Hand gefallen wäre.
»Was ist hier los? Wo ist mein Cousin?«
Fareeds Blick fiel auf die vier Männer, die den in eine Decke gehüllten Leichnam trugen. Das helle Blumenmuster war mit dunkelroten Flecken übersät.
»Es ist also wahr? Ist er das? Lasst mich meinen Cousin sehen! Was ist mit ihm passiert?«
Er drängte sich durch die Menge, aber drei Männer hielten ihn fest und murmelten Beileidsbekundungen.
»Sagt mir jetzt endlich jemand, was hier passiert ist?«, brüllte Fareed.
Alle Blicke richteten sich auf Hakimi. Der Polizeichef straffte seine Schultern und berichtete, was ihm bis jetzt bekannt war.
»Dein Cousin wurde im Hof gefunden. Wir können im Moment noch nicht sagen, wer ihn getötet hat. Niemand hat etwas gehört, bis Khanum Zeba zu schreien anfing. Wir glauben, dass sie die Leiche ihres Manns gefunden hat. Während wir weiter ermitteln, darf Zeba hierbleiben, um sich um die Kinder zu kümmern.«
Fareed starrte die Frau seines Cousins an, die noch heftiger zitterte, seit er hereingekommen war, und sich mit halb geschlossenen Augen hin und her wiegte. Fareed wandte sich um und starrte die Umstehenden an, von denen einige im vagen Gefühl einer Schuld, das sie sich selbst nicht erklären konnten, von einem Bein aufs andere traten. Seine Nasenflügel blähten sich, und seine Stirn legte sich in Zornfalten.
»Habt ihr denn alle den Verstand verloren?«
Die Männer sahen einander an.
Fareed wartete nicht auf eine Antwort. Er stürzte sich auf Zeba, und im nächsten Moment, noch bevor jemand es verhindern konnte, schlossen sich seine Hände um ihre Kehle.
KAPITEL 4
In jenen schlimmen Stunden sehnte sich Zeba nach ihrer Mutter wie ein kleines Kind, das Fieber hat. Aber sie rief nicht nach ihr. Nach den gehässigen Worten, die sie gewechselt hatten, war Zeba noch nicht verzweifelt genug, sich an Gulnaz zu wenden. Sie wollte warten.
Natürlich war es ein Jammer. Früher einmal waren Zeba und ihre Mutter so eng miteinander verbunden gewesen wie eine Blume mit ihrem Stiel. Zeba war ein bezauberndes Kind gewesen, die vollkommene Verkörperung ihres Namens, den ihr Vater ihr gegeben hatte. Sie rutschte gern vom Schoß ihres Vaters zu ihrer Mutter herüber und lachte entzückt, wenn ihre Eltern abwechselnd ihren Bauch kitzelten, ihr einen Kuss auf den Scheitel gaben oder sie in die Luft warfen.
Zebas Bruder Rafi war fünf Jahre älter als sie und von ernsterer Veranlagung. Er war ein unkomplizierter, gehorsamer Sohn, der seinen Eltern weder Grund zur Sorge noch zum Prahlen gab.
Während sich bei den meisten Frauen in Gulnaz’ Umgebung der Bauch bereits über dem nächsten Kind wölbte, sobald das vorige laufen gelernt hatte, war es bei Gulnaz anders. Ihr war es wichtig, die Kontrolle zu haben – Kontrolle über ihre Gefühle, ihren Körper, ihre Familie. Ihr Mann war es zufrieden, ihr ihren Willen zu lassen. Darum wurde sie heftig beneidet, was ihr Bedürfnis, das Sagen zu haben, noch mehr verstärkte.
Gulnaz wollte ein Kind bekommen, wenn sie es sich wünschte. Ob ihr das gelang, indem sie die Wünsche ihres Mannes ignorierte oder indem sie auf bestimmte Kräuter zurückgriff, wusste niemand. Sie lächelte bloß in sich hinein, wenn ihre Schwägerinnen danach zu fragen wagten.
Es war 1979, und die Sowjettruppen hatten gerade erst mit der Invasion begonnen, das Ergebnis eines Flirts zwischen Afghanistan und der Großmacht, der vor zwanzig Jahren, zur Zeit von Gulnaz’ Geburt, seinen Anfang genommen hatte.
Rafi, ihr Erstgeborner, war alt genug, um sich ohne Hilfe zu waschen, anzuziehen und allein zu essen, als Gulnaz entschied, dass sie für ein zweites Kind bereit war. Neun Monate nachdem sie diesen Wunsch ausgesprochen hatte, kam Zeba zur Welt. Gulnaz liebte Zeba umso mehr, weil ihre beglückende Existenz der Beweis war, dass Gulnaz selbst über ihr Leben bestimmte.
Afghanistan wechselte in jenem Jahr in rascher Abfolge seine Regierungschefs. Ein Präsident ersetzte den anderen, der entweder eines natürlichen Todes gestorben oder durch die Hand von Rebellen gefallen war – die Wahrheit würde wohl nie ganz ans Tageslicht kommen. Da Chaos weiteres Chaos erzeugt, würde der neue Präsident ersetzt werden, bevor das Jahr um war. Es war keine gute Zeit, um neues Leben zu schaffen. Gulnaz fragte sich sogar, ob Zeba nicht ein Fehler gewesen war.
Stell dir ein Haus vor, das in einem Jahr von drei verschiedenen Patriarchen geleitet wird, dachte sie. Nein, auf diese Art konnte ein Haus nicht überleben, und ein Land konnte es genauso wenig.
»Wir werden noch mehr Kinder haben«, hatte Gulnaz ihrem Mann und ihrer Familie verkündet. Niemand zweifelte an ihren Worten. Inzwischen wussten sie, dass Gulnaz die Natur nach ihren eigenen Wünschen lenken konnte.
Gulnaz war eine Hexe, eine geschickte Dompteuse des Schicksals, wie ihre Großmutter es gewesen war. Gulnaz behauptete zwar, ihre Großmutter hätte ihr nie etwas von den Kniffen beigebracht, die sie beherrschte, aber das stimmte ganz offensichtlich nicht. Was Gulnaz praktizierte, war eine hoch entwickelte, über Generationen verfeinerte Kunst, nichts, was man im Vorbeigehen hätte aufschnappen können.
Sie summte leise vor sich hin, wenn sie einen Trank zusammenbraute, was ihre Tätigkeit in den Augen ihres Mannes und ihrer Kinder noch harmloser erscheinen ließ. Schließlich profitierten sie von ihren Fähigkeiten. Wenn die Kinder fieberten, träufelte sie ihnen heiliges Wasser in den Mund und legte Amulette unter ihre Kissen. Als sich an Rafis Wade ein Geschwür von der Größe einer Tomate bildete und der Junge sich vor Schmerzen krümmte, machte sich Gulnaz auf den Weg zum See. Sie fing einen Frosch, schlitzte ihn mit einem Schälmesser auf, legte ihn ausgebreitet auf das Geschwür und befestigte den blutenden Kadaver mit Stoffbändern. Innerhalb einer Stunde schrie Rafi laut auf. Das Geschwür hatte sich geöffnet, und große Mengen Eiter flossen an seinem Bein hinunter. Gulnaz warf den toten Frosch weg, und zwei Tage später war Rafis Bein vollständig geheilt. Gulnaz war so liebevoll und fürsorglich, wie eine Mutter und Ehefrau nur sein konnte – und sie verfügte über mehr Wissen als andere. Ihre Kinder vertrauten den magischen Kräften ihrer Mutter, auch wenn ihre Methoden manchmal wehtaten.
Als Rafi sechs war, brach er sich ein Bein. Es passierte eines Tages, nachdem seine Tante eine Bemerkung über seine ungewöhnliche Körpergröße gemacht hatte. Leise Verwünschungen ausstoßend, hielt Gulnaz eine Nähnadel über eine Flamme und durchstach mit Tränen in den Augen, weil der Junge unter ihrer Berührung zusammenzuckte und schrie, Rafis Ohrläppchen. Und bis er vierzehn Jahre alt war, ließ sie eine Locke seines Haars lang wachsen, bis sie ihm tief über den Rücken hing.
»Um dich vor Nazar zu schützen«, sagte sie grimmig. Der böse Blick besaß große Macht. Diese Dinge mussten getan werden.
Die restliche Familie fühlte sich in Gulnaz’ Nähe unbehaglich. Cousinen, Schwägerinnen und Tanten bissen sich auf die Zungen und klammerten sich an ihre Gebete, als wären sie ein Gegengift. Die grünäugige Schönheit beunruhigte sie.
Zeba saß bei ihrer Mutter und schaute zu, wie sie heiße Nadeln in Tierfett oder gekochte Eier stieß, die sie später an der Türschwelle ahnungsloser Bewohner deponieren würde. Diese Dinge wurden für sie zu einer alltäglichen Routine wie Wäsche zu waschen oder Kartoffeln zu schälen. So war das Leben mit Gulnaz eben. Zeba leierte zusammen mit anderen Kindern ihres Alters das kleine und das große Einmaleins herunter, erfasste aber die Eigenarten der Mathematik sehr viel besser, als Gulnaz ihr zeigte, wie ein fünffach geschlungener Knoten fünfmal so wirkungsvoll darin war, Spannungen zwischen zwei feindlichen Frauen in ein heftiges Feuer zu verwandeln, sodass es ein Haus niederbrennen konnte.
Aber Gulnaz gebrauchte ihre Fähigkeiten nur, wenn es erforderlich war oder wenn diejenigen, die ihr nahestanden, sie um Hilfe baten. Sie ging besonnen damit um, weil sie wusste, dass es ihrem Mann Unbehagen bereitete, obwohl er es ihr nie direkt verboten hatte. Wie alles andere in ihrem Leben verstand sie sich auch darauf, ihre besonderen Kenntnisse gut zu kontrollieren und machte so viel oder so wenig Gebrauch davon, wie sie es für notwendig hielt.
All das änderte sich, als Zebas Vater verschwand. Sie bemerkte die plötzliche Veränderung bei ihrer Mutter, eine Verspannung in ihrem Kiefer, die sich nie mehr löste.
Zebas Vater verschwand zu der Zeit, als sie lesen lernte. In ihrer Erinnerung ergab damals eine Reihe von Buchstaben mehr Sinn als die Ereignisse in ihrem kleinen Zuhause. Gulnaz teilte Rafi und Zeba lediglich mit, dass ihr Vater in den Kampf gegen die gottlosen Kommunisten gezogen war. Die Kinder wünschten sich im Stillen seine baldige Rückkehr, lernten aber schnell, dieses Thema nicht mit ihrer Mutter zu diskutieren. Wenn Verwandte seine plötzliche Abreise ansprachen, verbrachte Gulnaz den restlichen Tag damit, vehement den Staub aus den Teppichen zu klopfen oder die geschwärzten Kochtöpfe zu scheuern. Es war besser, Padar nicht zu erwähnen, auch wenn seine Abwesenheit wie ein Fenster war, das im Winter offen stand. Der Krieg wurde von Tag zu Tag blutiger, und wie es schien, würde es bald mehr Märtyrer als Überlebende geben.
Gulnaz zog sich von der Familie ihres Mannes in die Mauern des Anwesens zurück, umgab sich immer enger mit ihren Kindern und nahm das Aussehen der übel gelaunten, im Stich gelassenen Ehefrau an. Als so viel Zeit verstrichen war, dass einige Leute anfingen, sie als Witwe zu bezeichnen, nutzte Gulnaz diese Mutmaßungen zu ihrem Vorteil. Sie trug nur noch Schwarz, zog die Vorhänge vor den Fenstern zu und sprach mit gesenkter Stimme. Sie blieb auf, wenn die Kinder schliefen, und beobachtete sie im schwachen Licht einer flackernden Kerze. Die Kinder hatten ihren Vater geliebt und vermissten ihn schmerzlich. Und als würde ihn die Abwesenheit seines Vaters schwächen, wurde Rafi noch reservierter, als er es von Natur aus ohnehin schon war. Zeba glaubte mit der unerschütterlichen Überzeugung eines Kindes an die Rückkehr ihres Vaters. Sie war in zu vielen Nächten zum besänftigenden Rhythmus seines Herzschlags eingeschlafen, um sich vorstellen zu können, sie würde nie wieder ihren Kopf an seine Brust legen.
Gulnaz und die Kinder zogen Blicke auf sich – manche mitleidig, andere argwöhnisch. Gulnaz verachtete beides gleichermaßen und fügte die Namen der Betreffenden der Liste ihrer Feinde hinzu. Und sie alle bekamen in irgendeiner Form ihre Rache zu spüren. Beschützt von ihrer Mutter, gewöhnte Zeba sich daran, ein Außenseiter zu sein. Rafi, ruhig und zurückhaltend wie er war, wurde ihr bester Freund. Er war der einzige Mensch auf der Welt, der verstehen konnte, was es bedeutete, Gulnaz zur Mutter zu haben.
»Wenn ein Mann genug hat, hat er genug«, hatte Zebas Tante einmal bei einem Festmahl bemerkt, als sich das Gespräch um ein benachbartes Ehepaar drehte, dessen Auseinandersetzungen bis auf die Straße zu hören waren. Die Frauen waren beim Abwaschen zu dem Urteil gekommen, dass der Mann ein brutaler Dickschädel sei, der die nahezu öffentliche Schelte seiner Frau mehr als verdient habe. Aber Ama Ferei, die Schwester von Zebas Vater, vertrat eine andere Meinung.
»Kein Ehemann, keine Ehefrau ist frei von Fehlern. Nur die beiden selbst kennen das wahre Wesen ihrer Beziehung.«
Zeba hatte sich dabei nicht viel gedacht, aber Gulnaz hatte gelächelt und zustimmend genickt. Ihre Tante war die Stimme der Vernunft gewesen, fand Zeba. Aber sowie Gulnaz und ihre Kinder sich wieder im Schutz ihrer eigenen vier Wände hinter den zugezogenen Vorhängen befanden, sah alles ganz anders aus.
»Sie glaubt, er hatte genug«, fuhr Gulnaz niemanden im Besonderen an. »Natürlich hatte er genug! Bei dieser schrecklichen Ehefrau!«
»Was ist denn los, Madar-jan?«, hatte Zeba vorsichtig gefragt. Sie war damals ungefähr zwölf gewesen, auf der Schwelle zwischen Kindheit und Jugend. Sie und die Cousinen, die in ihrem Alter waren, verbrachten ihre Zeit mit den Frauen und lernten so die Feinheiten von Klatsch und Etikette.
»Deine Tante sagt immer, was ihr durch den Kopf geht, und macht dabei ein Gesicht, als wäre sie furchtbar edel und über jeden Tratsch erhaben. Ich weiß nicht, was ich beleidigender finde – dass sie andeutet, ich hätte euren Vater aus dem Haus getrieben, oder dass sie glaubt, ich wäre zu dumm, um zu merken, was sie wirklich meint!«
Rafi wusste nie, wie er reagieren sollte, wenn seine Mutter sich in einen Wutanfall hineinsteigerte. Da er es hasste, sich hilflos zu fühlen, suchte er sich irgendeine Beschäftigung außerhalb des Hauses. Bei dieser Gelegenheit griff er nach dem gelben Plastikkanister und lief zur Tür hinaus, um Wasser aus dem Brunnen zu schöpfen. Zeba sah ihm nach. Ihr stand eine solche Fluchtmöglichkeit nicht offen, schon gar nicht in den Abendstunden.
»Aber Madar-jan, ich habe gar nicht gehört, dass sie etwas über unseren Vater gesagt hat«, protestierte Zeba zaghaft, die ebenso gekränkt gewesen wäre, wenn ihre Tante genau das getan hätte. Sie vermisste ihren Vater immer noch, auch wenn die Erinnerung an seine Gesichtszüge allmählich verblasste.
»Wirklich nicht? Ach, Zeba.« Gulnaz seufzte. »Ein winziger Skorpion kann genauso tödlich sein wie ein hungriger Tiger, meine Tochter. Du musst lernen, genau hinzuhören und jede Bedrohung auch als solche zu erkennen. Und wie sie dich beobachtet hat! Bestimmt ist sie neidisch, weil du viel größer als ihre Tochter bist und eine viel hellere Haut hast. Deine Cousine ist ein liebes Mädchen, aber sie hat nicht dein Aussehen, und ihre Mutter weiß das.«
Zeba hatte nicht den Eindruck, hübscher als ihre Cousine zu sein. Eigentlich fand sie sich wesentlich weniger hübsch als alle anderen. Es war ein gutes Gefühl zu denken, sie könnte sich geirrt haben, was ihr Aussehen anging.
»Nicht auszudenken, dass ich zwei Tage damit verbracht habe, Klößchen für das heutige Essen zu machen, weil sie mich darum gebeten hat – ganz zu schweigen davon, dass ich letzte Woche, als sie krank im Bett lag, jeden Tag für sie alle gekocht habe! Aber daran erinnert sich deine Tante nicht. Sie ist zu beschäftigt damit, darüber nachzudenken, dass ich ihren Bruder ins Gebirge geschickt habe – als ob ich so viel Macht über diesen Mann gehabt hätte! Sie weiß nicht, was sie redet, und sollte lieber ihre Zunge im Zaum halten.«
Es tat Zeba weh, ihre Mutter so kühl über ihren Vater reden zu hören. Er war jetzt seit sechs Jahren fort, aber Zeba klammerte sich immer noch an die Hoffnung, dass er zurückkommen könnte. Manchmal träumte sie davon, ihn zufällig auf dem Markt zu treffen. Würden sie einander erkennen? Würde er auf sie zulaufen und sie auf die Stirn küssen? Aber Zeba gingen auch weniger optimistische Gedanken durch den Kopf. Vielleicht waren sie schon einmal ganz in seiner Nähe gewesen, nur einen Steinwurf entfernt, und er hatte sich rasch geduckt, bevor sie ihn entdecken konnten. Es gab Zeiten, da drifteten ihre Gedanken immer stärker in diese bedrückende Richtung ab, und dann trübte sich Zebas Welt vor lauter Einsamkeit, Misstrauen und Zweifel.