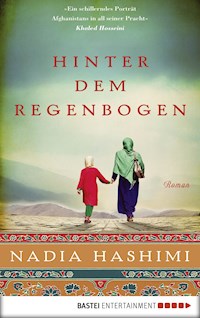9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Fereiba führt in Kabul ein glückliches Leben - bis die Taliban ihr die Arbeit als Lehrerin verbieten und ihren Mann hinrichten. Fereiba sieht sich gezwungen, mit ihren drei Kindern zu fliehen. Mithilfe von Schleppern und gefälschten Pässen will sie sich zu ihrer Schwester in London durchschlagen. Doch in Athen wird ihr ältester Sohn Saleem von der Familie getrennt. Schweren Herzens setzt Fereiba die Reise ohne ihn fort. Werden Mutter und Sohn sich jemals wiedersehen?
"Ein wunderschöner Roman mit tiefgründigen Charakteren vor dem dramatischen Hintergrund einer Welt, die verrückt geworden ist. Eine Geschichte unserer Zeit." Bookreporter
"Eine Geschichte, die von Herzen kommt. Sie erzählt von Mut inmitten einer Welt, der es an Mitgefühl mangelt." Toronto Star
"Nadia Hashimi hat sich auf ihre afghanischen Wurzeln besonnen und vor allem eine einfühlsame und wunderschöne Familiengeschichte geschrieben. Ein schillerndes Porträt Afghanistans in all seiner Pracht." Khaled Hosseini über "Hinter dem Regenbogen"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 572
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumWidmungGedichtPrologTeil einsKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26Kapitel 27Kapitel 28Kapitel 29Teil zweiKapitel 30Kapitel 31Kapitel 32Kapitel 33Kapitel 34Kapitel 35Kapitel 36Kapitel 37Kapitel 38Kapitel 39Kapitel 40Kapitel 41Kapitel 42Kapitel 43Kapitel 44Kapitel 45Kapitel 46Kapitel 47Kapitel 48Kapitel 49Kapitel 50Kapitel 51Kapitel 52Kapitel 53Kapitel 54Kapitel 55Kapitel 56DanksagungGlossarÜber dieses Buch
Fereiba führt in Kabul ein glückliches Leben – bis die Taliban ihr die Arbeit als Lehrerin verbieten und ihren Mann hinrichten. Fereiba sieht sich gezwungen, mit ihren drei Kindern zu fliehen. Mithilfe von Schleppern und gefälschten Pässen will sie sich zu ihrer Schwester in London durchschlagen. Doch in Athen wird ihr ältester Sohn Saleem von der Familie getrennt. Schweren Herzens setzt Fereiba die Reise ohne ihn fort. Werden Mutter und Sohn sich jemals wiedersehen? »Ein wunderschöner Roman mit tiefgründigen Charakteren vor dem dramatischen Hintergrund einer Welt, die verrückt geworden ist. Eine Geschichte unserer Zeit.« Bookreporter »Eine Geschichte, die von Herzen kommt. Sie erzählt von Mut inmitten einer Welt, der es an Mitgefühl mangelt.« Toronto Star »Nadia Hashimi hat sich auf ihre afghanischen Wurzeln besonnen und vor allem eine einfühlsame und wunderschöne Familiengeschichte geschrieben. Ein schillerndes Porträt Afghanistans in all seiner Pracht.« Khaled Hosseini über »Hinter dem Regenbogen«
Über die Autorin
Nadia Hashimi wurde als Tochter afghanischer Auswanderer in New York geboren. Die afghanische Kultur ist ihr von klein auf vertraut, aber erst 2002 reiste sie zum ersten Mal selbst nach Afghanistan. In Massachusetts und New York hat sie Mittelost-Studien, Biologie und Medizin studiert. Nach Abschluss des Studiums fand sie endlich die Zeit, sich einen lange gehegten Wunsch zu erfüllen: einen Roman zu schreiben, der in der Heimat ihrer Eltern und Großeltern spielt. Nadia Hashimi lebt gemeinsam mit ihrem Mann, drei Kindern und einem Papagei in Maryland, wo sie als Kinderärztin arbeitet.
Besuchen Sie auch die Homepage der Autorin: http://nadiahashimi.com
NADIA HASHIMI
WENN DIE NACHT AM HELLSTEN IST
Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
»When the Moon is Low«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2015 by Nadia Hashimi
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Anja Lademacher, Bonn
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Unter Verwendung eines Motives von © gettyimages/Ian Cumming
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-3960-4
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Zoran, der mich zum glücklichsten Mädchen der Welt machte, als er mir versprach, für immer mein bester Freund zu bleiben.
Der kleine Mann
Baut Käfige für jeden,
Den er
Kennt.
Indes der Weise,
Der den Kopf senken muss,
Wenn der Mond niedrig steht,
Die ganze Nacht Schlüssel fallen lässt
Für die
Schönen
Rauflustigen
Gefangenen.
Hafis, persischer Dichter und Mystiker des 14. Jahrhunderts
Prolog
Fereiba
Es erfüllt mich mit Freude, dass meine Kinder tief und fest schlafen, doch mein unruhiger Geist kehrt in der Stille ihres Schlummers zurück zu der Reise, die hinter uns liegt. Wie bin ich hierhergekommen, in dieses Hotelzimmer? Zwei meiner drei Kinder liegen neben mir auf einer kratzigen Matratze, so weit entfernt von zu Hause, so weit entfernt von allen bekannten Stimmen.
In meiner Jugend war Europa für uns das Land, aus dem die neueste Mode kam und alle kultivierten Dinge. Aus Europa kamen duftende Lotionen und modisch geschnittene Jacketts. Europa war der Kontinent der berühmten Universitäten. Kabul bewunderte die hellhäutigen Imperialisten von jenseits des Urals. Wir warfen ihnen verführerische Blicke zu und verschmolzen ihre Vornehmheit mit der Exotik unserer Stammeskultur.
Als Kabul dem Zerfall anheimfiel, zerbrachen auch die hochfliegenden Träume meiner Generation. Wir hatten keine Augen mehr für Europas Zierrat, denn wir erkannten unsere eigenen Straßen kaum wieder. Die Rauchschwaden des Krieges waren zu dicht geworden. Als mein Mann und ich beschlossen, aus unserer Heimat zu flüchten, hatte sich Europas Anziehungskraft für uns auf seine einzigartige, begehrenswerteste Eigenschaft verdichtet: Frieden.
Schon längst bin ich keine frisch erwählte Braut oder junge Frau mehr. Ich bin eine Mutter und weiter entfernt von Kabul als je zuvor in meinem Leben. Zusammen mit meinen Kindern habe ich Berge, Wüsten und Ozeane bezwungen, um in diesem feuchten Hotelzimmer anzukommen, in dem nichts zu spüren ist von Kultiviertheit und feinen Essenzen. Dieses Land ist ganz anders, als ich es erwartet hatte. Wie gut, dass all die Dinge, die ich als Jugendliche begehrte, heute keine Bedeutung mehr für mich haben.
Nichts von dem, was ich hier sehe, höre und berühre gehört mir. Meine Sinne verglühen in der Fremdheit, die ich erfahre.
Ich wage es nicht, die Kinder zu stören, obwohl ich mir wünsche, sie würden aufwachen und meinen Gedanken eine andere Richtung geben. Aber ich lasse sie schlafen, weil ich weiß, wie erschöpft sie sind. Wir alle sind müde, manchmal sogar zu kraftlos, um uns ein Lächeln zu schenken. Auch ich würde gern schlafen, doch ich fühle mich verpflichtet, wach zu bleiben und dem nervösen Hämmern in meinem Kopf zu lauschen.
Ich sehne mich danach, Saleems entschlossene Schritte im Flur zu hören.
Mein Handgelenk ist leer, meine goldenen Armreife sind fort und mit ihnen ihr melancholisches Klirren. Saleem trägt sie bei sich und wird sie verkaufen. Es war meine Idee, denn unsere Taschen sind zu leer für die Reise, die noch vor uns liegt. Es ist noch ein langer Weg bis an unser Ziel.
Saleem möchte sich so gerne beweisen. Er ähnelt seinem Vater mehr, als es sein jugendliches Herz wahrhaben will. Er hält sich für einen Mann, und das ist auch meine Schuld, denn ich habe ihm viele Gründe geliefert, das zu glauben. In Wirklichkeit aber ist er noch ein Junge, und die unerbittliche Welt dort draußen wird ihm das eifrig vor Augen führen.
Ich gehe, Madar-jan. Wenn wir uns jedes Mal, wenn wir nervös werden, in einem Zimmer verstecken, kommen wir nie in England an.
Und in gewisser Weise hat er recht gehabt. Ich habe mir bei seinen Worten auf die Zunge gebissen, aber jetzt bestraft mich das nagende Gefühl in meiner Magengrube dafür. Bis mein Sohn zurückkehrt, werde ich auf die kränklich weißen Wände, die Gemälde von Ankern und die verblichenen Seidenblumen starren. Ich werde darauf warten, dass die Wände zerbröckeln, die Anker zu Boden stürzen und die Blumen zu Staub zerfallen. Saleem muss zu mir zurückkommen.
Heute denke ich öfter an meinen Ehemann als damals, als er noch bei mir war. Wie dumm und undankbar sind doch unsere Herzen, wenn wir jung sind.
Ich warte darauf, dass sich die Tür öffnet, mein Sohn eintritt und sich damit brüstet, dass er für die Familie erledigt hat, was ich nicht tun konnte. Ich würde alles dafür geben, dass er nicht so viel riskiert, wie er es tut. Aber das bleibt wohl ein frommer Wunsch. Alles, was ich besitze, liegt ausgebreitet vor mir: zwei unschuldige Seelen, die sich in ihren eigenen bedrückenden Träumen unruhig bewegen.
Immerhin kann ich sie berühren. Und so Gott will, wird Saleem zurückkehren, und dann werden wir als Familie wieder so vollständig sein, wie es möglich ist. Eines Tages werden wir uns nicht mehr furchtsam umblicken oder mit halbgeöffneten Augen auf fremdem Grund schlafen oder beim Anblick einer Uniform erschaudern. Eines Tages werden wir einen Ort finden, den wir unser Zuhause nennen dürfen. Ich werde diese Kinder – die Kinder meines Ehemannes – so weit tragen, wie es mir möglich ist, und dafür beten, dass wir eines Tages diesen Ort erreichen, an dem auch ich in der Stille ihres Schlummers zur Ruhe kommen kann.
Teil eins
Kapitel 1
Fereiba
Mein Schicksal wurde am Tag meiner Geburt mit Blut besiegelt. Während ich darum kämpfte, in diese verrückte Welt zu gelangen, gab meine Mutter ihren Kampf auf und nahm mir damit jede Chance, zu einer guten Tochter zu werden. Die Hebamme durchschnitt die Nabelschnur und enthob meine Mutter damit allen weiteren Verpflichtungen mir gegenüber. Der Körper meiner Mutter erblasste, während ich rosiger wurde, und ihr Atem erstarb, während ich schreien lernte. Ich wurde gebadet, in eine Decke gewickelt und meinem Vater vorgestellt, der meinetwegen nun Witwer war. Er fiel auf die Knie, und alle Farbe wich aus seinem Gesicht. Padar-jan selbst erzählte mir später, dass er drei Tage brauchte, ehe er es über sich brachte, die Tochter in den Arm zu nehmen, die ihm die Ehefrau geraubt hatte. Ich wünschte, ich könnte mir nicht ausmalen, welche Gedanken ihm dabei durch den Kopf gingen, aber leider kann ich es. Ich bin mir so gut wie sicher, dass er, hätte er eine Wahl gehabt, meine Mutter mir vorgezogen hätte.
Mein Vater tat, was er konnte, aber er war seiner Aufgabe nicht gewachsen. Zu seiner Verteidigung muss ich sagen, dass es damals nicht einfach war. Und nicht nur damals. Padar-jan war der Sohn eines Wesirs von einigem lokalen Einfluss. Die Einwohner der Stadt wandten sich in rechtlichen Fragen an ihn, er vermittelte in Streitigkeiten und vergab Kredite. Mein Großvater, Boba-jan, war gelassen, entschieden und weise. Er traf schnelle Entscheidungen und geriet angesichts von Meinungsverschiedenheiten nicht ins Wanken. Ich weiß nicht, ob er immer recht hatte, aber er konnte so überzeugend sprechen, dass die Leute annahmen, dass es so war.
Kurz nach seiner Eheschließung kam Boba-jan durch einen klugen Handel an weitläufige Ländereien. Die Früchte dieses Landbesitzes beherbergten und ernährten unsere Familie über viele Generationen. Meine Großmutter, Bibi-jan, die zwei Jahre vor meiner tragischen Geburt starb, hatte ihm vier Söhne geschenkt, deren jüngster mein Vater war. Alle vier Söhne genossen die Privilegien, die ihr Vater für sie gesichert hatte. Die Familie wurde in der Stadt respektiert, und alle meine Onkel verheirateten sich gut und erbten ein Stück des Grundbesitzes für ihre eigene Familie.
Auch mein Vater besaß ein Stück Land – einen Obstgarten, um genau zu sein – und arbeitete als städtischer Beamter in unserer Heimatstadt Kabul, der geschäftigen Hauptstadt Afghanistans inmitten von Zentralasien. Die geografische Lage unseres Landes würde allerdings erst später Bedeutung für mich gewinnen. Padar-jan war eine Art blasse Blaupause meines Großvaters, ohne die Willenskraft, um starke Charaktere zu beeinflussen. Er hatte Boba-jans gute Absichten, aber es fehlte ihm an Entschlossenheit.
Er erhielt seinen Anteil am Grundbesitz der Familie, jene Obstplantage, als er meine Mutter heiratete. Fortan widmete er sich dem Garten mit Hingabe, pflegte ihn von morgens bis abends und kletterte auf die Bäume, um meine Mutter mit den saftigsten Beeren und Früchten zu verwöhnen. In heißen Sommernächten schlief er inmitten der Bäume, wie verzaubert von den bemoosten Ästen und dem süßen Duft reifer Pfirsiche. Einen Teil des Obstertrags tauschte er gegen Ware für den Haushalt ein und war offenbar mit dem zufrieden, was er auf diese Weise einbrachte. Er war genügsam und schien darüber hinaus nichts zu vermissen.
Meine Mutter muss nach allem, was ich über sie gehört habe, eine sehr schöne Frau gewesen sein. Über ihre Schultern fielen dichte Locken rabenschwarzen Haars. Sie hatte warme Augen und königliche Wangenknochen. Sie sang bei der Arbeit, trug immer einen grünen Schmuckanhänger und war bekannt für ihr köstliches aush, eine Nudelsuppe mit scharf gewürztem Hackfleisch und etwas Joghurtsoße, das in harten Wintern von innen wärmte. Mein Vater sprach nur selten über meine Mutter, aber wenn er es tat, füllten sich seine Augen mit Tränen. Ich gehe daher davon aus, dass ihre kurze Ehe sehr glücklich war. Ich verbrachte viel Zeit damit, alles zusammenzutragen, was ich über meine Mutter in Erfahrung bringen konnte, um mich davon zu überzeugen, dass sie mir wahrscheinlich meine Sünde gegen sie längst vergeben hatte. Zwar würde ich sie nie zu Gesicht bekommen, aber es war mir ein Bedürfnis, ihre Liebe zu spüren.
Etwa ein Jahr nach der Hochzeit brachte meine Mutter einen gesunden Jungen zur Welt. Als mein Vater die robuste Statur seines Sohnes sah, nannte er ihn Asad, der Löwe. Mein Großvater flüsterte den azaan, den Gebetsruf, in Asads Neugeborenenohren und machte ihn so zum Muslim. Allerdings bezweifele ich, dass Asad damals anders war als heute. Vermutlich hörte er nicht auf Boba-jans azaan, denn schon als Baby war er viel zu übermütig und ignorierte den Aufruf zur Rechtschaffenheit.
Asad schien zu glauben, dass ihm die ganze Welt gehörte. Immerhin war er der erstgeborene Sohn meines Vaters und damit der Stolz der ganzen Familie. Er würde unseren Familiennamen weitergeben, den Landbesitz erben und im Alter für unsere Eltern sorgen. Als ob er wüsste, was ihm bevorstand, nutzte er Mutter und Vater nach allen Regeln der Kunst aus. Er wurde gestillt, bis meine Mutter wund und erschöpft war. Mein Vater stellte unermüdlich neues Spielzeug für seinen Sohn her, plante seine Erziehung und arbeitete hart, um genügend Geld heimzubringen. Seiner Frau, der jungen Mutter, sollte es gut gehen, und sie sollte immer wohlgenährt sein.
Meine Mutter war sehr stolz darauf, ihrem Gatten einen Sohn geschenkt zu haben, der obendrein auch noch kerngesund war. Aus Furcht, Nachbarn oder Familienmitglieder könnten mit Neid reagieren und ihn mit dem bösen Blick, dem nazar verfluchen, nähte sie ein Amulett in Form eines kleinen, blauen Steins in die von ihrer Schwägerin übernommene Babykleidung. Dieser Stein schützt vor dem bösen Blick. Meine Mutter kannte ein ganzes Arsenal von Tricks, um den nazar zu bekämpfen. Wenn Asad zugenommen hatte oder ein Besucher seine rosigen, dicken Wangen bemerkte, blickte sie auf ihre Fingernägel und kommentierte alle Komplimente mit einem nam-e-khoda, einem Lobpreis des Namens Gottes. Arroganz zog nämlich den nazar mit der Gewalt eines Blitzschlags auf freiem Feld an.
Tag für Tag wurde Asad von der Muttermilch dicker. Sein Gesicht wurde rund und seine Oberschenkel pummelig. Vierzig Tage nach seiner Geburt atmete meine Mutter erleichtert auf, weil ihr Sohn die gefährlichste Zeit überstanden hatte. Sie hatte miterlebt, wie das Baby einer Nachbarin zwei Wochen nach seiner Geburt steif und von Krämpfen geschüttelt wurde, als hätte eine Woge des Bösen es gepackt. Das Neugeborene starb, ehe es einen Namen bekommen hatte. Erst später erfuhr ich, dass die Nabelschnur mit einem schmutzigen Messer durchtrennt worden war und das Blut des Säuglings offenbar mit schlechten Bakterien vergiftet hatte. Ob das nun stimmte oder nicht – wir Afghanen halten daran fest, unsere Hühner erst vierzig Tage nach dem Ausschlüpfen aus dem Ei zu zählen.
Wie viele andere Mütter auch, baute Madar-jan fest auf die Kraft wilder Rautesamen, die man bei uns espand nennt. Sie ließ eine Handvoll der schwarzen Samen über einem offenen Feuer schwelen, wedelte mit der Hand den Rauch über Asads Kopf und sang dabei:
Es bannt das Böse, es ist espand,
Der gute Segen von König Naqshband.
Augen, die leer sind, Augen, die kennen,
Augen, die einen, Augen, die trennen,
Wer dir Böses will, soll in dieser Kohle brennen.
Die Beschwörung hat ihren Ursprung in der vorislamischen Religion der Zoroastrier, aber auch Muslime glauben an ihre Kraft. Mein Vater sah zu und freute sich darüber, wie intensiv seine Frau sich um die Sicherheit seiner Nachkommenschaft bemühte. Und offenbar half die Beschwörung. Der Tod meiner Mutter wirkte sich auf das Leben meines Bruders weit weniger aus als auf meines. Er blieb der Erstgeborene meines Vaters, und er war erfolgreich im Leben, wenngleich meist auf Kosten anderer. Seine Gedankenlosigkeit verletzte seine Mitmenschen – und besonders oft mich –, und doch schien er immer wieder unversehrt aus allem hervorzugehen. In den beiden kurzen Jahren, in denen meine Mutter ihn umsorgte, sammelte er genügend Kraft, um sich seinen Platz in der Welt zu sichern.
Leider starb meine Mutter, ehe sie ein Amulett an meine Kleider nähen, das nam-e-khoda flüstern, auf ihre Fingernägel schauen und espand über meinen Kopf fächeln konnte. Mein Leben wurde zu einer Folge von Missgeschicken, möglicherweise weil es meiner Mutter verwehrt blieb, den bösen Blick von mir abzuwenden. Meine Geburt wurde durch den Tod meiner Mutter überschattet, und während Boba-jan einen traurigen azaan in mein Ohr flüsterte, wurde am ausgelaugten Körper meiner Mutter ein ganz anderes Gebet gesprochen. Der von meinem Großvater gesprochene azaan durchdrang mein Innerstes wie ein Faden ein Gewebe und forderte mich auf, meinem Glauben treu zu bleiben. Meine Erlösung war, dass ich darauf hörte.
Meine Mutter wurde auf einem erst kürzlich eröffneten Friedhof in der Nähe unseres Hauses begraben. Ich besuchte ihr Grab nicht häufig, einerseits, weil niemand mich mitnahm, und andererseits wegen meines immer noch lauernden Schuldgefühls. Ich wusste, dass ich sie dorthin gebracht hatte, und die Leute erinnerten mich ständig daran.
Mein Vater wurde zum jungen Witwer mit einem zweijährigen Sohn und einer neugeborenen Tochter. Mein Bruder, den die Abwesenheit meiner Mutter nicht zu stören schien, ging quengelnd weiter seinen Kleinkindaktivitäten nach, während ich instinktiv nach dem Busen meiner Mutter suchte. Mit zwei Kindern begrub mein Vater seine Frau und machte sich sofort auf die Suche nach einer neuen Mutter für seine Kinder.
Mein Großvater beschleunigte den Prozess, weil er wusste, dass ein Neugeborenes in der wenig kundigen Hand eines Mannes nicht gut aufgehoben war. Als Wesir war er mit sämtlichen Familien des Viertels vertraut. Er kannte einen Bauern mit fünf Töchtern, deren älteste im heiratsfähigen Alter war. Boba-jan war sicher, dass der Bauer, auf dem der Unterhalt für seine Töchter bis zu deren Verheiratung lastete, seinen Sohn gern als Bewerber akzeptieren würde.
Mein Großvater suchte den Bauern auf, pries seinen Sohn als großherzigen und vertrauenswürdigen Menschen, dem das Unglück widerfahren war, viel zu früh die Gattin zu verlieren, und handelte die Bedingungen für die Verlobung der ältesten Tochter mit meinem Vater aus. Und da es um das Wohlergehen zweier noch sehr junger Kinder ging, kam der Prozess rasch in Gang. Nur wenige Monate später zog Mahbuba bei uns ein. Wie die meisten Bräute erhielt sie einen »Hausnamen«, denn man sagt, es zeuge von Respekt, eine Frau nicht mit ihrem gewohnten Namen anzusprechen, auch wenn ich persönlich glaube, dass noch mehr dahintersteckt: Auf diese Weise wird die Braut dazu angehalten, nicht zurückzublicken. Und das kann manchmal gut sein.
Als älteste von fünf Schwestern hatte sich KokoGul schon in jungen Jahren um ihre Geschwister gekümmert und war problemlos in der Lage, zwei kleine Kinder zu versorgen. Schnell beschloss sie, nicht im Schatten meiner Mutter leben zu wollen. Sie räumte das Haus um, entledigte sich der Kleidung meiner Mutter und entfernte jegliche Erinnerung an ihre Existenz außer meinem Bruder und mir. Wir waren der einzige Beweis, dass KokoGul nicht die erste Frau meines Vaters war – und das war ein wichtiger Unterschied, auch wenn die erste Frau verstorben war.
Damals nahmen die Männer noch häufig mehrere Frauen, eine Praxis, die auf die vielen Kriege und die damit verbundene Notwendigkeit zurückzuführen war, Witwen zu unterstützen. So jedenfalls hat man es mir berichtet. Natürlich führte ein solches Vorgehen zu Spannungen zwischen den Frauen, denn der Status der ersten Frau konnte von den anderen Frauen nie erreicht werden.
KokoGul wurde der Möglichkeit, eine Erstfrau zu sein, durch eine Frau beraubt, die sie nie kennengelernt hatte und die sie daher auch nicht herausfordern konnte. Stattdessen war es ihre Aufgabe, die Kinder dieser ersten Frau großzuziehen.
KokoGul war keine böse Frau. Sie ließ mich nicht hungern, schlug mich nicht und warf mich nicht aus dem Haus. Sie fütterte mich, badete mich, zog mich an und tat all die Dinge, die Mütter tun. Als ich sprechen lernte, nannte ich sie »Mutter«. Meine ersten eigenen Schritte führten zu ihr, der Frau, die mir bei Fieber und aufgeschlagenen Knien zur Seite stand.
Trotzdem tat sie all dies mit einem gewissen Abstand. Ich brauchte nicht lang, um ihre Missgunst zu bemerken, obwohl es noch Jahre dauerte, ehe ich sie benennen konnte. Meinem Bruder erging es ähnlich, doch er verhielt sich anders. Schon bald bezeichnete auch er KokoGul als »Mutter« und vergaß, dass dies einst eine andere Frau gewesen war. Um Asad kümmerte sich KokoGul ein wenig eifriger, weil sie wusste, dass er der Schlüssel zum Herzen meines Vaters war. Mein genügsamer Vater zeigte sich recht zufrieden, eine passende Mutter für seine Kinder gefunden zu haben, sofern er zu Hause weilte. Mein mit den Jahren immer klüger werdender Großvater jedoch wachte aufmerksam über uns und war immer präsent.
Ich war keine Waise. Ich hatte Eltern, Geschwister, ein warmes Zuhause und genügend zu essen. Eigentlich hätte es mir an nichts fehlen dürfen.
Aber ein Leben ohne Mutter ist wie nackt in den Schnee geworfen zu werden. Meine größte Angst, die Furcht, die in gleichem Maß wächst wie meine Liebe zu meinen Kindern, ist die, dass ich sie auf die gleiche Weise verlassen könnte.
Und ich frage mich, ob diese Furcht je vergeht.
Kapitel 2
Fereiba
KokoGul war eine hübsche Frau, aber auch jemand, der in einem Raum voller Menschen nicht weiter auffiel. Sie war fast so groß wie mein Vater. Ihr dichtes schwarzes Haar reichte ihr bis zu den Schultern. Es war die Art von Haar, das sofort wieder glatt wurde, sobald man die Lockenwickler entfernte. Sie war zu rundlich, um zierlich zu wirken, und zu dünn, um gebieterisch zu erscheinen. Alles an ihr war mittelmäßig.
Zwei Jahre nach der Hochzeit mit meinem Vater gebar KokoGul ihr erstes Kind. Es war eine Tochter. Und für ihre Enttäuschung hierüber machte sie augenblicklich den Geist meiner Mutter verantwortlich. Meine Halbschwester erhielt den Namen Najiba, nach meiner verstorbenen Großmutter. Najiba hatte KokoGuls rundes Gesicht und dunkle Augen mit dichten, geschwungenen Brauen. Der Tradition gehorchend, umrandete KokoGul die Lider ihrer Tochter mit Kajal, das für gesunde Augen und einen eindrucksvollen Blick sorgen sollte. Während der beiden ersten Monate verbrachte KokoGul viele Stunden mit der Zubereitung eines Tranks aus Fenchelsamen und Kräutern, um Najibas Koliken zu lindern und so ihr dauerndes Schreien zu beenden. Aber solange Najiba sich nicht beruhigen ließ, bildeten Mutter und Tochter ein unausgeschlafenes, zänkisches Gespann.
Nachdem ihre eigene Tochter geboren war, nahm KokoGuls Geduld mit ihren Stiefkindern ab. Nun, da ihr noch bewusster wurde, dass wir nicht ihre Kinder waren, verlor sie schnell die Nerven. Dann schlug sie nach uns wie eine wütende Viper und rief uns mit der Rückseite ihrer Hand zur Ordnung. Wenn mein Vater nicht zu Hause war, gab es nur unregelmäßige Mahlzeiten, die lieblos zubereitet waren. Nur am Abend, wenn er nach Hause kam, aß die ganze Familie zusammen.
Nach Najibas Geburt gewöhnte sich KokoGuls Leib daran, Kinder auszutragen. Während der folgenden vier Jahre gebar sie drei weitere Mädchen. Mit jeder Schwangerschaft verlor sie schneller die Geduld, und mein Vater, der sich nach Frieden im Haus sehnte, aber ihn nicht einzufordern verstand, wurde immer distanzierter. Ein Jahr nach Najiba kam Sultana zur Welt. KokoGul machte sich keine Mühe, ihre Enttäuschung zu verbergen, denn im Gegensatz zu meinem seltsam desinteressierten Vater hatte sie sich einen Sohn gewünscht. Während ihrer dritten Schwangerschaft fast zwei Jahre später betete sie, gab widerwillig Almosen an die Armen und aß jedes Lebensmittel, das angeblich männliche Nachkommenschaft versprach. Mauriyas Geburt enttäuschte sie erneut, und sie glaubte, dass der Geist meiner Mutter einen mächtigen Fluch auf ihren Leib gelegt hatte. Als schließlich meine vierte Schwester Mariam geboren wurde, war KokoGul weder enttäuscht noch überrascht. Sie gab meiner toten Mutter die Schuld und beschloss, keine Kinder mehr zu bekommen. Und so blieb Asad der einzige Sohn meines Vaters.
Meine früheste Erinnerung sollte eigentlich etwas mit der Schule oder einer Lieblingspuppe zu tun haben, doch meine Kindheit war anders. KokoGul lag im Wohnzimmer auf einem Kissen. Neben ihr ruhte die neugeborene, eng in einen Gebetsschal gewickelte Mauriya. Ich war sechs Jahre alt.
»Fereiba!«, bellte KokoGul. Mauriyas kleines Gesicht verzog sich. Sie war so eng gewickelt, dass sie sich nicht anders äußern konnte.
»Ja, Madar-jan.« Ich stand nur wenige Schritte entfernt. KokoGul, die sich noch von der Geburt erholte, sollte nichts anderes tun als das Baby stillen. Ich wusste es, weil sie mich häufig daran erinnerte.
»Fereiba, deine Tante hat uns etwas Hühnereintopf auf dem Feuer dagelassen, aber es ist zu wenig für uns alle. Geh doch bitte und hole uns ein paar Kartoffeln, damit wir alle satt werden.«
Das bedeutete zweierlei. Erstens würden heute Abend nur mein Vater und mein Bruder Hühnchen zu essen bekommen. Wir anderen würden uns mit gekochten Kartoffeln begnügen müssen. Und zweitens musste ich in den eisigen Garten hinaus und nach den Knollen graben. Im Herbst hatten wir große Mengen an Kartoffeln, Rettich, Karotten und Rüben hinter dem Haus vergraben, wo sie in der Erde kühl lagerten.
»Madar, könntest du nicht Asad bitten, die Kartoffeln zu holen?« Draußen war es kalt, und ich sah mich bereits mit der Schaufel kämpfen.
»Er ist nicht da, und wir brauchen die Kartoffeln jetzt, damit sie bis zum Abendessen fertig sind. Zieh den Mantel an, den dein Vater dir gekauft hat. Es dauert doch nur ein paar Minuten.«
Ich wollte nicht gehen.
»Mach schon, Liebes. Du willst deiner Mutter doch helfen.«
Ihre Schmeicheleien waren wie Puderzucker auf verbranntem Brot. Ich biss hinein.
Ich erinnere mich daran, wie ich mit einer Schaufel kämpfte, die fast so groß war wie ich. Schließlich gab ich es auf und holte eine Kelle, mit der ich besser zurechtkam. Mein Atem schien in der eisigen Luft zu Kristall zu gefrieren, und meine Finger wurden trotz der Handschuhe sofort taub. Hastig sammelte ich vier Kartoffeln ein und wollte das Erdloch gerade wieder schließen, als ich ein paar Rettiche entdeckte. Aus einem mir heute nicht mehr erfindlichen Grund nahm ich auch die Rettiche mit. Ich steckte sie in meine Taschen, weil ich die Hände voll hatte.
»Ich habe sie, Madar-jan«, rief ich ihr aus der Küche zu.
»Gutes Mädchen, Fereiba. Gott segne dich. Jetzt wasche und schäle sie und lege sie in den Topf, damit sie in der Tomatensoße garen können.« Mauriya hatte inzwischen angefangen, zu wimmern.
Ich tat, was KokoGul gesagt hatte, und schnitt die Kartoffeln so, wie sie es mich gelehrt hatte. Dabei gab ich acht, mir nicht in die Finger zu schneiden. Dann wusch ich auch die Rettiche, schnitt sie klein und legte sie aus einer kulinarischen Eingebung heraus ebenfalls in den Topf. Ich rührte einmal um, legte den Deckel auf den Aluminium-Topf und ging zu meinen anderen Schwestern.
»Was ist das für ein schrecklicher Geruch? Fereiba! Was hast du getan?« KokoGuls Stimme raste durch unsere Wohnung, als hätte sie Beine und einen eigenen Willen. Auch ich hatte den Geruch bereits wahrgenommen, ihn aber in der Sorglosigkeit einer Sechsjährigen nicht weiter beachtet.
Mir war nicht bewusst, dass ich etwas mit den seltsamen Dünsten zu tun haben könnte, bis KokoGul sich aufrappelte, in die Küche ging und den Deckel hob. Eine stechend riechende Dampfwolke erfüllte den Raum. Ich bedeckte meine Nase mit der Hand und war überrascht, dass ich das nicht eher gerochen hatte.
»Fereiba, du Dummkopf! Wie kann man nur so dumm sein!«, rief KokoGul kopfschüttelnd und stützte ihre Hand ins Kreuz.
Die roten Rettichwürfel hatten mich verraten. An diesem Tag lernte ich, dass die harten, roten Knollen einen schrecklichen Geruch verströmen, wenn man sie kochte, einen Geruch, den ich nie vergessen werde.
Auf jede Geburt folgte das gleiche Ritual. Die Augen der Babys wurden mit Kajal umrandet, wir kauften Süßigkeiten, wenn sie die ersten vierzig Tage überlebt hatten, und ihr Kopf wurde rasiert, weil ihr Haar dicht und lockig werden sollte. Mir hingegen blieb nichts als der Kummer darüber, dass mich später einmal die Sehkraft und das Glück im Leben verlassen würden und mein Haar niemals voll würde. Denn all dies hatte für mich niemand getan.
Als die Zeit kam, dass ich zur Schule gehen konnte, überzeugte KokoGul Padar-jan davon, dass ich ihr im Haus mit den jüngeren Kindern helfen sollte. Mein Vater, der sich keine Haushaltshilfe leisten konnte, ließ sich überreden, mich ein Jahr zurückzustellen. Denn auch wenn ich noch sehr jung war, konnte ich mich nützlich machen, indem ich Besorgungen machte und kleinere Aufgaben im Haushalt erledigte. Und auch als meine Schwestern heranwuchsen, hörte ich diese Argumente noch.
Glücklicherweise entging unserem Großvater Boba-jan nichts. Er besuchte uns häufig, und in seiner Anwesenheit verhielt sich KokoGul völlig anders. Boba-jan lud Asad und mich zu Spaziergängen ein. Seine Taschen waren immer voller Münzen und Bonbons. Es gab keinen Besucher, auf den wir uns mehr freuten als auf Boba-jan. Er forderte uns auf, unsere Gebete zu sprechen, während er unsere Kleidung überprüfte und uns in die Arme kniff, um zu sehen, ob wir gut genährt waren. KokoGul beobachtete ihn aus dem Augenwinkel. Sie spürte sein Misstrauen und ärgerte sich insgeheim darüber.
Allerdings änderten Boba-jans Besuche nicht viel für mich. Als meine Schwestern älter wurden und KokoGul sich die Zeit damit vertrieb, sie zu betreuen, übernahm ich nach und nach immer mehr Aufgaben im Haushalt. Ich fütterte die Hühner, versorgte die Ziege und holte viele Eimer Wasser von der Quelle. Jeden Tag klopfte ich die Teppiche und passte auf die kleineren Mädchen auf. Als Najiba das Schulalter erreichte, argumentierte KokoGul, es sei mehr zu tun, als sie allein schaffen könne. Mein Vater gab nach, und ich wurde ein weiteres Jahr zurückgestellt. Meine jüngeren Schwestern verließen das Haus, um Rechnen und das Alphabet zu lernen, während ich mich im Kochen übte. Meine Hände waren wund und aufgesprungen, weil ich Essensflecken aus schmutzigen Kleidern entfernen musste. Aber schmerzlicher als diese Wunden war die Tatsache, dass ich in die Küche verbannt war, während alle anderen sich eifrig für die Schule ankleideten.
KokoGuls Hang zum Aberglauben verschlimmerte die Situation noch. In unserer Kultur gibt es viel Aberglauben, aber KokoGul übertrieb es mit ihrem Eifer. Zum Beispiel durften wir nicht mit Socken schlafen, weil uns ansonsten Blindheit drohte. Wenn jemand Besteck fallen ließ, musste ich sofort das gesamte Haus putzen, weil Gäste zu erwarten waren. Wenn sie beim Essen oder Trinken husten musste, verfluchte sie die Menschen, die zweifellos irgendwo schlecht über sie sprachen. Ich glaube, die Überzeugung, dass andere eifersüchtig auf ihr recht privilegiertes Leben sein könnten, trieb sie am meisten um.
Als ob der gängige Aberglauben noch nicht genug wäre, erschuf KokoGul zudem noch viele eigene Auslegungen. Zwei Vögel, die über sie hinwegflogen, bedeuteten einen Streit mit einer engen Freundin. Wenn ihr die Zwiebeln auf dem Feuer anbrannten, schmähte jemand ihre Kochkünste, und wenn sie mehr als zweimal nieste, war sie zum Spielball böser Geister geworden. Padar-jan sagte nichts dazu, verriet uns aber heimlich, welche Interpretationen sie erfunden hatte, damit wir sie nicht anderen weitererzählten. Das hätte er sich auch sparen können. KokoGul gehörte nicht zu denen, die mit ihren Gedanken hinter dem Berg hielten. Ihre fantastischen Theorien waren der gesamten Nachbarschaft vertraut.
In einer Ecke unserer Obstplantage stand eine Gruppe bemerkenswerter Maulbeerbäume. Ihre schweren Äste hingen herab und brachten kleine Früchte hervor, die in Reichweite unserer Arme hingen. Die Bäume waren sehr alt und hatten dicke, tief wurzelnde Stämme. Die Rinde eines der Bäume in der Mitte der Gruppe war so knotig und knorrig, dass KokoGul Stein und Bein schwor, in den hölzernen Windungen das Gesicht eines bösen Geistes zu erkennen. Sie erstarrte in Angst vor dem Rindengesicht, aber sie liebte die Maulbeeren, die auf den Zweigen darüber wuchsen. Wann immer KokoGul Lust auf Maulbeeren verspürte, schickte sie mich hinaus.
»Fereiba-jan«, rief sie dann freundlich und holte eine Keramikschüssel aus dem Schrank. »Ich brauche ein paar Beeren aus dem Garten. Nur du verstehst es, sie so vorsichtig zu pflücken. Wenn ich jemand anderen schicke, bekomme ich bloß Brei.«
Ihre Schmeichelei war unnötig, und das Wissen, dass KokoGul zu große Angst hatte, um selbst hinauszugehen, brachte mich zum Lächeln. Als dünne Neunjährige mit strähnigen Haaren fürchtete ich KokoGul mehr als das geheimnisvolle Baumlabyrinth draußen im Garten. Vielmehr war der Garten bei Tageslicht, wenn das Haus voll von Leuten und ihren Forderungen an mich war, eine Art Refugium.
Eines Abends an einem Wochentag, als meine Schwestern über ihren Hausaufgaben brüteten, überkam KokoGul plötzlich ein großes Verlangen nach Maulbeeren. Gehorsam schlich ich mit einer leeren Schüssel in den Garten und ging auf den vertrauten Baum zu, dessen verkrümmte Rinde im Mondlicht die Zähne zu fletschen schien. In der Dämmerung musste ich meine Finger vorsichtig durch die Blätter gleiten lassen, um die Beeren zu finden. Ich hatte kaum zwei oder drei gepflückt, als ich hinter mir wie ein zärtliches Flüstern eine sanfte Brise spürte.
Ich drehte mich um und erkannte eine leuchtende männliche Gestalt unmittelbar hinter mir. Ich wagte kaum zu atmen. Der Mann legte eine Hand auf meine Schulter. Die Berührung war so leicht, dass ich sie kaum spürte.
Ich blickte ihn an. Er war alt. Ein kurzer weißer Bart bedeckte sein Kinn, und Falten durchzogen sein Gesicht. Seine dichten weißen Brauen hingen schwer über seinen graublauen Augen und ließen nur schmale Schlitze erkennen. Ich wusste sofort, dass er mir freundlich gesinnt war. Mein wild pochendes Herz beruhigte sich beim Klang seiner Stimme.
»Fereiba-jan. Wenn du im Finstern gehst und den Boden unter deinen Füßen nicht erkennst, wenn deine Finger nur Nacht berühren, dann bist du nicht allein. Ich bin bei dir wie das Mondlicht, das sich im Wasser spiegelt.«
Ich blinzelte, und er war verschwunden. Ich blickte mich um, weil ich erwartete, ihn zwischen den Bäumen davongehen zu sehen, aber da war nichts. Ich lauschte dem Echo seiner Stimme und wiederholte seine Worte. Leise flüsterte ich sie vor mich hin, damit sie noch ein wenig verweilten. Selten hatte jemand meinen Namen mit mehr Liebe ausgesprochen.
»Fereiba!« KokoGul rief mich vom Haus aus. Sie war ungeduldig geworden.
Hastig sammelte ich so viele Maulbeeren wie möglich. Meine Finger trieften von ihrem roten Saft. Ich huschte zurück zum Haus, blickte mich aber noch einmal um, ob der alte Mann vielleicht zurückgekehrt war. Mit zitternden Händen stellte ich die Schüssel vor KokoGul, die meine Schwestern dabei beaufsichtigte, wie sie eifrig in ihre Hefte schrieben. Sie begann zu essen. Ich blieb unbeweglich vor ihr stehen.
»Was ist los? Was ist passiert?«, wollte sie wissen.
»Madar-jan, ich war draußen unter dem Maulbeerbaum.«
»Und?«
»Ich habe dort einen alten Mann gesehen. Er kam aus dem Licht, aus roshanee. Er nannte meinen Namen und sagte, er würde mir folgen und Licht auf meinen Weg bringen. Er sagte auch, er wolle über mich wachen.« Während ich die Worte aussprach, hörte ich seine Stimme in meinem Kopf.
»Ein alter Mann? Aber wo ist er hingegangen?« KokoGul lehnte sich vor und blinzelte mich an.
»Er ist verschwunden. Er kam ganz plötzlich. Ich habe seine Hand auf meiner Schulter gespürt. Als er alles gesagt hatte, ist er wieder verschwunden. Ich konnte nicht sehen, wohin er gegangen ist – er hat sich einfach in Luft aufgelöst. Ich weiß nicht, wer er war.« Ich war außer Atem, hatte aber keine Angst. Ich wartete darauf, dass KokoGul meine Vision interpretierte.
»B’isme-Allah!«, rief KokoGul. Gelobt sei Gott. »Du hast einen Engel gesehen! Es war ein Engel, du dummes Kind! Wie kann man nur einen Engel nicht erkennen, der einem auf die Schulter tippt und verspricht, einen zu beschützen!«
Ein Engel? War das möglich? Großvater hatte uns von Engeln und ihrer Macht erzählt, als er mit uns Suren rezitierte. Wie blind könne man sein, einen Engel nicht zu erkennen, wenn er unmittelbar vor einem stehe!, zeterte KokoGul weiter, weil ich die überirdische Erscheinung nicht erkannt hatte. Meine Schwestern starrten mich aus großen Augen an. KokoGuls schneidende Stimme verklang, als ich mir die Worte des Engels wiederholte.
Er würde über mich wachen. Mein Schutzengel würde mir roshanee bringen auf meinem Weg. Ich wäre niemals allein.
Am folgenden Jumaa, dem Freitag, warteten wir auf die Rückkehr meines Vaters aus der Moschee. KokoGul hatte meinen Vater beauftragt, dafür zu beten, dass auch sie und ihre Töchter ein Schutzengel besuchen möge. Mein Vater hatte nicht viel zu meiner Begegnung gesagt. Ich wusste nicht, was oder wie viel er davon glaubte.
KokoGul und ich glaubten jedenfalls beide daran. In dieser Sache waren wir uns einig. Sie bemerkte kleine Veränderungen bei mir, und ich sah, was diese Veränderungen bei ihr bewirkten. Ich ging aufrechter. Ich gehorchte ihr, aber ich zuckte nicht mehr vor ihr zurück wie zuvor. Kühn betrat ich die Obstplantage bei Tag und Nacht und wartete immer darauf, dass mein Engel wieder erschien und mir sanfte Trostworte zuflüsterte.
KokoGul war außer sich. Vor ihren Freundinnen brüstete sie sich damit, dass ich, ihre Tochter, von einem Engel besucht worden war. Der Besuch verhieß Glück, und sie hoffte, auch ein wenig von diesem Licht beschienen zu werden. Eifrig überwachte sie ihre Träume und prüfte sie auf Hinweise darauf, dass der Himmel auch mit ihr Verbindung aufnahm. Ich hörte ihre Bitten, wenn sie zu Hause betete. Sie sprach sanfter mit mir und streichelte mir dabei mit der Hand über den Kopf.
Meine Schwestern verfolgten die Angelegenheit mit großer Neugier, verstanden aber nicht, warum sich KokoGul so nach dem Mann sehnte, den ich im Obstgarten getroffen hatte. Vor allem für Najiba, die mir altersmäßig am nächsten stand, war KokoGuls Verhalten rätselhaft.
»Wie sah der Engel aus, Fereiba? Hattest du Angst vor ihm?«, fragte sie interessiert. Wir saßen im Schneidersitz auf dem Boden und pulten Erbsen.
»Er sah aus wie ein alter Mann. Wie ein Großvater.« Meine Worte hörten sich viel zu einfach an, aber ich wusste nicht, was ich sonst antworten sollte.
»Wessen Großvater? Unserer?«
»Nein, nicht wie jemand, den wir kennen. Einfach nur ein Großvater.« Ich hörte auf zu sprechen, denn ich wollte ihm gerecht werden. »Er hat geleuchtet, und er kannte meinen Namen.« Ich warf eine Handvoll Erbsen in die Schüssel zwischen uns.
Najiba überlegte schweigend. »Weißt du, eigentlich bin ich froh, dass ich ihn nicht gesehen habe. Ich glaube, ich hätte mich gefürchtet«, sagte sie schließlich.
Vielleicht wäre es mir ebenso ergangen, hätte ich nicht seine blaugrauen Augen gesehen. Seine freundliche Stimme hatte die Dunkelheit erfüllt und keinen Raum für Furcht gelassen. Trotzdem gaben mir Najibas Worte das Gefühl, mutig gewesen zu sein.
KokoGul sah das nicht ganz so. Nach und nach vereinnahmte sie meine Erfahrung, so als wäre der Engel ihr erschienen. Eines Tages hörte ich sie mit zwei Freundinnen beim Tee darüber sprechen.
»Und dann verschwand er? Einfach so?«
»Was erwartest du? Dass er mit Pferd und Kutsche abgeholt wird?«, entgegnete KokoGul in der ihr eigenen, scharfzüngigen Art, die ihre Freundinnen sehr unterhaltsam fanden, wenn sie nicht gerade selbst die Zielscheibe ihres Sarkasmus waren.
»Sie muss wohl unter dem ganz besonderen Schutz Gottes stehen, dass er ihr einen Engel schickt«, erklärte eine der beiden.
»Ach, weißt du, die arme Kleine. Der Geist ihrer Mutter im Himmel wacht über sie. Bestimmt hat es damit zu tun«, sagte die andere mitfühlend.
Die Erwähnung meiner Mutter spornte KokoGuls Fantasie an. »Ich hatte ihr an diesem Abend den Auftrag gegeben, in den Garten zu gehen. Es passiert mir selten, dass ich derartige Gelüste auf Maulbeeren verspüre, aber plötzlich überkam mich etwas Geheimnisvolles. Meine Zunge sehnte sich nach den süßen Beeren. Zunächst versuchte ich, nicht darauf zu achten, aber ich konnte nichts dagegen tun. Es war, als hätte mich etwas zu diesen Bäumen gelockt. Am liebsten wäre ich hinausgerannt, aber ich half den Mädchen bei ihren Hausaufgaben und bat so Fereiba, mir ein paar Beeren zu holen. Sie ist eine wirklich gute Tochter und ging hinaus in den Garten. Ich weiß also nicht, wen der Engel eigentlich treffen sollte. Vielleicht war das Verlangen seine Art, mich zu rufen. Da ich aber stattdessen Fereiba-jan geschickt habe, werden wir es wohl nie erfahren.«
Die beiden Frauen schienen von dieser Theorie nicht allzu beeindruckt zu sein, forderten KokoGul aber nicht weiter heraus. Ich betrat den Raum. Mit einer Hand balancierte ich ein Tablett mit drei Tassen heißen Tees, in der anderen hielt ich die Zuckerschale.
»Die afghanischen Teppiche wurden eigens für Fereiba-jan erfunden«, verkündete KokoGul. »Ihre rote Farbe verbirgt, wie viel Tee hier schon verschüttet wurde.« Die Frauen lachten leise. Höflich lächelnd und mit gesenktem Kopf stellte ich eine Tasse vor jede Frau und bot Zuckerwürfel an. Man beobachtete mich genau.
»Afareen, dokhtar-jan«, sagte KokoGul. Gut gemacht, Tochter. Ich kehrte mit dem leeren Metalltablett in die Küche zurück. An diesem Tag war ich ihre Tochter.
Und tatsächlich war ich an den meisten Tagen ihre Tochter. Denn ich ging nicht zur Schule, sondern verbrachte viel Zeit zu Hause mit KokoGul. Der Haushalt lastete fast ausschließlich auf meinen Schultern, und wenn ich etwas nicht richtig machte, tadelte sie mich scharf. Aber ich war ständig mit ihr zusammen. Wir verbrachten viele gemeinsame Stunden damit, zu kochen, das Haus zu putzen und die Tiere zu versorgen. Ihre scharfe Zunge brauchte ein Publikum – oder ein Ziel. Ich liebte es, mit ihr zum Basar zu gehen. So inspizierte sie zum Beispiel aufgeplatzte Tomaten und fragte den Verkäufer, ob sich seine dicke Frau versehentlich daraufgesetzt habe. Oder sie erkundigte sich beim Haushaltwarenhändler, ob seine viel zu teuren Teller aus der Privatsammlung des Königs stammten. KokoGuls Geistesblitze verstimmten die Menschen, oder sie führten zu einem Grinsen und einem Preisnachlass.
Wir waren Verbündete, wenn wir um die Dinge feilschten, die wir brauchten – Fleisch, Gemüse oder Schuhe. Ich imitierte KokoGuls unverschämtes Verhalten und handelte den bestmöglichen Preis aus. Sie pflegte dann zustimmend zu nicken. Auf dem Markt und in Haushaltsdingen konnten meine jüngeren Schwestern mir nicht das Wasser reichen.
»Jetzt schau dir das mal an, Najiba«, beschwerte sich KokoGul. »Bei diesem Hemd wird das Wasser immer noch braun. Wie kannst du nur glauben, dass es sauber ist? Hast du gesehen, welch schönen Schaum deine Schwester macht? Wie oft habe ich euch schon gesagt, dass ihr nicht erwarten könnt, dass das Hemd sich selbst reinigt. Gott sei gedankt, dass ich zumindest eine Tochter habe, die mir im Haus zur Hand gehen kann.«
Dies waren die Momente, in denen ich mich der Frau verbunden fühlte, die meine Mutter war, ohne es in Wahrheit zu sein.
Kapitel 3
Fereiba
Jeden Abend machten mein Bruder und meine Schwestern ihre Hausaufgaben mit dem Bleistift in der rechten und dem Radiergummi in der linken Hand. Sie stützten die Ellbogen auf den Tisch und legten das Kinn in die Hände, während sie lasen, auswendig lernten, addierten und subtrahierten. Zunächst taten sie sich noch schwer mit den Schriftzeichen, doch dann lernten sie, wie jeder Buchstabe mit schwungvollen Linien mit seinem Nachbarn verbunden wurde und wie Punkte und Striche an den richtigen Stellen Worte zum Leben erweckten. Dann schrieben sie kurze, einfache Sätze über die täglichen Aufgaben gehorsamer Jungen und Mädchen. Und als sie schließlich anfingen, das komplexe Arabisch des Korans zu erlernen, wurde ich wirklich neidisch. Zwar hatte ich die Gebete unter Anleitung meines Großvaters auswendig gelernt, aber den Text konnte ich nicht lesen.
Sie spielten mit Zahlen. In lustigen, gesungenen Versen lernten sie das kleine und große Einmaleins. Ich hörte zu. Auf dem Papier arbeiteten sie mit Zahlen und Symbolen, sie lernten Rechnen und verliehen den Zahlen so ihren Sinn.
Außerdem lernten sie viele Erzählungen kennen, die Geschichte unseres Landes. Den Aufstieg der Könige und ihrer Söhne. Mein Bruder beherrschte als Erster unsere Nationalhymne und sang sie mit grüßend erhobener Hand. Meine Schwestern lernten Spiellieder von ihren Klassenkameradinnen. Hand in Hand gingen sie, beschwingt und sorgenfrei im Rhythmus der Worte.
Kuckuck, Kuckuck, Ahornblatt,
Mädchen sitzen da und lachen,
Essen sich an Äpfeln satt.
Könnte ich ein Täubchen sein,
Das hoch und frei am Himmel fliegt,
Ich flög’ hinab zum Fluss, so rein,
Tränk’ heiliges Wasser, das nie versiegt.
Morgens sah ich zu, wie meine Schwestern in ihre stahlgrauen, schlichten Schuluniformen schlüpften. Sie zogen ihre Strümpfe hoch und schnürten hastig ihre Schuhe, weil sie Angst hatten, zu spät zu kommen, und noch mehr Angst, ungepflegt zu erscheinen. Beides wurde von den Lehrerinnen äußerst ernst genommen. Jeden Tag verspürte ich einen heimlichen Groll, weil sie das Haus verlassen durften, während ich daheimbleiben musste. Ich beneidete sie um ihre Taschen voller Hefte und Bleistifte und um ihre Geschichten und wusste, dass ich mindestens so intelligent war wie sie – vielleicht sogar intelligenter.
Mein Bruder war ein guter Schüler. Nicht unbedingt Klassenbester, aber immerhin so gut, dass mein Vater und Großvater keinen Grund zur Klage hatten. Ich bin sicher, dass er hervorragend gewesen wäre, hätte er es nur versucht, aber er beeilte sich mit seinen Hausaufgaben, um andere Dinge tun zu können – mit den Nachbarsjungen Fußball spielen, auf Bäume klettern oder auf der Straße vor unserem Haus Fahrrad fahren. Das Teenageralter war wohl die unangenehmste Zeit für ihn. Er bekam Pickel und konnte sich nicht mehr auf seine Stimme verlassen. Als er jedoch darüber hinaus war, war seine Stimme die eines selbstbewussten Mannes, den es in die Welt hinauszog.
Ich hatte schon öfter mit meinem Vater über das Thema Schule gesprochen. Bisher hatte er immer nur müde geantwortet, dass KokoGul meine Hilfe mit den jüngeren Kindern brauchte, doch inzwischen verfing dieses Argument nicht mehr. Meine jüngste Schwester Mariam war sieben Jahre alt und ging bereits in die Grundschule. Es gab keine Babys mehr im Haus.
Nachdem wir abends den Tisch abgeräumt hatten, wendete ich mich wieder einmal an meinen Vater. Ich war dreizehn Jahre alt und wild entschlossen. Ich wusste, dass Mädchen, die keine Schule besucht hatten, üblicherweise früher heirateten, aber ich wollte nicht heiraten. Und jedes Jahr ohne Schule brachte mich dem Dasein als Ehefrau einen Schritt näher.
»Padar-jan?« Er blickte auf, lächelte freundlich und schaltete das Radio aus, weil die Abendnachrichten vorbei waren. Ich stellte eine Tasse grünen Tee vor ihn hin. Die beiden Zuckerwürfel lösten sich schnell auf. Seinen Abendtee trank er immer gern süß.
»Danke, Liebes. Genau das, was ich nach einem so köstlichen Abendessen gebraucht habe«, sagte er, tätschelte sich den Bauch und atmete tief aus.
»Noosh-e-jan«, antwortete ich, wünschte ihm, dass sein Appetit befriedigt sein möge. »Padar-jan, ich möchte dich etwas fragen.«
Mein Vater hob eine Augenbraue und nippte vorsichtig an seinem Tee.
»Padar-jan, ich möchte zur Schule gehen wie meine Schwestern.«
»Ach, das schon wieder«, seufzte er. KokoGul beugte sich über ihre Häkelnadeln, hörte auf zu arbeiten und lauschte.
»Ich kann trotzdem zu Hause helfen, es dauert doch nur ein paar Stunden. Alle anderen Mädchen gehen hin, und im Haus sind keine kleinen Kinder mehr. Ich möchte die Dinge lernen, die meine Schwestern lernen.« Mehr bekam ich nicht heraus, ehe ich in Tränen ausbrach. Ich senkte den Kopf, ärgerte mich über mich selbst und wartete darauf, dass ich wieder ruhiger atmen konnte oder mein Vater etwas sagte, denn ich wusste nicht, was eher geschehen würde.
»Fereiba-jan, ich dachte, dass du dich inzwischen nicht mehr für die Schule interessierst. Deine Schwestern haben alle angefangen, als sie noch jünger waren. Du bist inzwischen eine junge Frau und warst noch nie in der Schule.« Er wurde nachdenklich. Seine Brauen zogen sich zusammen. Ich schob die Unterlippe vor.
»Ich weiß«, sagte ich schlicht. KokoGul nahm ihre Häkelarbeit wieder auf. Sie schien zufrieden, dass sich das Resultat des heutigen Gesprächs nicht von allen früheren unterschied.
»Geht es darum, lesen zu lernen? Vielleicht könnte Najiba dir dabei helfen. Oder Sultana – sie schreibt sehr gut und liest gern Poesie.«
Nie war ich so wütend auf meinen Vater gewesen. Sein Vorschlag verletzte mich, und ich ärgerte mich über sein warmes Lächeln. Ich wollte nicht, dass meine jüngeren Schwestern mir das Lesen beibrachten. Sie kamen jeden Tag heim und zitierten ihre Lehrerin. Ihre Stimmen brachten genau das zum Ausdruck, was ich vermisste.
»Moallim-sahib sagt, dass sich meine Handschrift verbessert hat. Moallim-sahib sagt, wir sollten jeden Tag ein Glas Milch trinken, um gesund und stark zu werden.«
Ich wollte meine jüngere Schwester nicht als meine moallim. Sie wäre vielleicht in der Lage, mir die Grundlagen des Alphabets und die Aussprache von Wörtern beizubringen, aber sie wäre keine echte Lehrerin, die vor der Klasse stand und mich dazu brachte, das Einmaleins zu lernen, und die meine Fortschritte überwachte. Ich wollte mehr.
»Nein, Padar-jan.« Ich spürte, wie ich wieder freier atmete und meine Stimme mit neuer Entschlossenheit zurückkehrte. »Ich will nicht von einer Schülerin lernen. Ich will von einer Lehrerin lernen.«
Meine Antwort musste ihn überrascht haben. Vermutlich dachte er, dass meine Ansprüche kindisch und wirklichkeitsfremd wären. Oder er dachte, dass ich es nur auf die Schuluniform abgesehen hatte und meinen Aufgaben im Haushalt entkommen wollte. Ich aber wollte sehr viel mehr, als ich in Worte fassen konnte. Und ich wusste, dass mir die Zeit davonlief. Mein Vater beobachtete mich genau. Seine Mundwinkel senkten sich.
»Es würde nicht leicht für dich. Du müsstest ganz von vorn in einer Klasse mit kleinen Kindern anfangen.«
»Er hat recht. Du wärst wie ein Riese, der zwischen Babys sitzt. Eine dumme Idee. Wie ein Huhn, das sich bemüht, ins Ei zurückzukriechen«, warf KokoGul ein.
»Das würde mich nicht stören«, sagte ich.
Eine Notlüge. Immerhin war es das erste Mal, dass mein Vater meinen Wunsch tatsächlich in Erwägung zu ziehen schien.
»Ich werde mit dem Schulvorsteher sprechen und sehen, was er dazu sagt. Aber ich bin sicher, dass deine Mutter dich hier tagsüber sehr vermissen wird.«
»Ist das nicht eine ziemlich unvernünftige Idee? Warum sollte sie sich jetzt noch mit der Schule belasten? Hier zu Hause hat sie doch alles, was sie braucht.« Die Wendung des Gesprächs hatte KokoGul offenbar überrascht.
»Ich verspreche nichts. Lass mich zunächst mit der Schule reden und sehen, was man dort davon hält.« Wie immer legte sich mein Vater nicht fest und ließ sowohl KokoGul als auch mich voller Hoffnung zurück.
Zu seiner größten Überraschung und zu KokoGuls Enttäuschung war die Schule bereit, mich aufzunehmen, vorausgesetzt, ich finge bei den Erstklässlern an. Und so kam ich mit acht Jahren Verspätung ins erste Schuljahr. In der Nacht vor meinem ersten Schultag bügelte ich die strenge Schuluniform, um bei meiner moallim-sahib einen guten Eindruck zu machen. Mauriya und Mariam, meine beiden jüngsten Schwestern, amüsierten sich köstlich, als sie mich zum ersten Mal in Schuluniform sahen. Wir verließen das Haus gemeinsam.
Najiba und Sultana, die beiden Älteren, schienen ein wenig besorgter darüber zu sein, was die anderen sagen würden, wenn eine Heranwachsende in eine erste Klasse ging. Auf dem Schulweg versuchte Najiba, mich darauf vorzubereiten.
»Moallim-sahib wird zunächst überprüfen, ob du ein Heft und einen Bleistift dabeihast. Außerdem wird sie dich bitten, dich in die letzte Reihe zu setzen, weil du größer bist als die anderen Schülerinnen.«
Mir gefiel die rücksichtsvolle Art, mit der Najiba sich ausdrückte. Sultana nickte und stimmte ihr weit weniger diplomatisch zu.
»Genau. Sonst kann keiner über deinen Kopf hinwegsehen.« Najiba warf ihr einen unmissverständlichen Blick zu, sodass Sultana sich auf ihre Schuhspitzen konzentrierte und ein wenig langsamer ging.
»Du kommst sicher bald in die nächste Klasse. Das Alphabet kennst du ja größtenteils. Von dort bis zum Lesen ist es nicht mehr weit.«
Ich lächelte Najiba dankbar an. Wir standen uns nicht sehr nah, aber in ihren Worten lag eine Ehrlichkeit, die ich an diesem Tag ganz besonders brauchte.
»Wenn Sultana es gelernt hat, wird es mir sicher nicht schwerfallen.«
Sultana reagierte beleidigt, starrte geradeaus und beschleunigte ihren Schritt wieder. Dabei hatte ich es gar nicht böse gemeint. Beschämt wandte ich mich zu Mauriya und Mariam um, die Hand in Hand mit ihren Taschen über den Schultern hinter uns herzuckelten.
Meine Schwestern lenkten mich von der Beklommenheit vor meinem ersten Schultag ab. Nachdem wir das Eisentor der Schule passiert hatten, zeigte mir Najiba den Weg zu meinem Klassenzimmer. Sultana verschwand hastig in ihrer eigenen Klasse. Mauriya und Mariam winkten mir fröhlich zu.
Langsam betrat ich den Raum und blickte mich um. Ich war nicht sicher, ob ich mir direkt einen Platz suchen oder lieber zunächst zur Lehrerin gehen und mich vorstellen sollte. Weitere Schülerinnen trafen ein und gingen eifrig zu ihren Plätzen. Ich beschloss, dass es besser wäre, mich vorzustellen, ehe die Lehrerin mich bemerkte und sich aufregte. Immerhin war ich eher eine Frau als ein Mädchen, das hier neben den Kindern sitzen würde. Ich hätte ihr Kindermädchen sein können, hier aber war ich ihnen gleichgestellt.
»Willkommen, meine Liebe. Ich habe bereits gehört, dass du zu uns kommst. Setz dich bitte ans Ende der letzten Reihe – es ist der letzte Platz, der noch frei ist. Hier, nimm dieses Buch. Aus dem lernen wir ab jetzt. Kennst du die Buchstaben schon?«
Meine erste Lehrerin war eine strenge, aber freundliche Frau, die mich glücklicherweise sofort in ihr Herz schloss. Sie behandelte mich ein wenig anders als meine jungen Klassenkameradinnen und ersparte mir auf diese Weise viel Peinlichkeit. Ich war dankbar und entschlossen und arbeitete fleißig. Weil ich immer zugehört hatte, wenn meine Schwestern das Alphabet lernten, gingen mir die Buchstaben relativ schnell über die Zunge.
Innerhalb von zwei Monaten wurde ich in die zweite Klasse versetzt. Einerseits freute ich mich, so schnell voranzukommen, aber es machte mich traurig, meine Lehrerin zurückzulassen. Und das bereits, ehe ich meine nächste Lehrerin kennenlernte. Der Lehrerin der zweiten Klasse schien die überdimensionierte Schülerin in ihrer Klasse nämlich nicht zu gefallen. Sie rief mich häufig zum Vorlesen auf und lauschte schadenfroh, wie ich mich mit einzelnen Wörtern abmühte. Wenn meine Klassenkameradinnen kicherten, schalt sie sie nur scherzhaft aus.
»Genug jetzt. Lasst euch von Fereibas Größe nicht täuschen. Sie ist noch ganz neu in der zweiten Klasse.«
Ich arbeitete noch härter, und nachdem ich eine Aufnahmeprüfung abgelegt hatte, blieb ihr nichts anderes übrig, als mich in die dritte Klasse zu überstellen. Wenn ich nachmittags aus der Schule kam, erledigte ich zunächst die Hausarbeit, der ich nicht entkommen konnte. Ich hatte KokoGul versprochen, ihr auch weiterhin zu helfen, und wollte auf keinen Fall riskieren, dass sie sich bei meinem Vater über meinen mangelnden Eifer beklagte. Nach wie vor klopfte ich die Teppiche, wusch unsere Wäsche und versorgte die Tiere im Hinterhof. Erst, wenn der Haushalt erledigt war und die Familie gegessen hatte, setzte ich mich an meine Hausaufgaben und arbeitete bis tief in die Nacht. Padar-jan bemerkte das.
»Dokhtar-jan, du arbeitest härter als deine Schwestern. Man sieht es an deinen Noten. Schaffst du dein Pensum?«
»Ja, Padar-jan. Ich will so schnell wie möglich den Stand erreichen, den ich eigentlich haben sollte.«
»Und was ist mit deinen Mitschülerinnen? Kommst du mit ihnen zurecht?« Ich wusste, was er meinte. Er wollte wissen, ob ich als Heranwachsende in der zweiten Klasse nicht zu viel negative Aufmerksamkeit erregte.
»Sie sind nett. Sie lassen mich in Frieden und außerdem hoffe ich, schon bald in die nächste Klasse zu kommen.«
Zufrieden überließ er mich meinen Schularbeiten. Solche Gespräche führten wir immer wieder, bis ich in die fünfte und sechste Klasse kam, in denen der Lehrstoff mehr Aufmerksamkeit und intensiveres Lernen erforderte. Das Lesenlernen fiel mir leicht, aber Mathematik war eine ganz andere Sache.
Einfache Mathematik hatte ich auf dem Markt gelernt. Wenn der Verkäufer mir den Preis für einen Meter Stoff sagte, wusste ich, wie viel ich für fünf Meter zu bezahlen hatte. Ich konnte auch den Preis für zweihundertfünfzig Gramm oder ein Pfund Trauben errechnen, wenn ich den Kilopreis kannte. Geometrie und Algebra jedoch fielen mir schwer, aber ich schaffte es dennoch.
Bei Kerzenlicht lernte ich auswendig und wiederholte das Gelernte, während ich Staub wischte. Während des Essens zeichnete ich unsichtbare Wörter und Ziffern mit den Fingern auf mein Knie. Ich stahl mir die Momente, in denen ich rekapitulieren konnte, was ich zu lernen hatte.
Und tatsächlich machte ich große Fortschritte. Mit sechzehn saß ich in der elften Klasse zusammen mit Mädchen meines Alters und würde im darauffolgenden Jahr den Abschluss machen. Ich war sehr stolz auf mich, genau wie mein Vater. Jedes Zeugnis studierte er sorgfältig, blätterte durch die Bemerkungen und blickte zu mir auf. In seinen Augen sah ich, was er nicht aussprechen konnte. Seine Mundwinkel hoben sich zu einem leichten Lächeln, während er sich bemühte, sein Lob möglichst gleichmütig klingen zu lassen.
»Gut gemacht.«
Mein Großvater saß mit einem Kissen im Rücken in der Ecke, ließ die Perlen seines tasbeh, der Gebetskette, durch die Finger gleiten und hörte zu. Sein Gesicht verriet mir, dass er nicht im Mindesten überrascht war.
Kapitel 4
Fereiba
Trotz des Fastens vom Sonnenauf- bis zum Sonnenuntergang war der Ramadan ein fröhlicher Monat. Normalerweise nahmen Schule und Hausarbeit mich so in Anspruch, dass die hungrigen Tage schnell und schmerzlos vergingen. Tagsüber knurrten unsere Mägen, aber nach Sonnenuntergang genossen wir das Essen, das wir den ganzen Tag über vorbereitet hatten, besondere Gerichte, die uns für unsere Ausdauer belohnten.
Während der Nachmittagsstunden im Ramadan war mein Bruder Asad oft übellaunig und boshaft. Im Jahr zuvor war Asad ins Wohnzimmer gekommen, als ich Boba-jan gerade ein Kissen hinter den Rücken stopfte. Wortlos warf er mit einem seiner Hemden nach mir. Überrascht drehte ich mich um.
»Asad! Was soll das?«, fragte ich. Es war ein langärmeliges Hemd, das ich erst kürzlich gewaschen hatte.
»Asad, bachem. Warum hast du das getan?«, schimpfte Boba-jan.
»Ich brauche ein sauberes Hemd, aber auf diesem hier ist immer noch ein Fleck, Boba-jan. Sie hätte den Fleck auswaschen müssen.«
»Was für ein Fleck?«, erkundigte er sich.
»Maulbeersaft.«
»Ah, jetzt verstehe ich. Maulbeersaft lässt sich nicht auswaschen. Und wisst ihr auch, warum?«
»Warum, Boba-jan?« Ich hatte ebenfalls keine Ahnung.
»Setzt euch, dann erzähle ich es euch. Es ist eine gute Möglichkeit, die Stunden bis zum iftar, dem Fastenbrechen, und der damit verbundenen Unruhe zu verbringen. Es war einmal ein hübsches, junges Mädchen …«
Er erzählte von dem Mädchen und dem Bogenschützen, die einander im Dschungel begegneten. Als das schöne Mädchen das Knurren eines Tigers hörte, bekam sie große Angst und Nasenbluten. Sie floh vor dem wilden Tier, ließ dabei aber ihr blutbeflecktes Kopftuch zurück. Ihr Liebster fand das Tuch, entdeckte den Tiger und befürchtete das Schlimmste. Mit gebrochenem Herzen jagte er hinter dem Tiger her, um seine Liebste zu rächen. Der Tiger aber tötete ihn unter einem Maulbeerbaum. Als das junge Mädchen den Mut fand, in den Dschungel zurückzukehren, schrie sie beim Anblick ihres leblosen, zerfleischten Liebsten auf und brach in ihrer abgrundtiefen Trauer tot zusammen. Und so vereinte sich ihre Seele unter dem Maulbeerbaum mit der ihres Liebsten, um sich auf den Weg in die nächste Welt zu begeben.
»Seit diesem Tag trägt der Maulbeerbaum Früchte, deren Saft Flecken von der Farbe des Blutes verursacht, das die Herzen dieser beiden Liebenden vereinte. Diese Flecken kann keine Lauge der Welt auswaschen.«
Asad hatte aufmerksam zugehört, aber als Boba-jan die Geschichte beendet hatte, war er enttäuscht, dass er niemandem die Schuld für die dauerhaften Flecken auf seinem Hemd mehr geben konnte. Missgelaunt hob er es vom Boden auf.
»Es ist ohnehin schon alt. Ich habe bessere Hemden.«
Diese Geschichte ging mir auch ein Jahr später noch durch den Kopf, als ich über den Basar lief, um leckere Datteln für unser iftar zu besorgen. Mein Schritt war beschwingt, denn ich freute mich darauf, zu Hause die gute Nachricht mitzuteilen: Ich hatte in einer Mathematikarbeit die zweitbeste Note bekommen. So laut, dass alle es hören konnten, hatte die Lehrerin verkündet: »Fereiba hat fast die volle Punktzahl erreicht und musste sich nur Latifa geschlagen geben. Sehr gut!«
Ich wusste, dass Boba-jans Augen vor Stolz auf eine Weise glitzern würden, die mehr sagte als alle Worte. Jetzt wollte ich nur noch die Datteln erstehen und dann schnell heimgehen, um meinem Großvater die freudige Nachricht zu überbringen.
Sheraga besaß einen Laden für Gewürze und Trockenfrüchte: Bei ihm bekam man Walnüsse, Mandeln, Kardamom, Steinsalz, leuchtend gelbes Kurkumapulver und feurige Pfeffersorten. Sein Laden war herrlich bunt und verführerisch für alle Sinne, auch wenn Sheraga selbst das kaum zu bemerken schien. Sein Gang war langsam und schwerfällig. Er war so dick wie zwei Männer, und seine Stirn glänzte sogar im kältesten Winter vor Schweiß. Selten gelang es mir, seine Preise herunterzuhandeln, aber an diesem Tag schien er großzügig zu sein. Mit gesenktem Kopf nahm ich die Datteln entgegen und achtete darauf, Sheragas dicke, haarige Finger nicht zu berühren.
Ehe ich mich auf den Heimweg machte, rückte ich den chadar