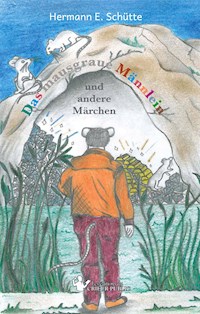
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Das mausgraue Männlein und andere Märchen wurde 74 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung im Jahr 1946 jetzt wiederentdeckt. Es ist eine märchenhafte Reise in die große weite Welt der Phantasie, der Träume, der Werte und eine Auseinandersetzung mit den Fragen des Lebens. In den 16 Märchen beschäftigt sich der Autor in kindgerechter Form mit Geschwisterliebe, Eitelkeit, Hilfsbereitschaft, Rachsucht, Liebe, Neid, Vergeben, Missgunst, Großzügigkeit, dem Verlust einer nahestehenden Person, Lug, Trug, Ehre und Mitmenschlichkeit. Das Werk macht Mut und inspiriert in unserer herausfordernden Zeit. Es ist insbesondere für 6-12 jährige Kinder - auch zum Vorlesen - sehr geeignet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meiner Tochter Anja Kathrin gewidmet
INHALTSVERZEICHNIS
Der Alte aus dem Moor
Trampelfuß
Die Wunderstiefel
Schnuck
Das Schwert
Die überlistete Sonne
Der Bauer mit dem harten Herzen
Das mausgraue Männlein
Knecht Mike
Das Rauschen des Meeres
Die beiden Tannen
Der faule Kuckuck
Die Puppe Amodie
Kaspers Rache
Wie Sommer und Winter ins Land kamen
Das Geheimnis des großen Steins
Der Alte aus dem Moor
Weit, weit draußen im Moor, da wo sich die Füchse gute Nacht sagen, wohnten einstmals zwei Schwestern. Ida hieß die ältere, während die um ein Jahr jüngere auf den Namen Gretel hörte. Gretel war blond wie ein Kornfeld. Ida hatte rötliches Haar, das wie eine feurige Lohe um ihren Kopf stand. Die Schwestern bewohnten ein kleines aus Lehm, Holz- und Flechtwerk errichtetes Häuschen. Zu ihrem Unterhalt hielten sie Hühner, zwei Ziegen, etliche Schafe, und für den Winter machten sie ein Schwein fett. Außerdem gab es noch Tauben, einige Kaninchen, vier oder fünf Bienenstöcke und einen Hund Tapsi.
Die Schwestern waren fleißig und brachten das kleine Anwesen gut voran. Nach dem Tode der Eltern hatte sich eine Tante der damals Drei- und Vierjährigen angenommen. Auch die Tante ist nun schon seit vielen Jahren tot. Gretel und Ida hatten sie sehr geliebt, aber ihre manchmal wunderlichen Reden wollten ihnen auch heute noch nicht aus dem Sinn. Sie wussten alle Worte noch auswendig: „Achtet auf den alten Mann aus dem Moor! Wenn er zu euch kommt, dann behandelt ihn gut, seid freundlich und aufmerksam, gebt ihm zu essen und zu trinken und bietet ihm ein Nachtlager an. In seiner Hand ruht aller Segen. Ohne ihn kann im Moor nichts gedeihen, keine Frucht und kein Vieh.“
Versuchten die Schwestern weiter in sie zu dringen, so wiederholte sie statt einer richtigen Antwort nur ihre Worte; und manchmal fügte sie hinzu: „Eure Waage wird dann ausschlagen; nach unten oder nach oben.“
Die Schwestern arbeiteten ohne Unterlass. Sie gruben das Land, schleppten den Dünger, versorgten das Vieh und hielten das Haus sauber und ordentlich. Mit seinen rotgestrichenen Fensterrahmen und Türen, seinen beinah schwarzen Balken und seinen weißgelb getönten Wänden stand das Haus da wie eine große bunte Blume. Und die Schwestern glichen fleißigen Bienen, emsig beschäftigt, den köstlichen Honig einzuheimsen.
Schien die Sonne, konnte das Haus herzhaft lachen; bei Regenwetter zog es ein krauses Gesicht und bat den Regen, nicht alle Farbe abzuwaschen. Der Regen war ein gutmütiger Patron und gab sich alle Mühe, die Farbe zu schonen. Schlug ihn der Wind jedoch mit harter Hand, dann half alle Gutmütigkeit nichts. Der Wind war stark und rücksichtslos, und alles, was er packen konnte, wurde durchgerüttelt und geschüttelt. Er ließ sich nicht erweichen. Auf den guten, weißen Schnee freute sich das Haus in jedem Jahr wieder. Der lag so weich auf dem Dach, und das Haus fühlte sich dann warm und geborgen.
Vor dem Haus hatten die Schwestern einen Garten angelegt. Hier zogen sie Tomaten, Petersilie und andere Küchengewürze. Jedes freie Plätzchen wurde durch Blumen ausgefüllt. Den Zaun entlang wuchsen Sonnenblumen und leuchteten beinah so hell wie die Sonne selbst. Aus dem Samen verstanden die Schwestern ein vorzügliches Öl zu pressen. Ein in ihm gebackener Buchweizenpfannkuchen mundete nicht nur, er gab auch Kraft und Ausdauer.
Zweimal im Monat musste eine der Schwestern in die Stadt, um dort Gemüse, Käse und andere Erzeugnisse ihres Fleißes zu verkaufen. Das war jedes Mal ein beschwerlicher Marsch. Ein schmaler Pfad führte über das Moor. Wer ihn verließ, den schluckte es. Er sank tiefer und tiefer in die so verführerisch grün aussehende, schlüpfrige Fläche. Das Schulterholz, an dem die Körbe hingen, drückte schwer. Aber einmal nahm der Weg ein Ende, und auf der zur Stadt führenden Landstraße fand sich gewöhnlich eine Fahrgelegenheit. Die Schwestern waren in der Gegend weit und breit bekannt und ob ihres Fleißes geachtet, so dass jeder sie gern mitnahm.
Hatten sie ihre Waren abgesetzt, kauften sie ein, was sie notwendig brauchten. Gretel brachte einmal einen Topf, einmal ein paar Löffel oder ein Sieb mit heim. Auch an Farbe dachte sie, an Knöpfe, Nadeln und Nähgarn. Für die Schafschur ließ sie die Schere schleifen, und ein neues Halsband für Tapsi wurde auch nicht vergessen. Auf dem Wege in die Stadt überlegte sie, was alles zu Hause gebraucht wurde. Auf dem Rückweg, wenn die Sachen wohlverwahrt im Korb ruhten, konnte sie dann ihren eigenen Gedanken nachgehen. Aber diese gingen kaum über das Haus und seine nähere Umgebung hinaus.
Ihrer Schwester Ida fehlte dieser hausfrauliche Sinn. Sie brachte auch wohl einen Eimer oder Besen mit, aber nur, wenn Gretel sie besonders darum bat. Sah sie jedoch ein buntes Band, einen farbigen Schürzenstoff oder ein schönes Stück Kattun zu einem neuen Kleid, dann konnte sie nicht widerstehen. Sie musste es kaufen. Und auf jedem Weg in die Stadt erblickte sie irgendein Stück, das ihr gefiel.
Der Rückweg war ihr besonders lieb. Die Last war leicht, und sie hatte Muße, ihren Gedanken nachzugehen. Da wurde aus dem Stückchen Band eine kostbare Spitze oder ein herrlicher Besatz, das Stück Kattun verwandelte sich in wunderbare Seide oder kostbaren Brokat. Bald wurde ein Kleid daraus. Aus dem einen Kleid wurden mehrere, und es dauerte gar nicht lange, dann hatte sie einen ganzen Schrank voll. Der Schrank stand in einem schön eingerichteten Zimmer. Das Zimmer gehörte zu einem Schloss. Zu dem Schloss gehörten große Ländereien, viele Pferde, Kutschwagen, vornehm gekleidete Diener, Kammerzofen und Köche. Das Schloss lag in einem Park. Auf großen, satten, grünen Rasenflächen standen alte, riesige Bäume und viele seltsame Blumen. Tauben tummelten sich auf dem Schlosshofe, und ein eitler Pfau schlug sein Rad. Auf der Freitreppe erschien die Besitzerin dieser vielen schönen Dinge. Ein gesatteltes Pferd wurde vorgeführt. Die Herrin ließ sich in den Sattel helfen und sprengte, von einem laut kläffenden Windspiel begleitet, davon.
Bei dieser Beschäftigung verging die Zeit wie im Fluge. Oftmals war sie erstaunt und ein wenig traurig, wenn sie sich so schnell vor ihrem Häuschen wiederfand. Dann war sie wieder die Ida, die Käse und Gemüse in die Stadt getragen hatte, und mit dem schönen Traum waren das Schloss, das Pferd, der Hund und der Park verschwunden.
Ihrer Schwester gegenüber erwähnte sie ihre Träumereien nicht. Die Bänder, die Stoffe und der übrige aus der Stadt heimgebrachte Flitterkram setzte Gretel manchmal in Erstaunen, aber sie sagte nichts und ließ ihre Schwester gewähren.
So lebten beide weiterhin im besten Einvernehmen, gingen ihrer Arbeit nach und mehrten ihren Besitz.
Es war im Herbst. Gretel war in der Stadt gewesen und befand sich auf dem Weg zu ihrem Häuschen. Da begegnete ihr auf dem Pfad durchs Moor ein alter Mann. Als sie ihm Platz machen wollte, blieb er stehen, sah sie aus großen, warmherzigen Augen an und fragte: „Bist du die Gretel aus dem kleinen Häuschen weit hinten im Moor?“ Gretel bejahte die Frage und wollte weitergehen. Aber der alte Mann hielt sie zurück: „Wie die Zeit vergeht! Früher, als ihr noch klein wart und eure Tante noch lebte, habe ich euch manchmal besucht. Eure Tante war eine liebe Frau. Ich habe viel Gutes von ihr erfahren. „Komm“ — dabei wollte er ihr das Schulterholz abnehmen — „ich helfe dir ein wenig tragen.“ Gretel wehrte ab. „Ich bin noch jung und kräftig. Die Last drückt mich nicht, und meine Tante würde mich gewiss schelten, wenn sie es sehen könnte. Sicher hast du einen weiten Weg hinter dir? Da wirst du Hunger haben. Ich bitte dich, unser Gast zu sein.“ Sie schulterte ihre Körbe und fuhr fort: „Wir geben’s gern.“
Der alte Mann murmelte etwas Unverständliches vor sich hin und folgte ihr.
„Wenn ich dir zu schnell gehe, musst du es sagen“,
nahm Gretel die Unterhaltung wieder auf.
„Geh nur zu, mein Kind“, antwortete der Alte, „ich
bin andere Märsche gewohnt.“
Nach einer Weile stellte der alte Mann eine Frage: „Gedenkst du noch manchmal deiner Tante?“ Erstaunt wandte Grete ihren Kopf. „Es vergeht kein Tag, an dem ich mich nicht ihrer Worte erinnere, aber soviel ich auch Ausschau halte, den guten Moorgeist, von dem sie uns oft erzählte, habe ich noch nicht zu Gesicht bekommen. Und ich möchte ihn so gern einmal sehen und ihn fragen, was meine Tante mit ihren Worten eigentlich gemeint habe.“
Der Alte lachte belustigt in sich hinein und meinte: „So, dem Moorgeist möchtest du begegnen? Da nimm dich nur in Acht; der Moorgeist ist ein gefährlicher Geselle, der hat schon manchem eine böse Nase gedreht.“ Gretel ließ den alten Mann kaum aussprechen. „Ich weiß nicht, ob der Moorgeist schon jemand eine Nase gedreht hat; eins aber weiß ich genau: wenn meine Tante sagte, ich solle dem Moorgeist gut sein, dann hat er es auch verdient. Ich lasse nichts auf ihn kommen. Und Ihr solltet keine schlechten Reden über ihn führen. — Und jetzt sind wir angelangt. Kommt! Schwester Ida wird uns ein Abendbrot bereiten.“
„Deiner Einladung kann ich leider nicht folgen“, bedauerte der alte Mann. „Ich habe noch einen weiten Weg vor mir. Vielleicht ein anderes Mal. Lasst’s euch gut gehen. Ich werde euch nicht vergessen.“ Ohne eine Antwort abzuwarten, machte er kehrt und ging seiner Wege. Nach einigen Schritten blieb er nochmals stehen, drehte sich um und rief: „Achte gut auf deine schwarze Henne. Sie kann dich reich und sie kann dich zufrieden machen — je nach Wahl. Willst du reich werden, so musst du zu ihr sagen:
Hühnchen, Hühnchen, komm herbei, leg mir schnell ein golden Ei!
willst du aber lieber Gesundheit und Zufriedenheit, dann sprich:
Hühnchen, Hühnchen, komm herbei,
leg mir schnell ein frisches Ei!
Eins jedoch vergiss nie:
Sie legt dir jeden Tag ein Ei.
Verlangst du mehr, dann ist’s vorbei.
Aber deiner Schwester darfst du das Geheimnis nicht verraten.“ Nach diesen Worten nahm er den Weg unter die Füße und war bald ihren Blicken entschwunden.
Auf ihrem nächsten Weg nach der Stadt hatte Ida eine Begegnung mit dem Alten. Er stellte dieselben Fragen an sie, und als er sich kurz vor ihrem Häuschen verabschiedete, sagte er: „Achte gut auf deine weiße Henne!“ Dann verriet er auch ihr die beiden Verse und ermahnte auch sie, der Schwester gegenüber Stillschweigen zu bewahren. Ida versprach’s, und der Alte ging seines Weges.
Die Arbeit wurde nicht weniger, und als sie sich eine Kuh kauften und später noch eine, kamen sie vom frühen Morgen bis zum späten Abend nicht mehr von den Beinen. Aber es lag ein Segen über ihrer Arbeit, und alles gedieh prächtig. Alle Stadtleute lobten ihre Butter, ihre Eier, ihren Honig und verlangten mehr, als sie liefern konnten.
Nach einer gewissen Zeit, als Gretel in der Stadt war, erinnerte sich Ida der Worte des alten Mannes. Sie rief ihre Henne, nahm sie auf den Schoß und sagte:
„Hühnchen, Hühnchen, komm herbei,
leg mir schnell ein golden Ei!“
Kaum hatte sie die Worte gesprochen, fing die Henne an zu gackern, und gleich darauf lag ihr ein glänzendes, goldenes Ei im Schoß. Ida wollte ihren Augen nicht trauen. Sie betrachtete das Ei von allen Seiten. Es war und blieb aus echtem Gold. „Ob ich es nochmal versuche?“ überlegte sie. Aber dann fielen ihr die Worte des alten Mannes ein:
„Sie legt dir jeden Tag ein Ei.
Verlangst du mehr, dann ist’s vorbei.“
Da ließ sie ihren Wunsch unausgesprochen. Sie trug das Ei ins Haus und verwahrte es gut.
Ihrer Schwester gegenüber erwähnte sie kein Sterbenswörtchen. Jeden Tag ließ sie sich jetzt ein Ei legen. Auf ihrem nächsten Gang in die Stadt nahm sie die Eier mit. Sie überlegte lange, an wen sie sich wohl wenden könne. Endlich fiel ihr der Goldschmied ein. Vor seinem Schaufenster hatte sie häufig gestanden und die herrlichen Geschmeide, die Broschen, Ketten und Spangen sehnsüchtig bewundert.
Als der Goldschmied die goldenen Eier sah, wollte er wissen, wie diese in ihren Besitz gelangt seien. Ida überlegte. Endlich fiel ihr ein, dass der alte Mann ihr nur ihrer Schwester gegenüber Stillschweigen geboten hatte, und so erzählte sie dem Goldschmied aufrichtig den ganzen Hergang. Der Goldschmied machte listige Augen. Das war einmal ein Glücksfall, den musste man nutzen! Er schlug ihr vor, ihm die goldenen Eier zu überlassen. Er würde sie einschmelzen und das Gold dann auf die Bank tragen. „Auf der Bank“, so fuhr er fort, „ist das Gold gut und sicher aufgehoben. Und wenn erst recht viel beisammen ist, kann man weitersehen.“ Dann durfte sie sich noch eine schöne Halskette aussuchen. Als Ida zögernd nach dem Preis fragte, meinte er: „Nimm nur! Das können wir später verrechnen.“ Und mit der Mahnung, recht bald mehr goldene Eier zu bringen, entließ er sie.
Allmählich fiel der Schwester ihr verändertes Wesen auf. Ida fing an, ihre Arbeit zu vernachlässigen. Das Land, die Tauben, die Kühe, die Schafe wurden ihr langweilig. Nur ihre weiße Henne hegte und pflegte sie. Kam sie aus der Stadt, brachte sie entweder ein kostbares Schmuckstück, einige Meter herrlichster Seide, einen schönen Schal oder sonst etwas Wertvolles mit. „Ida“, konnte Grete manchmal sagen, „woher stammen all die Kostbarkeiten, und was willst du mit ihnen hier im Moor? Es ist kein Mensch da, der dich bewundern kann. Und mir bist du ohne Seide, ohne goldenen Schmuck genau so lieb.“ -
Ida versuchte ihre Schwester zu beruhigen: „Lass mich nur machen. Ich erkläre dir später einmal alles.“ Dabei lächelte sie geheimnisvoll. Dieses Lächeln machte Gretel nur noch besorgter. „Da stimmt doch etwas nicht“, musste sie des Nachts, wenn sie sinnend wach lag, denken. Aber dem Geheimnis kam sie nicht auf die Spur, und Ida war ängstlich bemüht, sich mit keinem Wort zu verraten.
Auf Gretes Schultern ruhte immer mehr die ganze Last des Anwesens. Sie hätte so gern mit einem Menschen ihre Sorgen besprochen, aber es war niemand da. Die Tiere erschienen ihr in letzter Zeit bedeutend zutraulicher. Tapsi folgte ihr auf Schritt und Tritt, die Schafe drängten sich an sie heran, die Ziegen meckerten, und die Kühe muhten, sobald sie ihrer ansichtig wurden. Auch die Hühner kamen gelaufen. Und eine schwarze Henne mit einem blutroten Kamm wäre ihr am liebsten auf die Schulter geflogen. Nur die weiße Henne ihrer Schwester hielt sich scheu zurück.
Kannten die Tiere das Geheimnis ihrer Schwester und fanden nur keinen Weg, ihr dieses mitzuteilen?
Ida hatte bald nur noch Gedanken für ihr Gold, das sich täglich mehrte. Der Goldschmied hatte ihr verraten, dass der Zeitpunkt nahe sei, das Geld von der Bank abzuheben, um eine Fabrik oder etwas ähnlich Großes zu kaufen. ,,Ich werde meine Augen offenhalten“, hatte er ihr beim letzten Besuch gesagt. „Ich gebe Ihnen sofort Nachricht, sobald ich etwas Passendes gefunden habe.“ Der Goldschmied sah in ihr bereits eine reiche, vornehme Dame und redete sie nur noch mit „Fräulein“ und „Sie“ an. So kam es, dass Ida fast den ganzen Tag in Gedanken versunken umherging und auf eine Nachricht wartete. Nur ihre weiße Henne nahm sie täglich auf den Schoß, sagte ihren Vers her und war erst beruhigt, nachdem sie das goldene Ei in ihrer Hand hielt.
Endlich kam ein Brief. Gretel brachte ihn heim. „Vom Goldschmied“, sagte sie und gab ihn ihrer Schwester.
Diese riss den Umschlag auf und las. Gretel sah, wie ihre Gesichtszüge sich veränderten. Als sie fertig war, stand sie auf, ging zu ihrer immer noch sprachlos dasitzenden Schwester und sagte: „Ich muss dich morgen verlassen. Ich ziehe in die Stadt. Mir ist hier alles zu klein und zu eng geworden. Haus und Hof magst du behalten. Ich nehme nur meine Kleider, meinen Schmuck und meine Lieblingshenne mit.
Als Gretel sie nun bat, sich doch weiter zu erklären, wehrte sie ab: „Später sollst du alles erfahren. Heute möchte ich dir nichts sagen. Ich weiß selbst noch nicht, wie alles ausgeht.“
Am nächsten Tag verließ Ida ihre Schwester, das Häuschen, den Garten, die Tiere. Sie hatte es so eilig, dass sie vergaß, richtig Abschied zu nehmen. Bedrückt und traurig blieb Gretel allein zurück. Tapsi kam, bellte, wedelte und gebärdete sich wie toll, als wollte er sie auf seine Art trösten.
Nach ihrer Ankunft in der Stadt suchte Ida sofort den Goldschmied auf. Sie hatte mit ihm eine lange Unterredung. Als sie beendet war, wusste sie, dass sie mit ihm in die Landeshauptstadt fahren würde. Dort war sie Besitzerin einer großen Fabrik geworden. Es war beschlossen, diese Fabrik gemeinschaftlich zu verwalten.
In der Hauptstadt kaufte Ida sofort ein schlossähnliches, in einem großen Park gelegenes Haus. Sie nahm sich einen Diener, eine Köchin und eine Kammerzofe. In einem besonderen, neben ihrem Schlafzimmer gelegenen Raum wurde die weiße Henne untergebracht. Sie ließ ihr einen wundervollen Käfig bauen, und die Henne bekam täglich den besten Weizen und den reifsten Mais. Die Dienerschaft wunderte sich anfangs über das seltsame Gehabe ihrer Herrin. Doch sie beruhigte sich bald. „Reiche Leute haben ihr Steckenpferd“, dachten sie, „die einen halten sich einen Affen, andere Krokodile oder seltene Fische. Warum soll unsere Frau sich nicht eine Henne halten?“ Welche Bewandtnis es mit der Henne hatte, wussten sie natürlich nicht. Jeden Morgen nach dem Frühstück nahm Ida ihre Henne auf den Schoß und ließ sich ein goldenes Ei legen.
So wurde sie reicher und immer reicher. Sie kaufte Pferde und schöne Kutschwagen, und oftmals wusste sie nicht, ob sie nun reiten oder fahren sollte. Um ihre Fabrik kümmerte sie sich herzlich wenig. Das überließ sie dem Goldschmied.
Der war inzwischen auch ein vornehmer Herr geworden. Unter seiner geschickten Führung entwickelte sich die Fabrik schnell, so dass sie große Gewinne abwarf. Der ehemalige Goldschmied sorgte schon dafür, dass er selbst dabei nicht zu kurz kam.
Als es für Ida in der Hauptstadt nichts mehr zu sehen noch zu erleben gab, ging sie auf Reisen. Die weiße Henne führte sie natürlich mit sich. Sie besuchte Konstantinopel, fuhr zu den Pyramiden und schiffte sich sogar nach Indien ein. Hier traf sie ein schlimmer Schlag: die weiße Henne erkrankte und starb. Ida wurde recht traurig darüber und fürchtete, das gute Leben hätte nun ein Ende. Aber der Goldschmied beruhige sie. Er legte ihr die Geschäftsbücher vor, aus denen sie ersah, dass sie noch reicher war, als sie angenommen hatte, und weiterer goldener Eier nicht mehr bedurfte.
Ihrer Schwester Gretel gedachte sie nur selten. Als eines Tages ein Brief eintraf, in dem Gretel sie bat, sie einmal besuchen zu dürfen, schrieb sie zurück, sie möchte die Reise verschieben. Im Augenblick passe es ihr sehr schlecht. Sie möchte einmal wieder anfragen. Vielleicht käme sie dann gelegener.
Nachdem Gretel den Brief gelesen hatte, war sie sehr traurig. „Das hat meine Schwester doch nicht geschrieben“, wiederholte sie immer wieder. In ihrer Not wandte sie sich an die Tiere. Die schauten sie aus großen Augen an, als verstünden sie ihr Leid. Stumm und still saß sie da und hielt die Hände gefaltet. Plötzlich kam die schwarze Henne geflattert und setzte sich auf ihren Schoß. Da erinnerte sie sich plötzlich der merkwürdigen Worte des alten Mannes. Zufriedenheit könne sie jetzt brauchen, dachte sie.
„Hühnchen, Hühnchen, komm herbei, leg mir schnell ein frisches Ei!“
sprach sie, und ehe sie sich dessen versah, lag ein schönes frisches Ei vor ihr. Liebkosend streichelte sie das Gefieder. Dann ging sie und kochte das Ei. Nachdem sie es gegessen hatte, fühlte sie sich frisch wie ein Fisch im Wasser.
„Nanu“, dachte sie, „das ist wirklich ein sonderbares Ei. Da will ich gleich morgen der kranken Frau Bürgermeisterin ein Ei bringen. Vielleicht hilft es ihr.“
„Ich habe hier ein schönes frisches Ei“, sagte sie am nächsten Tag zu der kranken Frau Bürgermeisterin, „das wird Ihnen gewiss guttun.“ Die Frau Bürgermeisterin ließ sich das Ei sogleich kochen und verzehrte es im Beisein der Schwester. Wer beschreibt das Wunder? Kaum hatte die Frau den letzten Bissen hinuntergeschluckt, da warf sie auch schon die Bettdecke beiseite und verlangte aufzustehen. Mit einem Schlag war sie gesund und munter. Da gab es ein großes Hallo. Jeder wollte die Frau Bürgermeisterin sehen, um von ihr zu hören, wie dergleichen möglich sei. Das Ereignis sprach sich in der Stadt schnell herum, und Gretel wurde gesuchter als der beste Doktor.
Die Henne legte fortan jeden Tag ihr Ei, und viele Menschen wurden durch sie ihrer Leiden und Gebrechen ledig.
Die Kunde von der wundersamen Heilkraft der Eier drang auch in die Hauptstadt des Landes. Schwester Ida war von einer ihrer Reisen schwer krank zurückgekommen. Als sie von den heilspendenden Eiern erfuhr, ließ sie Nachforschungen anstellen. Gar bald brachte sie in Erfahrung, dass es die Henne ihrer Schwester Gretel sei, die diese Eier lege. Sie ließ sofort ihre schnellsten Pferde anspannen und fuhr zu ihrer Schwester ins Moor. Ihr Hausarzt, der sie begleitete, schüttelte beständig sein Haupt und sagte ein um das andere Mal: „Das geht nicht gut. Wir müssen langsamer fahren.“ Aber Ida achtete seiner Worte nicht.
Endlich hatten sie das Häuschen erreicht. Ida lag mehr tot als lebendig in den Kissen. Gretel kam gelaufen und wollte erst nicht glauben, dass das vornehme Gespann ihrer Schwester Ida gehöre. Als der Doktor jedoch den Wagenschlag öffnete und Gretel ihre Schwester elend und abgemagert in den Polstern gewahrte, empfand sie großes Mitleid. Sie ließ sie sofort ins Bett bringen. Dann erzählte ihr der Doktor, wie es um sie stehe. „Wenn wir Ihre Schwester retten wollen, dürfen wir keine Minute mehr verlieren.“
Nun war guter Rat teuer. Die Henne hatte ihr Ei bereits gelegt, und dieses war schon verbraucht. Aber es galt das Leben ihrer Schwester. Gretel rief ihre Henne, sprach den Vers, und gleich darauf konnte sie ihrer Schwester das frische Ei geben. Und Ida wurde zur selben Stunde gesund. Als die Schwestern die Henne riefen, diese aber nicht kam, gingen sie in den Stall. Dort fanden sie die Henne. Sie lag mit gespreizten Beinen auf dem Boden und war tot. Bedrückt und schuldbeladen gingen die beiden Schwestern davon.
Der Doktor saß wartend in der Stube. Als die Schwestern das Zimmer betraten, wünschte er ihnen Glück; Gretel zu ihrer wundertätigen Henne und Frau Ida zu ihrer schnellen Genesung. „Die feuchte Moorluft“, fuhr er dann fort, „wird Ihrer eben hergestellten Gesundheit schaden. Ich rate dringend, die Heimreise sofort anzutreten.“
Aber Ida erklärte ihm, dass sie nicht daran dächte, ihre Schwester wieder zu verlassen. Für den Goldschmied gab sie ihm einen Brief mit, worin sie ihm mitteilte, dass sie nicht wieder zurückkehre. Die Fabrik könne er behalten. Ihr eigenes Geld solle er den Armen und Kranken zukommen lassen.
Der Goldschmied schlug die Worte seiner Gönnerin in den Wind. Er wollte reicher und immer reicher werden. Eine Zeitlang ging alles gut. Dann erlitt er einen Verlust nach dem andern. Später musste er die Fabrik verkaufen. Aber auch das rettete ihn nicht mehr. Einsam und verlassen ist er irgendwo gestorben und niemand weiß, wo er begraben liegt.
Die Schwestern aber lebten noch viele Jahre. Der Hof gedieh weiterhin prächtig, so dass die Schwestern keinen Mangel litten. Der Zeit ihrer Trennung gedachten sie kaum. Wenn sie abends in ihrem Stübchen zusammensaßen, kam es schon mal vor, dass sie sich des alten Mannes erinnerten. Gretel meinte dann: „Manchmal glaube ich, es ist der Moorgeist gewesen.“ Aber so oft sie auch Ausschau hielten, der Alte ließ sich nicht wieder blicken.
Der auf dem Hof ruhende Segen ist bis auf den heutigen Tag nicht gewichen.
Trampelfuß
Im Schwarzwald, da wo die Tannen am dichtesten standen, hauste zu einer Zeit, als es weder Mond noch Sterne gab, ein uralter Mann. „Trampelfuß“, so sagten selbst die ältesten Leute, „war schon uralt, als wir noch jung waren. Und unsere Eltern, die nun schon lange tot sind, behaupteten dasselbe.“ Etwas Wahres muss schon daran gewesen sein, denn Trampelfuß war im Besitze vieler Geheimnisse. Er wusste Mittel gegen alle Krankheiten, konnte sämtliche Wunden heilen, ja, er verstand es sogar, reiche Menschen arm und arme reich zu machen. Mitgefühl besaß er jedoch nicht. Konnte er einen Menschen peinigen, dann sprang er vor lauter Freude von einem Fuß auf den andern. Dieser Angewohnheit verdankte er auch seinen Namen.
Es waren viele Gerüchte über Trampelfuß im Umlauf, und die Menschen hatten auch allen Grund, ihn zu fürchten. Sobald sie den Wald betraten, um Holz zu holen oder Pilze zu sammeln, schlugen sie drei Kreuze. Doch das half ihnen wenig. Trampelfuß folgte ihnen unbemerkt und stellte seine Opfer, wo und wie es ihm passte.
Nur einem Menschen, einem Knecht, gelang es, ihn zu übertölpeln! Der Knecht hatte im Walde eine Last Holz geschlagen. Im Begriff, dieses heimzufahren, hörte er plötzlich ein Eichhörnchen jämmerlich schreien. Er ging dem Geschrei nach und fand das Eichhörnchen auch bald mit seinem buschigen Schwanz derart unglücklich eingeklemmt, dass es weder vor noch rückwärts konnte. Nachdem er das arme Tier befreit hatte, forderte dieses ihn auf, ihm zu folgen. Es führte seinen Retter nach einem hohlen Baum. Dort hatte das Eichhörnchen ein von Moos und Blättern bedecktes und bis obenhin mit den kostbarsten Goldsachen angefülltes Versteck. Der Knecht machte große Augen, als er das viele Gold glitzern und funkeln sah. Das dankbare Eichhörnchen bot ihm den Schatz zur Belohnung an. Der Knecht war bescheiden und nahm nur einen Ring und einen goldenen Armreifen. Aber es ließ ihn erst gehen, nachdem er den ganzen Schatz in seinen Taschen untergebracht hatte.
Trampelfuß, der sich in der Nähe versteckt gehalten und dem Knecht ohnehin einen Schabernack hatte spielen wollen, wäre beim Anblick der vielen goldenen Reifen, Nadeln und Münzen beinahe vor Wut und Ärger geplatzt; er beschloss, den Knecht um seinen Besitz zu bringen. Er stellte sich ihm in den Weg. Der Knecht, dem manche Niederträchtigkeit von Trampelfuß zu Ohren gekommen war, befürchtete das Schlimmste. Doch Trampelfuß bot ihm seltsamerweise einen freundlichen „guten Tag“ und forderte ihn auf, ihm zu folgen. Der Knecht wagte aus Furcht um sein Leben nicht zu widersprechen. Der Alte führte ihn immer tiefer in den Wald. Bei einer riesigen Tanne machten die beiden halt. Am Fuße der Tanne erblickte der Knecht ein großes, durch eine aus Gräsern und Zweigen hergestellte Matte verhängtes Loch. Trampelfuß schlug die Matte zur Seite; sie betraten einen Gang, der immer tiefer in den Berg führte und zuletzt in einer großen Höhle endete. In dieser herrschte ein Glanz und eine Helligkeit, dass dem Knecht die Augen schmerzten. Die Wände, die Decke und der Boden, alles war aus reinstem Gold. Und überall lagen noch große Haufen davon aufgestapelt. Dem Knecht verschlug es schier die Sinne.
Trampelfuß stand neben ihm und verzog sein Gesicht zu einem hässlichen Grinsen. Als er glaubte, den Knecht gierig genug gemacht zu haben, sprach er ihn an mit einer Stimme, die sich ebenso schaurig anhörte, wie seine Erscheinung anzusehen war. „Ich will dich reich machen an Wald, an Vieh, an Feldern und Seen. Die Menschen fürchten mich.“ Er kicherte laut und trampelte mit den Füßen, dass die Höhle davon widerhallte. „Sie sollen mich auch fürchten. Alles Gold werde ich ihnen nehmen, denn alles Gold dieser Erde gehört mir. Und du wirst mir dabei helfen.“ Als der Knecht zu widersprechen versuchte, fuhr Trampelfuß ihn barsch an. „Vergiss nie, dass ich Gewalt über dich habe! — Hier hast du zwei Pulver, ein schwarzes und ein weißes. Das schwarze tötet die Menschen und macht dich zum Erben ihrer Habe. Das weiße ist von geringerem Wert; es hält Krankheit, Leid und Ungemach fern.“ Nach diesen Worten nahm Trampelfuß dem Knecht den Schatz ab, und ehe dieser sich’s recht versah, fand er sich in der Nähe seines Gespannes wieder. Er stand eine Zeitlang benommen da, betastete seinen Kopf, seine Arme und Beine und glaubte, geträumt zu haben. Als er jedoch die beiden Pulver in seiner Tasche fühlte, wurde ihm klar, dem gefürchteten Trampelfuß tatsächlich begegnet zu sein. Dem Bauern, dem das lange Ausbleiben seines Knechtes auffiel, antwortete er auf seine Frage, dass ein Rad abgesprungen und ein Pferd beinahe dabei zu Schaden gekommen sei. Den wahren Sachverhalt verschwieg er.
Als der Knecht im Laufe der nächsten Wochen von Trampelfuß weder etwas sah noch hörte, fing er langsam an, die Begegnung zu vergessen. Die Pulver hielt er unter seinem Kopfkissen verborgen.
Eines Abends, der Knecht wollte gerade das Bett aufsuchen, vernahm er vom Fenster her ein leises Pochen. Trampelfuß begehrte Einlass. Der Knecht öffnete das Fenster. Mit einem Satz, den er dem Alten nicht zugetraut hatte, stand dieser im Zimmer. Ohne den Knecht zu begrüßen, polterte er los: „Morgen machst du dich auf zu dem Bauern jenseits der großen Wiese. Er hat in der Stadt seine Ernte gegen blankes Gold verkauft. Dem gibst du von dem schwarzen Pulver. Wenn ich übermorgen komme, um das Geld zu holen, hoffe ich dich auf dem Hof als neuen Besitzer zu sehen.“ Nach diesen Worten war Trampelfuß verschwunden, ohne dass es dem Knecht möglich gewesen wäre, einen Einwand zu machen oder eine Frage an ihn zu richten.
Der Knecht fühlte sich unglücklich. Er kannte den Bauern als einen guten, hilfsbereiten Menschen, und es wollte ihm nicht in den Sinn, ihn auf Befehl des habgierigen Trampelfuß aus der Welt zu schaffen. Und noch weniger lag ihm daran, den Hof auf eine derart schmähliche Weise an sich zu bringen. Während der Nacht lag er lange wach und sann auf einen Ausweg. Da ihm jedoch nichts einfiel, beschloss er, den Auftrag einfach zu vergessen und sich um nichts zu kümmern.
Der folgende Tag verlief ohne Zwischenfall. Aber an dem darauffolgenden Abend fand sich Trampelfuß wieder
ein. „Warte, Bursche“, brüllte er den Knecht an, „das will ich dir eintränken. Was fällt dir ein, meinen Befehl in den Wind zu schlagen! Gehorche! Sonst geht es dir ans Leben!“
Wieder verbrachte der Knecht eine schlaflose Nacht. In aller Frühe suchte er den Bauern auf und erzählte ihm alles. Der Bauer wollte ihn auslachen. Als der Knecht ihm jedoch das schwarze Pulver zeigte, musste er sich von der Wahrheit überzeugen. Sie überlegten lange. Endlich wusste der Bauer Rat. „Die Sache ist ganz einfach. Ich stelle mich heute noch krank und bleibe im Bett. Morgen werden wir dann weitersehen. Trampelfuß musst du täuschen; sage ihm, ich sei verreist, oder was dir sonst einfällt.“
Zur festgesetzten Zeit fand Trampelfuß sich wieder ein. Er tobte: „Auf dem neuen Hof habe ich dich gesucht, und nun finde ich dich noch hier. Was soll das? Und wo ist das Gold?“ Der Knecht konnte vor Angst und Verlegenheit kaum sprechen; außerdem fiel ihm das Lügen schwer, selbst in diesem Fall.
Trampelfuß trat dicht an den Knecht heran, fuchtelte ihm mit seinen mageren Fingern vor dem Gesicht umher und sagte: „Mach keine Ausflüchte. Ich gebe dir noch vierundzwanzig Stunden. Dann will ich das Gold haben.“ Mit einem Schwung war er draußen und in der Dunkelheit verschwunden.
Wie abgemacht, legte sich der Bauer sofort hin und ließ die Kunde verbreiten, er sei plötzlich schwer erkrankt und müsse wahrscheinlich sterben. Auch den Schreiner ließ er kommen und bestellte bei ihm den Sarg. Später schlich der Knecht in den Stall, schlachtete einen Ziegenbock und versteckte den toten Bock unter dem Bett des Bauern. Dann schaffte er noch einige Steine herbei, packte einen Sack mit Lebensmitteln und richtete alles für die Flucht des Bauern her.













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)















