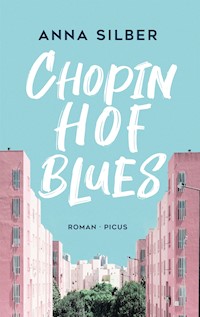18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Picus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Connie eines Tages nach Hause kommt, findet sie ein neues Nachbarskind vor ihrer Wohnung im Gemeindebau sitzen. Wie es heißt, will es nicht verraten, Schuhe trägt es auch nicht, aber Hunger hat es. Von da an steht das Kind regelmäßig vor ihrer Tür und sie trinken gemeinsam Kaffee, bis Connie zur Arbeit muss. Seit Jahren ist sie nun schon Küchenhilfe im Wiener Gasthaus Rösch, dabei hat sie doch Matura. Warum sie nicht mehr aus ihrem Leben macht, versteht niemand, am wenigsten ihre Kolleginnen und Kollegen. Als die Eltern des Kindes plötzlich weg sind, wird aus den ungezwungenen Treffen schlagartig Ernst. Kann Connie für das fremde Kind da sein, wenn sie nicht einmal ihr eigenes Leben wirklich im Griff hat? Mit viel Feingefühl erzählt Anna Silber von der Verantwortung des Erwachsenwerdens, vom Kindsein und von unverhofftem Zusammenhalt und Solidarität in einer anonymen Großstadt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Copyright © 2023 Picus Verlag Ges.m.b.H., Wien
Alle Rechte vorbehalten
Grafische Gestaltung: Dorothea Löcker, Wien
ISBN 978-3-7117-2135-8
eISBN 978-3-7117-5486-8
Informationen über das aktuelle Programmdes Picus Verlags und Veranstaltungen unter
www.picus.at
Anna Silber
Das Meer von Unten
Roman
Picus Verlag Wien
Für Emina
Inhalt
Prolog
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Die Autorin
Porque a un niño que no es mío nunca lo debí cuidar
Natalia Lacunza
Prolog
Es ist nicht so, dass es einen klaren Anfang gab, eine zeitliche Abgrenzung. Ich sah keinen Lkw oder Kleinlaster draußen parken, niemanden Kartons schleppen. Niemand erzählte, dass da neue Leute wohnten, hinter Tür siebenunddreißig. Nicht einmal Frau Zukić teilte ihre übliche Meinung zur Nachbesetzungspolitik von Wiener Wohnen. Sie waren einfach irgendwann da, am ersten Samstag im Februar. Sie gingen an mir vorbei zu Tür siebenunddreißig, als ich gerade meine Wohnungstür hinter mir zusperrte. Der Vater, das Kind, die Mutter mit Bauch. Dreieinhalb, dachte ich.
Eins
Wie immer ist der Mittwoch ein Tag, den man im Vorhinein nicht einschätzen kann. Er kann vorbeigehen, ohne dass viel passiert, aber er kann auch schlimm werden wie ein Freitag oder ein Samstag. In der Früh höre ich im Bett Handymusik, bis es halb elf ist, dann erst komme ich vom Bett auf. Ich ziehe das Gewand von gestern an, wem soll das auch auffallen, wen soll das interessieren. Im Bad schalte ich zum Zähneputzen das Licht nicht ein, damit ich nicht in den Spiegel schauen muss. Minze steht anklagend vor ihrem Napf, ich kippe Futter hinein, ziehe mir Schuhe an, dann den Wintermantel, alles zu langsam.
Als die Wohnungstür hinter mir zufällt, kommt mir etwas anders vor als sonst, ich schaue nach links, dann nach rechts. Vor Tür siebenunddreißig sitzt das Kind, das Kind vom Samstag. Die Beine angezogen, den Kopf unter einer Kapuze auf die Knie gelegt, die Augen verdeckt von dunklen Locken. Ich schaue weg, dann gleich wieder hin. Mein Handy vibriert in der Manteltasche, ich bin zu spät dran, Janosz schreibt mir, wo ich bleibe. Einmal schaue ich noch hinüber, das Kind rührt sich nicht.
Im Rösch angekommen weiß ich, dass es ein schlimmer Mittwoch wird. Die Vorbinderschnüre lösen sich dauernd, ich wickle sie fest umeinander, mache die Tür zur Küche auf, feuchte Wärme, dazwischen Sinan und Janosz. Sinan schreit, verliert viel Spucke dabei.
»Schleich dich, Janosz, schleich dich mit deiner g’schissenen Arroganz!«
»Beruhig dich, komm, reiß dich zusammen«, sagt Janosz. Ich schaue auf die Uhr, die über der Essensausgabe hängt. Zehn nach elf. Vor mir brummt der Ofen, in der oberen Backkammer flackert das Licht immer noch.
»Du kannst dich selber z’sammreißen«, schreit Sinan weiter, »du glaubst jetzt, du bist der Chef und kannst mir irgendwas anschaffen, aber der Andi ist der Chef, hörst?« Ich schaue zu Janosz, der mir zuzwinkert. »Brauchst der Connie gar nicht so blöd zuzwinkern, ich seh das!«, setzt Sinan nach.
»Lass die Connie da raus«, sagt Janosz.
»Geh, schleich dich doch«, erwidert Sinan, aber leiser. Er schaut zu mir, wird rot.
»Guten Morgen«, sage ich.
»Ist’s schon elf?«, fragt Sinan, ich nicke.
»Zehn nach«, sagt Janosz. Sinan räuspert sich, wischt sich die Hände am Vorbinder ab, nimmt zwei Pfannen von der Ablage, stellt sie auf den Herd.
»Wie schaut’n die Fritteuse aus?«, fragt er ganz normal in meine Richtung.
»Ich nehm an, die Lin hat sie gestern sauber gemacht«, sage ich.
»Und wo ist die jetzt?«
»Die kommt erst morgen wieder.«
»Wie immer«, wirft Janosz ein.
»Deine dummen Kommentare kannst dir gleich sparen«, sagt Sinan. Die Tür zwischen Küche und Restaurant geht auf, Andi kommt herein, immerhin bin ich nicht die Letzte. Er schaut in die Runde.
»Die ganze Bagage«, sagt er.
»Chef«, sagt Sinan.
»Grüß dich«, meint Janosz.
»Burschen«, sagt Andi, schaut dann zu mir, »Connie.« Ich antworte nicht.
»Und?«, fragt Janosz mich später. Wir stehen am Liefereingang, der auch die Hintertür des letzten Küchenteils ist. Ein Innenhof, in dem nie Kinder spielen. Soll mir recht sein, so kann man in Ruhe herumstehen, rauchen, ohne viel nachzudenken.
»Was, und?«
»Was gibt es Neues?«
»Janosz, wir haben uns gestern gesehen. Was soll’s geben?«
»Hast du einen Neuen?« Er zieht an seinem Tschick.
»Janosz, lass es endlich einmal gut sein.«
»Du weißt doch, Connie, wir …«
»Hör auf jetzt, Janosz.«
»Ich sage es ja nur.« Er atmet Rauch aus.
»Muss ich jetzt aufs Klo gehen zum Rauchen, damit ich meine Ruhe hab?«, frage ich.
»Bleib da, komm, bleib da.« Er legt seinen Arm um mich. Ich lasse den Kopf in den Nacken fallen, sein Arm wie einer von diesen Nackenpolstern im Flugzeug. »Du und ich, Connie.« Er hustet kurz. Ich hebe den Kopf, schaue auf den Tschick in meiner Hand. Schon zu viel Zeit vergangen.
»Komm, wir müssen rein«, sage ich.
»Sonst was?«
»Bleib halt da, wenn du meinst.«
»Nein, warte, ich komm schon.« Gleichzeitig werfen wir die Stummel auf den Boden, gehen zurück in die Küche. Die Kundschaft bestellt viel Frittiertes, vor allem Pommes, sicher träume ich in der Nacht wieder davon. Sie gehen nie weg, diese Küchenträume, auch nicht nach sieben Jahren.
Wir sitzen draußen im Gastgarten, der Heizpilz glüht in die Nacht. Alle haben sich umgezogen, Sinan im körperbetonten Pullover, Janosz mit Schal. Andi schaut wie ein Verlierer aus, wie einer, der nichts zu melden hat. Die Hose zu weit, das Hemd zu eng, der Bauch dominiert alles. Wenn ihn wer heimfahren sehen würde in der U-Bahn, hätte er vielleicht Mitleid. Man wüsste ja nicht, dass er Chefkoch ist, dass er vom Land ist, ein Arschloch. Die Tür geht auf, Berta kommt heraus.
»Und?«, fragt sie.
»Passt alles«, sagt Andi.
»Und für morgen?«
»Alles b’stellt, hat der Sinan erledigt.«
»Gut ist’s«, meint Berta, schaut in die Runde, dreht sich um, geht wieder hinein. Ich trinke einen Schluck Bier, merke Janosz’ Blick auf mir, strecke ihm die Zunge raus.
»Hörst, Connie«, sagt Andi, der es gesehen haben muss.
»Was denn?«
»Reiß dich z’samm, du bist ja nimmer vierzehn.«
»Mh.« Ich trinke noch einen Schluck, schaue in die graue Runde. »Ich geh heim, Burschen.«
»Bis morgen«, sagt Sinan.
»Morgen ist Donnerstag.«
»Dann halt bis übermorgen«, sagt Sinan.
»Wann kommt die Neue?«, frage ich im Aufstehen, schaue Andi dabei an. Sogar sein Bier trinkt er unelegant.
»Nächste Woche irgendwann«, antwortet er.
»Gut«, sage ich, »weil die Lin und ich zu zweit schaffen das nicht, nicht ohne die Hatice.«
»Ja ja, das könnts gut, jammern bis zum Umfallen, ihr …«
»Soll ich dich heimbringen?«, fragt Janosz, weil er wahrscheinlich ahnt, wie der Satz enden würde.
»Na, na, bleib ruhig da«, erwidere ich, »bis übermorgen.« Er lächelt, nickt.
»Schlaf gut«, sagt er. Ich lasse das Glas stehen, morgen bin ich sowieso nicht da. Soll es wer anderer wegräumen, am besten irgendeine von den Kellnerinnen.
Die anderthalb Straßen bis nach Hause sind in solchen Nächten der weiteste Weg in Wien. Links, rechts, links, durch den Innenhof, zu Stiege zwei. Erster Stock, zweiter, im dritten hört irgendwer laut Musik, ich schaue auf die Uhr, halb zwei, ich gehe weiter, vierter Stock. Die letzten Schritte bis zur Wohnungstür, dahinter höre ich Minze miauen. Ich stecke den Schlüssel ins Schloss, dann im Augenwinkel eine Bewegung, ich schaue genauer hin. Vor Tür siebenunddreißig sitzt wieder oder immer noch das Nachbarskind, es schläft mit dem Kopf an die Tür gelehnt. Dunkle Augenbrauen, dunkle Wimpern, die Kapuze ist verrutscht. Sieben, acht Jahre alt, oder vielleicht ein bisschen älter, wer weiß. Minze kratzt von innen an der Tür. Ein letzter Blick zu Tür siebenunddreißig, dann sperre ich auf, lasse das Kind schlafen.
Zwei
Minze weckt mich viel zu früh, ich schiebe sie vom Bett. Sie springt zu meinen Füßen, spielt mit meinen Zehen, ich ziehe sie ein. Minze schafft es, unter die Decke zu kriechen, bis zu meiner Achsel. Schnurren unter der Decke.
»Komm«, sage ich mehr zu mir als zu ihr, »stehen wir halt auf.« Sie bewegt sich nicht, ich auch nicht wirklich, greife nur zum Handy. Drei neue Nachrichten. Janosz: Arbeit ohne dich ist wie Kaffee ohne Milch. Mama: Constanze, lebst du? Dann noch einmal Mama: Ruf dich nachher an, heb ab. Draußen Sirenen, immerhin kein Hubschrauber.
Im Kühlschrank ist nicht einmal Milch. Ich ziehe den Mantel über die Jogginghose, vielleicht kaufe ich gleich auch Semmeln oder Eier. Wie lange ist es her, dass ich ein Ei gekocht habe, habe ich überhaupt je ein Ei für mich allein gekocht. In der Küche im Rösch ist alles exzessiv, hundert Eier, zehn Kilo Mehl, zwanzig Gurken. Minze streckt sich auf dem Boden aus, ich steige über sie, sie peitscht mit dem Schwanz. Die Tür fällt ins Schloss, ich schaue nach rechts, kein Kind vor Tür siebenunddreißig. Ich gehe los. Frau Zukić steht rauchend vor der Stiegentür.
»Connie, wie ist’s?«
»Geht schon, ich geh zum Hofer, brauchen Sie was?«
»Was ich brauch, gibt’s nicht beim Hofer.« Sie grinst, wie alt wird sie wohl mittlerweile sein, Anfang sechzig vielleicht. Der Lippenstift macht sie älter, warum trägt sie überhaupt Lippenstift, es ist Donnerstag, sie ist arbeitslos.
»Tschick?«, fragt sie, hält mir die Packung hin. Sie hat immer serbische oder russische Zigaretten, ich habe sie nie gefragt, woher die kommen, wer ihr die bringt. Vor ein, zwei Jahren hat sie Stangen an die ganze Nachbarschaft verkauft. Das ams macht mir einen Aufstand, wenn ich da ein Geschäft mach, hat sie gesagt.
»Gern.« Ich greife zu.
»Feuer hast selber, oder?« Ich nicke.
»Tür siebenunddreißig«, sage ich nach dem ersten Zug, »wissen Sie da was?«
»So neugierig, mh. Wieder so Islamisten, wie’s ausschaut.«
»Muslime«, sage ich, warum tue ich mir das überhaupt an, selber schuld.
»Connie, sei nicht blöd, glaub denen nix, die sind alle …«
»Wann sind die denn gekommen?«, unterbreche ich sie.
»Die Laslo hat gesagt, vorletzte Woche. Die hat das Auto gesehen, da vorn.« Sie deutet mit dem Kinn Richtung Leystraße. »Lauter Araber haben geholfen, hat sie gesagt.«
»Mh.« Ich will fragen, wie Frau Laslo von Weitem Araber erkennen konnte, aber lasse es bleiben.
»Die haben sicher wieder wen gekannt, Connie, bei Wiener Wohnen, weißt. Das kann ja nicht sein, die Nichte von der Laslo steht auf der Liste, seit sie in der Lehre ist, und nix passiert, gar nix. Das ist schon auffällig, Connie, ich weiß eh, du hörst das nicht gern, aber auffällig ist es schon, eine Islamistenfamilie nach der anderen und man muss sich schon fragen, also fragen wird man sich ja noch dürfen, wie geht das, mh. Und vielleicht sollt sich der Bürgermeister das einmal anschauen, wie das sein kann, dass sich da keiner wundert, wenn wieder so eine Frau Mohammed dasitzt, bei Wiener Wohnen, und wer dann die Wohnung kriegt. Die Kopftuchmafia, ich sag’s dir, Connie, es ist alles wahr.«
»Mh.« Letzter Zug, Rauch in der Lunge, serbischer Rauch.
»Bringst mir bitte einen Wein mit, einen roten«, sagt Frau Zukić, kramt in ihrer Handtasche.
»Geht schon«, antworte ich, das alte Spiel.
»Ich warte da.«
»Bis gleich.«
Ich kaufe Semmeln, Milch, keine Eier. Stattdessen Wein für Frau Zukić, dazu ein neues Feuerzeug. Frau Zukić steht nicht mehr vor der Stiegentür, als ich zurückkomme. Ich bin mir nicht sicher, ob es trister ausschaut, wenn sie davorsteht oder wenn da gar niemand steht. Den Wein stelle ich ihr vor ihre Wohnungstür, Tür vierundzwanzig. Vor Tür fünfunddreißig eine dunkle Flüssigkeit auf dem Boden, ich weiche aus.
»Hey«, sagt eine Kinderstimme. Ich schaue nach vorne, das Nachbarskind steht vor Tür siebenunddreißig, der Scheitel leicht über der Höhe der Klinke.
»Hey.«
»Wohnst du da?« Es deutet auf Tür sechsunddreißig.
»Ja.«
»Schon immer?«
»Seit fünf Jahren oder so. Und ihr?«
»Wer?«
»Du und deine Eltern.«
»Weiß ich nicht.«
»Warum bist du da heraußen?«
»Nur so.« Es sieht verloren aus, wie es dasteht, ausgesperrt.
»Magst du mit zu mir reinkommen?«, frage ich nach kurzem Zögern. Das Nachbarskind legt den Kopf ein bisschen schief.
»Okay.« Es kommt auf mich zu, langsame, schlurfende Schritte.
»Wie heißt du?«, frage ich, sperre auf.
»Kannst du eh nicht aussprechen.«
»Probier’s ruhig.«
»Wie heißt du denn?«
»Connie.«
»Bist du Österreicher?«
»Ja.« Ich ziehe meine Schuhe aus, das Kind hat keine an, nur Socken. »Du auch?«, frage ich.
»Nein.«
»Sondern?«
»Ist egal.« Es schaut sich um.
»Bad, Klo, Schlafzimmer, Küche«, sage ich, deute dabei auf die verschiedenen Türen.
»Meine Wohnung ist größer.«
»Drei Leute brauchen halt auch mehr Platz. Hast du schon was gefrühstückt?«
»Nein.« Gut, dass ich gleich vier Semmeln gekauft habe statt zwei.
Ich sitze am Küchentisch, gegenüber das Nachbarskind, das eine Semmel ohne Butter, überhaupt ohne alles isst. Minze schaut mich vom Türrahmen aus skeptisch an.
»Magst du Milch?«, frage ich. »Kakao hab ich keinen.«
»Hast du auch Kaffee?«
»Du trinkst Kaffee?«
»Schon lang.«
»Okay.« Ich stehe auf, hole das Glasgestell aus dem Küchenkästchen, French Press hat Mama es genannt, als sie es zu meinem letzten Geburtstag mitgebracht hat. Wer weiß, wo sie es gefunden oder mitgenommen hat. Ich habe es bei ihrem Besuch vor Monaten verwendet, seither nie wieder.
»Damit machst du Kaffee?« Die Kinderstimme ist ruhig für das Alter, tief.
»Was anderes hab ich nicht.« Ich stehe neben dem Wasserkocher, schaue dem Nachbarskind dabei zu, wie es die zweite Semmel in Stücke reißt.
»Wann kriegt deine Mama ihr Baby?«
»Bald.«
»Haben deine Eltern deswegen die Wohnung bekommen?«
»Wieso?«
»Wegen Wiener Wohnen. Die geben nicht so einfach Wohnungen her.«
»Die sind genauso scheiße wie die anderen.«
»Scheiße wie wer?« Das Kind antwortet nicht. Der Wasserkocher klickt, ich leere Wasser auf das Kaffeepulver im Glasgestell. Janosz würde lachen, wenn er mich sehen könnte.
»Hast du heut gar keine Schule?«, frage ich.
»Doch.«
»Und?«
»Ich geh halt nicht hin.«
»Wieso?«
»Ich hab nicht wechseln wollen.«
»Wo warst du denn davor?«
»Im Zehnten.« Einmal quer durch die Stadt übersiedelt.
»Oh.«
»Ist mir egal, ich brauch die alle nicht.«
»Wen?«
»Die kennst du nicht.« Ich drücke den Filter nach unten, das Nachbarskind verliert kurz den abgeklärten Blick.
»Magst du?«, frage ich, höre auf zu drücken. Das Kind nickt. Ich schiebe das Gestell vorsichtig hinüber, das Kind drückt den Filter konzentriert hinunter.
»Fertig«, sagt es, als der Filter ganz unten ist.
»Danke.«
»Und jetzt?«
»Jetzt trinken wir ihn.« Ich schenke uns ein.
»Schwarz«, sagt das Nachbarskind.
»Okay.«
Ich gieße, bis das Häferl voll ist. Das Kind umfasst es mit den kleinen Händen.
»Ist dir gar nicht kalt?«, frage ich.
»Wieso?«
»Du hast keine Schuhe angehabt.«
»Ja, und?«
»Wir haben Februar.« Das Nachbarskind schaut aus dem Küchenfenster, ich folge seinem Blick.
»Magst du Februar?«, fragt es, ohne mich anzuschauen.
»Na. Die Minze auch nicht. Also, die Katze.« Das Kind löst den Blick vom Fenster, schaut zu Minze, die immer noch im Türrahmen sitzt.
»Hat sie Angst?«
»Sie ist nur skeptisch. Sie kennt ja nur mich.«
»Hast du nie Besuch?«
»Manchmal schon.«
»Hast du die Katze, damit du nicht einsam bist?«
»Ja, vielleicht.«
»Ich will auch eine.«
»Damit du nicht einsam bist?«
»Nein, einfach so.« Das Kind trinkt Kaffee, verzieht keine Miene. Ich tue es ihm nach, der Kaffee schmeckt grauslich, wie lange steht das Pulver wohl schon da herum.
»Ich glaub, der ist schlecht«, sage ich.
»Kaffee kann nicht schlecht werden.«
»Woher weißt du das?«
»Das sagt meine Mama.«
»Vielleicht täuscht sie sich.«
»Nein.«
»Okay.« Minze kommt zu mir, streicht um meine Beine. Ich hebe sie auf den Tisch, schaue zum Nachbarskind, es scheint ihm egal zu sein. Minze reckt den gescheckten Kopf, schnuppert in die Luft, fixiert das Kind, bewegt sich nicht mehr. Das Kind bewegt sich auch nicht, schaut nur zurück. Irgendwann löst es die Hand vom Kaffeehäferl, streckt sie langsam Minze entgegen. Die Hand zittert ein bisschen, oder vielleicht bilde ich mir das nur ein. Minze streckt den Hals noch weiter, schnuppert, der Bauch hebt und senkt sich.
»Sie ist ganz klein«, sagt das Nachbarskind.
»Ja, aber sie ist schon alt. Sie sieht nur jung aus, weil sie so klein ist.« Minze schaut vom Kind zu mir, drei lange Schritte, springt auf den Boden, stolziert zurück zum Türrahmen.
»Ich geh jetzt«, sagt das Nachbarskind.
»Wohin?«
»In die Schule oder so.«
»Okay.« Es steht auf, ich auch, aber das Kind ist schneller mit allem, schneller im Aufstehen, schneller an der Tür, wo es sich noch einmal umdreht.
»Viel Spaß«, sage ich, will ihm etwas mitgeben, Semmeln oder Kekse oder Schuhe, aber ich habe nichts davon, nur Butter und Bier im Kühlschrank.
»Bei was?«
»Bei egal was.« Das Nachbarskind nickt, zieht die Tür zu. Minze miaut leise.
»Ich weiß«, sage ich, bücke mich zu ihr hinunter, kraule ihren Kopf. Das Handy vibriert im Schlafzimmer, sicher Mama. Ich warte, bis das Vibrieren endlich aufhört, erst dann gehe ich hinüber.
Drei
Freitage und Wochenenden sind am schlimmsten. Statt ins Rösch könnte ich einfach hinübergehen zu Frau Atamnaya, einmal hinter Stiege sechs hinaus auf die Pasettistraße, einbiegen in die Durchlaufstraße, hinauf in den fünften Stock, mich im Wartezimmer ans Fenster stellen, direkt auf die Schnellbahngleise schauen, auf das Spital dahinter, Perspektivenwechsel. Ich könnte ihr sagen, dass mir der Kopf wehtut oder dass mir schlecht ist. Sie würde fragen, ob ich immer noch im Rösch arbeite, warum ich nicht bei ihr Sprechstundenhilfe sein will, warum ich mir die Arbeit in einer Küche antue. Ich kann kein Türkisch und kein Arabisch, würde ich sagen, worauf sie antworten würde, dass das nichts ausmacht, dass man fast alles lernen kann, Arabisch vielleicht nicht, aber Türkisch schon, dass sie eine gute Türkischlehrerin kennt, dass eine Küche auf Dauer keine gescheite Arbeit ist, was meine Mutter dazu sagt, überhaupt, wie es meiner Mutter geht, dass sie schon lange nicht mehr da war, dass sie kommen kann, egal in welchem Zustand, jederzeit. Ich hätte keine Antwort darauf, auf keine einzige dieser Fragen.
Als ich die Wohnung verlasse, ist Ruhe am Gang. Kein Kind vor Tür siebenunddreißig, dafür immer noch die dunkle Flüssigkeit vor Tür fünfunddreißig, mittlerweile angetrocknet. Draußen vor der Stiegentür steht Frau Zukić, kein Lippenstift auf den Lippen, aber eine Zigarettenschachtel in der Hand, ungeöffnet.
»Connie.« Sie klingt müde.
»Ist alles in Ordnung?« Sie schüttelt den Kopf, atmet aus, als hätte sie Rauch in der Lunge.
»Alles hat ein Ende, Connie, vor allem das Leben.«
»Was ist denn passiert?«
»Meinen Schwager hat’s gestern erwischt.«
»Den in Serbien?«
»Ja, in Kragujevac.«
»Was war denn mit ihm?«
»Das weiß keiner. Serbische Ärzte sind anders, weißt.«
»Mein Beileid.«
»Danke, danke, das ist lieb.«
»Kann ich was helfen?«
»Du kannst kein Serbisch.«
»Ja, aber für Sie, meine ich?«
»Du bist ein guter Mensch, Connie, aber helfen kann mir nicht einmal ein guter Mensch. Der Tod ist, wie er ist.«
»Mh.«
»Geh ruhig arbeiten. Grüße an die Berta.«
»Richt ich aus.«
»Und verbrenn dich nicht.«
»Ich versuch’s.« Früher war Frau Zukić Putzfrau in einem Lokal in Meidling. Sie kennt die Brandnarben, die Wülste auf den Unterarmen. Sie weiß, dass Eiweiß auf Verbrennungen Blödsinn ist, aber Zwiebelsaft hilft, bei kleinen Wunden zumindest. Sie weiß, dass manche Kellnerinnen Angst vor den Köchen haben. Sie weiß, was ich von Kellnerinnen halte.
Ich gehe vorne ins Rösch hinein, Berta steht hinter dem Tresen, hebt den Blick.
»Connie.«
»Berta.«
»Was tut sich?«
»Ich soll dich von der Frau Zukić grüßen.«
»Grüße zurück.«
»Ist schon wer da?«
»Der Janosz.«
»Berta, wann kann die Neue …«
»Connie, ich schau eh, dass sie bald anfangt. Aber zwingen kann ich’s nicht, das musst schon auch verstehn. Sie fangt an, wann’s halt kann.«
»Hat sie schon einmal in einer Küche gearbeitet?«
»Na, du musst’s noch einlernen.«
»Aha.«
»Stell dich nicht an, Connie, das geht schnell. Ich zahl dir auch was drauf.«
»Mh.«
»Und du musst aufhören, dass du mir die Dirndln alle ankeifst.«
»Wen?«
»Connie, spiel dich nicht. Mehrere haben sich beschwert. Mehrere, Connie.«
»Wer denn? Die Nadja?«
»Ja, auch die Nadja.«
»Die Nadja stellt mir das dreckige Geschirr so hin, dass es fast runterknallt, Berta. Was soll ich machen, nix sagen?«
»Connie, sei einfach ein bisserl lieber. Mehr will ich eh nicht.«
»Mh.«
»Gut ist’s, bis später.«
»Bis später.«
Kellnerinnen glauben fast alle, sie wären etwas Besseres. Wenn sie Geschirr in die Geschirrablage stellen, ist es ihnen egal, ob es fallen wird oder nicht. Sie glauben, dass sie nichts mit der Küche zu tun haben, dass Gaststube und Küche zwei Welten sind, die nur durch Essensausgabe und Geschirrablage miteinander verbunden sind. Die meisten behalten mittlerweile ihr Trinkgeld, damit sie es nicht mit uns teilen müssen. Manche grüßen nicht einmal, wenn man sie am Klo trifft. Dabei sind sie nichts ohne uns.
Janosz zieht den Klopfer über das Fleisch, als ich hereinkomme. Er steht mit dem Rücken zu mir.
»Schon wieder?«, frage ich.
»Connie!« Er dreht sich um, den Edelstahlklopfer in der Hand, Kopfhörer im Ohr. Er zieht am Kabel, beide Hörer fallen ihm aus den Ohren, direkt auf den Küchenboden.
»Schon wieder Schnitzel?«, frage ich noch einmal.
»Ja, ich weiß es auch nicht.«
»Wird das Fleisch alt?«
»Keine Ahnung. Mir hat die Berta nur gesagt, dass das Sonderangebot Schnitzel ist. Hilfst du mir?«
»Klopfen oder panieren?«
»Connie.«
»Ja, ja, ich panier schon.«
»Ich muss wenigstens ab und zu wie ein Koch dastehen.«
»Ist schon okay.«
»Bist du mir böse?«
»Weil ich nicht klopfen darf? Hör mir auf.« Ich gehe nach hinten zum dritten Kühlschrank ganz links, halte die Luft an, an manche Gerüche gewöhnt man sich nie. Eier neben Milch neben Schmelzkäse neben Erdäpfelsalat in Kübeln. Ich hole ein Packerl Milch heraus, mache die Tür wieder zu, atme aus. »Die Eier sind bald aus, Janosz«, sage ich, während ich wieder nach vorne gehe.
»Sag das nachher am besten dem Andi.«
»Okay.«
»Oder soll ich es sagen?«
»Du brauchst mich nicht beschützen, danke.« Statt einer Antwort nur Klopfen auf Fleisch. Ich gehe zur Salatstation, hole eine große Schüssel, kippe etwas Salz hinein, dann einen kleinen Schuss Milch, rühre um. Ich tunke den kleinen Finger ein, schlecke ihn ab. Salzmilch. Milchsalz. Bertas Geheimrezept, einen Schuss Milch zu den Eiern, das Salz gleich auch hinein, weil es dann schneller geht, als jedes Stück Fleisch einzeln einzureiben.
»Magst du nicht zu mir kommen?«, ruft Janosz. Ich trage die Salzmilchschüssel vorsichtig um die zwei Ecken, stelle mich neben ihn.
»Platz musst mir aber schon machen.«
»Warte kurz.« Er hört auf zu klopfen, schiebt erst die Edelstahlwanne zur Seite, in der das dicke ungeklopfte Fleisch liegt, dann die Wanne, in der die dünnen geklopften Stücke sind. Ich stelle die Schüssel ab. Er steckt den kleinen Finger in die Salzmilch, schleckt ihn ab. Ich muss grinsen.
»Wenn das der Andi wüsste«, sage ich.
»Weiß er aber nicht.« Janosz grinst auch. Ich hole die Eier aus dem Kühlschrank, zwei Paletten aufeinander. Wenn ich jetzt ausrutsche und falle, sind sechzig Eier auf dem Boden, dann müssen wir die Panade mit mehr Milch strecken, weil wir nicht genug Eier für alles haben, weil Eierspeise und Eiergröstl Priorität haben. Die Leute merken das, gerade die, die wichtig fürs Geschäft sind, die schicken das Schnitzel zwar nicht zurück, aber sagen Berta beim Zahlen, dass die Panade dünn war. Dann kommt Berta in die Küche, um zu fragen, was wir uns einbilden, ob wir die Kundschaft für dumm verkaufen wollen. Dann muss ich erklären, dass ich schuld bin, ganz am Ende werden mir die sechzig Eier vom Lohn abgezogen.
»Wie war es gestern?«, fragt Janosz.
»Normal eigentlich.«
»Hast du irgendwas gemacht?«
»Ich hab neue Nachbarn. Die haben ein Kind, das war bei mir. Ein komisches Kind.«
»Wieso komisch?«
»Keine Ahnung, das trinkt Kaffee.«
»Wo kommen die her, die Nachbarn?«
»Weiß ich nicht. Die Mama hat ein Kopftuch, das ist alles, was ich weiß.«
»War ja klar.«
»Das heißt gar nix, Janosz.«
»Das heißt alles, Connie, alles.«
»Ist auch nicht so wichtig. Ein komisches Kind auf jeden Fall.« Ich schlage Ei nach Ei auf, während Janosz weiterklopft.
»Alle Kinder sind komisch«, sagt er.
»Und woher willst du das wissen? Hast du welche daheim?«
»Nein, aber …«
»Sorry, Janosz, so hab ich’s nicht gemeint. Sorry.« Er hält inne, schaut mich an.
»Die Sveti, die macht jetzt eine Kur, da trinkt sie nur noch Saft. Das soll anscheinend was bringen.«
»Glaubst dran?«
»Keine Ahnung. Aber ich muss es ja auch nicht machen.«
»Stimmt.« Eine Palette Eier fertig. Ich schaue zu Janosz.
»Das wird schon werden. Ihr probiert einfach immer weiter«, sage ich.
»Mh.« Ich schlage das nächste Ei auf den Schüsselrand, zu fest, die untere Hälfte bricht auseinander, Ei überall, Schalenteile in der Salzmilch. Ich hole noch eine Schüssel und ein Sieb, gieße um, Janosz hört wieder auf zu klopfen.
»Ich brauch keine Hilfe, geht schon«, sage ich.
»Wie du meinst.« Er klopft weiter. Ich nehme die nächsten Eier, schlage sie vorsichtiger auf. Als ich fertig bin, greift Janosz ungefragt nach links, holt den großen Schneebesen vom Haken. Ich bedanke mich, schlage die Salzeimilch, bis der Arm müde wird, wechsle die Hand. Es muss eine verwobene Flüssigkeit sein, sonst wird das Geheimrezept eine traurige Geschichte.
»Keiner macht das wie du«, sagt Janosz. Ich mache Pause.
»Wie meinst das?«
»So verbissen macht das sonst niemand.«
»Ist das was Gutes?«
»Weiß ich nicht.« Er holt noch drei Edelstahlwannen, stellt sie zwischen uns. Eine ist leer, die zweite voll mit Mehl, die dritte mit Semmelbröseln angefüllt.
»Fertig?«, fragt er.
»Fertig.« Ich schiebe die Schüssel mit der Flüssigkeit zwischen uns. Janosz schaut mich an.
»Manchmal ist es schon nett da«, sagt er.
»Wo? Im Rösch? Oder in Wien?«
»Im Rösch. Wien oder nicht, wir könnten überall sein.«
»Mh.«
»Alles ist austauschbar, Connie. Wien, das Rösch, die Berta, wir alle.«
»Ist alles okay bei dir?«
»Nur müde«, sagt er, wischt sich mit dem Handrücken über die Stirn, räuspert sich. »Ich weiß, du wärst immer am liebsten daheim, aber ich wäre manchmal gerne den ganzen Tag da, da in der Küche.« Ich nehme das erste Fleischstück, es ist kalt zwischen meinen Fingern, wende es im Mehl, ziehe es durch die Eisalzmilch, lasse es dann vorsichtig in die Bröselwanne fallen. Janosz streut Brösel darauf, dreht es um, zieht es nach oben wie einen Fisch aus dem Wasser, klopft es leicht ab. Brösel rieseln zurück in die Wanne.
»Wieso magst nicht heim?«, frage ich, lasse das nächste Stück in die Bröselwanne fallen. Wer hat sich das ausgedacht, Fleisch in Ei, Mehl, Brösel einpacken, um es dann in viel Fett herauszubacken. Ein Wahnsinniger.
»Ist nicht so wichtig.«
»Mir kannst du’s schon erzählen.«
»Ich weiß schon, Connie, aber das macht mich nur grantig.«
»Okay.«
»Erzähl mir lieber noch was von deinem freien Tag.«
»Sonst ist nix passiert, nix außer dem Kind, mein ich.«
»Bist du gar nicht rausgegangen?«
»Nur einkaufen.«
»Mh.« Ich merke seinen Seitenblick auf mir.
»Was ist, Janosz?«
»Nix, nur… Manchmal vergesse ich, dass aus dir was hätte werden können.«
»Was denn?«
»Na ja, du hast als Einzige von uns die Matura, und du …«
»Danke, das weiß ich eh selber.«
»Sei mir nicht böse, aber …« Neben uns geht die Tür auf, Sinan kommt herein.
»Hey«, sagen Janosz und ich gleichzeitig.
»G’schissener Tag«, erwidert Sinan.
»Wieso?«, frage ich.
»Die Berta hat gesagt, ich kann den Urlaub vergessen.«
»Welchen?«
»Eh den in zwei Wochen. Sie hat gesagt, der Ilya hat keine Zeit, der kann doch nicht einspringen.«
»Aber du hast es ihr doch schon ewig her gesagt, oder?«, frage ich.
»Sicher.«
»Dann …«
»Connie, lass es gut sein«, sagt Janosz. »Dich mag die Berta, du bist wie ein Kind für sie. Aber wir nicht, wir sind einfach nur irgendwer.« Ich schaue von ihm zu Sinan.
»Da hat er ausnahmsweise einmal recht, der Janosz.«
»Mh.« Ich schlucke meinen Widerspruch hinunter.
»Schon wieder Schnitzel?«, sagt Sinan mit Blick auf die Wannen.
»Ja, Sonderangebot.«
»Und bei dir?«, fragt Sinan mich. »Wie war der freie Tag?«
»Ich hab ein neues Nachbarskind, das war bei mir. Sonst war nix. Ah, und die Berta hat gesagt, die Neue hat noch nie in einer Küche gearbeitet.«
»Oje«, sagt Janosz.
»Hoffentlich ist sie eine Scharfe«, grinst Sinan.
»Hoffentlich stellt sie sich nicht deppert an«, sage ich.
»Musst du sie einlernen?«, fragt Janosz. Ich nicke.
»Wenn’s eine Scharfe ist, nehm ich’s dir ab«, sagt Sinan.
»Nimm mir lieber das da ab«, erwidere ich, deute auf die Wannen.
»Was, damit du Zwiebel schneiden kannst? Sicher nicht.«
»Wieso Zwiebel? Hat die Lin nicht …?«
»Die Lin ist nicht dazu gekommen«, sagt Sinan, »gestern ist es zugegangen wie im Prater, ich sag’s dir.«
»Mh. Also Zwiebeln auch noch?«
»Ja«, antworten beide.
Um zwölf druckt das kleine Druckgerät, das wir Minidrucker nennen, zum ersten Mal. Drei Bestellungen, drei Schnitzel, eines davon ohne Salat, Herr Liebmann und seine Pensionisten-Freunde, pünktlich wie immer.
»Drei Schnitzel, nur zwei mit Salat«, ruft Sinan von vorne.
»Pommes kommen«, ruft Janosz von links hinten bei den Kühlschränken.
»Connie, wie rennt’s?«, ruft Sinan. Ich gehe zum Waschbecken, spucke das Wasser aus, das Einzige, was beim Zwiebelschneiden hilft.
»Bin dabei, zwei Salate«, rufe ich zurück. Es geht schnell, Lin und ich sind ein eingespieltes Team. Alles ist geschnitten und sauber im Kühlschrank verstaut, nur der grüne Salat ist wie immer ein Witz, ein Viertel schmeißt man beim Waschen weg, ein Viertel am Abend. So viel Arbeit für so viel Mist. Der Minidrucker fängt wieder zu drucken an, wie immer erst bei mir an der Salatstation, dann vorne beim Herd.
»Vier Schnitzel, einmal Fisch, ein Bergsteigersalat, einmal Pommes groß«, ruft Sinan.
»Connie, machst du die Fritteuse? Ich muss den Fisch machen«, ruft Janosz.
»Hast wieder drauf vergessen?«, ruft Sinan.
»Dreihundert Schnitzel hab ich gemacht, du Vollkoffer«, schreit Janosz zurück.
»Janosz, was machst denn eigentlich da hinten?«, rufe ich.
»Du auch noch?«
»Ich will nur wissen, warum ich jetzt schon frittieren muss, obwohl’s grad erst zwölf ist.«