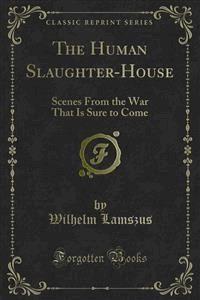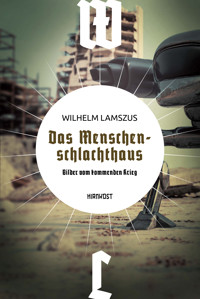
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hirnkost
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Wiederentdeckte Schätze der deutschsprachigen Science Fiction
- Sprache: Deutsch
Sie haben uns in malerischer Reihe hingelegt, und rührst du nur den Kopf, so stößt du schon an Menschenfleisch, und wendest du den gelben Augapfel, so siehst du nichts als Leichen in der Dämmerung. Die eine neben der anderen, so schlafen sie. Da schläft ein Bein, es ist am Kniegelenk gelöst. Das trug einst einen Briefträger treppauf, treppab; nun freut es sich, dass es verloren ging, und schmunzelt, weil es keiner finden kann. ''Das Menschenschlachthaus erreichte hohe Auflagen und wurde in mehrere Sprachen übersetzt. Dennoch erreichte es nicht die erhoffte friedensfördernde Wirkung; wohl nicht zuletzt, weil viele darin eher eine spannende fiktionale Dystopie als eine realitätsnahe Darstellung sahen. Gut einhundert Jahre später, also zu einem Zeitpunkt, da der Krieg in der Ukraine mit all seinen zerstörerischen Wirkungen uns tagtäglich vor Augen geführt wird, erscheint es mir umso wichtiger, auf die Anfänge des maschinell geführten Krieges, auf das menschenzerstörende Kraftfeld der Materialschlachten und auf die Verwüstung ganzer Landstriche zurückzublicken, und zwar in dem Bewusstsein, dass das Vergangene im Gegenwärtigen präsent sein muss, damit wir auf verantwortliche Weise die Zukunft gestalten können." (Wilhelm Krull in seinem Vorwort)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Originalausgabe
© 2024 Hirnkost KG, Lahnstraße 25, 12055 Berlin; [email protected];
http://www.hirnkost.de/ Alle Rechte vorbehalten, 1. Auflage Januar 2024
Die Erstauflage von Das Menschenschlachthaus – Bilder vom kommenden Krieg erschien 1912 im Alfred Janssen Verlag, Hamburg/Berlin; den Prolog veröffentlichte Wilhelm Lamszus erstmals vier Monate nach dem Erscheinen des Romans in der Dezember-Ausgabe der Friedens-Warte 1912, S. 454/455; Das Irrenhaus – Visionen vom Krieg erschien 1919 im Pfadweiser Verlag, Hamburg.
Vertrieb für den Buchhandel:
Runge Verlagsauslieferung; [email protected]
Privatkunden und Mailorder:
https://shop.hirnkost.de/
Herausgeber: Hans Frey
Lektorat: Klaus Farin
Korrektorat: Christian W. Winkelmann-Maggio
Layout: benSwerk: www.benswerk.com
E-Book: Hardy Kettlitz
ISBN:
PRINT: 978-3-98857-036-9
PDF: 978-3-98857-038-3
EPUB: 978-3-98857-037-6
Hirnkost versteht sich als engagierter Verlag für engagierte Literatur.
Mehr Infos: www.hirnkost.de/der-engagierte-verlag
Dieses Buch erschien als Band VI der Reihe »Wiederentdeckte Schätze der deutschsprachigen Science Fiction«. Alle Titel und weitere Informationen finden Sie hier:
https://shop.hirnkost.de/produkt/schaetze/
Wilhelm Lamszus • 1881–1965
wurde durch seine reformpädagogischen Streitschriften und vor allem seine Antikriegsliteratur überregional bekannt. Weltweites Aufsehen erlangte Lamszus 1912 mit seinem Roman Das Menschenschlachthaus – Bilder vom kommenden Krieg, mit dem ihm eine schockierende Vorausschau auf den industriellen Zukunftskrieg gelang. Das Buch löste einen Skandal aus und wurde verboten. Lamszus selbst, der als verbeamteter Lehrer arbeitete, wurde mit einem Forschungsauftrag zur Lage der deutschen Angehörigen der Fremdenlegion nach Nordafrika entsandt, offenbar um ihn aus dem Schuldienst zu entfernen. Sein Rechercheergebnis veröffentlichte er im Frühjahr 1914 in dem Buch Der verlorene Sohn. Der Fortsetzungsband zum Menschenschlachthaus mit dem Titel Das Irrenhaus lag noch vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges druckfertig vor, durfte dann aber erst 1919 mit einem Vorwort von Carl von Ossietzky erscheinen.
Lamszus’ Opus magnum, Das Menschenschlachthaus, erlebte zahlreiche Auflagen sowie Übersetzungen in neun Sprachen. Es folgten weitere Antikriegsschriften zur stets zeitgemäßen Ächtung von chemischen, biologischen und nuklearen Massenvernichtungswaffen sowie zahlreiche Arbeiten zur Aufsatzmethodik, Lehrerbildung, Gesundheits- und Friedenserziehung.
Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde er als einer der ersten Hamburger Lehrer entlassen. Bis 1945 lebte er von seiner verminderten Pension und journalistischen Gelegenheitsarbeiten, die er unter Pseudonym veröffentlichte.
1945 nahm er seine Lehrertätigkeit bis zu seiner Pensionierung im Herbst 1948 wieder auf. Einen Ruf als Gründungsrektor an die Pädagogische Hochschule Berlin lehnte er aus gesundheitlichen Gründen ab. Bis zuletzt arbeitete er für den NDR und veröffentlichte Beiträge zur Lehrerbildungsreform und Gesundheitserziehung, des Weiteren publizierte er vielfach in der Zeitschrift Das Andere Deutschland.
benSwerk
geboren 1970, lebt in Berlin. Studierte Werbegrafik und freie Kunst. Wenn sie nicht für Hirnkost layoutet, porträtiert sie das kleine Volk und andere Wesenheiten der Anderswelt, ersinnt Orakelkarten oder gestaltet andere Bücher – mit Vorliebe in den Bereichen WeirdFiction oder Phantastik. www.benswerk.com
Klaus Farin
geboren 1958 in Gelsenkirchen, lebt seit 1980 – Punk sei Dank – in Berlin-Neukölln. Nach Tätigkeiten als Konzertveranstalter und -Security, Buchhändler und Journalist nun freier Autor und Lektor, Aktivist und Vortragsreisender. Bis heute hat Farin 29 Bücher verfasst und weitere herausgegeben, zuletzt gemeinsam mit Rafik Schami: Flucht aus Syrien – neue Heimat Deutschland? und mit Eberhard Seidel: Wendejugend. Er ist Vorsitzender der Stiftung Respekt! und ehrenamtlich Geschäftsführer des Hirnkost Verlags. Weitere Infos: https://klausfarin.de/ueber-klaus-farin/biographie.
Hans Frey
geboren 1949, Germanist, Lehrer und Ex-NRW-Landtagsabgeordneter, ist in seinem »dritten Leben« Autor und Publizist. Seine Spezialität ist die Aufarbeitung der Science Fiction. Bisher veröffentlichte er ein umfangreiches Werk über Isaac Asimov, das Sachbuch Philosophie und Science Fiction und Monographien über Alfred Bester, J. G. Ballard und James Tiptree Jr. Seit 2016 arbeitet er an einer Literaturgeschichte der deutschsprachigen SF. Vier Bände sind bislang bei Memoranda erschienen. Für die ersten beiden Bände sowie den vierten erhielt er den Kurd Laßwitz Preis 2021 und 2024. Hans Frey verstarb im Januar 2024 im Alter von 74 Jahren.
Wilhelm Krull
geboren 1952, ist seit Januar 2020 Gründungsdirektor des New Institute in Hamburg. Zuvor war er von 1996 bis 2019 Generalsekretär der VolkswagenStiftung. Auf ein Studium der Germanistik, Philosophie, Pädagogik und Politikwissenschaften folgten Stationen als DAAD-Lektor an der Universität Oxford und in führenden Positionen beim Wissenschaftsrat und in der Max-Planck-Gesellschaft. Neben seinen beruflichen Tätigkeiten in der Wissenschaftspolitik und Forschungsförderung nahm und nimmt er zahlreiche Funktionen in nationalen, ausländischen und internationalen Aufsichtsund Beratungsgremien wahr.
Er erhielt vielfältige Ehrungen, u. a. wurde ihm im Mai 2016 die Ehrendoktorwürde der Ilia State University, Tiflis, verliehen. Im Oktober 2019 erhielt er ein Foreign Membership der Königlich Schwedischen Akademie der Ingenieurwissenschaften, im November 2019 ein Honorary Fellowship der St. Edmund Hall, University of Oxford, sowie im Juni 2022 die Leibniz-Medaille der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.
Seine jüngsten Buchveröffentlichungen sind Krieg – von allen Seiten (2013) und Die vermessene Universität (2017).
Andreas Pehnke
geboren 1957 in Greifswald, aufgewachsen in Wismar, 1977 bis 1984 Lehrer- und Forschungsstudium in Leipzig. 1984 Promotion und 1990 Habilitation mit Reformpädagogik-Themen. Er war als Erziehungswissenschaftler zunächst in Leipzig, Berlin und Halle/S. tätig, bevor er im März 1993 auf den Lehrstuhl (Gründungsprofessur) für Allgemeine Erziehungswissenschaft (Systematische/Historische/Vergleichende Pädagogik) an die Universität seiner Geburtsstadt berufen wurde.
Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen die Reformpädagogik-Rezeption in den internationalen Schulreformbestrebungen sowie Lehrermaßregelungen in den Diktaturen des 20. Jahrhunderts. Seine jüngsten Buchveröffentlichungen sind Vom Zeitzeugen des Völkermords an den Armeniern zum Reformpädagogen und Schriftsteller: Willy Steiger (1894–1976). Biografie und Werkauswahl (2019) und Bücher im Geiste der Weimarer Demokratie. Harry Schumann (1894–1942) und der Carl Reissner Verlag (2021).
Schließlich publiziert er bereits seit 1987 als Wilhelm-Lamszus-Biograf in fachhistorischen, literaturwissenschaftlichen sowie bildungsgeschichtlichen Foren des In- und Auslands.
Christian Winkelmann
geboren 1963, studierte Geschichte, Publizistik und Skandinavistik, bereiste zwischendurch und anschließend die halbe Welt, wirkte 20 Jahre als Privatlehrer und ist heute in Berlin im Verlagswesen tätig. Er schrieb u. a. Bücher über Erfindungen und Kultur der deutschsprachigen Länder sowie Brasilien.
Inhalt
Zum Geleit
Vorwort von Wilhelm Krull
Wilhelm Lamszus – ein Prolog
Das Menschenschlachthaus – Bilder vom kommenden Krieg
Das Irrenhaus – Visionen vom Krieg
Vorwort von Carl von Ossietzky
Wilhelm Lamszus – Texte
Vorworte und Rezensionen zum Menschenschlachthaus
Nachwort von Andreas Pehnke
Zum Geleit
Wir leben in einer Gegenwart des radikalen Umbruchs, der alle Bereiche der menschlichen Zivilisation durchdringt. Die Probleme scheinen uns über den Kopf zu wachsen. Wir brauchen kluge Ideen, tragfähige Lösungen, vielleicht sogar Utopien, die neue Perspektiven aufzeigen.
Vielleicht ist es gerade in dieser aufwühlenden Situation auch hilfreich, einmal innezuhalten und zurückzublicken. Denn vieles, was uns heute beschäftigt, ist nicht wirklich neu. Schon vor über einhundert Jahren machten sich Autoren und Autorinnen Gedanken über das Klima, über Armut, Wohnen, Ernährung und das Bildungssystem, ob und inwieweit Technik einen Motor für den Fortschritt oder eine existenzielle Gefahr darstellen kann (beispielsweise Atomkraft, Geoengineering, Gentechnik). Vor allem die Autoren und Autorinnen der einst »Zukunftsliteratur« genannten Science Fiction entwarfen wie in keinem anderen Genre gesellschaftliche Utopien und Dystopien, die noch heute so gegenwärtig wirken, als wären sie gerade erst entstanden. Sie sind trotz oder vielleicht gerade wegen ihres oberflächlich antiquiert wirkenden Charmes heute noch mit Gewinn und Genuss zu lesen. Vierzig Perlen aus der deutschsprachigen Science Fiction möchte Ihnen diese Edition im Laufe der nächsten Jahre präsentieren.
Jedes Buch der Edition enthält den Roman selbst sowie in einigen Fällen ergänzende Texte der jeweiligen Schriftsteller und Schriftstellerinnen. Umrahmt werden die Originaltexte von einem Vorwort namhafter Autoren und Autorinnen der Gegenwart und einem historisch-analytischen Nachwort von anerkannten Expertinnen und Experten, das vornehmlich die literaturhistorischen und zeitgeschichtlichen Hintergründe des Textes beleuchtet.
Parallel zur gedruckten Version erscheinen ePubs in allen Formaten und Vertriebsoptionen, die in der Regel zusätzliche ergänzende Materialien (etwa dazugehörige weitere Romane, Sachbücher und Essays der Autoren und Autorinnen, zeitgenössische Rezensionen und andere Leserstimmen sowie weitere Analysen) enthalten und so vor allem für die wissenschaftliche Beschäftigung eine wertvolle Bereicherung darstellen. Damit werden nicht nur die Originaltitel wieder einem größeren Lesepublikum zugänglich gemacht, sondern auch der Forschung in bislang einzigartiger Weise sowohl historisches Quellenmaterial als auch aktuelle Analysen aufbereitet zur Verfügung gestellt.
Besonderen Wert legen wir auf die Gestaltung. Auch sie soll zum Lesen einladen, denn die von uns herausgegebenen Werke haben es allemal verdient, neue Leser und Leserinnen zu finden. So werden die Werke nicht einfach als Faksimile reproduziert, sondern komplett neu Korrektur gelesen und gesetzt.
Wir, der Verleger Klaus Farin (*1958) und der Herausgeber Hans Frey (*1949), beide Sachbuchautoren, kennen uns schon seit Jugendjahren. Wir stammen beide aus dem Herzen des Ruhrgebiets, aus Gelsenkirchen, engagier(t)en uns für eine bessere, gerechtere Gesellschaft und sind seit unserer Jugend leidenschaftliche Science-Fiction-Leser. Als wir uns nach Jahren zufällig in Berlin wiedertrafen, wurden sofort Pläne geschmiedet. Angeregt durch die deutschsprachige SF-Literaturgeschichte von Hans Frey im Memoranda Verlag wurde die Idee geboren, eine langfristig angelegte Reihe mit wichtigen, aber fast vergessenen Originaltexten der deutschsprachigen Science Fiction zu veröffentlichen.
Aus dieser Idee ist Realität geworden. Die Reihe leistet einen wesentlichen Beitrag zur lebendigen Aufarbeitung und Bewahrung bedeutender Werke der deutschsprachigen SF. Zudem ist sie ein einzigartiges Dokument für die Vielfalt und Vielschichtigkeit des über die Jahre gewachsenen Genres.
Wahr bleibt indes auch: Ohne engagierte Leser und Leserinnen, die die Bücher kaufen und sich an ihnen erfreuen, kann das Projekt nicht gelingen. Empfehlen Sie es bitte weiter. Abonnieren Sie die Reihe. Wir unterbreiten Ihnen ein verlockendes Angebot. Greifen Sie zu!
Hans Frey, Klaus Farin
Vorwort
von Wilhelm Krull
Die Erde hat sich aufgetan … es blitzt und knallt,es donnert, und der Himmel reißt entzweiund fällt herab – die Erde fliegt in Stücken auf … dieMenschen und die Erde explodierenund fahren rund wie Feuerräder durch die Luft …und dann … ein Krach, ein wütendes Getöseschlägt uns auf die Brust,dass wir rücklings zu Boden fliegenund besinnungslos im Sand nach Atem ringen …Wilhelm Lamszus, Das Menschenschlachthaus (1912)
August 1914 – der Beginn des Krieges, der für mehr als vier Jahre das Leben von mehreren Hundert Millionen Menschen bestimmen sollte, wird allenthalben begeistert begrüßt, entfacht große Abenteuerlust und scheint vielen Freiwilligen die Gelegenheit zu bieten, durch entschlossenes Handeln zum Helden zu werden.
Nicht nur im Deutschen Kaiserreich, sondern auch in den Nachbarländern geht man von einem raschen Sieg aus. Während die deutschen Truppen auf schnellem Wege »nach Paris reiten« wollen, lesen wir auf französischen Militärwaggons umgekehrt von einer Reise »á Berlin«. Nicht nur der »Mann auf der Straße«, sondern auch die intellektuellen Eliten der Zeit – Professoren ebenso wie Schriftsteller und bildende Künstler – waren eifrig dabei, wenn es galt, mit nationalem Pathos den Kriegseintritt zu unterstützen. Ob Richard Dehmel, Gerhart Hauptmann, Hugo von Hofmannsthal oder Thomas Mann (und viele mehr) – sie alle stimmten mit großer Begeisterung in den Jubel über den gerade begonnenen Krieg ein.
»Wie hätte der Künstler, der Soldat im Künstler nicht Gott loben sollen für den Zusammenbruch einer Friedenswelt, die er so satt-, so überaus satthatte!«
Mit diesen Worten brachte Thomas Mann 1914 (in »Gedanken im Kriege«) den Überdruss am wilhelminischen Alltagsleben in ähnlicher Wiese wie viele seiner Kollegen (so etwa Georg Heym schon 1910) zum Ausdruck.
Eine ganze Reihe namhafter Autoren beteiligte sich eifrig an der Formulierung von Kriegszielen und Eroberungsplänen. Sie erhofften sich von dem erwarteten Sieg der Mittelmächte zugleich eine geistige und moralische Erneuerung des deutschen Volkes. Die emphatische Betonung der »Heiligkeit der deutschen Sache« (so Rudolf Borchardt in Der Krieg und die deutsche Selbsteinkehr) diente dazu, noch die absurdesten Kriegsforderungen zu rechtfertigen und das Verhalten der deutschen Seite zu einer unhintergehbaren Voraussetzung jeglicher Lagebeurteilung zu erklären.
Die mit solchen Argumentationsmustern verbundene Ausschaltung multiperspektivischer Argumentationslogiken wurde nicht nur gebilligt, sondern auch offen propagiert.
»Ich liebe Deutschland und will deshalb, dass es lebe – zum Teufel mit aller (objektiven) Rechtfertigung dieses Wollens aus der Kultur, der Ethik, der Geschichte oder Gott weiß was heraus. Sobald ich auf solche eintrete, bin ich gerade in der Gefahr jedes Beweisenden: widerlegt zu werden. Unwiderleglich ist nur das Unbeweisbare – unser Wille zu Deutschland, der sich über alle Deduktionen stellt.«
Diese Sätze aus einer Rede des Philosophen Georg Simmel zum Thema »Deutschlands innere Wandlung« geben den Sturz aus der Vernunft hinein in eine »geistige Mobilmachung«, den viele deutsche Intellektuelle bei Kriegsbeginn vollführten, durchaus gültig wieder (auch wenn viele Professoren und Schriftsteller nicht darauf verzichteten, den Krieg in zahlreichen Artikeln und sogar ganzen Schriftenreihen mit scheinbar wissenschaftlichen Methoden und Argumenten zu rechtfertigen).
Wie die in den Gedichten, Essays und Artikeln dominante Schwert-Schild-Heldenmetaphorik unterstreicht, ging man allenthalben davon aus, dass der Krieg noch von der Kavallerie und ritterlichen Zweikämpfen geprägt sein würde. Da passte es nicht ins Bild, dass es schon im Laufe des Herbstes 1914 zu einem von der modernen Waffentechnik erzwungenen Stillstand, zum Grabenkrieg und zu einer Erstarrung der Kampflinien kam, die sich auch in den nächsten Jahren – trotz ungeheurer Materialschlachten, insbesondere an der Westfront – nur noch um wenige Kilometer verschoben, aber nicht mehr entscheidend durchbrochen werden konnten. Erst als die deutschen Truppen, überanstrengt und erschöpft, den von zahlreichen Panzerwagen, Minenwerfern, Granaten und Kampfflugzeugen massiv verstärkten Angriffen französischer, britischer und amerikanischer Divisionen nicht mehr standhalten konnten, setzte sich in den letzten Monaten des Krieges eine neue Strategie des Bewegungskrieges durch.
Die erschütternde Erfahrung des maschinell betriebenen Krieges und das ungeheure Ausmaß der Zerstörung trafen die meisten Soldaten vollkommen unvorbereitet. Pointiert hat dies Walter Benjamin in seinem Aufsatz Der Erzähler (von 1936) formuliert:
»Eine Generation, die noch mit der Pferdebahn zur Schule gefahren war, stand unter freiem Himmel in einer Landschaft, in der nichts unverändert geblieben war als die Wolken und unter ihnen, in einem Kraftfeld zerstörender Ströme und Explosionen, der winzige, gebrechliche Menschenkörper.«
Die Unübersichtlichkeit und Unbegreiflichkeit der Ereignisse, die wie Naturkatastrophen über die Soldaten hereinzubrechen schienen, die ungeheure Reichweite und Durchschlagskraft der Geschosse, die Verwandlung ganzer Landstriche in kraterübersäte Wüsteneien und vor allem das Massensterben auf den Schlachtfeldern veränderten geradezu radikal die Wahrnehmung des Krieges. »Im Fegefeuer des Krieges«, so der Maler Franz Marc schon im Herbst 1914, stelle sich das soldatische Leben vollkommen anders als erwartet (wenngleich nicht frei von Faszination) dar:
»Was wir Krieger in diesen Monaten draußen erleben, überragt in weitem Bogen unsere Denkkraft. Wir werden Jahre brauchen, bis wir diesen sagenhaften Krieg als Tat, als unser Erlebnis werden begreifen können.«
Dabei fehlte es in der Vorkriegszeit nicht an warnenden Stimmen. Bereits 1892 hatte Alfred H. Fried die deutsche »Friedensgesellschaft« gegründet und seit 1899 auch die Friedenswarte. Zeitschrift für internationale Verständigung herausgegeben. Wegen seiner Verdienste um die Völkerverständigung erhielt Fried 1911 den Friedensnobelpreis. Im selben Jahr formulierte er im Vorwort des Handbuchs der Friedensbewegung voller Zuversicht:
»Es besteht für mich kein Zweifel, dass die Friedensidee nunmehr auch in Deutschland und Österreich jene Stellung einnehmen wird, die ihr in anderen Ländern bereits eingeräumt ist.«
Als der Krieg begann, befand sich Fried mitten in den Vorbereitungen für den 21. Weltfriedenskongress, der für Anfang September 1914 in Wien geplant war.
In sehr ausdrucksstarken Bildern vom kommenden Krieg (so der Untertitel) hatte der Hamburger Pädagoge und Schriftsteller Wilhelm Lamszus in seinem Buch Das Menschenschlachthaus 1912 eine realitätsnahe Schilderung des künftigen Geschehens auf den Schlachtfeldern vorgelegt. Anlässlich eines Manövers hatte Lamszus die ungeheure Wucht der modernen Waffentechnik beobachtet und versuchte, mit erzählerischen Mitteln seinen Lesern vor Augen zu führen, dass ein nächster Krieg von einer gewaltigen Tötungsmaschinerie und von Massensterben auf den Schlachtfeldern geprägt sein würde. Das Buch erreichte hohe Auflagen und wurde in mehrere Sprachen übersetzt. Dennoch erreichte es nicht die erhoffte friedensfördernde Wirkung; wohl nicht zuletzt, weil viele Leserinnen und Leser darin eher eine Art spannender fiktionaler Dystopie oder gar Science Fiction als eine realitätsnahe Darstellung sahen. In den Worten Carl von Ossietzkys (in seiner Einleitung zum Fortsetzungsband Das Irrenhaus. Visionen vom Krieg, der erst 1919 erscheinen konnte):
»Man delektierte sich daran, wie an den Utopien eines Wells. Doch fühlte man nicht das Seherische in dem schmalen Büchlein. Irgendwie ahnte man die ungeheure Gefahr, aber das Geschlecht war zu feige, um diesem Bild Wirklichkeit zuzusprechen. Das Menschenschlachthaus, als Fanal gedacht, wurde durch die Wertung zum belletristischen Ereignis.«
Gut einhundert Jahre später, also zu einem Zeitpunkt, da der Krieg in der Ukraine mit all seinen zerstörerischen Wirkungen uns tagtäglich vor Augen geführt wird, erscheint es mir umso wichtiger, auf die Anfänge des maschinell geführten Krieges, auf das Menschen zerstörende Kraftfeld der Materialschlachten und auf die Verwüstung ganzer Landstriche zurückzublicken, und zwar in dem Bewusstsein, dass das Vergangene im Gegenwärtigen präsent sein muss, damit wir auf verantwortliche Weise die Zukunft gestalten können.
In diesem Sinne wünsche ich der Neuausgabe dieses Buches möglichst viele engagierte Leserinnen und Leser, die bereit und in der Lage sind, Zukunftsbilder und Visionen auch negativer Art – im Sinne eines realitätsnahen Frühwarnsystems – ernst zu nehmen und kluge Schlüsse für sich und andere daraus zu ziehen. Blättern Sie um!
Wilhelm Lamszus
Ein Prologzu meinem Menschenschlachthaus,ein Präludium zum kommenden Krieg
Wenn aufgeschreckt die Völker von dem Ruhelager springen, weil drohend mit erhobenem Hammer der Krieg vor ihrer Türe steht, wenn sich die Menschheit schon zu ihrem letzten Gange rüstet, so liegen jene, die Gott zum Singen schuf, die Träumer und Poeten, noch auf dem Liebespolster und schlürfen eitel Himmelsblau und Maiengrün und singen rosarot die veilchenblaue Liebe – und wenn am Horizont das Blutgewitter steigt, der Sturm der Leidenschaften ehern sich zusammenballt, wenn schon der Weltgeschichte Atem stockt, so liegen die Begnadeten nur inniger versunken da und lauschen auf die Reinheit eines edlen Verses und sonnen sich am heiteren Glanze einer kostbaren Melodie, und für die Augen einer schönen Frau verraten sie das Blut der Völker – so kommt und sagt, es ist nichts weiter als ein Reigentanz gewesen, nichts mehr als luftige Gebilde, Wolkenstand und Regenbogenglanz. So kommt und sagt, es wird nichts weiter geben als ein wildes, fröhliches Soldatenspiel: Wachtfeuer lodern, und es dämmert schon das Morgenrot. Die Sonne steigt. Nun singen sie und ziehen jauchzend hin: Kein schönerer Tod ist auf der Welt als vom Feind erschlagen zu werden … Die Fahnen flattern, und die Kriegsmusik rauscht feurig auf … Es geht zum Sturm … und blitzend wirft die junge Lust dem brüllenden Tode sich entgegen. Und lauter als Gewehre und Kanonen donnern, donnert aus hunderttausend Siegeskehlen das Hurra … Im Schimmer steigt vor unseren Augen auf: die große Zeit, die unsterbliche Zeit der Väter und Heroen, und lässt sie farbenprächtig in die Lüfte rauschen: die wilde, flatternde, die ach so amüsante, todselige Kriegsnovelle.
Doch wenn ihr heute an diesem grauen Tag der Nüchternheit eure verzückten Augen rückwärtswendet, so reckt sich nackt am Horizont die Wirklichkeit und steht in Eisen und in Ziegelsteinen da. Verflattert sind die bunten Ritter und Romantiker. Die düsteren Schlote starren in die Luft. Geschossfabriken, Pulvermagazine, Waffendepots. Maschinen rasseln, und es rauchen Tag und Nacht die Schornsteine der Leichtindustrie. Versunken in der Stille des Laboratoriums steht hinter Gläsern, Tiegeln und Retorten der Forscher einsam da und lauscht den Elementen das letzte furchtbare Geheimnis ab. Noch immer ist es ihnen zu gering. Was nützt es, tausend Menschen auf einmal zu fällen, wenn aber tausend am Leben bleiben? Es sinnt der Menschengeist von alters her und grübelt und sucht das eine Mittel, das Mittel, das sich nicht mehr überbieten lässt, womit man eine ganze Stadt mit Türmen, Mauern, Kasematten und mit Menschen mit einem einzigen Blitz und Knall in Schutt verwandeln kann. Gebt uns das Mittel her, nicht nur ein Regiment – was ist schon ein Regiment? Das Mittel wollen wir, um ein ganzes Heer von Menschen, Rossen, Generalen und Soldaten, die ganze glänzende Armee, in einem herrlich konzentrierten Augenblick in Stücke und in Staub zu blasen. Wer wird der Erste sein, der das Zaubermittel findet? Und böte euch einer solch ein Wundermesser an, damit man einem ganzen Volk, dem ganzen Land die Gurgel auf einmal abschneiden kann – es würden gierig eure Hände nach dem Messer greifen, ihr würdet zitternd es an eurer Brust verstecken und würdet, wenn die große Stunde kommt, den letzten, großen Schnitt probieren – und hättet ihr die Macht, zu tun, wie euer Blut begehrt, es würden euch die Wollust und das Grausen packen, bis ihr den Erdball in die Luft gesprengt.
Das ist der Krieg: der unersättliche, der grandiose Blut- und Leichentraum der fieberkranken Menschheit, das rote, heulende Delirium der blutentbrannten Völker. Hinweg mit Flitter, Tand, Musik und Träumerei! So lasst die Wahrheit aus dem Grabe steigen, dass sie ihr Leichentuch von den verwesten Schultern schlage. So lasst den Chor der Wund- und Eitersänger sich zum Festgesang aufreihen, und gebt den Toten ihre Stimme wieder.
Wisst ihr, was dieser Krieg für euch bedeutet? Wisst ihr, was eine Million von Leichen unseres Geschlechts bedeutet? Verhüllt nicht schamhaft euer Haupt! Breitet sie malerisch vor euren Augen aus! – Da liegen sie! Wer wagt es, sie zu zählen? Abzuwägen tausend Tonnen totes Menschenfleisch? Zu filtern tausend Hektoliter frisches Menschenblut – und doch aus ungestilltem Mund zu singen von der Herrlichkeit des Krieges, des großen, heiligen, gottgewollten Krieges, des Zucht- und Lehrmeisters der weibischen Kultur, des strafenden Erziehers unserer schlechten Menschheit!
So lasst uns rufen: Wir haben ihn gesehen, nackt und würdelos. Denn wir lagen selber, aus offenem Halse röchelnd, auf der Erde und sind im eigenen Blut erstickt und sind mit hunderttausend armen Brüdern verscharrt in fremder Erde. – Ihr Brüder, zieht mit! Was rosenrot in seinen Schuhen steht, was sich ergötzt zu üppiger Gebärde, was sich umschlingt und Leben zeugt in ewig hold berücktem Reigen – lasst Tanz und Andacht hinter euch, lasst Haus und Hof nun hinter euch, lasst eure Frauen, eure Kinder, eure Väter, eure Mütter nun daheim und zieht mit. Der Krieg ist da! – Nun zieht mit hinaus aufs Schlachtfeld! Und seht zu, wie ihr vor ihm bestehen mögt.
Das Menschenschlachthaus
Bilder vom kommenden Krieg
Mobilmachung
Der Krieg ist da! So läuft es eilend mit verstörten Augen durch die Straßen. Wir haben Krieg! Es geht nun los!
Mobilmachung. – Das inhaltsschwere Wort sieht gebietend von den Anschlagsäulen in die Straßen. Die Zeitungen bringen Aufrufe in den fettesten Lettern. Und die Gerüchte und Depeschen flattern wie ein aufgeregter Taubenschwarm um diesen Tag von Blut und Eisen. – Nun wird es schrecklich ernst. Und dieser Ernst legt sich wie eine Lähmung auf den Staat. Dann aber geht ein Ruck durch das gewaltig eiserne Gefüge. Und diesem Ruck muss jedermann gehorchen. Vorbei das Sorgen und Bedenken, vorbei das Zweifeln und das Schwanken. Nun ist der Augenblick gekommen, da wir nicht Bürger mehr, da wir nur noch Soldaten sind. Soldaten, die nicht Zeit zu denken, die nur noch Zeit zu sterben haben.
Und dann kommen sie gezogen: aus den Werkstätten, aus den Fabriken, hinter dem Ladentisch hervor, aus den Kontoren, vom Lande kommen sie zur Stadt herein, und alles findet sich, um dem Vaterlande beizustehen.
»Am vierten Tage« stand in meiner Kriegsbeorderung. Nun ist der vierte Morgen da, und ich habe Abschied von meinem Weib und meinen beiden Kindern genommen. Gott sei Dank, dass der vierte Morgen gekommen ist; denn der Abschied ist mir nicht leicht geworden, und mir wird weh zumute, wenn ich an »zu Hause« denke.
»Wo willst du hin, Papa?«, fragte die Kleine, als ich mit der Reisetasche in der Hand zum letzten Mal sie küsste.
»Papa will verreisen«, sagte ihre Mutter und sah mich unter Tränen lächelnd an.
Ja, verreisen, mein Mädel, und du, mein kleiner Bursch’, nun haltet euch brav und macht der Mutter Freude.
Und rasch haben wir uns getrennt. Denn Dora hielt sich tapfer bis zum letzten Augenblick.
Nun stehen wir auf dem Kasernenhof mit Sack und Pack, wir ohne Rang und Charge, wir Reservisten, Landwehrleute, ein jeglicher bei seiner Tafel. – Wie ernst doch die Gesichter sind. Nichts ist von jugendlichem Übermut, von überschäumender Soldatenlust zu spüren. Vielmehr ein Sinnen in den ruhigen Gesichtern.
»Der Krieg, der musste endlich kommen«, so hörten wir und lasen in der Zeitung. »Das muss so sein, das ist Naturgesetz. Die Völker nehmen einander das Brot vor dem Munde weg und nehmen einander die Luft zu atmen weg. Das kann zuletzt nur mit Gewalt entschieden werden. Und muss es sein, so lieber heute als morgen!«
Wir sind keine Söldner mehr, Handwerker des Menschenmords, die einst ihr Blut für bares Geld an jedermann verkauften. Wir sind nicht mehr Gladiatoren, Sklaven, die im Zirkus das Sterben als ein schönes Schauspiel den Reichen zur Lust und Augenweide spielten. Es ist das Vaterland, dem wir geschworen haben. Und muss es sein, so wollen wir als Bürger sterben, sterben in voller Bewusstheit und voller Verantwortung unseres Tuns.
Was werden die nächsten Tage uns bringen?
Wohl keiner unter uns hat je ein Schlachtfeld mit eigenen Augen gesehen. Aber wir haben es von anderen gehört und haben es bei anderen gelesen, wie 1870/71 ein Schlachtfeld ausgesehen hat, und haben wie mit eigenen Augen Granaten die Leiber zerreißen sehen. Und auch das wissen wir: Es blieben damals vor vierzig Jahren trotz minderwertiger Kanonen und Gewehre über hundertzwanzigtausend Tote auf dem Felde der Ehre. Wie viel Prozent der Lebenden wird sich der Krieg von heute holen? Es werden Heere auftreten so ungeheuer, wie sie die Erde nie gesehen hat. Allein Deutschland stellt über sechs Millionen Soldaten ins Feld. Frankreich fast ebenso viel. War da 1870/71 mehr als ein ausgedehntes Vorpostengefecht? Es schwindelt mir, wenn ich die Massen vor mir sehe. Und wenn ich daran denke, wie sie aufeinander losmarschieren, will mir der Atem stocken.
Sind wir ein anderes Geschlecht als unsere Väter?
Ist es darum, weil wir nur das eine Leben zu verlieren haben?
Und kleben wir so fest an diesem Leben?
Ist uns das Vaterland nicht mehr wert als dieses kleine bisschen Leben?
Es werden wohl nicht viele unter uns sein, die da an Auferstehung glauben, die da glauben, dass unsere verstümmelten Leiber zu neuer Herrlichkeit erstehen werden. Wir glauben auch nicht, dass unser Vater im Himmel Freude an unserem mörderischen Tun haben und dass er in jener besseren Welt anders als zu Brudermördern zu uns sprechen wird. Aber wir beugen uns der eisernen Notwendigkeit. Das Vaterland hat uns gerufen, und wir als treue Söhne folgen gehorsam seinem unentrinnbaren Gebot.
Von heute an gehören wir dem Vaterlande, so rief noch eben der Major, als er die Kriegsartikel verlesen hatte.
Und nun geht es los. Schon hat der Bezirksfeldwebel die Listen revidiert und abgeschlossen. Schon sind wir zu viert eingeteilt. Und nun marschieren wir im langen Zuge über den Kasernenhof. Noch heute sollen wir den Bürgerrock ausziehen und zu unserem neuen Leib die neue Garnitur empfangen. Heute noch sollen wir Soldaten werden. – Es geht nun schnell mit uns.
1
Soldat
Am folgenden Nachmittag hat die Kompanie Innendienst. Wir liegen auf dem Kasernenhof auf dem Bauch und üben Anschlag und Laden im Liegen.
Ich halte mein Gewehr nach vorn. Vor mir, drüben an der Kasernenmauer, sind Scheiben angemalt – Ringscheiben, Kopfscheiben, Brustscheiben. Dreihundert Meter. Ich halte »Ziel aufsitzend« und drücke ab. »Brust aufsitzend abgekommen.« Das müsste ein Treffer geworden sein. – Wie viele Rahmen Patronen ich wohl verschießen werde? Ob wohl ein Treffer dazwischen ist?
Wenn jeder von den Millionen, die vor den Feind kommen, hundert Patronen verschießt und von hundert nur einen Treffer hat, das macht … dann kommt – und ich muss lächeln über diese glatte Rechnung –, dann kommt ja überhaupt keiner wieder heraus. Das ist ein lustiges Exempel.
Knips! Die fünfte Patrone ist heraus. Ich schiebe einen neuen Rahmen Exerzierpatronen hinein. Wie schnell und sicher das doch geht. Ein, zwei Sekunden, und fünf Patronen sitzen in der Kammer. Jede schlägt, wenn’s nötig ist, durch sechs Mann hindurch; sie geht durch Pfähle und durch Bäume, durch Erdwälle und Steinmauern. Es gibt vor diesem zierlichen Geschoss, vor diesem spitzen Mäntelchen so gut wie keine Deckung mehr.
Und welch ein Wunderwerk ist dieses Mausergewehr. Wie kümmerlich standen sie 1870/71 da mit ihren klapperigen Zündnadelgewehren. Eine lahme Kugel nur immer jeweils, und war sie abgeschossen, dann gab’s ein langes, umständliches Laden.
Und dennoch brachte der Krieg weit über 100.000 deutsche und französische Leichen. Wie viele Leichen wird dieser Krieg wohl bringen? Wenn nur jeder fünfte Mann im Felde bleibt und der zweite Fünfte als Krüppel wiederkehrt – wie groß wird dann die Ernte sein?
Es sind die ganzen Lande in diesem Augenblick mit liegenden Soldaten bedeckt, und alle lassen ihre Flinten starren, richten die todbringenden Läufe gegeneinander und üben sich in der Kunst, das Herz zu treffen.
Dahinter aber rücken die Geschütze an. Die Kanoniere springen ab und reißen die Lafette herum. Schon sind sie gerichtet, und tausend schwarze Schlünde sehen unheimlich zum Himmel auf.
Einst standen wir, als wir im Lager zu Schießübungen eingezogen waren, und sahen einer scharf schießenden Batterie zu. Sie hatte abgeprotzt und stand fertig zum Schuss. Die Offiziere schauten durch ihre Krimstecher ins Gelände. Noch waren die Scheiben nicht zu sehen. Wir alle schauten gespannt in das Schussfeld, wo jeden Augenblick sich etwas zeigen sollte. Da – hinten – weit – bewegt sich etwas.
Kommandoruf. Der Leutnant zeigt mit der Rechten auf das springende Ziel. Die Entfernung wird gerufen, die Kanoniere richten und –
»Achtung! Erstes Geschütz – Feuer!«
Und schon fliegt das Geschoss, und wir fühlen im selben Augenblick das Eisen flitzen. Es surrt die Luft. Ein Knall – und tausend Meter vor uns über der anreitenden Kavallerie ist das Geschoss zerplatzt und hat seinen Bleiregen auf die blauen Scheiben gestreut. Und nun das zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Geschütz.
Das nächste Ziel war 1.500 Meter weit. Und wieder wurden die Geschütze gerichtet. Und wieder flog das seltsame Geschoss und zog die abgemessene Bahn. Es war zum Staunen, wie es in der Luft von selber stehen blieb und explodierte. Es war, als hätte jeder dieser eisernen Zylinder ein Gehirn, als trüge er Leben und Bewusstsein in sich. So sicher fand er seinen Ort.
Und als die Batterie abgeschossen hatte und nach Hause fuhr und der Warnungsball heruntergezogen war, sind wir ins Gelände gegangen. Da lagen die abgeschossenen Gruppenscheiben und waren der Reihe nach von den Schrapnellen getroffen – Kopf, Leib, Gliedmaßen –, da fanden wir nicht eine Figur, die nicht durchlöchert war. Wir standen und bewunderten die Präzision und dachten mit verschwiegenem Grauen an andere Ziele als Holz- und Kleiderattrappen.
Ob sie wohl drüben auch so vollkommene Präzisionsmaschinen haben? Wie haben die Techniker nur mit jedem Tage neue Wunder der Mechanik erfunden und konstruiert? Das Kriegsmaschinenwesen hat sich zu genialer Höhe, zu künstlerischer Höhe entwickelt. 240 Kugeln und mehr in einer Minute! Welch ein Wunderwerk der Technik ist solch ein Maschinengewehr! Man lässt es schnurren, und schon spritzt es Kugeln, dichter als der Regen fällt. Und hungrig fletscht der Automat von links nach rechts. Er ist auf die Mitte der Leiber eingestellt und bestreicht die ganze Schützenlinie auf einmal. Es ist, als ob der Tod die Sense auf das alte Eisen geworfen hätte, als ob er nun ein Maschinist geworden wäre. Das Korn wird nicht mehr mit der Hand gemäht. Sogar die Garben werden schon mit der Maschine gebunden – so werden sie auch unsere Millionen Leichen mit Grabmaschinen in die Erde schaufeln müssen.
Verflucht! Ich kann den scheußlichen Gedanken nicht loswerden. Immer wieder kommt er mir. Man ist vom Kleinbetrieb zum Großbetrieb übergegangen. Anstatt des Webstuhls, daran man mit den Händen schaffend saß, lässt man jetzt die großen Schwungmaschinen sausen. Einst war’s ein Reitertod, ein ehrlicher Soldatentod. Jetzt ist es ein Maschinentod!
Das ist es, was mir bis zum Halse steht. Von Technikern, von Maschinisten werden wir vom Leben zum Tode befördert. Und wie man Knöpfe und Stecknadeln im Großbetrieb erzeugt, erzeugt man nun die Krüppel und die Leichen mit Maschinenbetrieb. Warum fängt mir auf einmal zu grausen an? Mir ist, als könnt ich mit Händen greifen, dass es Wahnsinn ist, blutroter Wahnsinn, der da auf uns lauert. Verflucht! Ich darf nicht länger grübeln, sonst werde ich verrückt. Vor das Gewehr! Ein Feind vor dir! Ist das denn nicht mehr Mann gegen Mann? Was schadet es, dass das Gewehr nun besser trifft? Ziel aufsitzend, mitten in die Brust …
Wer ist es eigentlich, den ich da vor mir habe? Den ich jetzt erschießen will? Ein Feind? Was ist ein Feind?
Und wieder sehe ich mich an jenem wunderschönen Ferienmorgen auf dem französischen Bahnhof, und wieder sehe ich neugierig aus dem Fenster heraus. Fremdes Land und fremde Leute. Der Augenblick zur Abfahrt ist gekommen. Schon gibt der Stationsvorsteher das Zeichen. Da reicht ein altes Mütterchen die zitternde Hand zum Fenster hinauf, und ein junger blühender Mensch, der mit uns fährt, nimmt diese welke Hand und streichelt sie, dass der Alten die Tränen von den mütterlichen Wangen fließen. Sie spricht kein Wort. Sie sieht nur ihren Jungen an, und der Junge sieht auf seine Mutter nieder. Da kommt es mir wie eine Offenbarung: Franzosen können weinen. Das ist ja alles wie bei uns. Sie weinen, wenn sie voneinander Abschied nehmen. Sie lieben sich und fühlen Schmerzen.
Und als der Zug nun aus dem Bahnhof rollte, sah ich noch immer zum Fenster hinaus, und wie die Alte so verlassen auf dem Bahnhof stand und regungslos dem Zuge nachschaute, da musste ich meiner eigenen Mutter gedenken. Das war ich selber, der da Abschied nahm, und dort auf dem Bahnsteig weinte meine arme, alte Mutter. Taschentücher wehten im Winde. Die Hände winkten und ich winkte mit; denn ich war einer von den ihrigen.
Und wieder leg ich an und ziele mitten in die Scheibe. Ich will mich nicht länger mit Gedanken quälen. – Die Scheibe scheint mir näher gerückt. Auf einmal ist es mir, als tritt die blau gemalte Figur aus ihrem weißen Viereck heraus. Ich starre hin. Ich sehe deutlich ein Gesicht vor mir. Ich hab den Finger an dem Abzugsbügel und habe Druckpunkt genommen. Weshalb ziehe ich nicht durch? Der Finger zittert mir – jetzt! Jetzt! erkenn ich das Gesicht! Es ist der junge Mensch aus Nancy, der von seiner Mutter Abschied nahm!
Da schnappt die Feder und ich schrecke tief zusammen, denn – ich habe abgedrückt auf das lebendige Gesicht. Mörder! Mörder! Du hast der Mutter ihren einzigen Sohn erschossen! Du bist ein Brudermörder!
Ich raff mich auf. Ich nehme mich zusammen. Ein Mörder? Torheit! Ein Fantast! Du bist Soldat! Soldaten sind nicht Menschen mehr! Es gilt das Vaterland! – Und gelassen ziel ich auf den Feind. Triffst du ihn nicht, so trifft er dich. – »Brust aufsitzend abgekommen.«
Vater unser, der Du bist im Himmel
Freitag sind wir eingezogen. Montag sollen wir fahren. Heute, am Sonntag, ist großer Kirchgang.
Ich habe diese Nacht schlecht geschlafen und fühle mich unruhig und abgespannt.