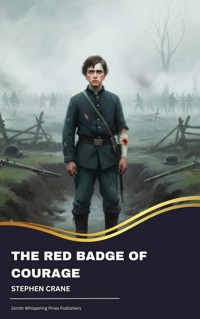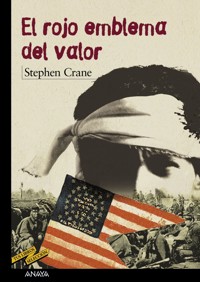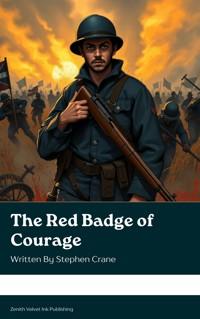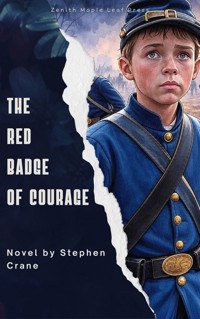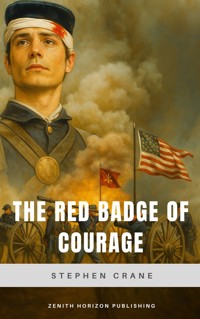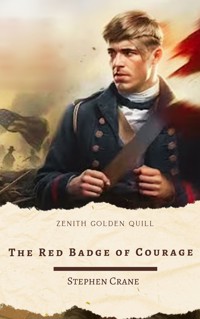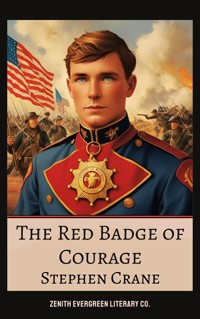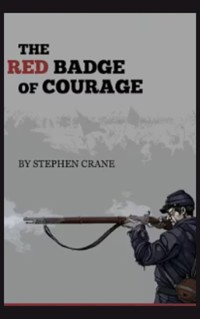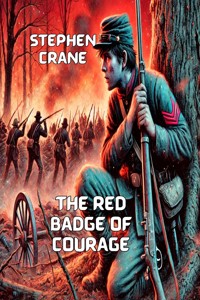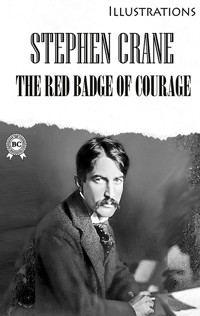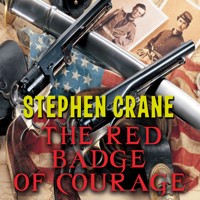18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Pendragon
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1898 schrieb Stephen Crane eine Erzählung, die viele für seine beste halten: Das Monster, die bedrückende Beschreibung eines dramatischen Unfalls. Als im Hause Dr. Trescotts ein Feuer ausbricht, wird der schwarze Stallknecht Henry Johnson bei der Rettung des kleinen Jimmie zum Helden. Er selbst allerdings wird durch die Flammen schwer entstellt. Johnson ist plötzlich für alle nur noch ein "Monster". Er wird gemieden und ausgegrenzt. Auch Dr. Trescott, der aus Dankbarkeit zu ihm hält, gerät zunehmend unter Druck. Der Band enthält weitere Geschichten, von denen die meisten erstmals auf Deutsch erscheinen. So erfährt man in Ein Hirngespinst in Rot und Weiß, wie ein Vater die Erinnerungen seiner Kinder manipuliert, weil er etwas zu verbergen hat. Und in den Erzählungen über den kleinen Gernegroß Jimmie Trescott beweist Crane sein großartiges Talent für Humor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Stephen Crane
Das Monsterund andere Geschichten
Herausgegeben von Günther ButkusÜbersetzt und mit einem Nachwortvon Lucien Deprijck
PENDRAGON
Inhalt
Anmerkungen zur Übersetzung
Neue Handschuhe
Redner in Nöten
Ein trauriges altes Haus
Purer Zufall
Zwölf Uhr
Ein Hirngespinst in Rot und Weiß
Mondlicht auf dem Schnee
Das Duell, das nie stattfand
Das Monster
Das kleine Regiment
Der kleine Engel
Das kleine Biest
Nachwort
Anmerkungen
Editorische Notizen
Hinweise zur Übersetzung
Stephen Cranes Texte werden in dieser Ausgabe so originalgetreu übersetzt wie irgend machbar, abgesehen von der Notwendigkeit, stellenweise (so sacht wie möglich) zu variieren, um das Original in einer anderen Sprache flüssig und lesbar zu machen.
Auf die Veränderung eines heute, im 21. Jahrhundert, als problematisch empfundenen Vokabulars wurde bewusst verzichtet, vor allem um Cranes Texten nichts an Aussagekraft zu nehmen. Denn auch Ausdrücke, die heute unwillkürlich als veraltet, und schlimmer, als rassistisch empfunden werden, haben im Zusammenhang ihren Sinn und sollten nicht verändert werden. Eine gutgemeinte Korrektur käme einer Retusche gleich, die das Werk verfälscht.
So sind auch nach heutigen Maßstäben rassistische Begriffe wie „negro“ und „nigger“ originalgetreu übersetzt worden. Crane verwendet den Begriff „negro“ zeitgemäß, es war die gängige Bezeichnung für Afroamerikaner und hatte seinerzeit, am Ausgang des 19. Jahrhunderts, keine negativen Konnotationen, es gab allgemein keine Bezeichnungen, die wir heute, im 21. Jahrhundert, als sensibler oder neutraler empfinden würden. Abwertend waren zu Cranes Zeiten Begriffe wie „nigger“ oder „coon“, auch wenn selbst diese von vielen für normal und unverfänglich gehalten wurden. Crane selbst hat den abwertenden Begriff „Nigger“ im Erzähltext nicht benutzt, er erscheint in wörtlicher Rede und in der Wiedergabe eines zitierten Spottverses – der ausdrücklich als „abscheulich“ ausgewiesen wird. Die Erhaltung der Begriffe ist notwendig, gerade für ein umfassendes Verständnis des zeitlichen Kontextes, und um der Leserschaft eine eigene Einschätzung der seinerzeit herrschenden Verhältnisse zu ermöglichen.
Der Inhalt der Erzählungen spricht für sich. Gerade der Rassismus ist, wenn auch vielleicht nicht plakativ und vorrangig, so doch durchgehend in Das Monster (1897) thematisch relevant, ihm wird aber keineswegs Vorschub geleistet, ganz im Gegenteil. Erleben wir doch in der Handlung eine bedrückende Darstellung des sozialen Gefälles zwischen Weiß und Schwarz am Ende des 19. Jahrhunderts (wohlgemerkt im Norden der USA), die an Beschönigung wahrhaftig vermissen lässt. Der Sprachgebrauch der damaligen Zeit sagt viel über einen latenten, von Vertretern einer Sprache oft unbewusst transportierten Rassismus, der nachträglich nicht aus der Welt zu schaffen ist und auch in dokumentarischem Sinne sichtbar bleiben sollte.
Rassismus in Wort und Tat ist in jeder Beziehung verachtenswert. Es versteht sich, dass mit heutigen, also aktuell geschriebenen Texten eine solche „Nachsicht“ keinesfalls mehr in Frage käme.
Lucien Deprijck
Neue Handschuhe
Der kleine Horace war auf dem Weg von der Schule nach Hause, weithin sichtbar mit einem Paar neuer roter Fausthandschuhe ausgestattet. Einige Jungen auf einem Feld bewarfen sich fröhlich mit Schnee. Sie riefen ihm zu: „Komm schon, Horace. Wir machen eine Schneeballschlacht.“
Horace war geknickt. „Nein“, sagte er, „ich kann nicht. Ich muss nach Hause.“ Mittags hatte seine Mutter ihm eingeschärft: „Also, Horace, du kommst direkt nach Hause, sobald die Schule aus ist. Hörst du? Und nicht, dass deine schönen neuen Handschuhe nass werden. Hörst du?“ Seine Tante hatte noch hinzugefügt: „Ich muss schon sagen, Emily, es ist eine Schande, wie du diesem Kind immer wieder erlaubst, seine Sachen zu ruinieren.“ Sie hatte damit die Handschuhe gemeint. Seiner Mutter hatte Horace artig mit „Ja Ma’m“ geantwortet. Aber nun trödelte er in der Nähe der Gruppe von tobenden Jungen, die wie Falken kreischten, während die weißen Bälle flogen.
Einige von ihnen durchschauten augenblicklich dieses auffällige Zögern.
„Ha!“ Sie unterbrachen ihr Spiel, um ihn zu verspotten. „Hast Angst um deine neuen Handschuhe, was?“
Einige kleinere Jungen, die noch nicht so weise in der Aufdeckung von Beweggründen waren, bejubelten diese Attacke unangemessen heftig. „Hat Angst um seine Handschuhe! Hat Angst um seine Handschuhe!“ Sie sangen diese Zeilen zu einer zynischen und monotonen Melodie, die vermutlich so alt ist wie Kindheit in Amerika überhaupt und deren vollständiges Vergessen das Privileg des herangereiften Erwachsenen ist. „Hat Angst um seine Handschuhe!“
Horace warf seinen Spielgefährten einen gequälten Blick zu und ließ ihn dann auf den Schnee zu seinen Füßen sinken. Er wandte sich dem Stamm eines der großen Ahornbäume zu, die den Bordstein säumten. Er tat so, als untersuche er gewissenhaft die raue und robuste Rinde. Es kam ihm vor, als verdunkele die Schande mit dichten Schatten die vertraute Straße von Whilomville. Die Bäume und Häuser waren nun in purpurfarbenes Zwielicht gehüllt.
„Hat Angst um seine Handschuhe!“ Die schreckliche Melodie trug in sich die Bedeutung mondbeschienener Kriegstrommeln zum monotonen Gesang von Kannibalen.
Schließlich hob Horace mit großer Anstrengung den Kopf. „’s is’ nich’ deswegen“, sagte er barsch. „Ich muss nach Hause, das ist alles.“
Woraufhin alle Jungen ihren linken Zeigefinger vorstreckten wie einen Bleistift und ihn mit dem der rechten Hand spöttisch anspitzten. Sie kamen dabei näher und sangen wie ein eingespielter Chor: „Hat Angst um seine Handschuhe!“
Als er die Stimme erhob, um die Anklage zu leugnen, war er gegen das Geschrei des Mobs hoffnungslos. Er war allein, konfrontiert mit allen Traditionen des Jungendaseins, aufgezeigt von unerbittlichen Repräsentanten. Er war derart tief gesunken, dass einer der Burschen, fast noch ein Baby, ihn überlistete und ihm einen schweren Schneeball an die Backe warf. Diese Aktion wurde mit lautem Hohngelächter gefeiert. Horace wollte sich seinem Angreifer mit einem scharfen Blick zuwenden, aber schon kam die andere Flanke mit einer Kostprobe, so dass er sich gezwungen sah, sein Gesicht weiterhin auf die Reihe ausgelassener Angreifer zu richten. Der Kleine verschwand in der Sicherheit der Menge und wurde für seinen Ausfall mit übertriebenem Lob bedacht. Horace hatte auf dem Weg langsam den Rückzug angetreten. Die ganze Zeit versuchte er, sich bemerkbar zu machen, aber unhörbar gegen den Sprechgesang „Hat Angst um seine Handschuhe!“ In diesem verzweifelten Rückzug ging das Leid des in die Enge getriebenen und eingeschüchterten Jungen über das gewöhnliche menschliche Los hinaus.
Obwohl er selbst ein Junge war, verstand er Jungen nicht im Entferntesten. Er war freilich der deprimierenden Überzeugung, dass sie ihm bis an sein Grab so folgen würden. Aber fast am Ende des Feldes schienen sie plötzlich gar nicht mehr daran zu denken. In Wahrheit besaßen sie nicht mehr Bosheit als herumhuschende Spatzen. Ihr Interesse hatte sich in der Laune eines Augenblicks anderen Dingen zugewandt. Schon waren sie wieder auf dem Feld und schwelgten im Schnee. Vielleicht hatte einer der Wortführer bloß gesagt: „Ach, nun kommt!“
Als ihr Vorhaben endete, beendete auch Horace seinen Rückzug. Eine Zeit lang erging er sich offensichtlich in dem Versuch, sein Selbstbewusstsein wiederherzustellen und machte sich dann daran, heimlich hinüber zur Gruppe zu gehen. Auch in ihm hatte sich eine bedeutsame Änderung vollzogen. Vielleicht waren seine heftigen Qualen ähnlich kurzlebig wie die Bosheit der anderen. In diesem Jungendasein wurde eingefordert, einem unausgesprochenen Verhaltenskodex zu folgen, mit launischer, aber gnadenloser Strenge. Alles in allem waren sie immer noch seine Kameraden, seine Freunde.
Sie beachteten seine Rückkehr nicht. Sie steckten tief in einer Auseinandersetzung. Anscheinend hatte man sich auf einen Kampf zwischen Indianern und Soldaten geeinigt. Die kleineren und schwächeren Jungen hatte man bei diesem Auftaktgefecht in die Rolle der Indianer gedrängt, aber das waren sie bald leid und gaben zögerlich aber standhaft ihrem Wunsch nach einem Klassenwechsel Ausdruck. Die größeren Jungen hatten alle großen Ruhm erworben, indem sie den Indianern entscheidende Verluste beibrachten, und sie wollten, dass der Krieg weiterging wie geplant. Sie erklärten lautstark, dass es für Soldaten angemessen sei, die Indianer stets vernichtend zu schlagen. Die kleinen Jungen versuchten gar nicht erst, die Wahrheit dieser Argumentation in Frage zu stellen; sie beschränkten sich auf die schlichte Erklärung, dass sie in diesem Falle lieber Soldaten sein wollten. Jeder der kleineren Jungen bekniete eifrig die anderen, doch Indianer zu bleiben, aber was sie selbst betraf, wiederholten sie ihren Wunsch, sich als Soldat zu melden. Die größeren Jungen brachte solcher Mangel an Enthusiasmus bei den kleinen Indianern zur Verzweiflung. Abwechselnd schmeichelten und drohten sie, aber sie konnten die kleinen Jungen nicht überzeugen, die lieber die schlimmsten Demütigungen hinnahmen als sich einem weiteren Ansturm der Soldaten auszusetzen. Man gab ihnen alle Kleinkinder-Attribute, die genug Gewicht hatten, sie tief in ihrem Stolz zu treffen, aber sie blieben hart.
Ein imposanter Bursche, ein Anführer von Ruf, einer der es mit vielen Jungen aufnehmen konnte, die lange Hosen trugen, blähte plötzlich die Backen und rief: „Also gut. Dann bin ich eben selbst ein Indianer.“ Die kleinen Jungen begrüßten diese Verstärkung ihrer geschwächten Reihen mit lautem Jubel und schienen damit zufrieden. Aber die Dinge standen nicht im Geringsten zum Besseren, weil jeder im persönlichen Gefolge des imposanten Burschen, und jeder Außenseiter dazu, spontan Fahnenflucht beging und sich zum Indianer erklärte. Jetzt gab es keine Soldaten mehr. Die Haltung der Indianer war einmütig. Der imposante Bursche machte seinen Einfluss geltend, aber dieser Einfluss konnte die Loyalität seiner Freunde nicht erschüttern, die es ablehnten, unter anderen Farben als seinen Farben zu kämpfen.
Ohne Zweifel gab es keine andere Möglichkeit, als die Kleinen zu zwingen. Aus dem imposanten Burschen wurde wieder ein Soldat, und er erteilte gnädig die Erlaubnis, ihm zu folgen, sicherte sich die ganze effektive Kampfkraft der Menge und ließ einen desolaten Haufen kleiner Indianer zurück. Dann griffen die Soldaten die Indianer an, wobei sie jene gleichzeitig ermahnten, Widerstand zu leisten.
Die Indianer betrieben zuerst eine Politik übereilter Kapitulation, aber das war fruchtlos, weil man keine Kapitulation gelten ließ. Also wandten sie sich unter lautem Protestgeschrei zur Flucht. Die grimmigen Soldaten jagten ihnen johlend nach. Die Schlacht griff um sich und brachte es dabei zu einer Vielfalt wunderbarer Details.
Mehrere Male hatte sich Horace zum Nachhause gehen gewandt, aber es half nichts: die Szene hielt ihn im Bann. Es war faszinierend über jedes Verständnis des Erwachsenen hinaus. Die ganze Zeit hatte er im Hinterkopf eine Ahnung von Schuld und auch eine Ahnung der heraufziehenden Strafe für Ungehorsam, aber dies konnte das Ekstatische dieser Schlacht im Schnee nicht aufwiegen.
Einer der angreifenden Soldaten, als er Horace erspähte, schrie im Vorübergehen: „Hat Angst um seine Handschuhe!“ Horace zuckte bei dieser Reprise zusammen, und der andere Junge blieb stehen, um ihn aufs Neue zu verspotten. Horace schaufelte mit den Händen Schnee zusammen, formte ihn zu einem Ball und bewarf ihn damit. „Ho!“, schrie der Junge, „du bist wohl ein Indianer. He, Freunde, hier ist ein Indianer, der noch nicht getötet worden ist.“ Er und Horace verstrickten sich in ein Duell, in dem beide so eilig Schneebälle formten, dass kaum Zeit zum Zielen blieb.
Einmal traf Horace seinen Gegner direkt auf die Brust. „He“, rief er, „du bist tot. Du kannst nicht mehr kämpfen, Pete. Ich hab dich erwischt. Du bist tot.“
Der andere Junge wurde rot, aber er fuhr fieberhaft fort, Munition anzulegen. „Du hast mich kein Mal getroffen“, erwiderte er mit finsterem Gesicht. „Du hast mich kein Mal getroffen. Na, wo denn?“, fuhr er herausfordernd fort. „Wo hast du mich getroffen?“
„Am Mantel. Genau auf deiner Brust! Du kannst nicht mehr kämpfen! Du bist tot.“
„Hast du niemals.“
„Hab ich wohl! He, Freunde, er ist doch tot, oder? Hab ihn genau getroffen.“
„Is’ er niemals.“
Keiner hatte den Vorgang beobachtet, aber einige der Jungen ergriffen Partei, gemäß ihrer Freundschaft zu einer der beteiligten Fraktionen. Horaces Gegner ging herum und tönte: „Er hat mich kein Mal getroffen! Er ist gar nicht an mich rangekommen! Er ist gar nicht an mich rangekommen!“
Der imposante Anführer trat nun vor und wandte sich an Horace. „Was warst du? Ein Indianer? Na, dann bist du tot – das wär’s. Er hat dich getroffen. Ich hab ihn gesehen.“
„Mich?“, schrie Horace. „Er ist nicht mal ’ne Meile an mich rangekommen …“
In diesem Augenblick hörte er, wie sein Name gerufen wurde, in der gewissen vertrauten Klangfolge zweier Tonhöhen, die letzte schrill und in die Länge gezogen. Er blickte hinüber zum Bürgersteig und sah seine Mutter dort stehen, in ihrer Trauerkleidung, zwei Pakete in braunem Papier unter dem Arm. Über die Jungen hatte sich Schweigen gesenkt. Horace näherte sich langsam seiner Mutter. Scheinbar bemerkte sie es gar nicht, sie blickte ernst durch die nackten Ahornzweige, wo der Sonnenuntergang zwei purpurrote Streifen über den tiefblauen Himmel legte.
In einer Entfernung von zehn Schritten wagte Horace einen verzweifelten Vorstoß. „Oh Ma“, bettelte er, „kann ich nicht noch ein bisschen draußen bleiben?“
„Nein“, antwortete sie getragen, „du kommst mit mir.“
Horace erkannte dieses Profil, es war das Profil der Unerbittlichkeit. Aber er fuhr fort zu quengeln, denn er hielt nicht für ausgeschlossen, dass eine gute Darbietung jetzigen Leidens seine späteren Leiden mindern könnte.
Den Blick zurück zu seinen Spielkameraden wagte er nicht. Es war bereits ein öffentlicher Skandal, dass er nicht so lange draußen bleiben konnte wie andere Jungen, und er machte sich über seine Stellung keine Illusionen, jetzt da er erneut von seiner Mutter weggeholt wurde, und das vor der ganzen Welt. Er war ein zutiefst unglücklicher Mensch.
Tante Martha öffnete ihnen die Tür. Licht umfing ihren gerade geschnittenen Rock. „Oh“, sagte sie, „also hast du ihn auf der Straße gefunden, hm? Na, ich muss schon sagen! Das wurde aber auch Zeit!“
Horace schlich in die Küche. Der Ofen, breitbeinig auf seinen vier eisernen Füßen, summte leise. Tante Martha hatte offenbar erst gerade die Lampe angezündet, denn sie steuerte auf sie zu und drehte versuchsweise am Docht.
„Nun“, sagte die Mutter, „lass uns mal die Handschuhe sehen.“
Horaces Kinn sank herab. Das Bestreben jedes Verbrechers, jene leidenschaftliche Sehnsucht flammte in seinem Herzen, es gäbe ein Asyl, das ihn bewahrte vor Strafe und Gerechtigkeit. „Ich … ich … weiß … weiß nicht, wo sie sind“, keuchte er schließlich, während er mit einer Hand über seine Taschen fuhr.
„Horace“, intonierte seine Mutter, „du erzählst mir ein Märchen!“
„’s is’ kein Märchen“, antwortete er, kaum lauter als gehaucht. Er sah aus wie ein Viehdieb.
Seine Mutter hielt ihn am Arm fest und durchsuchte seine Taschen. Beinahe sofort gelang es ihr, ein ziemlich nasses Paar Handschuhe zum Vorschein zu bringen. „Also, ich muss schon sagen!“, rief Tante Martha. Die beiden Frauen begaben sich nah zur Lampe hin und untersuchten minutenlang die Handschuhe, drehten sie immer wieder hin und her. Dann, als Horace aufschaute, war das von Traurigkeit gezeichnete, vertraute Gesicht seiner Mutter ihm zugewandt. Er brach in Tränen aus.
Seine Mutter zog einen Stuhl zum Ofen heran. „Jetzt setzt du dich da hin und rührst dich nicht, ehe ich’s dir sage.“
Er schlich sich duckmäuserisch auf den Stuhl. Seine Mutter und seine Tante machten sich geschäftig an die Zubereitung des Abendessens. Nichts an ihrem Verhalten ließ vermuten, dass er für sie überhaupt existierte, ihre Selbstvergessenheit gedieh so weit, dass sie nicht einmal miteinander sprachen. Bald gingen sie ins Ess- und Wohnzimmer, Horace konnte das Geschirr klappern hören. Seine Tante Martha brachte einen Teller mit Essen, setzte ihn auf einen Stuhl in seiner Nähe und verschwand ohne ein Wort.
Horace beschloss ohne Zögern, dass er nicht einen einzigen Bissen anrühren würde. Er hatte diese List im Umgang mit seiner Mutter schon oft angewendet. Er wusste nicht, warum es sie dazu brachte nachzugeben, aber das tat es jedenfalls manchmal.
Die Mutter sah auf, als die Tante aus dem Nebenraum zurückkehrte. „Isst er sein Abendbrot?“, fragte sie.
Die altjüngferliche Tante, mit Unwissenheit gewappnet, begegnete diesem Interesse mit einem mitleidigen und verächtlichen Blick. „Nun, also, Emily, woher soll ich das wissen?“, fragte sie. „Sollte ich ihm über die Schulter gucken? Was du dir über dieses Kind für Sorgen machst! Es ist eine Schande, wie du dieses Kind erziehst!“
„Nun, er sollte etwas essen. Es geht doch nicht, dass er ohne Essen bleibt“, erwiderte die Mutter schwach. Tante Martha, in tiefer Missbilligung für die Politik der Zugeständnisse, die in diesen Worten lag, ließ einen langen, verächtlichen Seufzer vernehmen.
Allein in der Küche starrte Horace mit umdüsterten Augen auf den Teller mit Essen. Lange Zeit deutete nichts darauf hin, dass er nachgeben könnte. Seine Laune war unumstößlich. Er war entschlossen, seine Rache nicht für Brot, kalten Schinken und saure Gurke zu verkaufen, und doch muss bemerkt werden, dass der Anblick ihm mächtig zusetzte. Insbesondere die saure Gurke war von einem beachtlichen verführerischen Reiz. Er begutachtete sie finster.
Doch schließlich, unfähig diesen Zustand und seine Haltung angesichts der Gurke länger zu ertragen, streckte er einen vorwitzigen Finger aus und berührte sie, und sie war kühl und frisch und üppig. Dann stürzte plötzlich die Erkenntnis des erbarmungslosen Jammers dieser Situation in seiner ganzen Tragweite über ihn herein und seine Augen füllten sich mit Tränen, die ihren Weg die Backen hinunter antraten. Er schniefte. Sein Herz war schwarz vor Hass. In seiner Fantasie malte er Szenarien tödlicher Vergeltung. Seine Mutter würde schon sehen, dass er nicht derjenige war, der Beschuldigungen sanftmütig hinnahm, ohne einen Arm zur Verteidigung zu erheben. Und so waren seine Träume ein Gemetzel der Gefühle, und fast an ihrem Ende erschien seine Mutter, gebeugt vor Schmerz, ihm zu Füßen. Weinend flehte sie ihn um Gnade an. Würde er ihr vergeben? Nein, sein Herz, einst sanft, war durch ihre Ungerechtigkeit zu Stein geworden. Er konnte ihr nicht vergeben. Sie musste den unvermeidlichen Preis bezahlen.
Der erste Punkt in diesem grausamen Plan war die Verweigerung der Mahlzeit. Er wusste aus Erfahrung, dass dies im Herzen seiner Mutter verheerend wüten würde. Und so wartete er verbissen.
Plötzlich jedoch fiel ihm ein, dass der erste Teil seiner Rache Gefahr lief, zu misslingen. Ihm kam der Gedanke, dass seine Mutter vielleicht nicht auf die gewohnte Art kapitulieren würde. Wenn er sich recht erinnerte, war es bereits höchste Zeit, dass sie hereinkäme, besorgt, ihm traurig zugetan, und ihn fragte, ob er krank sei. Er hatte es dann immer so gehandhabt, mit resignierter Stimme anzudeuten, er sei das Opfer einer unbestimmten Krankheit, dass er es aber vorzog, in aller Stille und einsam zu leiden. Wenn sie in ihrer Furcht beharrlich war, bat er sie stets mit gedrückter, leiser Stimme wegzugehen und ihn still und einsam im Dunkeln ohne Essen leiden zu lassen. Mit diesem Manöver hatte er es sogar schon zu Torte gebracht.
Aber was konnte die lange Pause und die Stille bedeuten? Hatte seine alte und bewährte List ihn im Stich gelassen? Während ihm die Wahrheit dämmerte, empfand er tiefen Abscheu für das Leben, die Welt, seine Mutter. Ihr Herz schlug die Belagerer zurück; er war ein wehrloses Kind.
Er weinte eine Weile, bevor er so weit war, zum entscheidenden Schlag auszuholen. Er würde fortlaufen. In einem entlegenen Winkel der Welt würde aus ihm jemand mit blutbefleckten Händen, in ein verbrecherisches Leben getrieben durch die Grausamkeit seiner Mutter. Sie sollte sein Schicksal nie erfahren. Jahrelang würde er sie mit Zweifeln über Zweifeln quälen und sie unerbittlich ins Grab bringen, erfüllt mit Reue. Und auch seine Tante Martha würde nicht entkommen. Eines Tages, in einem Jahrhundert, wenn seine Mutter tot war, würde er seiner Tante Martha schreiben und ihren Teil am Ruin seines Lebens darlegen. Den einen Schlag gegen ihn würde er, wenn die Zeit gekommen war, mit tausend vergelten – o nein, mit zehntausend.
Er erhob sich und nahm Mantel und Mütze. Auf seinem heimlichen Weg zur Tür warf er einen Blick zurück auf das Gepökelte. Er war versucht es mitzunehmen, aber er wusste, wenn er den Teller unberührt ließ, würde sich seine Mutter nur schlechter fühlen.
Blauer Schnee fiel. Die Menschen, nach vorne gebeugt, bewegten sich rasch über die Fußwege. Die elektrischen Lampen summten im Gewirr der Flocken. Als Horace aus der Küche trat, trieb eine scharfe Bö die Flocken um die Hausecke. Er duckte sich weg, und ihre Heftigkeit erleuchtete sein Denken undeutlich in neue Richtungen. Er sinnierte bezüglich einer Auswahl entlegener Winkel der Welt. Wie er fand, hatte er in geographischer Hinsicht keine hinreichenden Pläne, doch ohne viel Zeit zu verlieren, entschied er sich für Kalifornien. Er kam auf der Straße nach Kalifornien rasch bis zum vorderen Gartentor seiner Mutter voran. Er war also unterwegs. Sein Erfolg war ein wenig erschreckend; ein Würgen war in seiner Kehle.
Aber am Tor hielt er inne. Er wusste nicht, ob seine Reise nach Kalifornien kürzer wäre, wenn er die Niagara Avenue hinunterging oder durch die Hogan Street. Da der Sturm sehr kalt war und dieser Punkt sehr wichtig, entschied er sich zum Rückzug in den Holzschuppen, um nachzudenken. Er betrat den dunklen Bau und nahm Platz auf dem alten Hackklotz, an dem er sich auf Geheiß jeden Nachmittag, wenn er aus der Schule kam, ein paar Minuten versuchte. Der Wind schrie und brüllte gegen die losen Bretter, und auf dem Boden lag ein Streifen Schnee, der durch einen Spalt hereingeweht war.
Dort verließ die Idee, in einer solchen Nacht nach Kalifornien aufzubrechen, seine Gedanken und überließ ihn dem kummervollen Nachsinnen über sein Märtyrerdasein. Es blieb nichts anderes übrig, als die ganze Nacht im Holzschuppen zu schlafen und am Morgen in aller Frühe nach Kalifornien aufzubrechen. Als er an sein Bett dachte, trat er den Boden mit Füßen und stellte fest, dass die unzähligen Splitter alle festgefroren waren, eingebettet in Eis.
Später entdeckte er mit Freude Zeichen von Aufregung im Haus. Das Aufscheinen einer Lampe bewegte sich rasch von Fenster zu Fenster. Dann wurde die Küchentür laut zugeschlagen, und eine schalvermummte Gestalt eilte zum Tor. Endlich bekamen sie seine Macht zu spüren. Das zitternde Gesicht des Kindes war erhellt von satanischem Frohlocken, als es sich in der Dunkelheit des Holzschuppens an den Anzeichen der Bestürzung weidete. Die schalvermummte Gestalt war seine Tante Martha gewesen, die herausstürzte, um die Nachbarn zu alarmieren.
Die Kälte des Schuppens machte ihm zu schaffen. Er ertrug sie nur wegen der panischen Angst, die er verursachte. Aber dann fiel ihm ein, dass, wenn sie eine Suche nach ihm einleiteten, sie möglicherweise auch im Holzschuppen nachsehen würden. Er wusste, dass es nicht mannhaft wäre, so schnell aufgegriffen zu werden. Er war sich jetzt nicht mehr sicher, dass er für immer fortbleiben wollte, aber jedenfalls hatte er vor, etwas mehr Schaden anzurichten, bevor er sich zugestand, geschnappt zu werden. Wenn ihm nicht mehr gelang, als seine Mutter wütend zu machen, würde sie ihn verdreschen, sobald sie ihn vor die Augen bekam. Er musste Zeit gewinnen, um sicherzugehen. Wenn er lange genug durchhielt, war ihm ein liebevoller Empfang sicher, selbst wenn er vor Sünden triefte.
Offenbar hatte sich der Sturm noch gesteigert, denn als er hinausging, erfasste er ihn heftig mit rauer und gnadenloser Kraft. Keuchend, gepiesakt und halb geblendet von den treibenden Flocken, war er nun ein heimatloses Kind, verbannt, ohne Freunde und mittellos. Mit zerspringendem Herzen dachte er an sein Zuhause und seine Mutter. In seinen elenden Augen waren sie so fern wie der Himmel.
Horace war derart raschen Gefühlsschwankungen unterworfen, dass er bloß hin- und hergerissen wurde wie ein Drachen. Er war nun bestürzt von der gnadenlosen Grausamkeit seiner Mutter. Sie war es, die ihn hinaus in diesen wilden Sturm gestoßen hatte, und sie war seinem Schicksal gegenüber gleichgültig, vollkommen gleichgültig. Der verlassene Heimatlose war nicht mehr in der Lage zu weinen. Die tiefen Schluchzer ergriffen seine Kehle, so dass sein Atem in kurzen, hastigen Stößen kam. Alles in ihm war besiegt, abgesehen von dem rätselhaften kindlichen Ideal der Förmlichkeit. Dieses Prinzip behauptete sich weiter, und nur das lag zwischen ihm und der Unterwerfung. Wenn er aufgab, dann musste er auf eine Art aufgeben, die dem unbestimmten Code entsprach. Er sehnte sich schlicht danach, zur Küche zu gehen und hineinzustolpern, aber dies verbat ihm sein unergründlicher Sinn für Schicklichkeiten.
Bald fand er sich am Beginn der Niagara Avenue und starrte durch den Schnee in die erleuchteten Fenster von Stickneys Metzgerladen. Stickney war der Familienmetzger, nicht so sehr, weil er andere Metzger in Whilomville übertraf, als vielmehr, weil er nebenan wohnte und ein enger Freund von Horaces Vater gewesen war. Reihen glänzender Schweine hingen mit dem Kopf nach unten jenseits der Tische, die mächtige Stücke von rotem Rindfleisch bargen. Magere Truthähne waren hier und da in Bündeln aufgehängt. Stickney, rüstig und frohgemut, scherzte mit einer Frau in einem Umhang, die, mit einem Riesenkorb am Arm, um irgendetwas im Wert von acht Cent feilschte. Horace beobachtete sie durch eine bereifte Scheibe. Als die Frau heraus- und an ihm vorbeikam, ging er zur Tür. Er berührte den Riegel mit den Fingern, zog sich aber plötzlich wieder auf den Gehsteig zurück. Drinnen pfiff Stickney gut gelaunt und sortierte seine Messer.
Schließlich schritt Horace verzweifelt voran zur Tür, öffnete sie und betrat den Laden. Sein Kopf hing tief herab. Stickney hörte auf zu pfeifen.
„Hallo, junger Mann“, rief er, „was führt dich hierher?“
Horace hielt inne, sagte aber nichts. Er schwang einen Fuß vor und zurück über den sägemehlbestreuten Boden.
Stickney hatte seine beiden fetten Hände mit den Flächen nach unten und weit auseinander auf den Tisch gestützt, die Haltung des Metzgers einem Kunden gegenüber, aber nun richtete er sich auf.
„Nanu“, sagte er, „was ist los? Was ist los, Kleiner?“
„Nichts“, antwortete Horace rau. Etwas in seiner Kehle machte ihm für einen Augenblick zu schaffen, dann fügte er hinzu: „’s is’ nur … ich bin … ich bin weggelaufen und …“
„Weggelaufen!“, rief Stickney. „Weggelaufen von wo? Von wem?“
„Von … zu Hause“, antwortete Horace. „Ich kann’s da nicht mehr aushalten. Ich …“ Er hatte sich eine Rede zurechtgelegt, um die Sympathie des Metzgers zu gewinnen, er hatte eine Aufstellung vorbereitet, um das Für und Wider seines Falles so logisch wie möglich darzulegen, aber es war, als wäre sein Kopf wie leergefegt. „Ich bin weggelaufen. Ich …“
Stickney streckte eine enorme Hand über das Aufgebot an Fleisch und packte den Auswanderer mit festem Griff. Dann schwang er sich hinüber auf Horaces Seite. Sein Gesicht verzog sich in einem Lachen und er schüttelte seinen Gefangenen spaßhaft. „Komm, komm, komm. Was ist das denn für ein horrender Blödsinn? Weggelaufen, he? Weggelaufen.“ Woraufhin der so arg geprüfte Mut des Kindes sich in Geheule Luft machte.
„Komm, komm“, sagte Stickney lebhaft. „Lass nur gut sein, lass gut sein. Du kommst jetzt schön mit mir mit. Wird alles wieder gut. Ich mach das schon. Lass gut sein.“
Fünf Minuten später führte der Metzger, einen weiten Ulster-Mantel über der Schürze, den Jungen nach Hause.
Schon an der Türschwelle hisste Horace seinem Stolz die letzte Flagge. „Nein … nein“, schluchzte er. „Ich will nicht. Ich will nicht da reingehen.“ Er stemmte den Fuß gegen die Stufe und zeigte eine beachtliche Gegenwehr.
„Ach was, Horace“, rief der Metzger. Er stieß mit einem Knall die Tür auf. „Hallo, da drinnen!“ Auf der anderen Seite der dunklen Küche öffnete sich die Tür zum Wohnzimmer und Tante Martha erschien. „Sie haben ihn gefunden!“, schrie sie.
„Wir kommen auf einen Besuch“, brüllte der Metzger. Am Durchgang zum Wohnzimmer senkte sich Stille über sie alle. Auf einer Couch sah Horace seine Mutter liegen, schlaff, bleich wie der Tod, Schmerz schimmerte in ihren Augen. Es entstand eine spannungsvolle Pause, bevor sie eine wächserne Hand nach Horace ausstreckte. „Mein Kind“, murmelte sie mit bebender Stimme. Woraufhin der angesprochene Bösewicht, mit einem langgezogenen Klagelaut, gemischt aus Kummer und Freude, eilig zu ihr lief. „Ma-ma! Ma-ma! Oh, Ma-ma!“ Sie war nicht in der Lage verständlich zu sprechen, als sie ihn in ihre schwachen Arme schloss.
Tante Martha wandte sich verbissen dem Metzger zu, weil ihr Gesicht sie verriet. Sie weinte. Sie machte eine halb militärische, halb feminine Geste.
„Wollen Sie nicht ein Glas von unserem Süßbier, Mr. Stickney? Es ist selbstgemacht.“
Redner in Nöten
In der Schule von Whilomville war es üblich, dass sich die Kinder, wenn sie eine gewisse Klasse erreicht hatten, am Freitagnachmittag dem widmeten, was man Vortragskunst nannte. Dies in dem erbarmungswürdig ignoranten Glauben, man könne sie auf diese Weise zu Rednern machen. Im Zuge der Schulordnung wurden unglückliche Jungen und Mädchen herangezogen, ihren Schulkameraden die Literatur der Jahrhundertmitte vorzutragen. Vielleicht litten darunter am meisten jene Kinder, die sich am besten ausdrücken konnten, die Kinder, die für die Macht des Gesprochenen am empfänglichsten waren. Kleine Dummköpfe, die acht Zeilen konventioneller Dichtung auswendig lernen und aufspringen und sie ihren Klassenkameraden schnell abspulen konnten, litten dabei nicht im Geringsten. Der Plan war wohl im Wesentlichen, viele Kinder dauerhaft davon abzuschrecken, sich mit ihren Gedanken an ihre Mitmenschen zu wenden.
Jimmie Trescott kam auf die Idee, durch Zurschaustellung ungebührlicher Ignoranz der Überführung in das erste Klassenzimmer zu entkommen, dessen Insassen eine solche Schikane erwartete. Er zog es vor, im Schatten weniger klassischer Gefilde zu verweilen, anstatt sich in eine Domäne zu wagen, wo ihm eine Pflicht aufgezwungen wurde, die ihm schlimmer erschien als der Tod. Doch ob er nun wollte oder nicht, man schickte ihn irgendwie doch an den Ort der Qualen.
Jeden Freitag mussten mindestens zehn der kleinen Kinder das Podest hinter dem Tisch des Lehrers erklimmen und etwas brabbeln, was keines von ihnen verstand. Damit wollte man sie zu Rednern machen. Hätte man angeordnet, sie sollten quaken wie Frösche, wäre den meisten von ihnen der Weg zur Kunst der Rhetorik nicht weiter vorgekommen.
Alphabetisch stand Jimmie Trescott fast am Ende auf der Liste der Opfer, aber schließlich musste seine Zeit eben doch kommen. „Tanner, Timmens, Trass, Trescott …“ Er sah seinen Untergang nahen.
Er ließ es teilnahmslos über sich ergehen, dass ihm die Lehrerin die unverständlichen Zeilen von „The Charge of the Light Brigade“ eintrichterte.
Eine halbe Leuge, eine halbe Leuge,
Eine halbe Leuge von hier …
Er konnte sich von einer „Leuge“ keine Vorstellung machen. Hätte ihm im alltäglichen Leben jemand gesagt, dass er eine halbe „Leuge“ weit von zu Hause weg war, hätte er vielleicht Angst gehabt, eine halbe „Leuge“ seien fünfzig Kilometer. Aber er kämpfte mannhaft mit dem Tal des Todes und den mystischen Sechshundert, die dort etwas darboten, das großartig war, wie man ihm sagte. Er lernte alle Strophen. Aber als sein Freitagnachmittag näherkam, drängte es ihn, seine Familie darüber in Kenntnis zu setzen, dass eine schreckliche Krankheit ihn befallen hatte und im Begriff stand, ihn am Gang zu seiner geliebten Schule zu hindern.
An dem großen Freitag, an dem die Kinder seines Namens ihre Stücke vorzusprechen hatten, war Doktor Trescott nicht zu Hause, und die Mutter des Jungen war über die Maßen alarmiert angesichts der merkwürdigen Krankheit, die ihn dazu brachte, auf dem Teppich vor dem Kaminfeuer zu liegen und aus tiefster Seele zu stöhnen. Sie badete seine Füße in heißem Senfsud, bis sie krebsrot waren. Sie legte ihm außerdem ein Senfpflaster auf die Brust. Er ließ verlauten, dass diese Mittel ihm nicht im Geringsten wohltaten – nicht im Geringsten. Mit dem Gehabe eines Märtyrers erduldete er den ganzen Tag lang einen regelrechten Schwall mütterlicher Aufmerksamkeit. Auf diese Weise verbrachte er den ersten Freitag in Sicherheit. Mit beispielloser Geduld saß er vor dem Feuer im Esszimmer und sah sich Bilderbücher an, und er klagte nur dann über Schmerzen, wenn er bei seiner Mutter den Gedanken aufkeimen sah, es gehe ihm besser.
Am nächsten Tag – ein Samstag und somit schulfrei – war er wunderbarerweise aus der Umklammerung der Krankheit befreit und nahm seine Spiele wieder auf, ein gesunder Junge, wie er lautstark bewies.