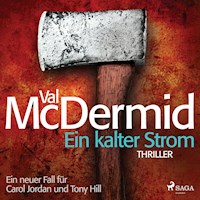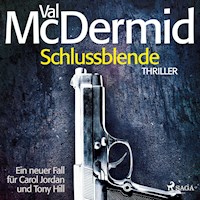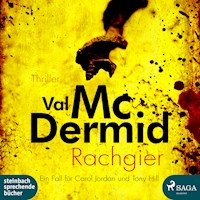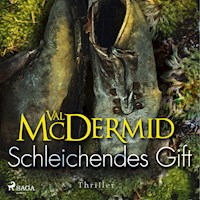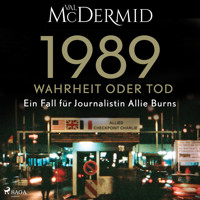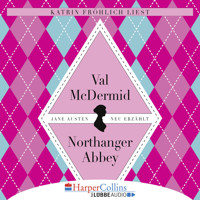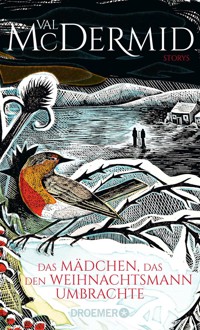6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
In der Idylle des Lake District wird eine zweihundert Jahre alte Moorleiche entdeckt. Der Tote weist bizarre Tätowierungen aus der Südsee auf und bestärkt einen Verdacht, den die junge Literaturwissenschaftlerin Jane Gresham schon länger hegt: Könnte es sich um die sterblichen Überreste von Fletcher Christian handeln, jenem legendären Anführer der Meuterei auf der Bounty? Ist er damals vielleicht heimlich zurückgekehrt und hat mit seiner abenteuerlichen Geschichte William Wordsworth, dem berühmten Dichter und Jugendfreund, den Stoff für ein verschollenes Meisterwerk geliefert? Jane scheint nicht die Einzige zu sein, die auf der Suche nach dem wertvollen Manuskript ist. Denn plötzlich geht der Tod um. Innerhalb kurzer Zeit verlieren alle, bei denen man das Epos vermutet, auf mysteriöse Weise ihr Leben ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 695
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Val McDermid
Das Moor des Vergessens
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
Für Kelly – mein Schneeblümchen
O Reader! had you [...]
[Kapitel]
Präludium
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
Danksagung
Für Kelly – mein Schneeblümchen
O Reader! had you in your mind
Such stores as silent thought can bring,
O gentle Reader! you would find
A tale in every thing.
William Wordsworth
Simon Lee
O Leser! Hättest in deinem Sinn
gehortet still Gedankenwert,
du fändest dann in jedem Ding,
o Leser, eine Mär.
Präludium
September 2005
Jede Landschaft hat ihr Geheimnis. Schicht für Schicht ist die Vergangenheit unter der Oberfläche verborgen. Nur selten ist ihr Geheimnis unwiederbringlich verloren, es wartet nur darauf, dass durch menschliche Eingriffe oder die Unbilden des Wetters in der Gegenwart ihr Skelett unter Haut und Fleisch wieder zum Vorschein kommt. Die Vergangenheit bleibt uns immer erhalten, genau wie die Armut.
Diesen Sommer regnete es in England, als sei das Land in die Tropen versetzt worden. Das Wasser ergoss sich in Sturzbächen, zerstörte wundervolle Gärten und machte aus den Wiesen einen Morast, auf dem das Vieh bis zu den Fesseln im Matsch watete. Die Flüsse traten über die Ufer, ihre plötzlich befreiten Wassermassen suchten sich ihren eigenen Weg und zerstörten alles, was ihnen in die Quere kam. Auf den überschwemmten Straßen der bisher malerischen Dörfer wurden die Autos wie Spielzeug mitgerissen und blieben im Hafen liegen, der vom Chaos zerschmetterter Metallteile blockiert war. Fahrzeuge wurden durch Erdrutsche verschüttet, und die Farmer klagten über ihre verdorbene Ernte.
Kein Teil des Landes blieb vom dichten nadelfeinen Regen verschont. Stadt und Land litten gleichermaßen unter der Last des nassen Elements. Im Lake District prasselte es auf Berge und Täler nieder und veränderte sogar unmerklich die Konturen der jahrhundertealten Landschaft. Die Wasserstände der Seen erreichten in diesem Sommer Rekordhöhen, und der einzige erkennbare Vorteil war, dass alles in einem üppigeren Grün als sonst leuchtete, wenn gelegentlich die Sonne schien.
Über dem Dorf Fellhead an den Ufern des Langmere hatte die ungestüme Macht des Wassers den alten Torfhexen neue Form verliehen. Und als es langsam Herbst wurde, gab die Erde nach und nach eines ihrer wohlgehüteten Geheimnisse preis.
Aus der Ferne sah es wie ein faltiges Stück Zeltplane mit braunen Flecken vom brackigen Moorwasser aus. Auf den ersten Blick schien es unbedeutend, nur Abfall, der an die Oberfläche gekommen war. Aber wenn man genauer hinsah, war es etwas, das einen schaudern ließ, das weit über die Jahrhunderte zurückreichte und viel dramatischere Veränderungen mit sich bringen sollte als das Wetter.
Mein geliebter Sohn,
ich hoffe, dass ihr alle, du und deine Kinder, bei guter Gesundheit seid. Ich habe dieser Tage etwas gefunden, das mir Sorgen macht – von der Hand deines Vaters geschrieben. Es mag dich überraschen, dass ich, obwohl wir so vertraut miteinander waren, zu seinen Lebzeiten nichts davon wusste, und ich wünschte mir sehr, es hätte so bleiben können. Du wirst sicher verstehen, dass dies ein Geheimnis bleiben musste, solange dein Vater noch lebte, und er hinterließ mir keine Anweisung, wie ich damit verfahren soll. Da es dich so direkt betrifft und vielleicht noch mehr Schmerz verursachen würde, will ich dir die Entscheidung überlassen, wie damit umgegangen werden soll. Ich übergebe dir die Sache also zu treuen Händen. Du musst so handeln, wie es dir recht erscheint.
Deine dich liebende Mutter
1
So wie es in diesem Sommer regnete,
es hätte dir das Herz gebrochen.
Die Wassermassen zerbarsten
und schossen über die Blechdächer
trostloser Bahnhöfe.
Und ich saß da und wartete auf Züge,
die Füße in einer trüben Pfütze,
im Kopf nichts als Leere und Regen,
und dachte an dich, so viele Meilen entfernt von mir
unter der griechischen Sonne,
wo niemals Regen fällt.
Jane Gresham starrte auf das, was sie geschrieben hatte, hinunter und strich es dann mit einem ungeduldigen Federstrich so heftig durch, dass das Papier zerriss. Dieser Scheiß-Jake, dachte sie wütend. Sie war doch erwachsen, kein verliebter Teenager. Und pseudo-lyrische Ergüsse waren etwas, das sie schon seit Jahren hinter sich haben sollte. Sie konnte sich selbst gut genug einschätzen, dass ihr bereits bei ihrem ersten Uniexamen klar gewesen war, eine Dichterin würde sie nie sein. Sie war gut im Studium von Gedichten anderer, im Interpretieren ihrer Werke, den thematischen Zusammenhängen ihrer Verse, und konnte sie in ihrer Komplexität anderen zugänglich machen, denen sie, so hoffte sie jedenfalls, darin einige Schritte voraus war. »Gemeiner Kerl«, sagte sie laut, zerknüllte das Blatt und warf es in den Papierkorb. Er verdiente es nicht, dass sie sich seinetwegen den Kopf zerbrach. Und genauso wenig hatte er den ihr so vertrauten Schmerz verdient, der sie bei dem Gedanken an ihn ergriff.
Sie wollte nicht mehr an Jake denken und wandte sich in dem engen Zimmer, das die Wohnungsbehörde zwar als Schlafzimmer einstufte, das sie aber in bewusster Anmaßung ihr Arbeitszimmer nannte, einem Stoß CDs neben dem Schreibtisch zu. Sie las die Titel und fing bei der Suche nach einem Song, der sie nicht an ihn erinnerte, absichtlich am unteren Ende an. Was war er eigentlich? Ihr Ex? Ihr ehemaliger Liebhaber? Ihr zeitweilig nicht verfügbarer Lover? Wer wusste das? Sie jedenfalls nicht. Und sie hatte wirklich Zweifel daran, dass er nach einer Woche überhaupt noch einen Gedanken an sie verschwenden würde. Leise vor sich hin murmelnd, zog sie Nick Caves Murder Ballads heraus und legte sie ins CD-Laufwerk ihres Computers. Die dunkel grollende Stimme passte so gut zu ihrer Stimmung, dass sie paradoxerweise wie ein Gegenmittel wirkte. Unwillkürlich lächelte Jane.
Sie nahm das Buch, das sie hatte lesen wollen, bevor Jake Hartnell sie abgelenkt hatte. Aber sie brauchte nur ein paar Minuten, bis ihr klar wurde, wie weit sie in Gedanken davon entfernt war. Ärgerlich über sich selbst schlug sie heftig das Buch zu. Wordsworths Briefe von 1807 würden eben warten müssen.
Bevor sie sich entschieden hatte, was sie als Nächstes in Angriff nehmen wollte, klingelte der Wecker ihres Mobiltelefons. Jane runzelte die Stirn und verglich die Zeit auf ihrem Telefon mit der auf ihrer Uhr. »Verflixt«, sagte sie. Wie war es möglich, dass es schon nach halb zwölf war? Wo war der Morgen geblieben?
»Scheiß-Jake«, sagte sie wieder, sprang auf und schaltete den Computer ab. So viel Zeit mit dem Gedanken an ihn zu vertrödeln, wo es doch bessere Dinge gab, auf die man sich stürzen konnte. Sie griff nach ihrer Tasche und ging ins andere Zimmer. Offiziell war dies ihr Wohnzimmer, aber Jane nutzte es als Wohn-/Schlafraum, weil sie lieber einen Raum ausschließlich zum Arbeiten haben wollte. Dadurch war der Rest der Wohnung etwas beengt, aber sie fand, das war kein zu hoher Preis dafür, dass sie einen Platz hatte, wo sie ihre Bücher und Papiere liegen lassen konnte, ohne jedes Mal alles wegräumen zu müssen, wenn sie essen oder zu Bett gehen wollte.
Das kleine Zimmer bot selbst für ihren spartanischen Lebensstil kaum genug Raum. Ihre Bettcouch nahm den meisten Platz ein, obwohl sie jetzt zusammengeklappt war. An der gegenüberliegenden Wand stand ein Tisch mit drei darunter geschobenen Stühlen. Ein kleiner Fernseher war hoch oben auf einem Wandarm montiert, und ein Knautschsessel lag ganz hinten in der Ecke. Aber mit dem frischen lindgrünen Anstrich wirkte das Zimmer hell und freundlich. Der Couch gegenüber hingen einige farbige Digitalfotos vom Lake District, die auf A3-Format vergrößert und laminiert waren. Mitten in der Landschaft lag Greshams Farm, wo ihre Familie, so weit man zurückdenken konnte, ihr mageres Auskommen gefunden hatte. Egal, wie es draußen vor den Fenstern aussah, Jane konnte morgens in der Welt aufwachen, in der sie aufgewachsen war und die ihr immer noch an jedem einzelnen Tag ihres Stadtlebens fehlte.
Sie zog ihre Freizeithose und ihr Oberteil aus Fleecestoff aus und eine enge schwarze Jeans und ein schwarzes Stretchtop mit spitzem Ausschnitt an, das ihre ansehnlichen Brüste betonte. Es war keineswegs ihre Lieblingskleidung, aber die Erfahrung hatte ihr gezeigt, dass sie mehr Trinkgelder von den Gästen bekam, wenn sie ihre Vorzüge unterstrich. Glücklicherweise wirkte sie dank ihres dunklen Teints in schwarzer Kleidung nicht sterbenskrank, und ihr Kollege Harry hatte ihr versichert, dass sie in dem engen Top nicht so plump aussah, wie sie sich vorkam. Nach einem Blick aus dem Fenster auf das Wetter nahm sie ihre Regenjacke vom Haken, streifte sie über und eilte zur Wohnungstür. Es war ihr egal, dass sie alles andere als chic aussah, bei diesem Platzregen war es ihr wichtiger, trocken und warm zur Arbeit zu kommen.
Jane warf wie immer einen letzten Blick auf die Ansichten vom Lake District, bevor sie in eine völlig andere Welt hinausging. Sie glaubte nicht, dass irgendjemand in Fellhead sich ihre jetzige Umgebung vorstellen konnte, nicht einmal in seinen schlimmsten Träumen. Als sie ihrer Mutter gesagt hatte, dass ihr eine Sozialwohnung in der Marshpool-Farm-Siedlung zugeteilt worden sei, hatte Judy Gresham gestrahlt. »Das ist aber schön, Schatz«, sagte sie. »Ich wusste gar nicht, dass es in London Farmen gibt.«
Jane schüttelte resigniert, aber zugleich amüsiert den Kopf. »Es gibt dort seit Ewigkeiten keine Farm mehr, Mum. Es ist eine Wohnsiedlung aus den sechziger Jahren. Beton so weit das Auge reicht.«
Enttäuschung trat auf das Gesicht ihrer Mutter. »Ach. Na ja, wenigstens hast du ein Dach über dem Kopf.«
Dabei beließen sie es. Jane kannte ihre Mutter gut genug, um sich darüber klar zu sein, dass sie die Wahrheit gar nicht wissen wollte. Jane erfüllte nämlich so wenige der erforderlichen Bedingungen, dass die einzige Wohnung, die die Wohnungsbehörde ihr anbieten würde, genau einer solchen Behausung entsprach, in der sie gelandet war. Ein Hasenstall, für den kaum ein Mieter zu finden war, in einer heruntergekommenen Siedlung im East End, wo fast niemand legale Arbeit hatte, wo Tag und Nacht die Kinder ohne Aufsicht herumtobten und wo es mehr gebrauchte Kondome und Spritzen gab als Grashalme. Nein, Judy Gresham würde sich auf keinen Fall vorstellen wollen, dass ihre Tochter an einem solchen Ort lebte. Von allem anderen abgesehen, würde es ja auch die Möglichkeiten sehr einschränken, mit Jane und ihrem Erfolg anzugeben.
Aber ihrem Bruder Matthew hatte sie es erzählt. Alles war ihr recht, um die Bitterkeit zu dämpfen, die er empfand, weil sie diejenige war, die es geschafft hatte, wegzugehen, während er, wie er sich ausdrückte, im hinterletzten Kaff verschimmelte, wo ja wegen der Eltern jemand bleiben musste. Es spielte dabei keine Rolle, dass er als der Ältere zuerst ausgeflogen war, studiert und dann beschlossen hatte, zu der Arbeit zurückzukommen, die er sich immer schon gewünscht hatte. Matthew, dachte Jane, war einfach schon beleidigt zur Welt gekommen.
Das Ironische daran war, dass Jane London sofort gegen Fellhead eingetauscht hätte, wenn sie dort die geringste Chance gehabt hätte, der Arbeit nachzugehen, die sie liebte. Aber es gab im Lake District keine Stellen für Akademiker, nicht einmal für eine Wordsworth-Spezialistin wie sie. Höchstens wenn sie die streng wissenschaftliche Forschung gegen Vorträge in Schulen über die Dichter des Lakeland eingetauscht hätte. Doch bestimmt hätte nichts anderes ihre Liebe zum Wort schneller zerstört. Also saß sie hier im schlimmsten städtischen Inferno fest. Jane drückte das Kinn auf die Brust, als sie über die Galerie zum Treppenhaus ging. Die Bauweise ihres Blocks konnte sie nur einer bösartigen Laune des Architekten zuschreiben, denn der Wind aus der meistens vorherrschenden Richtung pfiff so über die Fußwege, dass einem selbst die sanfteste Sommerbrise stürmisch und unangenehm vorkam. An diesem regnerischen Herbsttag fegte der Wind in jede Ecke und jeden Winkel des Gebäudes und drang in die Kleider der Bewohner, die sich aus ihren Wohnungen herauswagten.
Jane wandte sich dem Treppenhaus zu und hatte kurz Ruhe vor ihm. Mit dem Aufzug fahren zu wollen war sinnlos. Sie ignorierte die Graffiti mit den vielen Rechtschreibfehlern, die unappetitlichen Abfallhäufchen, die vom Wind in die Ecken geweht worden waren, und den Gestank von Fäulnis und Urin und ging die Treppe hinunter. An der ersten Biegung drehte es Jane fast den Magen um. Der Anblick war ihr so vertraut, dass sie eigentlich daran hätte gewöhnt sein müssen, aber jedesmal, wenn sie die kleine Gestalt im wackeligen Lotossitz drei Stockwerke höher auf dem schmalen Treppengeländer sitzen sah, zitterten ihr die Knie.
»He, Jane«, rief die kleine Gestalt leise.
»Hallo, Tenille«, antwortete Jane und zwang sich trotz ihrer Angst zu einem Lächeln.
Tenille streckte die Beine aus und ließ sich mit todesverachtender Lässigkeit auf den feuchten Beton neben Jane gleiten. »Weißte was Neues?«, fragte die Dreizehnjährige, während sie neben ihr herging.
»Ich weiß nur, dass ich zu spät zur Arbeit komme, wenn ich mich nicht beeile«, sagte Jane, beschleunigte ihre Schritte und lief die Treppe hinunter. Tenille ging genauso schnell, und ihre langen Dreadlocks hüpften auf ihren schmalen Schultern.
»Ich komm mit«, sagte Tenille und versuchte mit recht kümmerlichem Erfolg den großspurigen Gang der kleinen Gangster nachzuahmen, die sich im Labyrinth dieser trostlosen Siedlung herumtrieben und ihr Gewerbe von älteren Brüdern, Cousins oder sonst irgendjemandem lernten, der es geschafft hatte, lange genug außerhalb der Knastmauern zu bleiben, um es ihnen beizubringen.
»Ich hör mich nicht gern wie ’ne alte spießige Nervensäge an, Tenille, aber solltest du nicht in der Schule sein?« Es war Janes üblicher Spruch, und sie wusste die Antwort schon im Voraus.
»Die Lehrer ham mir nix zu sagen«, antwortete Tenille automatisch und machte noch größere Schritte, um mit Jane mithalten zu können, als sie die Straße erreichten. »Was wissen die schon von meinem Leben?«
Jane seufzte. »Ich hab’s so satt, Tenille, immer wieder das Gleiche von dir zu hören. Du bist doch viel zu intelligent, um dich mit dem Mist abzufinden, der auf dich zukommt, wenn du keine Ausbildung hast.«
Tenille steckte die Hände in die Taschen ihrer dünnen Jacke aus Lederimitat und zuckte abwehrend die schmalen Schultern. »Ach, scheiß drauf«, sagte sie. »Ich will doch kein Brutkasten für so ’n kleenen Scheißer sein. So ’n Baby-Mamma-Drama is nix für Tenille.«
Sie passierten einen Durchgang unter dem Wohnblock und kamen neben einer Schnellstraße wieder heraus, wo Autos vorbeirasten, deren Fahrer sich freuten, endlich aus dem zweiten Gang hochschalten zu können, sodass die Reifen auf dem nassen Asphalt zischten. »Schwer, sich vorzustellen, wie du das vermeiden willst, wenn du deinen Kopf nicht anstrengst«, sagte Jane trocken und hielt gebührenden Abstand von der Straße und den vorbeifahrenden, spritzenden Fahrzeugen.
»Ich will so sein wie du, Jane.« Dies war ein Wunsch, den Jane schon unzählige Male von Tenille gehört hatte.
»Dann geh in die Schule«, sagte sie und versuchte, ihre Frustration zu verbergen.
»Ich hasse das sinnlose Zeug, was wir dort machen müssen«, sagte Tenille und verzog die Lippen zu einem spöttischen Grinsen, das ihr unbefangenes nettes Gesicht zu einer starren verächtlichen Maske machte. »Es ist nicht so wie die Sachen, die du mir zu lesen gibst.« Ihre Ausdrucksweise hatte sich vom Straßenslang zu vorschriftsmäßigem Englisch gewandelt, als erlaube ihr das Verlassen der Siedlung, ihre Rolle abzustreifen und sich als normaler Mensch zu geben.
»Das ist mir klar. Aber auch ich habe mein Ziel noch nicht erreicht, weißt du. Als ich angefangen habe, wollte ich eigentlich nicht in Bars und Seminarräumen jobben, während ich mein Buch schreibe, damit ich eine richtige Stelle bekommen kann. Aber um auch nur so weit zu kommen, musste ich den gleichen Mist durchmachen. Und es stimmt, ich betrachte den größten Teil davon als Mist«, fuhr sie fort und übertönte damit, was immer Tenille noch hatte einwenden wollen. Sie wünschte, sie könnte ihr etwas anderes als Plattitüden bieten, aber sie wusste nicht, was sie einer dreizehnjährigen Waise mit dunkler Haut sagen sollte, die Wordsworth, Coleridge, Shelley und De Quincey nicht nur verehrte, sondern auch die Bedeutung ihrer Werke mit einer Leichtigkeit erfasste, die zu erreichen Jane selbst zehn Jahre konzentrierten Studiums gekostet hatte.
Tenille wich einem Kinderwagen aus, in dem ein Kleinkind mit schokoladebeschmiertem Mondgesicht und einem Schnuller im Mund lag, der wie ein Stöpsel die Luft zu stoppen schien, damit die dicken Backen aufgeblasen blieben. Die junge Frau, die den Kinderwagen schob, wirkte nicht viel älter als Tenille. »So was schaff ich einfach nicht, Jane«, sagte Tenille niedergeschlagen. »Vielleicht könnte ich irgendwas anderes mit Versen machen. Rappen wie Ms. Dynamite«, fügte sie hinzu, klang aber nicht sehr überzeugt.
Sie wussten beide, dass es nie so weit kommen würde. Außer wenn jemand eine Droge zur Hebung des Selbstbewusstseins erfände, die Jane ihr spritzen könnte, bevor sie dem Heroin verfiel, das die halbe Siedlung als Beruhigungsmittel zu nehmen schien. Jane blieb an der Bushaltestelle stehen und wandte sich Tenille zu. »Niemand kann dir die Worte in deinem Kopf wegnehmen«, sagte sie.
Tenille zupfte an einem abgekauten Fingernagel und starrte auf den Gehweg. »Meinst du, das weiß ich nicht?«, schrie sie beinahe. »Wie sonst meinst du, verdammt noch mal, schaffe ich es, zu überleben?« Plötzlich drehte sie sich auf den Fußballen um, lief weg und sprang mit überraschend eleganten Bewegungen wie eine Gazelle den unebenen Bürgersteig entlang. Sie verschwand in einer Gasse, und Jane empfand die gewohnte Mischung aus herzlicher Zuneigung und Frust. Während der zehn Minuten Busfahrt dachte sie weiter darüber nach, und der Gedanke verfolgte sie immer noch, als sie die Tür der Weinbar aufstieß.
Fünf Minuten vor zwölf wirkte die Viking Bar kahl und leer. Das helle Holz, Glas und Chrom glänzten unter den Halogenleuchten, ein Zeichen, dass noch niemand da gewesen war, seit die Putzfrau nach Hause gegangen war. Harry hatte Michael Nymans CDThe End of an Affair aufgelegt, und der Klang der Streicher schien fast sichtbar in der Stille zu strahlen. In zwanzig Minuten, wenn die Großstädter hereindrängten und in ihrer kurzen Pause schnell so viel wie möglich zu essen und zu trinken versuchten, würde die Viking Bar sich verwandeln. Es würde laut hergehen, die Luft vom Rauch und den vielen Menschen verbraucht sein, und Jane würde keine Sekunde Zeit haben, an etwas anderes zu denken als an die Gäste, die sich an der Bar drängten.
Aber im Moment war es noch friedlich. Harry Lambton stand mit aufgestützten Armen am einen Ende der langen bogenförmigen Theke aus Birkenholz und überflog die Zeitung. Das Licht schimmerte auf dem Kranz seiner kurzen, steil hochstehenden blonden Haare und ließ ihn wie einen postmodernen Heiligen aussehen. Als er Janes Schritte auf dem Holzboden hörte, sah er auf und winkte ihr einen kurzen Gruß zu, während ein Lächeln sein scharf geschnittenes, schmales Gesicht belebte. »Regnet’s noch?«, fragte er.
»Ja, regnet noch.« Jane beugte sich zu ihm und küsste ihn auf die Wange, als sie an ihm vorbei in die kleine Kammer ging, wo das Personal seine Mäntel aufhängte. »Sind alle da?«, fragte sie, als sie in die Bar zurückkam, während sie ihre langen dunklen Korkenzieherlocken mit einem Haargummi zusammenband.
Harry nickte. Gott sei Dank, dachte Jane, schlüpfte an seinem muskulösen Rücken vorbei und vergewisserte sich, dass alles da stand, wo sie es brauchte, damit ihre Schicht so problemlos wie möglich verlaufen würde. Sie hatte diese Stelle bekommen, weil Harrys Freund Dan ein Bekannter und ein Kollege von ihr an der Uni war, aber sie wollte nicht, dass man ihr vorwerfen würde, sie nutze diese Beziehung aus. Außerdem behauptete Harry, dass er das Lokal nur vorübergehend führe. Eines Tages werde er vielleicht wirklich aus seinem Leben das machen, was er eigentlich vorhatte, und Jane wollte ihren Kollegen keine Gelegenheit geben, sie bei ihrem neuen Chef als faul oder unfähig anzuschwärzen. Die Arbeit in der Viking Bar war anstrengend, ermüdend und wurde schlecht bezahlt, aber sie brauchte sie.
»Ich hab endlich einen Titel gefunden«, sagte sie, während sie sich eine lange weiße Kellnerschürze umband. »Für das Buch.« Harry neigte fragend den Kopf zur Seite. »Der große Dichter und sein Image. Politik, Poetik und Anspruch in William Wordsworths Werken. Was hältst du davon?«
Harry runzelte die Stirn und überlegte. »Gefällt mir«, sagte er. »Da klingt der alte Langweiler sogar halbwegs interessant.«
»Interessant ist gut, das verkauft sich.«
Harry nickte, blätterte um und ließ den Blick über die Seite schweifen. Dann wurden seine dunkelblauen Augen schmal und zwischen seinen hellbraunen Augenbrauen entstand eine Falte. »He«, sagte er. »Fellhead, ist das nicht der Ort, wo du herkommst?«
Mit einem Glas Oliven in der Hand drehte Jane sich um. »Stimmt. Sag bloß, da hat endlich mal jemand was getan, das in die Nachrichten gekommen ist?«
Er zog die Augenbrauen hoch. »Das könnte man wohl sagen. Eine Leiche wurde gefunden.«
Heute Abend wurde ich an unsere Zeit in Alfoxden erinnert, wo auf Coleridge und mich der Verdacht fiel, wir seien Agenten des Feindes und sammelten als Spione Informationen für Bonaparte. Ich habe Coleridges Erklärung noch in Erinnerung, dass es gegen den gesunden Menschenverstand verstieße, zu meinen, Dichter eigneten sich für ein solches Unterfangen, da wir doch alles als Material für unsere Verse ansehen und keine Neigung dazu hätten, Geheimnisse, die unserer Berufung dienen könnten, in der Brust zu verschließen. Er hatte in diesem wichtigen Punkt Recht, dass die Ereignisse des heutigen Tages mich bewegen und nach einem Ausdruck in Versen suchen. Aber im Hinblick auf die weit wichtigere Tatsache, dass wir unsere Meinung nicht für uns behalten können, hat er, glaube ich, Unrecht, denn meine Begegnung in unserem abgeschiedenen Garten hat mir bereits eine schwere Wissenslast auferlegt, eine Last, die mir und meiner Familie noch sehr beschwerlich werden könnte. Zuerst wähnte ich zu träumen, denn ich glaube nicht an Erscheinungen der Toten als Geister. Aber dies war kein Geist. Es war ein Mann aus Fleisch und Blut, ein Mann, den ich niemals wiederzusehen geglaubt hätte.
2
Matthew Gresham trank den letzten Schluck Kaffee und stellte seinen Becher in die Spüle. Alle vom Lehrkörper sollten eigentlich ihre Tassen selbst spülen, aber Matthew fand, eine höhere Stellung müsse doch ein paar Vorteile bieten, und ließ daher seit seiner Beförderung zum Schulleiter sein schmutziges Geschirr stehen, damit sich irgendjemand anders darum kümmerte. Außerdem hatte er schließlich Wichtigeres zu tun. Bisher hatte niemand seine Überheblichkeit kritisiert, obwohl er Marcia Porters missbilligende Blicke schon mehr als einmal bemerkt hatte. Aber Marcia hatte nun mal ihre Chance verpasst. Als er es an ihr vorbei in die höchste Position geschafft hatte, gab sie den Versuch auf, die Welt nach ihren Wünschen zu formen. Es war, als hätte sie aufgegeben. Was Matthew tat, mochte ihr zwar nicht gefallen, aber sie versuchte nicht, ihn herauszufordern. Es war nicht so wie vorher, als sie sich theoretisch gleichberechtigt gegenüberstanden, abgesehen davon, dass sie ständig ihr höheres Dienstalter betonte. Dieser Tage machte sie einen möglichst großen Bogen um ihn, so weit das in einer Dorfschule mit fünf Lehrern und vier Helferinnen möglich war.
Helferinnen. Das war ein Witz. Mütter, die Zeit hatten und dem irrigen Glauben anhingen, einfach dadurch, dass sie ein Kind zur Welt gebracht hatten, das Insiderwissen zu besitzen, wie man Kinder erzieht. Aber sie waren noch in der Zeit vor der Einführung der Standardtests und des landesweit gültigen Lehrplans zur Schule gegangen und hatten keinen blassen Schimmer von den hohen Anforderungen, mit denen echte Lehrer wie er täglich leben mussten. Matthew versäumte keine Gelegenheit, sie daran zu erinnern, wie sehr sich die Welt verändert hatte. Die wichtigste Folge dieser Ermahnungen war, dass sie genauso wie seine anderen Mitarbeiter so wenig Zeit wie möglich im Lehrerzimmer herumsaßen. Dies war Matthew recht, denn sein Büro genügte seiner Meinung nach kaum seinen eigenen Bedürfnissen. Er arbeitete viel lieber im Lehrerzimmer, wo er sich einen Kaffee machen konnte, wann immer er Lust hatte.
Er musste sich leicht bücken, um in den Spiegel über dem Spülbecken zu sehen, der so aufgehängt war, dass er besser für Lehrerinnen als für Rektoren passte, die über einen Meter achtzig groß waren. Dunkelblaue Augen sahen ihn aus einem Gesicht mit etwas dunklerem Teint, als hier üblich war, an. Dieses Erbe seines Großvaters aus Cornwall hatten Matthew und Jane von ihrer Mutter. Er fuhr sich durch die dunklen ungebärdigen Locken, die er von der anderen Seite der Familie geerbt hatte. An seiner Schwester sahen sie toll aus, aber ihm gaben sie einfach das Gefühl, eine billige Imitation von Harpo Marx zu sein. Er lächelte ironisch und dachte an den Unterricht, den er gleich in den beiden obersten Klassen halten würde. Genealogie und Genetik, deren gewundene Bahnen zusammengehörten wie die Doppelspirale der DNA, einschließlich der Abweichungen, die zu allen möglichen unvorhergesehenen Folgen führen konnten. An seiner Abstammung konnte es keinen Zweifel geben, auch nicht an der Verwandtschaft mit seiner Schwester. Ihr Vater hatte die gleichen Korkenzieherlocken wie der Großvater vor ihm.
Die Glocke rief zum Nachmittagsunterricht, und Matthew verließ eilig das Lehrerzimmer. Als er sich dem Klassenzimmer näherte, hörte er leises Murmeln, das verstummte, als die fünfzehn Kinder ihn auf der Türschwelle sahen. Das war einer der Vorteile kleiner Dorfschulen, dachte Matthew. Sie lernten zusammen mit den Inhalten des nationalen Lehrplans auch noch Manieren. Er beneidete die armen Kerle nicht, die die Kinder aus der Siedlung unterrichten mussten, wo Jane wohnte. »Guten Tag, Kinder«, sagte er, während er mit seinen langen Beinen schnell den kurzen Weg zum Tisch zurücklegte.
»Guten Tag, Mr. Gresham«, erwiderte der holprige Chor der Schüler.
Er öffnete seinen Laptop und drückte auf eine Taste, um ihn aus dem Wartemodus zu holen. Sogleich erschien auf dem Whiteboard hinter ihm das Abbild des Bildschirms mit der Überschrift Stammbäume. Matthew saß auf der Ecke des Tischs, von wo er die Tastatur leicht bedienen konnte. »Heute fangen wir ein wichtiges neues Projekt an, das wir auch bei der Weihnachtsfeier zeigen werden. Also, wir alle haben Vorfahren. Wer kann mir sagen, was ein Vorfahr ist?«
Ein kleiner Junge mit einem dichten Schopf schwarzer Haare und dem Gesicht eines kleinen Klammeraffen stieß den Finger in die Luft. Vor lauter Eifer rutschte er auf seinem Stuhl herum.
»Sam?«, sagte Matthew und bemühte sich, nicht genervt zu klingen. Immer war es Sam Clewlow.
»Es ist unsere Familie, Sir. Nicht die Familie, die jetzt lebt, sondern alle, die vor uns da waren. Wie zum Beispiel die Großeltern und deren Großeltern.«
»Richtig. Unsere Vorfahren sind die Menschen, die vor uns gelebt und uns zu dem gemacht haben, was wir sind. Jeder von uns ist der Mensch, der er ist, durch die Art und Weise, wie sich unsere Gene im Lauf der Zeit zusammengesetzt haben. Also, weiß jemand, was ein Stammbaum ist?«
Wieder hob Sam Clewlow die Hand. Die anderen sahen gleichgültig oder zufrieden zu, wie Sam alle Arbeit tat und ihnen die Mühe ersparte. Diesmal wartete er nicht, bis er gefragt wurde. »Sir, es ist wie eine Landkarte unserer Familiengeschichte. Da stehen alle Geburtstage drauf und wann und wen sie geheiratet haben und wann sie Kinder bekamen und wann sie gestorben sind und all das.«
»Genau, Sam. Und was wir in den nächsten Wochen machen werden, ist Folgendes: Wir werden versuchen, unsere eigenen Familien darzustellen. Für einige von euch wird das leichter sein als für andere. Diejenigen, deren Familien seit Generationen hier in der Gegend gelebt haben, werden sie in den Kirchenbüchern zurückverfolgen können. Für diejenigen, deren Familien relativ neu hier sind, wird es schwerer sein. Aber was wir bei diesem Projekt vor allem tun werden, ist, die vielen verschiedenen Möglichkeiten aufzuspüren, mit denen wir unsere Vergangenheit ergründen können. Das Besondere an diesem Projekt ist, dass ihr mit den älteren Mitgliedern eurer Familie zusammenarbeiten müsst, hauptsächlich mit den Großeltern oder Großtanten und Großonkeln.«
Wieder einmal war Matthew dankbar, dass er nicht an einer städtischen Problemschule unterrichten musste. Ein solches Projekt wäre dort, wo die Lebensläufe nicht kontinuierlich verliefen und die Ansichten von dem, was eine Familie darstellte, auseinander gingen, völlig undenkbar. Aber in Fellhead hatten alle entweder seit Generationen in einer Großfamilie gelebt oder waren Zugezogene aus netten Familien der Mittelklasse, in denen, selbst wenn man so tat, als gehöre man zur New-Age-Bewegung, Trauscheine meist noch an der Tagesordnung waren.
»Um euch zu erklären, was wir machen wollen, werde ich euch den Stammbaum meiner eigenen Familie zeigen.« Ein Mausklick, und sein Name erschien auf dem Bildschirm. Darunter stand sein Geburtsdatum. Er klickte noch einmal, und diesmal gesellte sich Diane Brotherton mit einem Gleichheitszeichen dazu. »Könnt ihr raten, was dieses Zeichen bedeutet? Jonathan?«, fragte er einen stämmigen rothaarigen Jungen und ignorierte Sams eifrig erhobene Hand.
Jonathan Bramley sah leicht erschrocken drein. Er runzelte vor Anstrengung die Stirn.
»Weiß nich«, gab er endlich zu.
Matthew unterdrückte seine Frustration und sagte geduldig: »Es bedeutet ›verheiratet mit‹. Mrs. Gresham war Diane Brotherton, bis sie mich heiratete.« Er klickte noch einmal, und eine senkrechte Linie erschien, die sie mit Gabriel Stephen Gresham verband.
»Das ist Ihr Kind«, platzte eines der Mädchen ungefragt heraus.
»Stimmt, Kylie.« Matthew klickte wieder. Jetzt waren neben jedem Namen kleine Bilder zu sehen. »Wir können sogar Fotos dazunehmen. So können wir sehen, wie die Ähnlichkeiten in der Familie in den verschiedenen Generationen auftreten. Also, wir können alle unsere Stammbäume mit dem anfangen, was wir schon wissen.« Er tippte auf die Tastatur und zeigte ein anderes Bild auf dem Bildschirm. Es waren seine Eltern und seine Schwester, inklusive Fotos, Geburtsorte und Berufe.
»Aber wir werden noch mehr tun. Wir werden in die Vergangenheit zurückgehen und unsere Stammbäume so weit zurückverfolgen, wie wir können.« Diesmal waren auf dem Stammbaum, den er zeigte, seine Großeltern mit einbezogen, ein Großvater war als Umsiedler aus den Zinnminen Cornwalls zugezogen, der in den Lake District gekommen war, um Schiefer abzubauen, der andere war ein Schäfer aus Cumberland – und auch seine Tanten, Onkel, Cousins und Cousinen.
»Und wir werden auch erfahren, wie so eine Gemeinde wie unsere im Lauf der Jahre gewachsen ist. Wir werden viele Verbindungen zwischen den Familien finden, von denen ihr unter Umständen nichts gewusst habt. Vielleicht werdet ihr sogar gemeinsame Vorfahren entdecken und eine Ahnung davon bekommen, wie sich das Leben der Leute im Lauf der Jahrhunderte verändert hat.« Matthews Gabe, seine Begeisterung auf andere zu übertragen, riss die Kinder jetzt mit. Sie hingen an seinen Lippen.
»Wir werden mit euren nächsten Angehörigen beginnen. Seht euch meinen Stammbaum an, damit ihr wisst, wie ihr es auf eurer Seite einteilen müsst. Und heute Abend, wenn ihr nach Hause geht, könnt ihr die anderen Mitglieder eurer Familie bitten, euch zu helfen, damit ihr den Rest eintragen könnt. Nach und nach werden wir uns verschiedene Wege ausdenken, wie man Informationen über seine Familiengeschichte und seine Vorfahren finden kann. Jetzt fangt ein frisches Blatt in eurem Heft an und legt los.«
Matthew wartete, bis sie sich alle an die Arbeit gemacht hatten, und setzte sich dann an seinen Tisch. Er zog einen Stoß Mathematikhefte zu sich heran und begann, die Aufgaben durchzusehen und zu benoten. Wegen des leisen Gemurmels und Kicherns im Zimmer konnte er sich nicht recht konzentrieren. Als er aufsah, hatte Sam Clewlow einen roten Kopf, und seine Augen glänzten feucht von unterdrückten Tränen. Jonathan Bramley sah schadenfroh drein.
»Was ist los?«, fragte Matthew und stand auf. Niemand wollte ihm in die Augen sehen. »Jonathan? Was ist los«?
Jonathan presste die Lippen aufeinander. Er wusste es noch nicht, aber seine eigene Dummheit zusammen mit seiner Unfähigkeit, sich zu verstellen, sollte ihm sein ganzes Leben lang immer wieder ein Schnippchen schlagen. »Nix«, murmelte er schließlich.
»Du kannst es mir jetzt sagen oder nach dem Unterricht hier bleiben und es dann tun«, sagte Matthew streng. Er hatte die Klagen der Lehrer nie begreifen können, die behaupteten, sie kämen mit den Kindern nicht zurecht. Man musste ihnen nur zeigen, wer das Sagen hatte, und es ihnen immer wieder klar machen.
»Ich hab nur gesagt …« Jonathan verstummte und sah sich verzweifelt um, ob ihm nicht jemand zu Hilfe käme.
»Du hast was gesagt?«
»Ich hab gesagt, dass wir alle wissen, wer Sams Vorfahr war«, murmelte er vor sich hin.
»Sehr interessant«, sagte Matthew. »Und an wen genau hast du da gedacht?«
Jonathans Ohren wurden rot, und er hielt den Blick gesenkt. »Der Affenmann oben im Moor«, flüsterte er mit kaum hörbarer Stimme.
»Du meinst die Leiche im Moor?«, fragte Matthew. Der gruselige Fund war schon seit ein paar Tagen Hauptgesprächsthema im Dorf.
Jonathan nickte und schluckte. »Es war nur ein Witz.«
»Witze sollten komisch sein«, sagte Matthew tadelnd. »Aber Beleidigungen sind keine Witze. Und es gehört sich nicht, Witze über die Toten zu machen. Als der Mann noch lebte, hatte er Freunde und Verwandte, die ihn gern hatten, genau wie du. Stell dir mal vor, wie du dich fühlen würdest, wenn jemand gestorben wäre, den du gern hattest, und ein gedankenloser Mensch würde Witze über ihn machen.«
»Aber Herr Lehrer, es gibt doch niemanden mehr, der sich was aus dem Affenmann macht«, sagte Kylie, die sich nie unterkriegen ließ.
Matthew stöhnte innerlich. Es würde wieder eines dieser schwierigen Gespräche werden, das wusste er schon jetzt. Er glaubte an den Sinn seiner Arbeit, aber manchmal wünschte er sich, er hätte den Kindern nicht ganz so gut beigebracht, ihre wissbegierigen Köpfchen zu nutzen. »Warum nennst du ihn Affenmann?«, fragte er.
»Weil, so sieht er doch aus«, meldete sich ein Junge. »Da war eine Sendung im Fernsehen über den einen, den sie unten in Cheshire gefunden haben. Der hat wie ’n Affe ausgesehen.«
»Deshalb nennen wir ihn den Affenmann«, fügte ein anderer hinzu.
Sam Clewlow lachte verächtlich. »Das ist ja dumm«, sagte er.
»Warum ist es dumm, Sam?«, fragte Matthew.
»Weil der Mann, der im Moor in Cheshire gefunden wurde, in der Steinzeit gestorben ist. Deshalb sieht er so aus. Aber der von hier oben ist nicht so alt. Deshalb sieht er nicht wie ’n Affe aus, er sieht aus wie wir«, sagte Sam bestimmt.
Unterdrücktes Lachen folgte auf seine Worte. »Der sieht nich aus wie ich«, platzte Jonathan heraus. »Der Jason hat gesagt, er sieht im Gesicht aus wie ’n alter Lederbeutel. Und der muss es wissen, er spielt Darts mit Paul Lister, der wo die Leiche gefunden hat.« Jonathan lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. Jetzt, da sie alle an seinen Lippen hingen, war die Demütigung von vorhin vergessen.
»Vielleicht ist er ja einer von unseren Vorfahren«, meldete sich Sam.
»Ja«, sagte Kylie begeistert. »Vielleicht ist er ermordet und im Moor begraben worden.«
»Stimmt. Nämlich, wie wär er sonst da hingekommen?«, sagte ein anderer.
»Er hätte auch einfach verunglückt sein können, als er dort oben war«, sagte Matthew, um ihre Begeisterung für das Makabre etwas zu bremsen. »Er hätte hinaufgehen können, um nach einem Schaf zu sehen, ist dann gestürzt und im Moor gestorben.«
»Aber dann hätte ihn doch jemand gesucht, und sie hätten seine Leiche gefunden«, argumentierte Sam vernünftig. »Er wäre doch nur da oben im Moor gelandet, wenn jemand ihn dort vergraben hätte, weil er nicht wollte, dass man wusste, was mit ihm passiert ist. Ich glaube, Kylie hat Recht. Ich glaube, jemand hat ihn ermordet.«
»Na ja, bevor die Wissenschaftler nicht ihre Untersuchungen durchgeführt haben, werden wir nichts Genaues wissen«, sagte Matthew bestimmt.
»Es wird so sein wie in ›Der stumme Zeuge‹«, sagte Kylie. »Der Arzt wird herausfinden, wie er gestorben ist, und dann wird die Polizei herauskriegen müssen, was passiert ist.«
Matthew lächelte unwillkürlich. »Ich glaube nicht, dass es ganz so sein wird, Kylie. Nach allem, was ich gehört habe, müsste der Mörder auch schon längst tot sein, falls der Tote im Moor ermordet wurde. Aber bis wir Tatsachen haben, schlage ich vor, dass wir uns wieder mit dem beschäftigen, was wir wissen.« Er hielt eine Hand hoch, damit sie aufhörten zu schwatzen. »Und wer weiß, vielleicht entdeckt ja einer von euch einen Urahn, der zur passenden Zeit verschwunden ist.«
Sam Clewlow starrte ihn mit offenem Mund an. »Das wäre phantastisch«, flüsterte er.
Ich war mit der Gestaltung meines langen Gedichts über mein Leben beschäftigt und dachte darüber nach, wie ich die Dinge, die mir lieb sind, am treffendsten darstellen könnte, als ich eine Gestalt am Tor erblickte. Beim ersten Hinsehen glaubte ich, es sei einer jener fahrenden oder wandernden Burschen, die von Zeit zu Zeit an unsere Tür klopfen und um Essen bitten. Meine Schwester pflegt ihnen Speise und Trank zu geben, bevor sie sie weiterziehen lässt. Bei solcher Gelegenheit hat sie Geschichten von ihnen erfahren, die mir als Stoff für Gedichte dienten, und so halte ich sie nicht von dieser bescheidenen Wohltätigkeit ab. Der Mann am Tor mit seinen von der Reise verschmutzten Kleidern und dem breitkrempigen Hut, der ihn vor Sonne und Regen gleichermaßen schützte, schien ein solcher Wanderer zu sein. Gerade wollte ich ihn an die Küchentür schicken, als er zu sprechen begann. Zu meinem Erstaunen nannte er mich beim Vornamen und sprach mich voll Herzlichkeit und Vertrautheit an. »William, ich sehe, du arbeitest hart. Ich habe gehört, du bist der größte Dichter unserer Zeit, und jetzt sehe ich das selbst.« Ich hatte immer noch keine Vorstellung, wer dieser Mann war, aber er öffnete ohne Zögern das Tor und kam durch den Garten auf mich zu. Sein etwas krummbeiniger Gang hatte etwas von einem Seemann an sich, und als er näher kam, wurde ein unmöglicher Verdacht, der mir in den Sinn kam, immer stärker.
3
Um halb vier war in die Viking Bar die vorübergehend unterbrochene Stille und Leere zurückgekehrt. Ein paar Nischen im hinteren Teil waren noch von Männern besetzt, die bei einem Espresso Geschäfte besprachen. Sie hatten schon gezahlt, und das Personal war aus ihrem Blickfeld verschwunden. Jane stellte die letzten Gläser in die Geschirrspülmaschine und setzte sich dann auf einen Hocker am Ende der Bar, um ihre schmerzenden Füße zu entlasten.
Harry kam aus der Küche mit einer Platte belegter Brote, die übrig geblieben waren.
Jane nahm sich eines, während Harry sich einen Hocker heranzog und neben sie setzte. »Wo hast du die Zeitung hingelegt?«, fragte sie.
»Ich hol sie.« Harry sprang vom Stuhl, trat hinter die Bar, zog die Zeitung aus einem der Regale und gab sie ihr.
Jane nahm sich gleich den Artikel vor, den richtig zu lesen sie wegen des Ansturms zur Mittagszeit keine Zeit gehabt hatte.
Leiche im Lakeland-Moor gibt Rätsel auf
Die Leiche eines Mannes, die im Moor im Lake District gefunden wurde, könnte Hunderte von Jahren alt sein, sagte die Polizei gestern.
Zunächst dachte man, die Überreste seien Tausende von Jahren unentdeckt geblieben wie die Funde aus der Steinzeit an ähnlichen Fundorten.
Aber bereits die erste Untersuchung durch Gerichtsmediziner deutet darauf hin, dass die Leiche nicht so alt ist. Detective Chief Inspector Ewan Rigston sagte: »Wir glauben, dass die Leiche schon sehr lange Zeit in der Erde liegt, vielleicht Hunderte von Jahren. Aber wir meinen nicht, dass sie so alt ist wie manche der sterblichen Überreste, die an anderen Orten gefunden wurden.
Wir werden mehr wissen, wenn die Gerichtsmediziner ihre Arbeit gemacht haben.«
Auf die Frage, wann der Mann gestorben sei, sagte DCI Rigston, es sei noch nicht möglich, dies zu beantworten. Die Leiche wurde von einem in der Gegend ansässigen Schäfer entdeckt, der nach einem verlorenen Schaf suchte. Die Polizei glaubt, dass die uralten Torfbänke bei Carts Moss in der Nähe des Dorfes Fellhead durch die starken Regenfälle dieses Sommers teilweise weggeschwemmt worden waren.
Paul Lister, 37, wohnhaft in Coniston Cottages in Fellhead, berichtete gestern Abend von der schauerlichen Entdeckung. »Ich ging auf der Suche nach einem verlorenen Lamm hinter meinem Hund über Carts Moss. Auf dem nassen Gras rutschte ich aus und fiel in eine der Spalten zwischen den Torfhexen.
Als ich an meiner Hand etwas Glattes spürte, sah ich hin. Zuerst begriff ich nicht, was ich da sah. Ich dachte, es wäre Rindsleder oder so etwas. Dann wurde mir klar, dass es ein menschliches Gesicht war.
Ich konnte es kaum fassen. Es war wie in einem Horrorfilm.«
Während er auf die Polizei wartete, konnte Mr. Lister den schrecklichen Fund näher betrachten. »Er hatte schwarzes Haar, und es sah aus, als hätte er auf den Armen und dem Körper schwarze Tätowierungen. Aber ich weiß nicht, ob das nur die Folge davon war, dass er so lange im Moor gelegen hat.«
Die forensische Anthropologin Dr. River Wilde der University of Northern England wurde hinzugezogen, um bei dem Versuch, das Geheimnis um die Leiche im Moor zu lüften, mit Experten aus der Umgebung zusammenzuarbeiten. DCI Rigston sagte: »Bevor Dr. Wilde ihre Untersuchungen nicht abgeschlossen hat, können wir nichts weiter sagen.«
Jane verschluckte sich fast an ihrem Sandwich. »Sieh dir das mal an, Harry«, sagte sie, als sie sich erholt hatte, und zeigte auf den vorletzten Abschnitt.
Bevor Harry antworten konnte, legte jemand den beiden eine Hand auf die Schulter. Ein rasierter Schädel tauchte zwischen ihnen auf. »Was gibt es so Interessantes?«, fragte eine wohl bekannte Stimme.
Jane drehte sich um und küsste Seabourne auf die glatte Wange. »Dan! Was für eine Überraschung! Harry hat nicht gesagt, dass du kommen würdest.«
»Harry wusste es nicht«, sagte Harry etwas verdrießlich.
»Mein Seminar um drei Uhr wurde abgesagt, da dachte ich, ich könnte vorbeikommen und dich abholen«, sagte Dan und fuhr seinem Freund durchs Haar.
»Oder wolltest du etwa überprüfen, wie es zwischen Harry und dem neuen italienischen Koch steht?«, witzelte Jane. »Ich hab’s ja gleich gewusst, dass wir dich nie wieder los werden, wenn du Giaco erst mal in seiner weißen Kochmontur gesehen hast.«
Dan hob die Hand zum Herzen und tat so, als sei er schockiert. »Du hast ja den großen Durchblick«, seufzte er. Dann griff er an ihr vorbei nach einem Hocker. »Jane, ich hab dich schon eine Woche lang nicht gesehen. Versteckst du dich etwa vor mir?«
Jane seufzte. »Es ist wegen des Buchs. Ich soll es doch bis Ende des Jahres fertig haben, und im Moment glaube ich, das werde ich nur schaffen, wenn Mephisto mir ein Angebot macht, dem ich nicht widerstehen kann. Als ich den Vertrag unterschrieben habe, dachte ich, es wäre kinderleicht, aus dieser Doktorarbeit ein Buch zu machen.« Sie lachte. »Da war ich ganz schön auf dem Holzweg.«
»Vielleicht solltest du mal ’ne Weile raus aus der Stadt und ganz konzentriert daran arbeiten, bis es fertig ist«, sagte Dan. »Ich könnte für deine Kurse die Vertretung übernehmen.«
Jane grinste. Sie und Dan saßen im gleichen Boot. Sie waren nach ihrer Promotion in der Forschung an der Universität tätig und immer auf der Jagd nach eventuellen Kursen, die sie dem fast unerreichbaren Ziel einer festen Anstellung näher bringen würde. Und sie bemühten sich, ihre Professorin zu beeindrucken und gleichzeitig mit ihren kümmerlichen Einkünften auszukommen. Eigentlich hätten sie sich gegenseitig Konkurrenz machen müssen, aber ihre weit in die frühe Studienzeit zurückreichende Freundschaft verhinderte das. »Und auch meine Honorare kassieren? Das könnte dir so passen, Dan«, scherzte sie und stieß ihm den Ellbogen in die Rippen. »Du bist völlig skrupellos, weißt du das? Du solltest dich zusammenreißen und selbst ein Buch schreiben.«
Dan breitete die Arme aus und unterstrich damit seine Unschuldsmiene. »He, ich wollte ja nur helfen. Ein bisschen weniger Ablenkung wäre doch gut für dich, oder?«
Harry zog die Zeitung zu sich heran. »Nach dem, was hier steht, hat man auch in Fellhead genug Zerstreuung.« Er zeigte auf den Artikel und gab ihn an Dan weiter. »Der Tod geht im Moor um.«
Harry und Jane aßen weiter, während Dan den Artikel las. »Na, wenigstens müsstest du dir keine Sorgen machen, dass ein durchgeknallter Axtmörder frei herumläuft«, sagte er. »Wenn dies ein Mordopfer ist, muss sein Mörder schon fast genau so lange unter der Erde sein.«
»Lassen wir den Mord mal beiseite«, sagte Jane und zeigte auf den vorletzten Absatz. »Mich interessiert eher die Tätowierung.«
»Tätowierung?«, fragte Dan.
»Schwarze Tätowierungen. Woran erinnert dich das?«
Dan zuckte die Schultern. »Außer an David Beckham an überhaupt nichts.«
»Achtzehntes Jahrhundert, Seeleute, Südseeinseln. Viele von ihnen hatten Tätowierungen wie die Einheimischen. Wie Fletcher Christian.«
Dan grinste. »Deine Lieblingssaga aus dem Hinterland da oben.«
»Wovon redet ihr beiden?«, fragte Harry.
»Was weißt du über die Meuterei auf der Bounty?«, sagte Jane.
Harry zuckte die Schultern. »Mel Gibson. Sehr sexy in seiner engen Hose.«
Jane stöhnte. »Du hast ja wirklich gut zugehört.«
»Ach, ich mach doch nur Spaß, bin doch nicht nur ’n Dandy, Jane«, protestierte Harry. »Ich erinnere mich an die Stelle, als Mel die Meuterei anstiftet, den bösen Captain Bligh in einem offenen Boot aussetzt und dann nach Tahiti segelt.«
»Sehr gut, Harry. Nur dass es eigentlich nicht Mel Gibson war, sondern Fletcher Christian, der die Meuterei anführte. Und was mich daran interessiert, ist nicht die Meuterei, sondern das, was danach kam. Nach Blighs heldenhafter langer Reise an einen sicheren Ort und schließlich zurück nach London wurde der Marine der Auftrag erteilt, die Meuterer ausfindig zu machen und sie nach London zurückzubringen, wo sie vor Gericht gestellt werden sollten. Jahre danach wurde eine Gruppe von ihnen auf Tahiti gefunden und zurückgeholt. Aber das Schicksal von Fletcher und seiner kleinen Gruppe von Meuterern blieb lange Zeit ein Geheimnis. Tatsächlich sind sie schließlich mit einigen der einheimischen Frauen und Männer auf der Insel Pitcairn gelandet und haben dort eine Siedlung gegründet.«
Harry nickte. »Pitcairn … Da gab es doch vor ein paar Jahren einen Skandal wegen Sex mit Kindern, oder?«
»Stimmt. Und da kamen einige direkte Nachkommen der Meuterer vor. Aber das war nicht der erste Aufruhr im Paradies«, sagte Jane. »Im Grunde gab es nicht genug Frauen dort. Die offizielle Version ist, dass die Meuterer einen Streit mit den Eingeborenen hatten und es zu einem Massaker kam. Angeblich war Fletcher Christian der erste Weiße, der umgebracht wurde. Ende der Geschichte.«
»Aber …? Ich meine, es muss doch ein Aber geben, oder? Andernfalls wärst du doch wegen einer schwarz tätowierten Leiche nicht so aufgeregt«, sagte Harry.
»Das ist Janes Hirngespinst«, mischte sich Dan ein.
Jane wirkte eine bisschen verlegen. »Es hat im Lake District immer ein Gerücht gegeben, dass Fletcher Christian nicht auf Pitcairn gestorben sei und dass das Massaker nur etwas vertuschen sollte. Irgendwie gelang ihm die Flucht von der Insel, und er schaffte es, nach England zurückzukommen, wo er, durch Familie und Freunde vor dem Arm des Gesetzes geschützt, den Rest seines Lebens verbrachte. Es war für alle Beteiligten eine hochriskante Sache. Wenn Fletcher verraten oder entdeckt worden wäre, hätte man ihn als Anführer der Meuterei auf jeden Fall gehängt. Und auch jeden, der wissentlich mit ihm Kontakt hatte, ohne ihn an die staatlichen Behörden auszuliefern.«
Harrys Gesichtsausdruck wechselte von Überraschung zu Zweifel. »Das meinst du doch nicht ernst? Ich meine, es ist doch nur Gerede?«
»Wie ich schon sagte, das ist Janes Lieblingsgeschichte aus der Provinz«, sagte Dan und zündete sich eine Zigarette an.
Jane schüttelte den Kopf, und ihre langen Locken glänzten im Licht. »Es ist nicht nur Geschwätz. John Barrows Buch hat diese Frage schon 1831 aufgeworfen.«
»Was Verschwörungstheorien angeht, muss man zugeben, dass diese nicht schlecht ist«, sagte Dan. »Mr. Christian veranstaltete ein Massaker und segelte dann in den Sonnenuntergang davon. Ach so, warte mal. Wie ist er eigentlich geflohen, Jane? Sie haben das Schiff doch verbrannt, oder?«
Jane lehnte sich an den Tresen. »Ja. Aber die Bounty hatte zwei Jollen an Bord, und man hat nie klären können, was mit ihnen geschehen war. Außerdem ist da noch die Sache mit dem fehlenden Logbuch.« Sie grinste. »Hier solltest du sagen: ›Was für ein fehlendes Logbuch?‹«
Dan neigte den Kopf und hielt mit gespieltem Erstaunen die Hände hoch. »Was für ein fehlendes Logbuch?«
»Fletcher Christian war Wachoffizier. Er war daran gewöhnt, ein Logbuch zu führen. Es musste ihm in Fleisch und Blut übergegangen sein.«
»Klar«, sagte Harry.
»Es wäre doch merkwürdig, wenn es keine Aufzeichnungen darüber gäbe, wie Pitcairn besiedelt wurde. Es gab keinen Mangel an Papier und Schreibzeug. Sie haben diese Dinge viele Jahre später noch in der Schule benutzt, die sie für ihre Kinder einrichteten. Aber der einzige authentische Bericht, der je bekannt wurde, ist von einem der anderen Meuterer, Edward Young. Und er fängt erst nach dem Massaker an, woraus zu schließen ist, dass jemand anders bis dahin die Aufzeichnungen machte. Und wer wohl sonst als Fletcher? Wenn er gestorben wäre, ist doch klar, dass das Logbuch erhalten geblieben wäre. Aber wenn er auf See ging …« Jane verstummte.
»Dann hätte er es mitgenommen, stimmt’s?«, schloss Harry. Sie sah, dass auch er sehr interessiert war, obwohl er sich die ganze Zeit so unbeteiligt gab. »Okay, ich gebe zu, dass dies zumindest darauf hindeutet. Aber wie du selbst sagst, es sind alles nur Spekulationen.«
»Nicht alles. Ich erzähle dir mal etwas über Peter Heywood. Er war einer der Meuterer, die zurückkamen. Aber anders als bei den meisten anderen, die vor Gericht gestellt wurden, hatte seine Familie die Mittel und Beziehungen, um sicherzustellen, dass ihrem Liebling die Strafe erlassen wurde. Statt gehängt zu werden, machte er danach noch eine glänzende Karriere bei der Marine. Aber das wirklich Interessante an Peter Heywood ist, dass er weitläufig mit Fletcher Christian verwandt war. Er wuchs auf der Isle of Man auf, wo Fletcher während seiner Jugend einige Zeit verbracht hatte. Heywood hatte also neben der gemeinsamen Zeit auf dem Schiff noch eine persönliche Verbindung zu Fletcher. Er kannte ihn gut«, sagte Jane. »Und irgendwann um 1809 herum sah Peter Heywood Fletcher Christian in Plymouth.«
Harry runzelte die Stirn. »Aber Plymouth war doch ein Stützpunkt der Marine, oder? Er wäre doch verrückt gewesen, wenn er am helllichten Tag in Plymouth herumgelaufen wäre, als bekanntester Meuterer in der Geschichte der britischen Marine. Ich meine, selbst jemand wie ich, der sich nicht für Geschichte interessiert, hat von ihm gehört. Und deiner Meinung nach hat dieser Mann alles mögliche unternommen, um nach der Meuterei nicht in Schwierigkeiten zu geraten, ein Mann, dem der Strick des Henkers sicher war, hätte man ihn je erwischt. Und trotzdem macht er einen Spaziergang in einer Stadt, die voll von Marineoffizieren und anderen Angehörigen der Marine ist. Und dann trifft er doch tatsächlich seinen alten Kumpel Peter Heywood.« Harry hob die Hände wie ein Mann, dessen Argument sich nicht widerlegen lässt. »Und selbst wenn man annimmt, dass es so war, dass Heywood und Christian sich so gut kannten, wie du sagst, warum hätte er zugeben sollen, dass er Christian gesehen hatte? Das ergibt keinen Sinn.«
»Er hat es nicht zugegeben, Harry. Zumindest nicht öffentlich. Es kam erst nach seinem Tod heraus. Und ich kann spekulieren«, sagte Jane mit sanfter Stimme. »Was wäre, wenn er ein Treffen mit Heywood geplant hatte und Heywood in letzter Minute vielleicht einen seiner Kollegen nicht loswerden konnte? Und als Fletcher sah, dass Heywood nicht allein war, floh er.«
Harry schüttelte den Kopf. »Aber warum hätte Fletcher Christian die Insel Pitcairn überhaupt verlassen sollen? Er war doch bestimmt sicher dort. Warum sollte er das aufs Spiel setzen?«
»Ich weiß nicht, ob er sich sicher fühlte«, sagte Jane. »Es steht fest, dass es neben den Problemen mit den Eingeborenen tiefe Gegensätze zwischen den Meuterern gab. Es gibt auch Hinweise, dass die anderen Meuterer ihm, dem einzigen übrig gebliebenen Offizier, seine Autorität verübelten. Und er war ein anständiger Mann, vergiss das nicht. Vielleicht wollte er Frieden mit sich machen wie der Matrose in der Ballade vom alten Seemann. Vielleicht wollte er erklären, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass er zum Meuterer wurde«, argumentierte Jane. »Aber als er zurückkam, entdeckte er, dass Bligh nicht nur überlebt hatte, sondern dank seiner erstaunlichen Leistung als Schiffsführer auf dem Pazifik zum Helden geworden war. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass er jede Menge Zeit gehabt hatte, um seine Version der Meuterei bekannt zu machen. Was immer Fletchers Motive dafür waren, dass er die Besatzung gegen Bligh aufstachelte, es war jetzt auf jeden Fall zu spät für ihn, seine Sache vorzubringen.«
»Aber was hätte er vorbringen können?«, fragte Harry. »Meuterei bleibt Meuterei, oder?«
»Es gab eine Entschuldigung für Meuterei, auf die Christian sich hätte berufen können«, sagte Dan.
Harry zog die Augenbrauen hoch. »Bist du jetzt plötzlich der Experte für Rechtsfragen bei der Marine?«
»Nein, aber ich weiß etwas über die Geschichte der Unterdrückung von Homosexuellen, mein Lieber«, sagte Dan. »Was wäre, wenn Christian Bligh widernatürliche Unzucht vorgeworfen hätte? Das war damals ein Vergehen, für das man gehängt wurde, oder? Wenn er hätte beweisen können, dass Bligh ihn gezwungen hatte, gegen seinen Willen Sex mit ihm zu haben, hätte das nicht als strafmildernder Umstand bei der Meuterei gegolten?« Er hielt inne, runzelte die Brauen und biss sich auf die Unterlippe. »Natürlich hätte er einen unabhängigen Zeugen gebraucht, um dies hieb- und stichfest zu machen. Damals verlangten die Kriegsgerichte mehr als das Wort eines Mannes gegen das eines anderen, weil dies eine Anschuldigung war, die zwar leicht vorzubringen, aber sehr schwer glaubhaft zu machen war. Und Christian muss das gewusst haben.«
»Vielleicht gab es tatsächlich einen Zeugen«, sagte Jane nachdenklich, »und vielleicht war das einer der Gründe, warum Fletcher die Meuterei anführte – weil er diesen Zeugen schützen wollte …« Sie verstummte und starrte gedankenverloren durch das leere Lokal.
»Wie meinst du das?« Harry war noch immer fasziniert.
Jane hielt einen Finger hoch und machte eine Pause, um ihren Standpunkt zu überdenken. »Lasst uns zu Peter Heywood zurückkehren«, sagte sie und ging im Kopf ihr Wissen durch, das sie in Jahren leidenschaftlichen Interesses gesammelt hatte. »Fletcher war früher schon mit Bligh gesegelt, und es ist überliefert, dass er der Favorit des Kapitäns war. Die gleiche Geschichte wie bei der Fahrt der Bounty bis nach Tahiti. Dann verbringt Fletcher sechs Monate an Land, nimmt sich eine eingeborene Konkubine …«
»Konkubine, das Wort finde ich toll«, sagte Dan und sprach es genießerisch aus.
»Jedenfalls«, sagte Jane bestimmt, »als das Schiff Tahiti verlässt, will Fletcher nicht wieder Blighs …«
»Lustknabe. Das ist der Ausdruck, den du suchst. Noch so ein schönes Wort«, unterbrach Dan sie.
»Was auch immer. Bligh fängt an, ihn beschissen zu behandeln. Und diese Entscheidung hat Fletcher auch noch in ein anderes Dilemma gestürzt. Er glaubt, für den jungen Peter Heywood, seinen Verwandten, eine Sorgepflicht zu haben. Es ist nämlich genau belegt, dass Heywood nach Fletcher Blighs zweiter Favorit war. Also will Fletcher Heywood schützen, aber nicht um den Preis, sich selbst Bligh wieder unterwerfen zu müssen.«
»Und so zettelt er eine Meuterei an, obwohl er weiß, dass ihm der Tod sicher ist, sollte er je erwischt werden? Alles, um Peter Heywoods Ehre zu schützen?« Harry schien das zu bezweifeln.
»Vielleicht schützte er sich auch selbst«, sagte Dan. »Wenn Bligh auch Heywood bedrängt hatte, dann war er für Christian ein Zeuge. Dann konnte Christian vorbringen, dass die Meuterei die einzige Möglichkeit war, einen Verfolger mit sexuellen Motiven davon abzuhalten, dass er fern vom Heimathafen seine Mannschaft ausnutzte. Das würde doch funktionieren?«
»Ich nehme an, ja«, sagte Harry widerwillig. »Mann, du hast ja deinen Standpunkt ganz schön geändert. Du warst doch derjenige, der dies alles Janes Hirngespinst genannt hat. Jetzt verteidigst du ihre Ideen, und ich bin derjenige, der dies alles auf Janes Phantasie zurückführt.«
Jane stand auf und ging hinter den Tresen, um fertig aufzuräumen. »Das sind eben die Überzeugungskräfte einer Frau, Harry. Und außerdem hast du Unrecht. Es gibt etwas, das ein bisschen konkreter ist. Die Meuterer, die schließlich vor Gericht standen, darunter auch Peter Heywood, hatten Christian gebeten, sie nach Tahiti zurückzubringen. Diese Jungs kamen niemals nach Pitcairn. Als die beiden Gruppen sich trennten, nahm Fletcher Heywood zur Seite. Und als Fletcher sich privat von Heywood verabschiedete, bat er ihn, der Familie Christian zu Hause eine Nachricht zu überbringen. Aber Heywood hat nie verraten, was Fletcher gesagt hatte. Warum sollte er schweigen, wenn die Nachricht nicht als beschämend betrachtet wurde, wahrscheinlich sowohl für ihn selbst als auch für Fletcher? Der tiefere Grund für Fletchers Meuterei könnten also Blighs sexuelle Übergriffe gegenüber Christian und Heywood gewesen sein.«
Harry lachte laut auf. »Jane, du solltest Romane schreiben, keine Interpretationen. Gilt so was als streng wissenschaftliche Arbeit in der anglistischen Abteilung?« Er trat zu ihr hinter den Tresen, nahm Gläser aus dem Geschirrspülautomaten und stellte sie auf die Regale.
Jane stützte sich auf die Theke und grinste. »Vielleicht sollte ich ja tatsächlich Romane schreiben. Und wenn ich es täte, dann würde ich mit William Wordsworths verschollenem epischem Gedicht beginnen.«
»Wordsworths verlorenes episches Gedicht?«, sagte Harry verwirrt.
»Sie hat das Beste bis zum Schluss aufgehoben, Harry«, sagte Dan. »Das ist jetzt der große Moment. Du wirst begeistert sein.«
Jane sprach trotzdem weiter. »›Unschuld und Verworfenheit, die wahre Geschichte der Meuterei auf dem Schiff Bounty in der Südsee‹, oder etwas ähnlich Wordsworthmäßiges.«
»Hä?«, sagte Harry.
»Sie sind zusammen zur Schule gegangen, Harry. William Wordsworth, der verehrte Dichter und Meister der Romantiker aus dem Lakeland, und Fletcher Christian, der Meuterer auf der Bounty, sind zur gleichen Zeit auf der Hawkshead School gewesen. Fletchers Bruder Edward unterrichtete sie. Er wurde dann Juraprofessor an demselben College in Cambridge, wo Wordsworth seinen Abschluss machte. Und er vertrat die Familie Wordsworth in einem wichtigen Prozess. Wem also sollte Fletcher seine Version der Ereignisse mitteilen, wenn nicht seinem alten Schulfreund? Dem Freund seiner Familie, der später ein berühmter Literat werden sollte. Und selbst wenn er wusste, dass er es wegen der möglicherweise schlimmen Folgen selbst nie würde veröffentlichen können, hätte Wordsworth eine so bedeutsame Geschichte nicht links liegen lassen können, oder?«
Obwohl ich ihm nicht antwortete, sprach er weiter. Der Mann schien ganz unbefangen und machte es sich auf der Bank bequem, die neben meinem Arbeitstisch steht. Er streckte die Beine aus und legte die Füße übereinander. »Erkennst du mich immer noch nicht, William?«, sagte er mit amüsiertem Unterton. Beim Sprechen schob er den Hut nach hinten und ließ mich zum ersten Mal sein ganzes Gesicht sehen. Viele Jahre waren vergangen, seit ich zum letzten Mal einen Blick auf sein Antlitz geworfen hatte, aber ich erkannte ihn sofort. Zeit und Erfahrung hatten ihre Spuren darauf hinterlassen, aber nicht vermocht, seine charakteristischen Gesichtszüge zu verwischen. Meine Vermutung wurde zur Gewissheit, und das Herz tanzte mir vor Freude in der Brust.
4
Tenille wusste alles über Chancen. Ihr war klar, dass die Lehrer, obwohl sie so gern ihre scheinheiligen Sprüche über die Möglichkeiten ihrer Schüler losließen, eigentlich meinten, Menschen wie sie hätten keine Wahl. Nicht auf die gleiche Art und Weise wie die Lehrer und ihre Schüler aus der Mittelschicht. Im Grunde ihres Herzens dachten sie, dass Schüler wie Tenille in ihrem derzeitigen Leben ohne Hoffnung auf eine Verbesserung bleiben würden. Was immer sie also versprachen, ihr Verhalten verkündete etwas anderes, nämlich: Du wirst Drogen nehmen, in Geschäften klauen, als Teenager schwanger werden und ein beschissenes Leben in einer elenden Wohnsiedlung führen, bis du vorzeitig sterben wirst, weil du rauchst, trinkst oder arm bist. Warum gebe ich mir also Mühe, euch irgendetwas beizubringen?
Aber sie täuschten sich. Sie hatte Möglichkeiten, auch wenn sie nicht so offenkundig oder vielfältig waren wie die der meisten Dreizehnjährigen. Tenille war sich verdammt sicher, dass sie mehr auf dem Kasten hatte als der Rest der Null-Bock-Kids aus der Marshpool-Farm-Siedlung. Deshalb trieb sie sich nicht mit den anderen Schulschwänzern herum. Ihr ging es nicht darum, den Aufpassern in der Schule oder den Sicherheitsleuten in den Einkaufspassagen und Spielsalons zu entgehen. Sich den Banden anzuschließen, die billige Kleider und wertloses Make-up klauten, hatte für sie keinen Reiz. Nicht dass sie sich zu gut dazu gewesen wäre, Sachen mitgehen zu lassen. Nur eben nicht den Schrott, den die anderen interessant fanden. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass Aleesha Graham und ihre Bande zum Überfall auf eine Waterstone-Buchhandlung zu überreden wären, um Gedichtbände an sich zu bringen. Von allem anderen abgesehen, würde sie in einer Buchhandlung ja auch genauso auffallen wie ein Businessdreiteiler im wilden Tanzgewühl eines Hip-Hop-Konzerts. Schon bei dem Gedanken daran verdrehte sie die Augen und verzog die Lippen zu einem spöttischen Lächeln. Und sie hatte auch nicht die Absicht, ihre Tage in irgendeinem Dreckloch von Wohnung zu verbringen und sich DVDs mit einem Haufen von Losern reinzuziehen, die sich nur mit Gras, extra starkem Apfelwein oder Alkopops zudröhnen wollten.