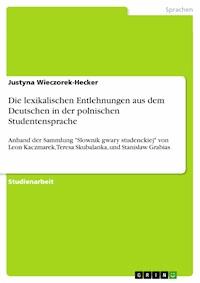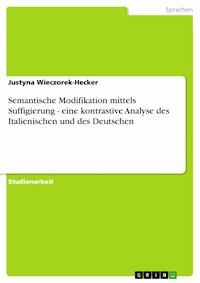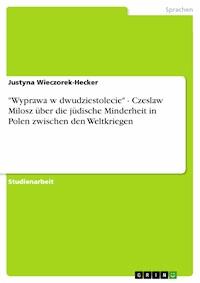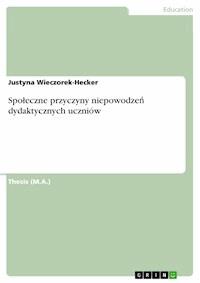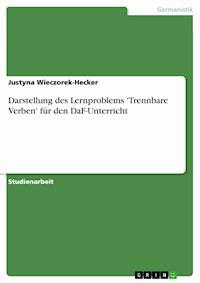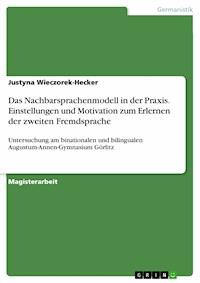
Das Nachbarsprachenmodell in der Praxis. Einstellungen und Motivation zum Erlernen der zweiten Fremdsprache E-Book
Justyna Wieczorek-Hecker
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Magisterarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Didaktik für das Fach Deutsch - Deutsch als Fremdsprache, DaF, Note: 1,3, Technische Universität Dresden (Germanistik), Sprache: Deutsch, Abstract: Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, die Motivation zum Erlernen der polnischen bzw. deutschen Sprache im binationalen-bilingualen Zweig des Augustum-Annen-Gymnasiums Görlitz zu erforschen sowie die Motivation im Sachfachunterricht mit bilingualen Modulen. Im Weiteren soll untersucht werden, wie die Schüler selbst als Teilnehmende ihren Unterricht beurteilen, welche Schwierigkeiten der bilinguale Sachfachunterricht mit sich bringt und welche Vorteile sie darin sehen. Darüber hinaus sollte in Erfahrung gebracht werden, ob bilingualer Unterricht auch das Verhalten und Interessen der Schüler beeinflusst, sie beispielsweise dazu ermutigt, Kontakte mit polnischen/deutschen Gleichaltrigen zu suchen oder polnische/deutsche Medien zu nutzen. Inhaltliche Leitlinien der Arbeit: Die vorliegende Arbeit besteht aus sieben Kapiteln, wobei das erste und das letzte Kapitel der Einleitung bzw. der Zusammenfassung vorbehalten sind. Im zweiten Kapitel werden bildungspolitische Rahmenbedingungen für das Erlernen von Fremdsprachen sowie verschiedene Aspekte der Vermittlung von Mehrsprachigkeit in Grenzregionen (das Nachbarsprachenmodell) erörtert. Das 3. Kapitel stellt eine komprimierte Skizze der Entwicklung und Struktur der bilingualen Bildungsangebote in Deutsch-Polnischem Kontext dar. Der theoretische Teil zur Bildungspolitik, unter besonderer Berücksichtigung der Grenzregion Görlitz erklärt, weswegen es bilinguale Bildungsgänge überhaupt gibt. Schwerpunkt des Theorieteils ist das darauf folgende Kapitel zur Motivationsforschung, in dem sowohl unterschiedliche Motivationskonzeptionen für den Fremdsprachenunterricht als auch Motivationen der Lerner für die Verwendung einer Fremdsprache im Sachfachunterricht in Bezug auf verschiedene Fachliteratur analysiert werden. Daraus ergeben sich die theoretischen Grundlagen für die nachfolgende empirische Untersuchung der Motive und Einstellungen. Darauf folgt die Beschreibung und ausführliche Darstellung der eigentlichen Untersuchungen. Die empirische Analyse beinhaltet die explizite Erklärung und Begründung der Untersuchungsfragen und Untersuchungsmethoden, denen die Vorstellung der Schule Augustum-Annen-Gymnasium Görlitz vorangestellt wird. Eine kritische Prüfung und Bewertung der Untersuchungsergebnisse und deren Rückschlüsse auf die Motivation und Einstellungen im bilingualen Sachfachunterricht bilden den Abschluss der Arbeit. Im empirischen Teil wird die Methode der schriftlichen Befragung eingesetzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2006
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort
1. Einleitung
1.1. Zielsetzung
1.2. Inhaltliche Leitlinien der Arbeit
1.3. Methodisches Vorgehen
2. Förderung der Mehrsprachigkeit in Europa.
2.1. Bildungspolitische Rahmenbedingungen für das Erlernen von Fremdsprachen
2.1.1. Stellung der Sprachen in den Lehrplänen der Europäischen Union
2.1.2. Fremdsprachenunterricht an deutschen und polnischen Schulen
2.2. Das Nachbarsprachenmodell als einer der Wege zur Sicherung der Mehrsprachigkeit in Europa
3. Vermittlung von Mehrsprachigkeit im Rahmen bilingualer Bildungsgänge
3.1. Begriffsbestimmungen
3.2. Ziele und Motive für die Einrichtung bilingualer Angebote
3.3. Bilinguale Bildungsgänge in Deutschland und in Polen
3.3.1. Gestaltung und Struktur des bilingualen Lernens in Deutschland
3.3.2. Gestaltung und Struktur des bilingualen Lernens in Polen
3.4. Desiderata und Perspektiven
4. Motivationsforschung im Fremdsprachenunterricht
4.1. Klärung der Begriffe: Motiv, Motivation und Einstellung
4.2. Motivationskonzeptionen für den Fremdsprachenunterricht
4.3. Motivation der Lerner für Verwendung einer Fremdsprache im Sachfachunterricht
5. Empirische Untersuchung am Augustum-Annen-Gymnasium Görlitz
5.1. Vorstellen der Schule
5.1.1. Entwicklung des binationalen Bildungsganges
5.1.2. Zugangsvoraussetzungen und Aufnahmeprüfung
5.1.3. Struktur des binationalen-bilingualen Bildungsganges Polnisch (Sekundarstufe I und II)
5.1.4. Unterrichtsergänzende Angebote
5.2. Fragestellungen und Hypothesen der Untersuchung
5.3. Methoden der Untersuchung
5.3.1. Schriftliche Befragung
5.3.2. Auswahl der Stichprobe
5.3.3. Durchführung der Befragung
6. Untersuchungsergebnisse
6.1. Einstellungen der polnischen und deutschen Schüler zum Besuch des binationalen-bilingualen Zweiges (Fragen im Bereich A)
6.2. Gründe für die Sprachwahl (Fragen im Bereich B)
6.3. Einschätzung des Gebrauchs der Fremdsprache im Sachfachunterricht (Fragen im Bereich C)
6.4. Zusammenhang zwischen der Berufsvorstellung der Schüler und dem Besuch des binationalen-bilingualen Zweiges respektive Motivation zum Erlernen der polnischen bzw. deutschen Sprache (Fragen im Bereich D)
7. Resümee und Diskussion der Erhebungsdaten
Verzeichnis der Abbildungen und Tabellen
Verzeichnis der Abkürzungen
Länderkürzel für die Abbildung 1
Literaturverzeichnis
„Nichts ist so mächtig,
wie eine Idee,
deren Zeit gekommen ist“
Victor Hugo
Vorwort
Anlass dieser Arbeit ist die in den letzten Jahren gestiegene Bedeutung des bilingualen Unterrichts an Schulen und das damit verbundene Forschungsinteresse an dieser Unterrichtsform in Deutschland und in Europa. So wächst in den letzten Jahrzehnten zum einen die Anzahl der Schulen mit bilingualem Angebot, zum anderen die Zahl der Beiträge in fachwissenschaftlichen Zeitschriften der Fremdsprachen und Sachfächer.
Die Gründung des ersten bilingualen deutsch-polnischen Bildungsganges am Augustum-Annen-Gymnasium Görlitz brachte mich auf die Idee, in meiner Magisterarbeit das Thema „Das Nachbarsprachenmodell in der Praxis“ zu bearbeiten. Das Erlernen der polnischen Sprache kommt der bildungspolitischen Forderung der Europäischen Union (EU) nach Mehrsprachigkeit unter besonderer Beachtung der jeweiligen Nachbarsprachen entgegen. Die Beherrschung der polnischen Sprache ermöglicht den Schülern sowohl den Zugang zu einer modernen Fremdsprache als auch zum erweiterten slawischen Sprach- und Kulturraum.
Dazu kamen kürzlich weitere Ereignisse, die meine Aufmerksamkeit auf die Beziehungen zwischen den beiden benachbarten Ländern richteten. Gleichzeitig erregte dies großes Interesse auf internationaler Ebene. Als Beispiel sei hier die Verkündung des Deutsch-Polnischen Jahres 2005 - 2006 genannt. Am 30.04.2005 wurde das Deutsch- Polnische Jahr durch die Präsidenten der beiden Länder eröffnet. Damit verknüpft ist die Hoffnung den Beziehungen der beiden Staaten neue Impulse zu verleihen.
Weitere Anregungen für mein Vorhaben erhielt ich aus der Bewerbung Görlitz als „Kulturhauptstadt Europas 2010“, was im Moment nicht nur in Görlitz, sondern in der gesamten Bundesrepublik Deutschland für Diskussionen sorgt. Dabei war für mich nicht primär die Frage nach dem Nutzen des Titels und dem möglichen Erfolg des Vorhabens entscheidend, wie sie beispielsweise von der Bevölkerung ebenso häufig wie aus den Kreisen der Politik gestellt wurde, sondern eher die damit zusammenhängende grenzüberschreitende Entwicklung dieser Region.
Wie Raasch richtig bemerkt, sind die Grenzen Narben der Geschichte. Das Ziel beim Sprachenlernen im Grenzgebiet ist nicht nur, die Nähe der Grenze zu nutzen, um die Sprachkompetenz zu verbessern, sondern auch „Türen und Herzen zu öffnen und das heißt, eine Sprachkompetenz zu entwickeln, die es ermöglicht, aus der Nachbarschaft ein nachbarliches Verhältnis zu machen, Grenzen abzubauen.“[1]
Aus diesen Gründen habe ich den einzigartigen deutsch-polnischen Bildungsgang am Augustum-Annen-Gymnasium Görlitz zu meiner Betrachtung herangezogen und die Motivation der Schüler zum Erlernen der Sprache des Nachbarlandes untersucht. Diese Aufgabe sollte meinem Wunsch nach einem aktuellen, sowie zukunftsorientierten Blick auf die länderübergreifenden deutsch-polnischen Bildungsprojekte sowie meinem Interesse an der Vermittlung von Mehrsprachigkeit im Rahmen bilingualer Bildungsgänge entgegenkommen.
1. Einleitung
1.1. Zielsetzung
Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, die Motivation zum Erlernen der polnischen bzw. deutschen Sprache im binationalen-bilingualen[2] Zweig des Augustum-Annen-Gymnasiums Görlitz zu erforschen sowie die Motivation im Sachfachunterricht mit bilingualen Modulen.
Bilingualer Unterricht findet heutzutage immer mehr Zuspruch.[3] Mit dieser Arbeit soll aufgezeigt werden, welche Einstellung die deutschen/polnischen Schüler[4] zum binat.-biling. Bildungszweig haben und inwieweit die Kontakte zu Polen bzw. Deutschland einen Einfluss auf die Sprachwahl hatten.
Im Weiteren soll untersucht werden, wie die Schüler selbst als Teilnehmende ihren Unterricht beurteilen, welche Schwierigkeiten der bilinguale Sachfachunterricht mit sich bringt und welche Vorteile sie darin sehen. Darüber hinaus sollte in Erfahrung gebracht werden, ob bilingualer Unterricht auch das Verhalten und Interessen der Schüler beeinflusst, sie beispielsweise dazu ermutigt, Kontakte mit polnischen/deutschen Gleichaltrigen zu suchen oder polnische/deutsche Medien zu nutzen.
Im Blick auf das gemeinsame Lernen der deutschen und polnischen Schüler in einem Klassenzimmer war für diese Studie auch von Interesse, welchen Einfluss dieser Faktor auf die Einstellungen der anderen gegenüber ausübt.
1.2. Inhaltliche Leitlinien der Arbeit
Die vorliegende Arbeit besteht aus sieben Kapiteln, wobei das erste und das letzte Kapitel der Einleitung bzw. der Zusammenfassung vorbehalten sind. Der Einleitung ist das Vorwort vorangestellt.
Im zweiten Kapitel werden bildungspolitische Rahmenbedingungen für das Erlernen von Fremdsprachen sowie verschiedene Aspekte der Vermittlung von Mehrsprachigkeit in Grenzregionen (das Nachbarsprachenmodell) erörtert. Das 3. Kapitel stellt eine komprimierte Skizze der Entwicklung und Struktur der bilingualen Bildungsangebote in Deutsch-Polnischem Kontext dar. Der theoretische Teil zur Bildungspolitik, unter besonderer Berücksichtigung der Grenzregion Görlitz erklärt, weswegen es bilinguale Bildungsgänge überhaupt gibt.
Schwerpunkt des Theorieteils ist das darauf folgende Kapitel zur Motivationsforschung, in dem sowohl unterschiedliche Motivationskonzeptionen für den Fremdsprachenunterricht als auch Motivationen der Lerner für die Verwendung einer Fremdsprache im Sachfachunterricht in Bezug auf verschiedene Fachliteratur analysiert werden. Daraus ergeben sich die theoretischen Grundlagen für die nachfolgende empirische Untersuchung der Motive und Einstellungen.
Darauf folgt die Beschreibung und ausführliche Darstellung der eigentlichen Untersuchungen (5. Kapitel). Die empirische Analyse beinhaltet die explizite Erklärung und Begründung der Untersuchungsfragen und Untersuchungsmethoden, denen die Vorstellung der Schule Augustum-Annen-Gymnasium Görlitz vorangestellt wird.
Eine kritische Prüfung und Bewertung der Untersuchungsergebnisse und deren Rückschlusse auf die Motivation und Einstellungen im bilingualen Sachfachunterricht bilden den Abschluss der Arbeit.
Einen Anspruch auf Vollständigkeit bezüglich der inhaltlichen Kapazität sowie hinsichtlich einer Plausibilität der festgestellten Ergebnisse kann diese Arbeit nicht erheben. Insofern versteht sie sich als eine Teilleistung zu einer komplexen Sprachlernmotivationsforschung von internationalem Ausmaß. Nach der Auswertung des Materials im Schlusskapitel soll sie jedoch einen Beitrag zur Diskussion um die Motivation beim Fremdsprachenerwerb sowie um Erfahrungen im bilingualen Modul leisten.
1.3. Methodisches Vorgehen
Bei der Untersuchung werden in Anlehnung an Albert/Koster und Lamnek folgende Methoden angewandt:
Die Vorgehensweise im theoretischen Teil beruht auf einer Auswertung der vorhandenen Materialien und Literatur zu den Themen der Sprachpolitik, der Struktur der bilingualen Bildungsgänge in Deutschland und in Polen und der aktuellen Motivationsforschung, die als theoretische Grundsteine der vorliegenden Auseinandersetzung angesehen werden.
Im empirischen Teil wird die Methode der schriftlichen Befragung eingesetzt. Als Instrument zu deren Umsetzung wird ein Fragebogen mit offenen und geschlossenen, direkten und indirekten Fragen entwickelt. Bei der Wahl der Stichprobe wird das Quotenverfahren angewandt, das heißt, die Probanden wurden nach bestimmten, für die Untersuchung relevanten Merkmalen (Sprache: Deutsch/Polnisch sowie altes/neues Entwicklungskonzept des biling.-binat. Bildungsganges) ausgewählt. Die methodische Herangehensweise dieser Studie ist qualitativ. Die Auswertung der Ergebnisse dieser qualitativen Studie ist entsprechend interpretativ. Die Erhebungsdaten zur Motivation und Einstellung erfolgen in einer tabellarischen Zusammenfassung.
2. Förderung der Mehrsprachigkeit in Europa.
Im vereinigten Europa werden zunehmend Menschen unterschiedlicher nationaler, kultureller und sprachlicher Herkunft miteinander leben und arbeiten. Die steigende Bedeutung des Lernens fremder Sprachen ist die wichtigste und folgenreichste inhaltliche Veränderung in der Schule von heute. Viele Menschen können sich heute noch gar nicht vorstellen, dass man in naher Zukunft sowohl im Alltag als auch im Beruf ohne eine zweite oder dritte Sprache nicht mehr auskommen wird.
Wenn man die Fremdsprachenkenntnisse der Europäer näher betrachtet, stellt man fest, dass 74% von ihnen keine zweite Fremdsprache sprechen und 92% keine dritte Fremdsprache. 47% der Befragten sprechen außer ihrer Muttersprache keine andere Sprache.[5] Jedoch sind viele Befragten der Ansicht, dass jeder eine Fremdsprache beherrschen sollte (71%). Die am meisten gesprochene Fremdsprache ist mit großem Abstand Englisch (41%), dann Französisch (19%), Deutsch (10%) und Spanisch (7%). Etwa ein Fünftel der Europäer (22%) glaubt nicht „gut in Sprachen“ zu sein. Das größte Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten haben Dänen, Griechen und Luxemburger. Am wenigsten trauen sich Franzosen und Deutschen zu. Die Gründe, die die europäischen Bürger abhalten, eine Fremdsprache zu erlernen, sind laut der Eurobarometer-Umfrage an erster Stelle Zeitmangel (34%), woran sich mangelnde Motivation anschließt (31%). Entmutigend, vor allem in den Ländern Südeuropas, wirken außerdem die Kosten der Sprachkurse.[6]
Mit dem Ziel, die Bürger der Europäischen Union zum Erlernen mehrerer Sprachen anzuregen, wurde das Europäische Jahr der Sprachen 2001 eröffnet. Seine zentralen Anliegen waren:
- Vertiefung des Bewusstseins, welchen Reichtum die sprachliche Vielfalt in der Europäischen Union darstellt,
- Förderung der Sprachenvielfalt,
- Aufklärung einer möglichst großen Zahl von Menschen, welche Vorteile die Beherrschung mehrerer Sprachen bietet,
- Anregung zur lebenslangen Aneignung von Sprachkenntnissen,
- Sammeln und Verbreiten von Informationen, die den Sprachunterricht und das Erlernen von Fremdsprachen betreffen.[7]
Ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Förderung der Mehrsprachigkeit ist der alljährlich am 26. September stattfindende Europäische Tag der Sprachen.[8] Er dient vorrangig der Erinnerung an die Zielsetzungen des Europäischen Jahres der Sprachen 2001 und der Fortführung seiner Ideen.
2.1. Bildungspolitische Rahmenbedingungen für das Erlernen von Fremdsprachen
Das Ziel der Europäischen Sprachenpolitik ist das Erlernen von zwei Sprachen außer der Muttersprache. Alle Bürger sollen sich bemühen, in einem lebensbegleitenden Prozess ihre Sprachkenntnisse zu festigen, zu nutzen, zu erweitern und sie anderen zur Verfügung zu stellen.[9] Nun verläuft die Umsetzung dieses Zieles in jedem europäischen Länd unterschiedlich.
2.1.1. Stellung der Sprachen in den Lehrplänen der Europäischen Union
In Anbetracht der Tatsache, dass die junge Generation über deutlich mehr Fremdsprachenkenntnisse als die ältere verfügt (Tab.1), schließt man auf die Zunahme des Fremdsprachenunterrichts sowohl in öffentlichen als auch in privaten Schulen.
Tab. 1: Fremdsprachenkenntnisse nach Altersgruppen[10]
Laut der Europäischen Eurydice-Informationsstelle setzt der obligatorische Fremdsprachenunterricht immer früher ein. In fast allen Staaten sind die Schüler bereits im Primarbereich verpflichtet, eine Fremdsprache zu lernen. In mehreren Staaten gilt dies sogar bereits ab dem ersten Schuljahr: