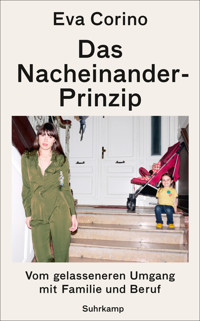
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Die gute Nachricht: In den vergangenen fünfzig Jahren hat sich die Lebenserwartung von Frauen um 15 Jahre verlängert. Warum aber hetzen sie trotz ihrer gewonnenen Zeit immer schneller durchs Leben? Weil auch die Erwartung an sie gestiegen ist, nur leider auf ein ungesundes Maß. Kindererziehung, Fortbildung, Studium, Partner, Karriere, soziales Engagement – Frauen sollen und müssen heute selbstverständlich alles liefern und beherrschen, gleichzeitig, nebeneinander. Zeitmangel und Überforderung sind noch die harmlosen, das Scheitern von Beziehungen oder Burn-outs gravierende Folgen dieses neuen, gefährlichen Lebensmodells.
Ob Vierfachmutter, die sich am Laptop neu erfinden muss, Friseurin, Polizistin, Managerin, kreative Quereinsteigern – dieses Buch erzählt von ihren modernen Leben und privaten und beruflichen Anforderungen. Gemeinsam mit Experten aus Politik, Wirtschaft oder Soziologie analysiert die Autorin Erwerbsbiografien im digitalen Zeitalter. Erläutert die Vor- und Nachteile gehypter Phänomene wie »Mompreneurs«, deckt Risiken, aber auch versteckte Chancen in der derzeitigen Sozial- und Familienpolitik auf.
In diesem engagierten Ratgeber beschreibt Eva Corino die Gefahren des modernen Gleichzeitigkeitswahns sowie seine Alternativen. Und sie fordert: Damit wir alle Lebensphasen voll ausschöpfen und endlich ein schönes, erfülltes Familien- und Berufsleben haben können, muss die Gesellschaft umdenken und kostbare Schonzeiten schaffen. Vergessen wir bei all dem nie: Die Gesellschaft – das sind wir!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Eva Corino
Das Nacheinander-Prinzip
Vom gelasseneren Umgang mitFamilie und Beruf
Suhrkamp
Inhalt
Teil 1 Das Nacheinander-Prinzip
Im Gleichzeitigkeitswahn
Was mir vorschwebt
Die Angst vor dem Urteil der anderen
Die drei Wellen des Feminismus. Und der Anfang der vierten
Kritik von rechts
Kritik von links
Das umgekehrte Tabu
My Way – oder die Unkultur des Bereuens
Teil 2 Lebensgeschichten
Marie, die Managerin
Amelie, die Theaterintendantin
Ursula, die Ärztin
Paula, die Wissenschaftlerin
Christine, die Therapeutin
Nikki, die Polizistin
Mathias, der Consultant
Teil 3 Bestandsaufnahmen
Selbstständige
Angestellte im öffentlichen Dienst
Angestellte in der Privatwirtschaft
Herausforderungen
Erste Herausforderung: Berufliche Auszeit als Alleinerziehende nehmen
Diese Beratungsstellen helfen:
Zweite Herausforderung: Richtig aus- und wieder einsteigen
Weitere praktische Ratschläge zum Wiedereinstieg von Experten sind:
Dritte Herausforderung: Nicht in die Coaching-Falle tappen.
Teil 4 Expertisen
Wo ist meine gewonnene Zeit geblieben?
Ein Gespräch mit dem Soziologen Hartmut Rosa
Kann ich mit 45 mein Leben noch mal umkrempeln?
Ein Gespräch mit dem Familiensoziologen Hans Bertram
Wie kann ich mir eine Weiterbildung leisten?
Ein Gespräch mit der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt
Was tun Arbeitgeber für die Familien?
Ein Gespräch mit der Personalleiterin Christiane Grunwald
Gibt es meinen Job in zehn Jahren überhaupt noch?
Ein Gespräch mit dem Arbeitsforscher Klaus F. Zimmermann
Teil 5 Metamorphosen
Eine weibliche Gründerzeit
Von der Projektmanagerin zur Gartendesignerin
Von der Tänzerin zur Gastronomie-Ikone
Von der sozialen Absteigerin zur Agenturchefin
Von der Medienanwältin zur Redenschreiberin und wieder zurück
Vom sinnlosen Meeting ins Homeoffice
Vom Jöbchen zum Jobsharing
Von der Mami zum Mompreneur
Teil 6 Chancen
Was wir individuell verändern können
Vorausschauend planen – und Überraschungen einkalkulieren
Die Entwicklungslinien des Kindes berücksichtigen
Was die Politik verändern muss
Ehegattensplitting zeitlich begrenzen
Elterngeld verlängern
Frühkindliche und schulische Bildung fördern
Unterhaltsrecht verbessern
Mutige Reformen angehen
Renteneintritt verzögern und flexibilisieren
Bildung für Erwachsene besser organisieren
Weiterbildung fördern
Arbeitsagenturen reformieren
Returnships einführen
Was die Wirtschaft verändern muss
Arbeitszeit weiter flexibilisieren
Eine neue Unternehmenskultur prägen
Wie wir die Kultur verändern können
Danksagung
Literaturverzeichnis
Teil 1 Das Nacheinander-Prinzip
Im Gleichzeitigkeitswahn
Nehmen wir meine Schulfreundin Marie*. Sie ist 36 Jahre alt, hat einen attraktiven Franzosen geheiratet, beide sind aufstrebende Ingenieure. Marie arbeitet als Managerin bei der französischen Eisenbahn. Sie managt den Bahnhof von Toulouse*, hat 230 Leute zu beaufsichtigen. Sie stellt sicher, dass die Züge auf den richtigen Gleisen einfahren, die technischen Störungen behoben werden, dass der Bahnhof sauber ist, die Geschäfte pünktlich öffnen. Außerdem überwacht sie den Bau einer neuen TGV-Trasse.
Ein ganz normaler Tag in ihrem Leben, sagen wir, ein Mittwoch, sieht so aus: Sie hetzt früh los, um ihre beiden Kinder, ihre fast dreijährige Tochter und einen sechs Monate alten Sohn, in die Krippe zu bringen, dann gleich weiter ins Büro. Dort muss sie als Erstes die Gleisarbeiter beschwichtigen, denn für den kommenden Tag ist ein Streik angekündigt. Es folgt ein Meeting nach dem anderen. Um 17 Uhr hetzt sie zurück zur Krippe, um ihre beiden Kinder abzuholen. Sie bugsiert die Babyschale in den Van, lässt ihre Aktentasche auf dem Autodach liegen und merkt erst zu Hause, dass sie fehlt. Sie kehrt um, findet sie, macht noch ein paar Einkäufe auf dem Weg, kocht dann ein warmes Abendessen, badet die Kinder, schläft beim Vorlesen in Kleidern ein, wacht um Mitternacht wieder auf und spült die schmutzigen Töpfe ab.
Mittlerweile ist Donnerstagnacht. Früher hat ihr Mann Jean* am Donnerstagnachmittag die Tochter abgeholt und im Park mit ihr gespielt. Aber seit er in die Privatwirtschaft gewechselt ist, macht er viele Dienstreisen. In dieser Nacht wird Marie vier Mal geweckt. Der kleine Jacques* braucht seine Flasche, will getragen werden, holt sich vermutlich die Nähe, die seine Mutter ihm am Tag vorher nicht geben konnte. In den frühen Morgenstunden küsst sie seine Stirn und stellt fest, dass er hohes Fieber hat. Sie ruft bei ihren Eltern an, in der Hoffnung, dass ihre Mutter anreisen und Jacques versorgen kann; in den nächsten Tagen soll der zweite Streckenabschnitt der TGV-Trasse eingeweiht werden. Am Telefon sagt die Mutter, sie könne nicht kommen, der Vater müsse ins Krankenhaus. Marie hat das Gefühl, dass sie eigentlich stehenden Fußes nach Deutschland reisen müsste, um den Eltern Beistand zu leisten. Aber das geht jetzt leider nicht, sie bestellt ihre Babysitterin, zwängt sich in ihr Kostüm und los, ein neuer Tag beginnt -- und dieser ganz normale Wahnsinn, den man heute gerne »Vereinbarkeit« nennt.
»Vereinbarkeit – wer weiß, wie es geht?«, titelt die ZEIT. »Die Lüge von der Vereinbarkeit«, beklagt die Wirtschaftswoche. Vereinbarkeit ist der Fetisch, das Sehnsuchtswort der Stunde, und das hat natürlich einen tieferen Grund. Vereinbarkeit ist ein beschönigendes Wort für etwas, das sich in Wirklichkeit oft anfühlt wie Zerrissenheit. Heute fällt die Zeit der Familiengründung mit der beruflichen Profilierung beider Eltern zusammen. Zeitnot und das ständige Gefühl von Überforderung sind die Folge. Kinder, Partnerschaft: ein logistisches Problem statt Glücksversprechen! Am Arbeitsplatz muss man so funktionieren, als hätte man keine familiären Aufgaben. Und wenn die Großeltern nicht mehr helfen können, sondern selbst hilfsbedürftig werden, bewegt sich die »Generation Sandwich« hart an der Grenze der eigenen Belastbarkeit.
Phasen der Entspannung und der äußersten Anspannung aller Kräfte sind heute zu ungleich über den Lebenslauf verteilt. Im Alter haben die meisten Menschen weniger Verantwortung, als gut für sie wäre. Die Pubertät wird in die Länge gezogen, die Familiengründung immer weiter hinausgezögert – aus Angst vor Festlegung und den anstrengenden Aufgaben, die sich in der Lebensmitte drängeln. Den richtigen Partner finden und »dingfest machen«, solange die biologische Uhr noch tickt. Familie gründen, sich hingebungsvoll um die eigenen Kinder kümmern. Ein Zuhause schaffen, bauen, renovieren, einrichten. Für das Alter vorsorgen. Alles geben im Beruf, zwei Karrieren voranbringen, wenn nötig, sogar umziehen und pendeln. Dabei gutaussehend und sportlich sein, kulturell und politisch auf dem Laufenden bleiben. Wie soll man das alles gleichzeitig schaffen und bewältigen? Das ist kaum möglich. Und ich kenne viele, die an dieser Quadratur des Kreises gescheitert sind, die ihre Gesundheit ruiniert, ihre Ehen beschädigt, ihre Kinder vernachlässigt haben. Mit teilweise äußerst dramatischen Folgen.
Der Familiensoziologe Hans Bertram hat dieses Phänomen die »Rushhour des Lebens« genannt. Noch treffender finde ich es, von einem »Gleichzeitigkeitswahn« zu sprechen: Weil es wahnsinnig ist zu glauben, dass moderne Mütter all das gleichzeitig leisten könnten, was sie leisten müssten, um in Familie und Beruf ihr »Soll« zu erfüllen. Das schaffen nur sehr wenige, die Happy Few, die besonders stark sind, besonders begabt und besonders gute Bedingungen haben. Aber was ist mit den anderen? Mit der großen Mehrheit der Frauen, die unter ganz normalen Bedingungen leben? Sollen die sich trotz der ständigen Selbstausbeutung als ungenügend empfinden?
Frauen werden nicht ermutigt, Familienphasen einzulegen. Weil die ökonomische Faktenlage es so will: Die Sozialforscherin Ute Klammer etwa, die 2011 im Auftrag des Familienministeriums am ersten Gleichstellungsbericht mitgeschrieben hat, warnt vor längeren Erwerbspausen. Mütter, die über das gesetzlich zugesicherte Maß hinaus vom Arbeitsmarkt fernbleiben, haben oft ein sehr geringes Lebenserwerbseinkommen. Und das Armutsrisiko ist groß, vor allem, wenn sie sich scheiden lassen und als Alleinerziehende große Lasten schultern müssen.
Aber was ist die Alternative? Marie hielt den gnadenlosen Takt ihrer Arbeitstage knapp zwei Jahre durch. Kurz nach der Geburt ihres dritten Kindes brach sie vor Erschöpfung zusammen und brauchte lange, um sich wieder zu erholen.
Nehmen wir eine andere Freundin, Stephanie*. Sie arbeitete bis vor ein paar Jahren in Brüssel bei der Europäischen Kommission* und sanierte daneben ein marodes Haus, hochschwanger, während ihr Sohn sich in der Krippe ständig irgendwelche Keime einfing, so dass sie ihn den halben Winter lang zu Hause behalten und ihre liegengebliebene Arbeit in Nachtschichten erledigen musste. Leider hatte ihr Mann das Gefühl, dass sie den Aufbau seiner Karriere nicht hinreichend unterstützte. Und leider hatte Stephanie das Gefühl, dass er sich nicht genug um die Kinder kümmerte – so dass sie ihre knappe Zeit zu zweit mit Streit und Vorwürfen zubrachten. Und als dann eine fröhliche Praktikantin an seine Bürotür klopfte, ging die Ehe endgültig in die Brüche.
In Deutschland werden heute 49 Prozent der Ehen geschieden, in Belgien, wo beide Eltern in der Regel Vollzeit arbeiten, sind es sogar 71 Prozent. Natürlich gibt es immer persönliche Gründe für das Scheitern von Beziehungen. Aber sie scheitern auch, weil die Druckzustände der Rushhour so schwer auszuhalten sind. Und weil die Paare ein unrealistisches Bild von Vereinbarkeit im Kopf haben, dem nur Supermänner und Superfrauen gerecht werden könnten. Ein familienpolitischer Diskurs, der dieses unrealistische Bild zum Leitbild erhebt, ist gefährlich und alles andere als nachhaltig. Er führt nämlich dazu, dass viele Frauen sich als Versagerinnen fühlen. Sie können sich abrackern, wie sie wollen. Sie haben trotzdem das Gefühl, immer im Defizit zu sein: Die Kinderlosen, weil sie Teil der demografischen Krise sind. Die hauptberuflichen Mütter, weil sie kein Geld in die Rentenkasse einzahlen. Und die berufstätigen Mütter, weil sie im Büro weniger verfügbar sind als die kinderlosen Kolleginnen und ihren Kindern weniger Aufmerksamkeit schenken können als die hauptberuflichen Mütter.
Die hellsichtige amerikanische Soziologin Arlie Russell Hochschild hat analysiert, dass berufstätige Mütter heute mindestens in zwei Schichten arbeiten: die erste Schicht am Arbeitsplatz und die zweite Schicht zu Hause. Wenn sie Pech haben, kommt auch noch eine dritte Schicht hinzu: die Auseinandersetzung mit den negativen Folgen ihrer Abwesenheit, der erschöpfte Kampf gegen die Traurigkeit, Wut und Verweigerungshaltung ihrer Kinder.
Inzwischen nimmt jeder dritte Vater Elternzeit, in der Regel allerdings nicht länger als zwei Monate, was auch zeigt, welches Männerbild in Deutschland noch immer herrscht. Der Mann muss arbeiten, aufsteigen und funktionieren, außerdem noch, so viel es geht, Vater sein und wenigstens symbolisch im Haushalt helfen. Und weil das natürlich auch eine Überforderung ist, kriechen Väter und Mütter gleichermaßen auf dem Zahnfleisch, vermuten aber ständig, der andere habe in diesem Rollenspiel den leichteren Part. Wahrscheinlich würde es Männern tatsächlich besser gehen, wenn sie sich weigerten, »potente Funktionsmaschinen« zu sein, die niemals scheitern. Aber von dieser Weigerung sind die meisten Männer im Alltag noch ziemlich weit entfernt.
Wenn aber Mütter kurz nach der Geburt ihrer Kinder ins Erwerbsleben zurückkehren und Väter zu Hause nicht einspringen können oder wollen, ist man oft beim »Outsourcing« angelangt. Dann sollen Tagesstätten, Tagesmütter, Nannies und Au-pairs die Lücke füllen, die die übermäßige Berufstätigkeit der Eltern im Leben ihrer Kinder hinterlässt. Geht das? Und bedeutet Familienmanagement dann nicht, dass immer weniger Familie und immer mehr Management stattfindet? Sehr viel Organisation, rings um eine leere Mitte?
Bei Wikipedia findet sich folgende Definition: »Outsourcing bzw. Auslagerung bezeichnet in der Ökonomie die Abgabe von Unternehmensaufgaben und -strukturen an externe Dienstleister. Es ist eine spezielle Form des Fremdbezugs einer bisher intern erbrachten Leistung.«
Im Jahr 2012 hat Hochschild in den USA ein Buch veröffentlicht mit dem Titel: Outsourced Self. What happens when we pay others to live our life. (Das outgesourcete Selbst. Was passiert, wenn wir andere Leute dafür bezahlen, dass sie unser Leben leben). In diesem hochinteressanten Buch beschreibt sie, dass Aufgaben, die früher das »Kerngeschäft« der Familie waren, heute zunehmend an externe Dienstleister vergeben werden. Weil den Eltern einfach die Kraft fehlt, sie noch selbst zu übernehmen.
Immer größere Teile des privaten und familiären Lebens werden zu Markte getragen: Das Kleinkind? Zack, zur Tagesmutter. Der demente Opa? Zack, ins Altenheim. Die kriselnde Ehe? Zack, zum Therapeuten. Das warme Mittagessen? Wird in verschiedenen Kantinen eingenommen. Der Einkauf? Wird per Internet bestellt. Die Hemden? Werden in der Reinigung gleich gebügelt. Die Herbstferien? Gestaltet der Trainer im Fußballcamp. Der Kindergeburtstag? Organisiert das Team in der Kletterhalle.
Hochschild spricht mit den Konsumenten dieser schönen neuen Dienstleistungswelt. Und sie macht deutlich, dass sie diesen Konsum zugleich als Erleichterung und als großen Verlust erleben. Denn natürlich erinnern die Eltern einen Kindergeburtstag, den sie selbst imaginieren und mitfeiern, viel intensiver als einen, den sie nur »gebucht« haben.
Zu viel »Outsourcing« bedeutet, dass wir als Eltern eine tiefe Dimension der eigenen Lebenserfahrung einbüßen.
Eine andere Folge des Gleichzeitigkeitswahns ist, dass so mancher Kinderwunsch unerfüllt bleibt. Viele junge Paare träumen von einer großen Familie, trauen sich aber nicht, mehr als ein oder höchstens zwei Kinder zu bekommen. Sie haben panische Angst, sonst den Anforderungen ihres Berufs nicht mehr gerecht zu werden und aus allen Karriere-Rastern herauszufallen, und zwar für immer.
Und wenn die Kinder flügge werden und aus dem Nest hüpfen, sind die Eltern plötzlich traurig. Weil sie nicht richtig »satt« geworden sind als Mütter oder Väter. Weil sie die Erfahrung, für Kinder sorgen zu dürfen, doch gerne mehr ausgekostet hätten. Der psychologische Umschlag von: »Bloß kein Kind mehr, das wird mir alles zu viel!« zu: »Hätten wir doch bloß noch eins bekommen, es ist auf einmal so still hier im Haus!« kann heute sehr schnell kommen.
Das ist das Problem bei dem Modell des »Adult Worker«, das in familienpolitischen Kreisen viel diskutiert wird: Wenn Vater und Mutter zu jedem Zeitpunkt ihres Lebens Erwerbstätigkeit und Erziehungsleistung kombinieren wollen, dann kombinieren sie auch den Stress aus beiden Bereichen: Den Stress der Deadlines, der ständigen Meetings, der Telefonate in überfüllten Zugabteilen, der hastig verschlungenen Brötchenhälften. Den Stress der durchwachten Nächte, der streitenden Geschwister, der Trotzanfälle und der umgestoßenen Gläser. Und den Stress, zwischen zwei ganz verschiedenen Zeitgefühlen zu vermitteln.
Nun ist das kindliche Zeitempfinden wie ein langsamer, ruhiger Fluss. Es ist schön, wenn Eltern die Gelegenheit haben, mit offenen Augen an seinem Ufer entlangzugehen – und wartend zu sehen, wie lange ihre Kinder spielen, streunen, staunen, toben, trödeln und träumen wollen … Aber wenn alles gleichzeitig stattfinden muss, die Familiengründung und die berufliche Profilierung von beiden Eltern, dann heißt das auch, dass sie diese Gelegenheit nicht mehr haben. Und dass die Kindheit ihren freien und fließenden Charakter verliert.
Die Autorin Antonia Baum hat das einmal sehr gut beschrieben, in einem FAS-Artikel mit dem Titel: »Man muss wahnsinnig sein, um heute ein Kind zu kriegen«. Baum ist Anfang dreißig und sieht die Kinderfrage wie ein Damokles-Schwert auf sich zukommen. Warum, fragt sie sich, soll sie ein Kind bekommen, wenn sie gar keine Zeit dafür hat und es pausenlos wegorganisieren muss? Wann solle denn da eine Beziehung zu dem Kind entstehen? Mit einem Jahr in die Kita, dann in die Ganztagsschule: »Auf dem Weg zur Kita rennen, damit ich nicht zu spät komme, aber mein Kind will sich vielleicht irgendeine Blume ansehen oder findet einen Lastwagen toll, und dann muss ich es da wegziehen, weil ich, im Dienst der Arbeit, keine Zeit habe.« Die Autorin nennt es ein »Selbstausbeutungskonzept«, das schon beginnt, bevor man überhaupt Kinder hat. Arbeit, Beziehung, Körper, Bildung und Einrichtung – alles müsse heute perfekt sein, und perfekte Kinder sollten obendrauf, wobei die sich so oft dem Perfektions- und Timing-Wahn entziehen würden, dass das Ganze gar nicht mehr kompatibel sei, nach dem Motto: »Es ist jetzt aber total unpassend, dass du schlecht träumst, muss das sein? Ich habe zu tun!«
Nun kann man natürlich argumentieren, dass wir auch die Freuden aus beiden Bereichen kombinieren. Aber mein Eindruck ist, dass wir beim Zehnkampf des modernen Lebens inzwischen emotional nach dem Motto leben: »Mehr ist weniger!«
In den letzten fünfzehn Jahren sind die Familienphasen immer kürzer und gehetzter geworden. In einer Studie des DIW zur Wirkung des Elterngeldes, das im Januar 2007 eingeführt wurde, heißt es: »Erwerbsunterbrechungen von Müttern in Deutschland waren im internationalen Vergleich überdurchschnittlich lang. Die Verkürzung der maximalen Bezugsdauer von 24 Monaten beim Erziehungsgeld auf zwölf Monate beim Elterngeld entsprachen der politischen Zielsetzung, diese Unterbrechungen zu verkürzen. Eine Analyse tatsächlicher Veränderungen des Erwerbsverhaltens auf Basis des Mikrozensus bestätigt, dass sich die Erwerbsbeteiligung von Müttern im zweiten Jahr nach der Geburt des Kindes deutlich erhöht hat, vor allem unter Müttern mit niedrigem Einkommen.«
Für viele Vertreter aus Wirtschaft und Politik ist das ein Sieg. Aber ein Sieg ist es nur, solange wir uns in einem Diskurs bewegen, der Erwerbstätigkeit für das Wichtigste hält, und Familienarbeit nur für ein notwendiges Übel. Und solange wir nichts dagegen haben, dass die Tage unserer Kinder durchgetaktet werden und diktiert sind von den beruflichen Zwängen ihrer Eltern, von uns.
Was mir vorschwebt
2006 präsentierte Ursula von der Leyen eine von der Deutschen Industrie gesponserte Broschüre mit dem Titel: Wachstumseffekte einer bevölkerungsorientierten Familienpolitik. Die Strategie dieser Politik müsse sein, »knappe Ressourcen so einzuteilen und zu konzentrieren, dass die wesentlichen Funktionen von Familie – Reproduktion, Unterhaltssicherung, Sozialisation, Daseinsvorsorge – mit ökonomischen Zielen harmonieren können«. Und was ist mit der Erziehung der Kinder durch ihre Eltern? In ihr sehen die Autoren jener Broschüre anscheinend »keine wesentliche Funktion von Familie«.
Über die Bedeutung der frühen Jahre für die kindliche Entwicklung wurde in den letzten Jahren viel geforscht und geschrieben. Alles, was im ersten, zweiten und dritten Lebensjahr passiert, hat große Auswirkungen auf die körperliche, geistige und soziale Entwicklung eines Kindes. Und noch wichtiger: auf seine Lebensfreude und seine Bindungsfähigkeit. Moderne Bindungsforscher wie der Psychiater und Psychotherapeut Professor Dr. Karl Heinz Brisch von der Universität München werden nicht müde zu betonen, dass Bindung der Bildung vorausgehen muss. Weil ein sicher gebundenes Kind in der Regel mehr Lust hat, zu lernen und seine Umwelt zu erkunden.
Kurioserweise hat sich zeitgleich eine Lebensform etabliert, die auf die frühestmögliche Trennung von Eltern und Kindern setzt – und für alle sehr schmerzhaft ist, jedoch der herrschenden Karrierelogik dient.
Aber warum eigentlich diese Ungeduld, warum die Eile?Die Lebenserwartung von Männern bei Geburt lag 2015 bei 78,4, die Lebenserwartung bei Frauen bei 83,4 Jahren, Tendenz steigend. Seit dem Jahr 1900 ist die Lebenserwartung beider Geschlechter um rund 40 Jahre gestiegen. Und seit dem Jahr 1950 haben sowohl die Männer als auch die Frauen rund 15 JahreLebenszeit hinzugewonnen. Das muss man sich einmal vorstellen: Was wir mit 15 zusätzlichen Jahren alles anstellen können! Wenn wir es richtig anstellen, zumindest:
Wir sind in einer historisch einmaligen Situation.
Wir haben so viele berufliche Chancen wie nie zuvor.
Wir sind gleichberechtigt wie nie zuvor.
Wir leben so lang wie nie zuvor. Und das gesünder als je zuvor.
Wir profitieren von den Errungenschaften der modernen Medizin, von Sport und guter Ernährung. Unser Alltag verlangt uns vergleichsweise wenige körperliche Strapazen ab. Das bedeutet, dass wir länger gesund und leistungsfähig sind. Junge Frauen haben Möglichkeiten, von denen frühere Frauen-Generationen nur träumen konnten, wie den selbstverständlichen Zugang zu Bildung und Beruf, das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und eine sensationelle Wahlfreiheit in jedem Bereich des privaten und öffentlichen Lebens. Noch im 19. Jahrhundert war jede Geburt für sie eine Frage von Leben und Tod, die Kinder- und Müttersterblichkeit hoch, das Kindbettfieber grassierte. Heute ist das Risiko, bei der Geburt eines Kindes sterben zu müssen, winzig klein geworden. Fast alle Kinder, die eine Mutter zur Welt bringt, darf sie auch großziehen und bis ins hohe Erwachsenenalter begleiten. Wenn ihr letztgeborenes Kind die Pubertät erreicht, steht sie in der Mitte ihres Lebens. Das bedeutet, dass die Mutterrolle heute nicht mehr ein ganzes Frauenleben ausfüllen kann. Und umgekehrt heißt es auch, dass wir die Lebensphase, in der wir Mutter werden und sein können, wieder mehr ausschöpfen sollten.
Wenn wir wollen, dann können wir länger arbeiten und später in Rente gehen. Dann haben wir mehr Zeit für Verrücktheiten, mehr Zeit, um unsere Kinder zu erziehen und uns an ihnen zu freuen, mehr Zeit, um etwas zu lernen, Berufe zu ergreifen und zu wechseln. Wir könnten nach einer glücklichen und gelassenen Familienphase mit neuen Impulsen ins Berufsleben zurückkehren.
Aber so einfach ist das anscheinend nicht. Zwar sind in den westlichen Demokratien die Frauen dem Gebären längst nicht mehr »unterworfen«. Durch Verhütung, Abtreibung und künstliche Befruchtung haben sie die Möglichkeit, ihre Fortpflanzung stärker willentlich zu kontrollieren. Das ist im Grunde ein Fortschritt, hat aber auch eigene Tücken, insofern, als sich die Frauen und Männer manchmal mit ihren Planungen selbst im Weg stehen, in ihrem »Karriere- und Optimierungswahn« ewig nach dem perfekten Partner und dem idealen Zeitpunkt suchen – und am Ende allein dastehen.
Denn von all den Wahlmöglichkeiten fühlen viele sich auch verunsichert. Eben weil sie nicht wissen, was sie wählen sollen. Weil sie Angst haben, etwas zu verpassen. Und weil sie den Eindruck haben, den widersprüchlichsten Erwartungen gerecht werden zu müssen. Manche wünschen sich aus diesem quälenden Zustand sogar zurück in eine Zeit, in der gesellschaftliche Konventionen regelten, wie Männer, Frauen und Kinder zu leben hatten. Aber diese Form von Eskapismus bringt niemanden weiter.
Es gibt diesen berühmten Satz von Leo Tolstoi, der am Anfang von Anna Karenina steht: »Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich, jede unglückliche ist unglücklich auf ihre Weise.«
Ich glaube, das stimmt nicht mehr. Nicht nur, weil sich in den vergangenen hundertfünfzig Jahren die Gesellschaft und die Art, wie die Menschen leben, arbeiten und sich selbst wahrnehmen, auf revolutionäre Weise verändert haben: Von der Agrar- zur Industriegesellschaft, von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft, von der analogen zur digitalen Wissensgesellschaft – mit diesen unterschiedlichen Produktionsweisen haben sich natürlich auch die Familienformen verwandelt, von der bäuerlichen Großfamilie bis hin zur multilokalen Mehr-Generationen-Familie.
Ich denke, dass heute, im sogenannten Zeitalter des Individualismus, jede Familie ihre eigene Weise erfinden muss, um glücklich zu sein. Und dass wir alle lernen müssen, noch mutiger und zugleich realistischer mit unserer neuen Wahlfreiheit umzugehen.
Frauen und Männer haben heute gute Chancen, sich ein Leben zu entwerfen, das ihren individuellen Talenten, Interessen und Bedürfnissen entspricht. Sie können sich fragen: Was ist gut für mich? Was ist gut für die Menschen, die ich liebe? Und was ist meine eigene Philosophie vom guten Leben?
Früher hatten die Frauen nur eine einzige Option: nämlich Familie. Es wurde erwartet, dass alle Frauen die Mutterrolle anstreben, annehmen und ausfüllen – und zwar ihr Leben lang. Und das war natürlich eine schreckliche Einengung und Bevormundung. Heute gibt es drei klassische Optionen, und die Frauen können wählen: Sie können nur für die Familie leben. Sie können nur für den Beruf leben. Sie können Familie und Beruf gleichzeitig leben.
Natürlich gibt es Frauen, die sich für eine dieser drei Möglichkeiten entscheiden und damit glücklich werden. Aber in den Hunderten von Gesprächen, die ich in den letzten drei Jahren mit Müttern geführt habe, wurde mir klar, dass viele sehr unzufrieden sind und auf der Suche nach einem Ausweg. Weil sie beides, Familie und Beruf, auf eine anspruchsvolle Weise leben wollen. Und weil ihnen das mit den drei klassischen Optionen nicht gelingt.
Leben sie nur für die Familie, dann leiden sie, wenn die Kinder sie nicht mehr brauchen und die Enkel auf sich warten lassen. Weil sie dann 15 bis 25 Jahre lang nicht genug zu tun haben.
Leben sie nur für den Beruf, dann fehlt ihnen das Zusammensein mit ihren Kindern. Und sie leiden, weil sie mit deren Erziehung einen bedeutungsvollen Teil ihres eigenen Lebens outsourcen.
Leben sie Familie und Beruf gleichzeitig, dann leiden sie in der Rushhour des Lebens unter Stress, Überanstrengung und dem Gefühl, nichts richtig zu machen.
Und weil diese Nachteile sehr ins Gewicht fallen, brauchen wir unbedingt noch eine
Option: das Nacheinander-Prinzip. Leben wir nach diesem Prinzip, können wir unsere Kinder in Ruhe begleiten, ohne dafür mit zwei Jahrzehnten der Langeweile zu büßen. Und wir können uns beruflich verwirklichen, ohne den mörderischen Stress der Rushhour zu erleiden.Es schenkt uns einen gelasseneren Umgang mit Familie und Beruf. Und zwar besonders in Konstellationen, wo Gleichzeitigkeit misslingt: Wenn beide Partner sowohl starke berufliche Ambitionen haben als auch eine anspruchsvolle Vorstellung von Erziehung und Familienleben. Wenn sie sich mehr als ein oder zwei Kinder wünschen. Wenn die Frau ihren Mann stoisch weiterliebt, obwohl er keine Lust hat, sich »feministisch korrekt« zu verhalten, sprich: Wenn er keinen Eifer zeigt, Milchflaschen aufzuwärmen, Töchter zum Schwimmunterricht zu fahren, Rechtschreibfehler in Schulheften zu korrigieren und nach dem Baden dreißig winzige Fingernägel zu schneiden. Wenn er dreckige Töpfe erst mal »einweicht«, anstatt schnell den Abwasch zu machen. Und wenn er sich trotzdem nachts ans Bett der Kinder schleicht, um ihnen über das Haar zu streichen. Wenn Chefs den Wunsch nach Teilzeit mit einem lauten Hohnlachen quittieren. Wenn einer der Partner für seinen Beruf ständig umziehen muss. Wenn keine fabelhafte Großmutter um die Ecke wohnt, die alle Zeit und Geduld der Welt hat – und wenn das Geld fehlt, um jemanden anzuheuern, der diese fehlende Großmutter ersetzen könnte.
Und last but not least: Wenn man gar keinen Ersatz möchte, sondern lieber selbst die prägende Figur im Leben der eigenen Kinder sein.
In diesem Buch will ich versuchen, möglichst unideologisch zu sein. Ich will fragen, zuhören und Geschichten erzählen, die von eigenen Wegen zwischen Beruf und Familie handeln, von Erfolg und Scheitern, Wut und Sehnsucht. Auf keinen Fall will ich anderen Frauen vorschreiben, wie sie zu leben haben. Nein, meine Schilderungen sollen den Blick freimachen für die Vielfalt der modernen weiblichen Lebensläufe und für die wachsende Möglichkeit, die Mutterrolle als eine echte Hauptrolle zu begreifen, ohne für immer darauf festgelegt zu sein.
Im Gespräch mit Experten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft habe ich analysiert, wie die Gesellschaft umdenken und eine kostbare Schonzeit schaffen kann für die sensiblen Jahre der Familiengründung, auch wenn die finanziellen Ressourcen der Eltern knapp sind. Und ganz praktisch möchte ich zeigen, wie der Wiedereinstieg und berufliche Neustart von Müttern heute gelingen kann.
Im Folgenden beschreibe ich ausführlich die Lebensläufe von sechs Frauen und einem Mann, die das Nacheinander-Prinzip gelebt haben.
Man kann es so sehen: Sie mussten gegen den Strom des Zeitgeists schwimmen, um die eigene Karriere für die Kinder phasenweise auszusetzen und um dann wieder ambitioniert berufstätig zu werden.
Man kann es aber auch so sehen: Sechs von den sieben Beschriebenen haben studiert und sind Teil der gut ausgebildeten Mittelschicht. Sie waren privilegiert, denn sie hatten finanziell die Möglichkeit, sich für eine Familienphase zu entscheiden und wurden von ihren Partnern unterstützt. Ich bin davon überzeugt, dass sie etwas vorgelebt haben, das immer mehr Frauen – und Männer! – nachahmen und erfinderisch variieren können. Gleichzeitig weiß ich natürlich, dass Alleinerziehende oder weniger gut ausgebildete Normalverdiener zusätzliche Herausforderungen zu bewältigen haben. Der materielle Verzicht für sie ist in einer Familienphase härter und der berufliche Wiedereinstieg oft mit größeren Risiken verbunden. Wie Frauen aus allen Schichten genau das trotzdem schaffen und phasenweise im Beruf kürzertreten können: Dieser Frage gehe ich in der zweiten Hälfte des Buches nach.
Mit Anfang 20 habe ich das Pariser Picasso-Museum besucht. Jeder Raum dort ist einer bestimmten Schaffensphase gewidmet – der blauen und der rosa Periode, der kubistischen und der surrealistischen. Und auch wenn die meisten Menschen nicht die Schaffenskraft eines Picasso haben, könnten wir uns ein Leben in Phasen vorstellen.
Möglich wäre es nämlich schon: Eine junge Frau kann heute erst einmal ihre Ausbildung machen, ein paar Jahre ihre Freiheit genießen, studieren, experimentieren, reisen, ausgehen, die Heldin sein in ihren unglücklichen und glücklichen Liebesgeschichten. Sie kann sich in ihren ersten Job stürzen, sich in einer professionellen Welt ein Standing erarbeiten. Dann eine Familie gründen, sich auf ihre Kinder konzentrieren – und fünf, acht, zwölf Jahre später, wenn die Kinder sie nicht mehr so dringend brauchen, ihren beruflichen Wiedereinstieg vorbereiten und realisieren.
Sie kann zunächst in Teilzeit arbeiten, den Umfang und die Reichweite ihrer Arbeit konsequent steigern, im Crescendo sozusagen. Sind die Kinder groß, kann sie noch einmal ihre geballte Kraft und Erfahrung in den Beruf investieren und eine zweite berufliche Blütezeit erleben. Nach dem späten Renteneintritt hat sie die Möglichkeit, ihre beruflichen Kenntnisse in Ehrenämter einfließen zu lassen, den Familien ihrer Kinder als Großmutter beizustehen. Sie kann auf Reisen gehen, eine andere Form der Ungebundenheit erleben – und in der Zeit des hohen Alters darauf vertrauen, dass ihre Kinder und Enkel ihr zur Seite stehen, wenn die eigenen Kräfte nachlassen.
Das wäre für mich, mit ein paar Strichen skizziert, die Vision eines selbstbestimmten Frauenlebens. Und sie ist nicht etwa utopisch, es gibt eine ganze Reihe von existentiellen, sozialen und technischen Entwicklungen, die für ein Nacheinander-Prinzip sprechen.
Frauen sind heute tendenziell besser ausgebildet als Männer. Mädchen haben in der Schule bessere Noten und machen häufiger Abitur als Jungen. Frauen studieren zielstrebiger als Männer und sie haben auch häufiger einen qualifizierten Abschluss. 84 Prozent der Frauen zwischen 20 und 30 haben eine abgeschlossene berufliche Ausbildung – 27 Prozent der jungen Frauen sogar einen Universitäts-, einen Fachhochschulabschluss oder einen Meisterbrief.
Außerdem verfügen viele zum Zeitpunkt der Familiengründung schon über etliche Jahre Berufserfahrung und ein Netzwerk, auf das sie später wieder zurückgreifen können. Das ist etwas, was in der Generation unserer Eltern alles andere als selbstverständlich war; da gab es noch zahllose Frauen, die ihre Ausbildung abbrachen, sobald sie heirateten und das erste Kind erwarteten.
Auch waren Krippen, Kindertagesstätten und Ganztagsschulen in Westdeutschland noch eine absolute Rarität. Kinder kamen um 12 oder 13 Uhr aus der Schule, und es war gesellschaftlicher Konsens, dass sie dann ein von der Mutter selbst gekochtes Mittagessen vorfinden sollten. Und dieses Mittagessen »zerhackte« den Tag und ließ es vielen finanziell bessergestellten Müttern als Frivolität erscheinen, an eine Erwerbstätigkeit außer Haus zu denken. Worte wie »Telearbeit« und »Homeoffice« waren noch nicht erfunden. Und das führte dazu, dass sie die Jahre, in denen ihre Kinder längst auf weiterführende Schulen gingen und sich für andere Dinge interessierten als die treublickende Begleitung ihrer Mütter, nicht für ihr berufliches Fortkommen nutzen konnten.
Erst als die Kinder das Elternhaus wirklich verlassen hatten, machten sich diese Mütter oft halbherzig auf die Suche nach einer Arbeit oder einem wirkungsvollen Ehrenamt, das die entstandene Leere füllen sollte – häufig ohne Erfolg. Das ist vielleicht die problematischste Seite des westdeutschen Hausfrauenmodells: Die Trauer über das »empty nest« im Alter zwischen 50 und 65 Jahren konnte zum beherrschenden Lebensgefühl werden.
Die Anwältin Susanne Winckler erzählt zum Beispiel, dass ihre Mutter an dem Tag, als ihre jüngste Tochter Abitur machte, bitterlich geweint habe. »Meine Mutter ist ganz in der Mutterrolle aufgegangen«, sagt Susanne, »hat sich vollumfänglich um mich und meine zwei Schwestern gekümmert, und zwar bis zum Abitur. Sie hat gerne gekocht und gebastelt. Sie hat Kostüme genäht, Puppenhäuser gebaut und uns liebevoll gepflegt, wenn wir krank waren. Aber sie hat sich sehr schwergetan, von dieser Rolle Abschied zu nehmen, zwanzig Jahre lang eigentlich. Und wir Töchter hatten auch nie das Gefühl, wirklich losgelassen zu werden. Berufstätig ist meine Mutter nie gewesen. Ehrenamt, das hat sie überlegt, aber nie realisiert. Mein Vater war als Rentner noch sehr aktiv und hatte es nicht nötig, ständig umsorgt zu werden. Also schlug sie dann den resignativen Weg ein, mit langen Bridgepartien am Nachmittag.«
In den vergangenen fünfzehn Jahren wurde gewaltig in den Ausbau der Betreuungsinfrastruktur investiert. Inzwischen ist es für Eltern aus allen gesellschaftlichen Schichten normal geworden, dass sie diese Infrastruktur auch nutzen. Das hilft auch denjenigen Müttern, die nach einer längeren Familienphase in den Beruf zurückkehren, weil sie so die Verantwortung für die Erziehung ihrer Kinder auf mehrere Schultern verteilen können.
Außerdem hat die Rollenflexibilität der Männer zugenommen, auch ihre Bereitschaft, zu Haushalt und Erziehung beizutragen. Sie pochen nicht mehr auf das Gewohnheitsrecht, sondern lassen sich darauf ein, die Arbeitsteilung in der Familie in verschiedenen Lebensphasen neu auszuhandeln.
Beim beruflichen Wiedereinstieg können die Frauen heute deutlich selbstbewusster sein. Die demografische Krise sorgt für eine zunehmende Knappheit auf dem Arbeitsmarkt, für den viel beschworenen Fach- und Führungskräftemangel. Und das setzt immer mehr Unternehmen unter Druck, sich im Inneren zu reformieren und nach außen als ein »attraktiver Arbeitgeber« zu präsentieren.
In einem werbenden Text der Firma Bosch heißt es zum Beispiel: »In seinen Leitlinien hat sich das Unternehmen einer flexiblen und familienbewussten Arbeitskultur verpflichtet. Dies zeigt den weltweit rund 375 000 Mitarbeitern, dass familiäre Verpflichtungen genauso wertgeschätzt werden wie berufliches Engagement. Dafür stehen zum Beispiel über 100 verschiedene Arbeitszeitmodelle, Homeoffice, Jobsharing und auf Betreuungszeiten abgestimmte Familienarbeitsplätze im administrativen und produktionsnahen Bereich … Das Ziel ist klar: das Potential einer top ausgebildeten Generation von Frauen noch besser zu nutzen – und zwar auf allen Hierarchie-Ebenen.«
Der tendenziell spätere Renteneintritt macht es für die Unternehmen attraktiver, in den Wiedereinstieg von qualifizierten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu investieren, die noch zwanzig bis dreißig produktive Jahre vor sich haben. In der Generation unserer Eltern gab es in vielen Unternehmen gar keine Möglichkeit, Teilzeit zu arbeiten. Oder es gab genau eine Möglichkeit: die 50-Prozent-Stelle. Heute hat sich das Spektrum deutlich erweitert. Und in besonders fortschrittlichen deutschen Unternehmen wie beispielsweise dem Werkzeugmaschinenbauer »Trumpf« kann man seine Arbeitszeit alle zwei Jahre neu festlegen, kann zum Beispiel 15 Stunden arbeiten, 28 oder 40.
Telearbeit und Homeoffice sind keine Notlösungen mehr, sondern ein attraktiver Teil der neuen Arbeitswelt. Und zwischen dem, was Homeoffice vor dreißig Jahren war und was es heute bedeutet, hat die Digitalisierung einen echten technischen Quantensprung bewirkt. Besonders in wissensintensiven und kreativen Berufen sind ein stilles Zimmer, ein Laptop und ein Smartphone schon die besten Voraussetzungen, um produktiv zu sein.
Die Erfindungen der letzten beiden Jahrzehnte erlauben es einer wachsenden Zahl von Menschen, zu Hause zu arbeiten, in der Nähe ihrer Kinder und in Einklang mit den Lebensrhythmen ihrer Familien. Außerdem schafft das Internet neue Möglichkeiten für Mütter, sich selbstständig zu machen und mit wenig Kapital ein florierendes Unternehmen zu gründen.
Trotz dieser Entwicklungen sind Frauen, die das »Nacheinander-Prinzip« leben, noch die Ausnahme und nicht die Regel. Warum ist das so? Es gibt Widerstände, die wir überwinden müssen.
Wenn Mütter wiedereinstiegen, dann konkurrieren sie einerseits mit den Young Professionals, die mit frischen Qualifikationen von der Uni kommen, rund um die Uhr verfügbar sind und noch dem Ideal des modernen Arbeitnehmers entsprechen: No attachment, no obligation! Und andererseits konkurrieren sie mit den früheren Kollegen gleichen Alters, die deutlich mehr Berufserfahrung haben.
Noch herrscht die Überzeugung, dass die entscheidenden Karriereschritte schon bis zum 35. Lebensjahr passiert sein müssen. Es gibt Untersuchungen, dass die überwältigende Mehrheit der Angestellten, die besser oder überdurchschnittlich gut verdienen, das schon in eben diesem Alter getan haben. Aber diese unsichtbaren »Altersnormen« ergeben in einer Gesellschaft mit einer drastisch erhöhten Lebenserwartung keinen Sinn mehr. Genauso die grobe Bismarck’sche Dreiteilung, die in unserem Rentensystem fortwirkt, welche die Jugend für die Ausbildung vorsieht, die Erwachsenenzeit für die Arbeit und das Alter für das reine Ausruhen von der Arbeit. Dieses starre Schema widerspricht den Ideen vom »lebenslangen Lernen«. Die Innnovationszyklen der Informationsgesellschaft sind so schnell, dass wir uns ständig neu orientieren müssen und die Menge an spezifischer Berufserfahrung weniger wert ist. Das ist eigentlich gut für Mütter und Väter, die nach einer Familienphase wieder einsteigen wollen.
Auch in Deutschland verabschiedet man sich allmählich »von dem bürokratischen Monster einer kontinuierlichen Karriere« (Hans Bertram). Denn es passt nicht mehr zur wachsenden Fragmentierung der Berufsbiografien, die den Menschen eine größere geistige und räumliche Beweglichkeit abverlangt.
Der amerikanische Soziologe Richard Sennett hat diese Fragmentierung schon vor vielen Jahren in seinem Buch Der flexible Mensch beschrieben: In den USA ist es selbstverständlicher als in Europa, dass Menschen in ihrem Leben mehrfach Jobs und berufliche Identitäten wechseln können und wechseln müssen. Das spiegelt sich in der optimistischen Formel: »Re-invent yourself!«
Entsprechend müssten wir darauf hinwirken, dass sich neue Altersnormen durchsetzen, bestimmte Karrieren auch zwischen vierzig und fünfzig Jahren angefangen und beschleunigt werden können. Denn was ist mit all den gut ausgebildeten Müttern, die ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen beziehungsweise ein bis zwei Jahrzehnte in Teilzeit arbeiten, um ihre Familien gut versorgen zu können? Oft wird unterstellt, dass sie mit Anfang vierzig keinen beruflichen Ehrgeiz mehr haben. Aber stimmt das? Tatsächlich sind viele Frauen mit Anfang vierzig auf dem Höhepunkt ihrer Schaffenskraft. Und sie wissen auch genau, was sie mit dieser Kraft noch alles erreichen wollen.
Familienarbeit ist Arbeit, nicht das Gegenteil davon. Sie muss ein selbstbewusster Teil der Lebensläufe werden. Man soll nicht schamvoll verstecken müssen, was man bei der Erziehung der eigenen Kinder geleistet hat. Und es muss klar sein, dass in dieser »Schule des Lebens« eine Reifung der Persönlichkeit stattfindet, die der Berufstätigkeit in Form von sogenannten »Soft Skills« zugutekommt: als Menschenkenntnis und Entscheidungsfreude, als die Fähigkeit, Gespräche zu führen, Gemeinschaften zu stiften und lebendige Prozesse zu organisieren.
Natürlich gibt es Branchen, in denen allgemeine Lebenserfahrung den Mangel an spezifischer Berufserfahrung nicht ausgleichen kann, Branchen, in denen die Qualifikationen schnell veralten, wo bei den »ausgestiegenen« Eltern tatsächlich das stattfindet, was Ökonomen mit einem überaus kühlen Wort als »Humankapitalverlust« beschreiben. Es wäre deshalb klug, wenn wir als Gesellschaft mehr Mittel und Möglichkeiten für Weiterbildung bereitstellen, spezielle Returnship- und Trainee-Programme für wiedereinsteigende Eltern, kurze Studiengänge für das »Updaten« von Fachwissen. All das würde dazu beitragen, die Durchlässigkeit des Arbeitsmarktes für engagierte Mütter und Väter zu erhöhen.
Allerdings – ein Bewusstseinswandel vollzieht sich nur langsam. In den allermeisten Personalabteilungen herrscht immer noch das alte Denken. Und beim Recruiting zählt am Ende dann doch, ob man eine lückenlose Erwerbsbiografie vorweisen kann. Dabei wird nicht bedacht, dass Mutter und Väter nach der Rushhour deutlich produktiver sein können als währenddessen. Weil sie sich wieder mehr auf den Beruf konzentrieren können. Und weil sie durch die Feuertaufe der Familiengründung standhafter, effizienter und insgesamt leistungsfähiger geworden sind.
Aber viele Personaler haben diesen neuen Frauentypus noch nicht »auf dem Schirm«: ambitionierte Frauen, die nach zehn Jahren intensiver Familienarbeit den Hebel wieder umlegen und Karriere machen wollen. Weil sie keine Notwendigkeit mehr sehen, ihrer zwölfjährigen Tochter bei den Hausaufgaben das Händchen zu halten. Und weil sie die Unternehmensziele jetzt wichtiger nehmen als den Schnupfen der Tante. Und das sind dieselben Frauen, die ihren Kindern in den ersten Lebensjahren kaum von der Seite gewichen sind, sie geduldig gestillt und getragen haben, wenn sie nachts mit einem Alptraum aus dem Schlaf schreckten.
Hier müssten die Unternehmen umdenken und überlegen, wie sie diese Frauen – beim Kampf um die besten Köpfe – für sich gewinnen können.
Die Angst vor dem Urteil der anderen
Es ist absurd: Wir leben in einem der reichsten Länder dieser Erde und behaupten, für die wesentlichen Dinge des Lebens keine Zeit zu haben. Und kein Geld.
Viele junge Paare haben tatsächlich den Eindruck, dass sie sich eine Familienphase finanziell gar nicht mehr leisten können. Zwar sind sie oft traurig, ihre Kinder nach 14 Monaten Elternzeit schon in Betreuung zu geben. Und vielleicht sogar in eine Betreuung von zweifelhafter Qualität. Aber sie denken, dass sie keine andere Wahl haben. Und bei Eltern mit niedrigen Einkommen ist das leider oft so. Auch hier müsste der Staat einspringen und dafür sorgen, dass die zusätzliche Privilegierung von Besserverdienenden durch das Elterngeld wieder ausgeglichen wird. Darauf werde ich im sechsten Teil des Buches noch zu sprechen kommen.
Doch was ist mit den Angehörigen der breiten gesellschaftlichen Mittelschicht? Sie haben durchaus die Möglichkeit, sich bis zu einem gewissen Grad zwischen Zeit- und Geldreichtum zu entscheiden – zwischen einer größeren Lebensqualität (durch mehr Zeit für die Familie) und einem größeren Lebensstandard (durch mehr Konsum von Gütern und Dienstleistungen).
Beim Nacheinander-Prinzip müssen die Paare ja nur für eine Weile auf ein zweites Gehalt verzichten – und nicht ein ganzes Leben lang wie bei der klassischen Hausfrauenehe. Weil die Perspektive ja ist, nach ein paar Jahren wieder in einen interessanten und lukrativen Job einzusteigen. Und weil die Paare sich dann überlegen können, wie sie diese Jahre finanziell überbrücken: Wie lange können wir mit einem einzigen Einkommen auskommen? Können wir auf Erspartes zurückgreifen? Auf was können wir verzichten? Und können wir sparen, indem wir bestimmte Aufgaben in Haushalt und Erziehung wieder selbst übernehmen, anstatt sie von bezahlten Dienstleistern ausführen zu lassen?
Schon jetzt sind Putzkräfte, Lieferdienste, Babysitter und natürlich auch die Erzieherinnen in der Kita die unverzichtbaren Vereinbarkeitshelfer der modernen Familie. Und sie verschlingen einen nicht unbeträchtlichen Teil des erwirtschafteten Einkommens.
In dem 2017 erschienenen Buch Die verkaufte Mutter schreibt Christiane A., die sich entschieden hat, ihre Berufstätigkeit an den Nagel zu hängen und mit ihren Kindern zu Hause zu bleiben: »Unser Haushalt soll mehr als ein Haushalt sein, in dem Schul- und Arbeitsleben organisiert wird. Wir wollen mehr als funktionieren. Leben ist mehr. Familienleben ist schön.« Christiane A. weiß, dass sie dem Staat bestimmte Einnahmen durch Steuern auf ihr Arbeitsgehalt vorenthält und auch die Umsatzsteuer des Schnellimbisses neben der Schule. Sie bezahlt kein Geld für einen Business-Dress, keine Animatoren für Geburtstagsfeiern, verzichtet auf Fertiggerichte und die Reparatur des Fahrradplattens im Fachgeschäft, engagiert keine Fensterspezialreinigungsfirma und sagt: Lieber »keine weiteren Ausführungen, nicht dass ich durch Publikmachen meines Lebensstils zum Feind des wachsenden Bruttosozialprodukts werde«.
Es wird oft gesagt, dass Familien heute häufiger auf zwei Einkommen angewiesen sind, anders als noch in den siebziger und achtziger Jahren, als das Einkommen des Vaters in der Regel ausreichte.
Die ökonomische Forschung zu dieser Frage ist nicht eindeutig. Aber jüngste Untersuchungen belegen die These, dass die Löhne sogar gestiegen sind. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) und das Bundesfinanzministerium haben im Auftrag der ZEIT die Lohn- und Steuerdaten der Bundesbürger analysiert. Und sie haben herausgefunden, dass das mittlere Gehalt für eine Vollzeitstelle zwischen 1985 und 2014 um erstaunliche 99 Prozent gestiegen ist. Die Lebenshaltungskosten sind dabei nur um 65 Prozent gestiegen. Und die Steuerabgaben sind sogar gesunken, so dass eine vierköpfige Familie heute – unter Berücksichtigung der Inflation – deutlich mehr Geld zur Verfügung hat als noch vor dreißig Jahren.
»Wie aber ist dann das Klischee zu erklären, wonach ein Mittelschichtsgehalt heute nicht mehr für das reicht, was früher möglich war?«, fragen die ZEIT-Journalisten Kolja Rudzio und Frida Thurm in ihrem Artikel »Wozu der ganze Stress?«. Die Antwort, die sie geben: Mit dem Wohlstandsniveau der achtziger Jahre gäbe sich heute niemand zufrieden. Niemand wolle heute ein Auto ohne Klimaanlage oder sich eine Ferienreise verkneifen, um ein Reihenhaus in einem Vorort abzubezahlen. Die meisten Menschen würden sich nicht nach den Eltern oder Großeltern orientieren, sondern nach ihrer unmittelbaren Umgebung.
Wenn in der höheren Bildungsschicht in 73 Prozent der Familien beide Eltern arbeiten, dann setzen sie den Maßstab. »Dann werden ihre Doppelverdiener-Einkommen zur Messlatte für das, was man sich leisten können muss: den Städtetrip zwischendurch, die Bio-Lebensmittel, die Wohnung in einem beliebten Stadtviertel, die Smartphones der Kinder. Ein Alleinverdiener mit mittlerem Gehalt fällt da leicht ab.«
Diese Daten zeigen, dass es oft nicht die wirtschaftliche Notwendigkeit ist, die die jungen Paare daran hindert, das Nacheinander-Prinzip zu realisieren. Es ist eher die Angst, mit dem Lebensstandard der Nachbarn nicht mehr mithalten zu können.
Und es sind andere psychologische Widerstände: die Angst, als rückwärtsgewandt zu gelten und dem herrschenden Leitbild von einer »modernen Frau« nicht zu entsprechen, wenn man ein paar Jahre mit seinen Kindern zu Hause bleibt.
Die drei Wellen des Feminismus. Und der Anfang der vierten
Dem leidenschaftlichen Engagement von Feministinnen in den vergangenen hundert Jahren haben wir es zu verdanken, dass die Gleichberechtigung von Mann und Frau heute in den westlichen Gesellschaften ein unbestrittenes Ideal geworden ist. Und vielleicht lohnt es sich, einen kurzen Moment innezuhalten, um die Siege und Errungenschaften der Frauenbewegung zu feiern.
Die erste Welle der Frauenbewegung setzte Anfang des 20. Jahrhunderts ein und dauerte bis zum Beginn der Weimarer Republik. Sie erstritt ein paar ganz fundamentale bürgerliche Grundrechte für die Frauen, nämlich das Recht auf Bildung und Beruf sowie das aktive und passive Wahlrecht. 1893 wurden die ersten Gymnasialkurse für Frauen eingerichtet. Ab 1909 hatten Frauen in Deutschland endlich Zugang zu den Universitäten. 1919 konnten Frauen zum ersten Mal deutschlandweit wählen, und zwar die Weimarer Nationalversammlung.
Dann kam die Nazi-Zeit mit ihrer verheerenden Mutterkreuz- Ideologie (dem Führer ein Kind schenken!), mit einer strengen Bestrafung von Abtreibung und der festen Überzeugung, dass Frauen in qualifizierten Berufen nichts zu suchen hätten. Während des Krieges und auch in der Nachkriegszeit waren sie jedoch »berufstätiger« als jemals zuvor und mussten es auch sein, weil die Männer im Krieg waren, in Gefangenschaft oder an der Front gefallen.
In der Wirtschaftswunderzeit der fünfziger und sechziger Jahre kehrten viele Frauen in den USA und in Westdeutschland an den »Herd« zurück. Die Familien wuchsen, man zelebrierte und mystifizierte die Hausfrauen- und Mutterrolle in einem technisch modernisierten Umfeld: mit Kühlschränken, Waschmaschinen, figurbetonten Kleidern und brechend vollen Supermärkten. Aber gerade den gebildeten Frauen war das zu wenig – und sie trauerten heimlich, dass sie das, was sie etwa im Studium gelernt hatten, nicht noch anders gebrauchen konnten. Das war »das Problem ohne Namen«, das Betty Friedan in ihrem 1961 erschienenen Buch The Feminine Mystique (Weiblichkeitswahn) beschrieb.
In Ostdeutschland war die Lage natürlich anders. Die Berufstätigkeit der Frauen war ein zentraler Teil des neuen sozialistischen Menschenbilds. Die Kindheit der Kinder wurde früh verstaatlicht, um die Frauen »freizustellen« für ihre Arbeit, und auch, um die Erziehung der nächsten Generation von Anfang an ideologisch in die »richtigen Bahnen zu lenken«.
Die zweite Welle der Frauenbewegung setzte 1968 ein und dauerte bis zum Ende der siebziger Jahre. Für sie war die sexuelle Selbstbestimmung der Frau eines der zentralen Themen. Sie kämpfte für neue Möglichkeiten der Verhütung (durch die neu erfundene Antibabypille), für die Legalisierung der Abtreibung und gegen Vergewaltigung in der Ehe. Einerseits. Gleichzeitig diskutierte sie die Rolle der Frau in einer immer noch von Männern regierten Welt, stritt für die finanzielle Unabhängigkeit der Frauen, für Berufstätigkeit und die Besetzung von Machtpositionen im öffentlichen Leben.





























