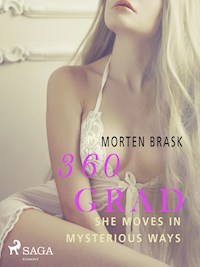17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag Nagel & Kimche AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Die Presse feierte ihn als "intelligentesten Menschen aller Zeiten", er galt als Beweis für das unerschöpfliche Potential des menschlichen Gehirns: William Sidis, 1898 bis 1944, war ein Wunderkind und ein Star. Im Alter von 18 Monaten liest er die "New York Times", mit 6 Jahren beherrscht er 10 Sprachen, mit 10 präsentiert er seine Theorie der vierten Dimension. Das sei ganz normal, behauptet sein Vater, für den Intelligenz eine Frage der strikten Erziehung ist. Mit meisterhafter Gestaltungskraft erzählt Morten Brask von einer Zeit, die an den grenzenlosen Fortschritt glaubt, und vom tragischen Schicksal eines unverständlich intelligenten Menschen. Eine unglaubliche wahre Geschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 423
Ähnliche
Im Alter von achtzehn Monaten liest William die New York Times, mit vier Jahren kann er Griechisch und Latein – selbst beigebracht –, mit sechs beherrscht er zehn Sprachen. Mit zehn Jahren präsentiert er seine Theorie der vierten Dimension vor der Professorenschaft in Harvard, wo er mit elf zu studieren beginnt. Das sei ganz normal, behauptet sein Vater, der die Studien seines Sohnes nach den neuesten Erkenntnissen der Psychologie überwacht. Als Billy erwachsen wird, wendet er sich von der Öffentlichkeit ab. Er verliebt sich in die kommunistische Aktivistin Martha Foley, wird 1919 bei einer Demonstration verhaftet und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.
Morten Brask erzählt von einer Zeit, die an den Fortschritt glaubte, und vom tragischen Schicksal eines einzigartig intelligenten Menschen, der versuchte, mit dieser Intelligenz sein Schicksal zu wenden. Entlang der historischen Fakten erzeugt Brask virtuos eine Unmittelbarkeit, die den Leser mitfiebern und mithoffen lässt.
Nagel & Kimche E-Book
Morten Brask
Das perfekte Leben des William Sidis
Roman
Aus dem Dänischen von Peter Urban-Halle
Nagel & Kimche
Für Mads, Marie und die ganz neue Alma
Der Verlag dankt der
Titel der Originalausgabe: William Sidis’ perfekte liv
Politikens Forlag, Kopenhagen 2011 © Morten Brask
ISBN 978-3-312-01026-4
© 2017 Nagel & Kimche im Carl Hanser Verlag München
Umschlag: Hauptmann & Kompanie, Zürich © plainpicture/Erickson/Jim Erickson
Satz im Verlag
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
«Ich möchte das perfekte Leben leben.
Die einzige Art, das perfekte Leben zu leben, ist,
es in Einsamkeit zu leben.»
William James Sidis in einem Interview, 1914
Downtown, Boston 1944
Der Himmel hängt tief über Boston. Nebel kriecht in die Avenuen der Stadt, verschluckt die Kronen der Bäume, die Statuen, die Lampen, die über den Straßen hängen. Er senkt sich auf den Asphalt und das Pflaster der Straßen, dringt in die Keller, durch die Kanalgitter, in die Tunnel der Subway. Die Luft wird immer feuchter, die Hochhäuser verschwinden in der undurchdringlichen Nässe, Stockwerk um Stockwerk, Wände, Fenster und Dächer lösen sich in der grauen Masse auf.
Auf den Bürgersteigen beugen sich die Passanten vor, wenn sie durch die nassen Nebelschwaden gehen. Sie wischen sich mit Taschentüchern die Tropfen vom Gesicht und drücken sich an den Geschäftsfassaden entlang, tasten sich behutsam voran. Keine Kopfbedeckung, keine Kleidung kann die Nässe abhalten, die Brillengläser sind beschlagen. Der Nebel saugt die Geräusche auf und verursacht eine eigenartige Stille: Das rhythmische Klacken lederner Schuhsohlen, zufallende Fenster, die Gespräche der Menschen, das Brummen der Automotoren, alles verschwindet in der geblendeten Stadt.
Im 21. Stock des Custom House Towers am McKinley Square 3, exakt um 16.01 Uhr, tritt William Sidis aus dem Büro der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Lynch & Co. Sein Mantel, über die Jahre verschlissen, ist noch offen, der Hut, der seine Form verloren hat, ist fest in die Stirn gezogen, und kaum hat er die Tür des Büros vier Meter hinter sich gelassen, steckt er einen Finger hinter den Krawattenknoten, um ihn ein wenig zu lockern.
An den Fahrstühlen herrscht wie immer dichtes Gedränge, die Angestellten kommen aus allen Richtungen. Die Männer tragen Trenchcoats, die von einem leger gebundenen Gürtel zusammengehalten werden, zwischen ihren Lippen klemmen frisch angezündete Zigaretten, und sie kneifen die Augen gegen den Rauch zusammen, wie sie es von ihren Kinohelden auf der Leinwand gelernt haben. Die Frauen, meist Sekretärinnen und Stenotypistinnen, tragen Röcke und billige helle Mäntel und duften, duften aufdringlich nach Persian Lamb von De Raymond, das in diesem Jahr offenbar alle Frauen in Amerika tragen. William verabscheut den Geruch von Persian Lamb, seine schwere violette Note, die hinter den Augapfel dringt und aufs Hirn drückt. Wenn er einer Frau begegnet, die damit parfümiert ist, hält er den Atem an und geht schnell weiter.
Vor den Aufzügen herrscht ein summendes Stimmengewirr, leichte, fließende, scherzende Worte über den Tag, die Kollegen, die Chefs, den Traum, eines Tages ein Auto kaufen zu können. Kurz hintereinander kommen die drei Aufzüge, die Türen gehen auf und verschlingen die Büroangestellten mit großem Appetit. Es wird geschubst, ungeduldig gedrängelt, jeder hofft, in den Fahrstuhl zu kommen, ehe kein Platz mehr ist, die Türen mit mechanischem Gurgeln geschlossen werden, und die Kabinen ihre Last nach unten transportieren.
William nimmt wie immer die Treppe. Es wurmt ihn ein bisschen, denn er liebt den Sog, wenn der Fahrstuhl durch den Schacht abwärtsgleitet, die Geräusche der Zahnräder und Stahlseile, aber der Gedanke, im Fahrstuhl Kollegen aus seinem Büro zu begegnen, ist ihm ein Graus. Dort müsste er ja mit ihnen sprechen. Das Treppenhaus ist eine Zufluchtsstätte, wo man nur selten andere Menschen trifft, da bleibt keiner vor ihm stehen und stellt Fragen, immer dieselben Fragen, wenn er eine Zeitlang an einer neuen Arbeitsstelle gewesen ist. Das Risiko ist zu groß, dass sie jetzt schon entdecken, wer er ist.
Seit zwanzig Tagen ist er bei Lynch & Co. angestellt, und jeden Tag hat William die Treppe genommen, 21 Stockwerke, 42 Absätze, 360 Stufen. Er liebt die Eintönigkeit beim Hinabsteigen, das rhythmische, kontrollierte Abwärts von Stufe zu Stufe. Unten angekommen, hält er inne, direkt vor der Tür zur Eingangshalle, und lockert den Schlips noch einen Millimeter mehr. Er dreht sich um und betrachtet die Stufen, die er eben heruntergekommen ist: Wie oft ist er auf jede einzelne getreten? Zwanzig Tage je 360 Stufen hinauf und 360 Stufen herunter. Das macht exakt 14.400 Stufen, aber das ist nicht ganz korrekt, er hat den Tag des Einstellungsgesprächs mit Mr Kowalski nicht mit berechnet, auch an dem Tag nahm er die Treppe, die korrekte Anzahl Stufen muss also 15.120 betragen.
Zwanzig Tage am selben Arbeitsplatz ist nicht schlecht. Das sind viele Tage ohne Fragen, und er fühlt sich wohl bei Lynch & Co. Man lässt ihn in Ruhe, nur der junge Peterson, der ihm gegenübersitzt, ist neugierig, aber Peterson ist harmlos. Zwanzig Tage. Mit etwas Glück kann er den Job noch lange behalten. Den letzten hatte er 33 Tage. Sein Büro befand sich in der sechsten Etage, das Gebäude hatte zwölf Stufen pro Treppe, also 7920 Stufen im Laufe von 33 Tagen, das heißt … er rechnet nach … das heißt, bis jetzt ist er hier im Custom House Tower 52,38 Prozent mehr Stufen hinuntergestiegen als in seiner vorigen Anstellung, obwohl er dort doch 65 Prozent mehr Tage geschafft hat. 33 Tage sind schon gut, aber das ist zu wenig. Er muss lernen, seine Jobs länger zu behalten. Wenn er doch bloß mal einen Job in Ruhe ausüben könnte, einen Job, wo sie ihn in Frieden lassen, wo keine Fragen gestellt werden, wo sich keiner über ihn wundert, wo nicht plötzlich eines Morgens das Murmeln in den Fluren anders klingt, wenn er auftaucht, und sie ihn mit wissenden Blicken anstarren, hinter seinem Rücken einander zunicken und flüstern: «Er ist es wirklich, nicht zu glauben!»
William öffnet die Tür zu der großen Eingangshalle. Normalerweise bleibt er hier einen Moment lang stehen und betrachtet die dorischen Säulen unter der Kuppel, aber nicht heute, heute hat er es eilig. Er erreicht die Drehtür im selben Augenblick wie ein anderer Mann, ein Bürovorsteher im frisch gebügelten Anzug. Sie halten beide inne, der Mann sieht William kurz an, mustert ihn von oben bis unten: den verschlissenen Tweedanzug, die nicht geputzten Schuhe, den verbeulten Hut. Sie zögern. Wem gebührt das Recht, zuerst zu gehen? Wer hat die Pflicht, dem andern den Vortritt zu lassen? Welche Regel gilt, wenn zwei Menschen gleichzeitig zum Ausgang kommen? William tritt zur Seite.
«Nach Ihnen», sagt er.
Der Bürovorsteher nickt und tritt in die Drehtür. William geht hinter ihm hinein, er schiebt die Drehtür und denkt: Wenn nur ein Viertel aller 400.824 männlichen Bürger Bostons, ungeachtet des Alters, einem anderen im Laufe eines Tages an der Tür den Vortritt ließen, eine Aktion, die, sagen wir, drei Sekunden dauert, erforderte dies alles in allem 83,51 Stunden tägliche Höflichkeit. Nicht mehr. Und nicht weniger.
HARVARD 1910
Still fallen die Schneeflocken auf die Oxford Street. Es schneit seit gestern Abend, zunächst in dichten nächtlichen Wirbeln, dann sanfter, und nun, im ersten Licht des Tages, schweben die Kristalle geradezu gemächlich vom Himmel.
Der Professor und Arzt Boris Sidis steigt aus der Tram auf die weiße Fahrbahn, es knackt im Schnee, er geht zwei Schritte, zögernd, um sich zu vergewissern, dass die Schuhsohlen rutschfest sind.
Er dreht sich um. «Kommst du, Billy?»
William steht noch in der Bahn. Er hält ein Stück Papier in der Hand, das er gründlich untersucht: eine Fahrkarte, die er vom Boden aufgehoben hat. Er dreht sie, studiert den Datumstempel, taxiert den schiefen Schnitt des Fahrkartenautomaten.
Der Fahrer betätigt die Glocke. «Billy, komm jetzt und wirf die Fahrkarte weg, die Bahn fährt los!»
Erst jetzt fällt William auf, dass sein Vater ausgestiegen ist, er stopft die Karte in die Manteltasche und springt in den Schnee. Hinter ihm gehen die Türen zu, die Straßenbahn gleitet weiter.
«Du weißt, was deine Mutter wegen dieser schmutzigen Fahrkarten sagt, mit denen du nach Hause kommst», sagt Boris.
«Ja, ja», sagt William.
Er geht neben seinem Vater und schaut auf seine Schuhe, die tief in den Schnee sinken, im Schnee verschwinden, er wendet sich um und sieht auf ihre Fußspuren im frisch gefallenen Schnee, Boris’ große und Williams kleine, verräterische Abdrücke, die davon zeugen, dass sie hier gegangen sind, ein Erwachsener, ein Kind, Seite an Seite.
«Beeil dich, wir müssen gleich da sein», drängelt Boris.
William bückt sich, füllt die Hände mit Schnee und wirft ihn hoch in die Luft. Er lacht, als der Schnee auf sein Gesicht fällt und hinter den Mantelkragen rutscht.
«Billy, jetzt hör mal auf, dich dreckig zu machen, bevor wir überhaupt da sind!»
Boris geht auf dem verschneiten Bürgersteig weiter, William formt einen Schneeball und wirft ihn nach seinem Vater. Er trifft dessen Schulter, William lacht.
«Schluss mit dem Unsinn!»
William schließt zu Boris auf und lässt, ohne darüber nachzudenken, seine Hand in die seines Vaters gleiten. Boris erstarrt einen Augenblick, sieht William an, verlegen, sie gehen ein Stück, keiner von ihnen sagt etwas, sie hören das Knirschen den Schnees unter ihren Schuhen, hören ihre Schritte nebeneinander, Williams Hand liegt in Boris’ Hand, leicht, ganz leicht, die beiden Hände zusammen sekundenlang, bis Boris husten muss und William loslässt, um die Hand vor den Mund zu halten. Er räuspert sich ein paarmal und lässt dann die Hand in die Manteltasche gleiten. William spürt noch immer den leichten, warmen Druck von der Hand seines Vaters.
«Bist du nervös, Billy?»
«Ein bisschen», sagt William.
«Wird schon gutgehen. Frierst du?»
«Nee.»
«Ich finde, die Kälte beißt einen in die Ohren, du hättest die Mütze aufsetzen sollen, deine Mutter hat’s gesagt.»
«Ich finde die Kälte schön», sagt William.
Er atmet durch die Nase. Die Luft ist metallisch, klar, sie füllt die Lungen mit Kälte, und die Kälte wird zu Wärme, er atmet tief ein.
«Wenn es kalt ist, gibt es nichts, was riecht.»
«Hm, du und deine Gerüche, das ist schon seltsam mit dir», sagt Boris.
William bückt sich wieder und nimmt Schnee in die Hände, er liebt dieses Gefühl des Schnees, der in den Händen zusammengedrückt wird und Form annimmt, er liebt die komprimierte Härte, den massiven Laut gequetschten Schnees, die Rundung des Schneeballs in den Händen. Er formt ihn zu einer perfekten Kugel, drückt ihn zusammen, bis es fester nicht mehr geht. Er wirft den Ball an eine Mauer, wo er mit einem sachten, dumpfen Ton zerplatzt und in Stückchen herunterfällt. William lacht.
«Hast du das gehört, Vater? Das Geräusch, als der Schneeball gegen die Mauer flog?»
«Was für ein Geräusch? Billy, ich hab dir gesagt, du sollst dich vor deinem Auftritt nicht schmutzig machen!»
Die perfekte Kugel klebt wie eine plattgedrückte weiße Scheibe an der braunen Mauer, und William und Boris gehen an der Mauer weiter, bis sie die grüne Doppeltür der Conant Hall erreichen.
Es ist noch früh, aber der Festsaal ist fast voll. Die ersten Zuhörer sind schon vor einer Stunde gekommen. Die Veranstalter der Harvard Mathematical Society hatten damit gerechnet, dass der Vortrag an diesem Morgen etwas mehr Publikum als gewöhnlich anziehen würde, das war nach all den Zeitungsartikeln zu vermuten, aber so viele hatte man nun doch nicht erwartet. Der Vorsitzende der mathematischen Gesellschaft, John Dixon, empfängt die Besucher persönlich, er hat über sechzig Professoren gezählt. Sie sind aus Harvard gekommen, aus Tufts, von der University of Massachusetts, aus Yale, Princeton, vom Wellesley College, dem Massachusetts Institute of Technology und anderen Universitäten aus ganz Neuengland. Ein Teil der Zuschauer hat bereits in den Stuhlreihen Platz genommen, aber die meisten stehen noch immer in kleinen Grüppchen, aus denen Stimmen emporsteigen, die von den nackten Wänden zurückgeworfen werden und sich in dem hohen Raum zu einem schwirrenden Summen vermischen. Dixon geht unter seinen Kollegen umher, nimmt an Gesprächen teil, rastlos, hellwach. Er geht weiter und macht sich auf die Suche nach dem Hausmeister, der weitere Stühle beschaffen soll. Der Hausmeister muss in den Keller gehen, um Sitzgelegenheiten zu holen. Vier Reihen werden angefügt, und doch sieht es so aus, als müssten sich etliche Besucher mit Stehplätzen begnügen.
Boris stößt die Haupttür auf und tritt ein, die Brille beschlägt, er nimmt sie ab und putzt sie am Mantelärmel, während er kurzsichtig über die Anwesenden blickt. Ohne Brille wirken seine Gesichtszüge schärfer, slawisch, das Haar ist kräftig, leicht gewellt, zurückgekämmt, die Augenbrauen buschig und so schwer, dass es aussieht, als drückten sie die Augen ein wenig zusammen, schnelle, observierende Augen. Wie gewöhnlich trägt Boris einen grauen Anzug mit einem schmalen schwarzen Schlips.
Hinter ihm kommt William, er hat den Mantel in der Garderobe aufgehängt. Obwohl Winter ist, hat er Knickerbocker an aus schwarzem Samt, ein russisches Bauernhemd und ein rotes Tuch um den Hals. Sein Haar ist dunkler als das von Boris, genauso kräftig, aber glatt. Sarah hat es ihm in die Stirn gekämmt, es sieht aus wie ein Helm und reicht ihm fast bis an die grauen Augen, die unruhig die Anwesenden betrachten. Die Halle ist so überfüllt, dieser Lärm, die Stimmen, diese Unruhe aus Menschen. William will am liebsten umkehren, wieder auf die Straße in den Schnee, in die geruchlose Kälte.
«Boris! Boris!»
Ein Ruf übertönt den Lärm der vielen Gespräche, William erkennt die Stimme, es ist Professor William James. Er entdeckt ihn im Gewimmel, er steht in einer der größeren Gruppen, er verlässt sie und bahnt sich seinen Weg in ihre Richtung. Die Leute unterbrechen ihre Gespräche, für den berühmten William James treten sie beiseite.
«Boris! Boris!»
Professor James hat sie erreicht, er drückt Boris’ Hand mit beiden Händen.
«Ach, wie schön, dich wiederzusehen!», sagt Boris und lächelt.
«Ganz meinerseits, lieber Boris. Wie geht es Sarah?»
«Danke, es geht ihr glänzend», sagt Boris, «sie bat mich, Alice ihre Grüße zu überbringen.»
«Das wird Alice sehr freuen, ich weiß, dass sie auf dieses Ereignis hier sehr gespannt ist, sie erwartet, dass ich ihr heute Abend davon in allen Einzelheiten berichte.»
Professoren versammeln sich um sie. Schwarze und graue Anzüge, steife Kragen, glänzende Silberketten hängen zwischen dem Knopfloch der Seidenweste und der Uhrtasche. Boris wird von allen Anzügen gegrüßt. Hände werden gereicht und gedrückt, alle wollen Boris grüßen, alle kennen ihn.
Professor James entdeckt William und hebt die Arme.
«William, mein Freund, wie geht es dir?»
Er streckt William die Hand entgegen, aber dann zögert er, zögert eine linkische Sekunde und klopft William stattdessen auf die Schulter.
«Danke, mir geht es gut, Professor James», sagt William.
«Das ist fein, das ist fein! Meine Frau bat mich, dir zu sagen, dass sie immer überzeugt war, dass du ein guter Junge bist.»
«Danke, Professor James.»
Drei andere Professoren kommen hinzu, neugierig schauen sie William an, runzeln die Stirn, neigen sich gegeneinander, nicken William zu. Er schaut zu Boden. Er spürt den Druck ihrer starren Augen.
«Bist du angespannt, Billy?», fragt Professor James.
William nickt.
«Das kann ich gut verstehen, aber ich mache mir bei dir überhaupt keine Sorgen, es wird großartig, das weiß ich.»
«Danke», sagt William.
«Das ist also der junge Sidis?», sagt ein weißhaariger Professor, Gerald Hauptmann vom Massachusetts Institute of Technology.
«Ja, das ist mein Patensohn, William James Sidis», sagt Professor James und klopft William wieder auf die Schulter.
«Ach, stimmt ja, ich habe irgendwo gelesen, Professor Sidis habe seinen Sohn nach Ihnen benannt.»
«Ja, und das hab ich als große Ehre verstanden», sagt Professor James.
«Und wie alt bist du jetzt, William?», fragt Professor Hauptmann.
«Elf», sagt William.
«Elf?» Hauptmann sieht Professor James an. «Ich war mir sicher, gelesen zu haben, er sei zehn.»
«Er ist im April elf geworden, am ersten April, nicht wahr, William?»
William nickt.
«Am ersten April? Ein Aprilscherz also, ha, ha! Na, das wird interessant», sagt Hauptmann.
«Sie finden keinen stolzeren Patenonkel als mich, meine Herren», sagt Professor James. «Sie werden überrascht sein.»
«Ja, das sagen alle, das sagen alle.»
Als William aufblickt, bemerkt er einen Mann, der eben den Saal betritt. Er erkennt ihn sofort: die rote Mähne, den harten Blick – das ist McGlenn, der Journalist! Hinter McGlenn kommt ein anderer Mann mit einem Fotoapparat über der Schulter. William hat den Fotografen noch nie gesehen, es ist jedenfalls nicht derselbe wie damals, als sie ihn am Brookline Reservoir festgehalten haben. Er muss schlucken, er hatte schon befürchtet, dass McGlenn heute auftauchen würde, andererseits überrascht es ihn auch nicht.
McGlenn bleibt an der Tür stehen und beobachtet prüfend die Versammlung von Professoren, er sagt irgendetwas zu dem Fotografen, der nickt. William weiß, dass die beiden Männer nach ihm Ausschau halten.
«Das ist ein großer Tag, Billy, ein großer Tag», sagt Professor James und wendet sich an seine Kollegen. Die Professoren wenden sich von William ab und bilden einen Kreis um Boris. William steht jetzt ganz allein da. Er schaut zu seinem Vater auf. Er sieht Boris’ Rücken und ein Stückchen von seinem Gesicht durch einen Spalt in dieser Wand aus Anzügen. Boris’ Gesicht ist Dixon zugewandt, er nickt und spricht, sie sind in ein Gespräch vertieft, das im Chor der Stimmen verhallt. William sucht den Blick seines Vaters, aber der bemerkt es nicht, er lacht über etwas, das Dixon erzählt.
William fühlt sich nicht wohl. Ihm ist übel, er sieht kleine glasartige Flecke in der Luft. Ihm ist schwindlig, es ist der Rauch der Zigaretten und Pfeifen, der Lärm, die Stimmen, der Geruch feuchter Kleidung, der erhitzte Staub auf den Glühbirnen an der Decke, das Eau de Cologne, die Urintropfen in der Unterwäsche der Professoren, ihr Atem, ihr Schweiß, der säuerliche, kratzende Schweißgeruch im Futter der Baumwollmäntel. Er hat das Bedürfnis, sich hinzusetzen, und geht zu einem freien Platz in der ersten Reihe, er setzt sich und tut, als wäre er einfach müde, aber er spürt einen Sturz durchs Gehirn. Die Glasflecke tanzen vor seinen Augen, er hebt die Hände und presst sie gegen die Augen, drückt auf die Pupillen, dass es schwarz wird. Als er wieder loslässt, lösen sich die blinden Punkte auf, und zurück bleibt ein verschwommener Widerschein des Saals.
Wenn es doch bloß schon überstanden wäre! Damit er und Boris endlich befreit wären von den menschlichen Gerüchen um sie herum und in die reine kalte Welt draußen entkommen könnten. Er hat nicht die geringste Lust, das zu tun, was sie von ihm erwarten. Er will es nicht tun, will es nicht. Aber er weiß, wie viel es für seinen Vater bedeutet, und er weiß, was Sarah gesagt hätte, wenn er Dixons Einladung, einen Vortrag zu halten, abgelehnt hätte. Es sei eine Ehre, eine große Ehre, haben sowohl Boris als auch Sarah gesagt. Und William hat genickt, aber er will nicht, nicht vor all diesen Menschen, er sieht zu den Fenstern, sieht die Schneeflocken draußen, das Weiße.
Schrill ertönt eine Glocke, die Stimmen werden leiser, sie lösen sich auf. Die Professoren, die sich noch nicht gesetzt haben, bewegen sich durch den Saal zu ihren Plätzen, als folgten sie festgelegten Bahnen, poltern mit den Stühlen, Ledersohlen auf dem Parkett im Fischgrätmuster, das durch den geschmolzenen Schnee von den Schuhen der Professoren schon schmutzig geworden ist. Boris kommt zu William und setzt sich auf den Stuhl neben ihn.
«Bist du bereit, Billy?»
William schaut zu Boris hoch, aber Boris wendet sich ab, um einen Mann zu grüßen, der sich zu seiner anderen Seite hinsetzt.
William dreht sich um, hinter ihnen ist jede Reihe mit Anzügen besetzt, und dahinter die Zuschauer auf den Stehplätzen in mehreren Reihen, es sind jüngere Dozenten und ausgewählte Studenten, die sich in Mathematik, Physik und Philosophie ausgezeichnet und deshalb eine Sondererlaubnis erhalten haben, an den Treffen der Mathematical Society teilzunehmen. Unter den Gesichtern sieht William ein bekanntes, einen jungen Studenten mit langem strähnigen Haar, einem Hemd, das nicht mehr sehr weiß ist, die Hände in den Taschen, leger, unbekümmert, leicht gebückt, mit immer unruhigen Augen, dunklen, sehr dunklen, fast schwarzen Augen: Nathaniel Sharfman. Sharfman ist im selben Schlafsaal wie William untergebracht. Es ist immerhin ein kleiner Trost, ein bekanntes Gesicht zu sehen, obwohl er Sharfman nicht besonders gut kennt. Eigentlich haben sie nie mehr als ein paar Worte gewechselt, aber Sharfman ist einer der wenigen, der William grüßt, wenn sie sich in den Vorlesungen über den Weg laufen. Sharfman ist elf Jahre älter, aber von allen Studenten, denen William bislang begegnete, ist er der netteste. Als einer der anderen im Schlafsaal, Prescott Bush, Williams Knickerbocker versteckte, so dass William nichts anzuziehen hatte, hatte Sharfman ihm verraten, wo sie waren, und als William sie aus dem Mülleimer fischte, lachte Bush nur, sagte aber nichts weiter. Man hat Respekt vor Sharfman, er ist einer der «Armen», einer mit Stipendium, aber er ist auch dafür bekannt, einer der besten Studenten in Harvard zu sein. A. N. Whitehead, ihr Philosophieprofessor, hat ihn zu seinem Schützling gemacht.
«Dreh dich mal um», flüstert Boris.
Der Festsaal ist voll besetzt, er ist überfüllt, die Hitze ist unerträglich, Jacken und Westen werden aufgeknöpft, Taschentücher an Stirnen getupft. Dixon gibt dem Hausmeister ein Zeichen, er möge ein, zwei Fenster öffnen, dann tritt er an das Rednerpult aus Mahagoni. Er hat die Glocke noch in der Hand und läutet ein zweites Mal. Notwendig ist das nicht, abgesehen von kleinen Hüsteleien und Kleiderrascheln ist es im Festsaal mucksmäuschenstill.
«Meine verehrten Kollegen, Mitglieder der Harvard Mathematical Society und Gäste von der Presse», hebt Dixon an. «Es freut mich sehr, Sie zu unserer ersten Veranstaltung des Jahres am heutigen 5. Januar 1910 in der Conant Hall zu begrüßen. Ich glaube, wir sind alle gespannt, den Vortrag über die ‹Größen in der vierten Dimension› zu hören, und deshalb möchte ich unseren Referenten willkommen heißen, den die meisten sicher aus der Presse kennen, den Sohn von Professor Boris Sidis und – das kann ich ruhigen Gewissens sagen, ohne irgendwo nachschlagen zu müssen – den jüngsten Redner, der je in der Harvard Mathematical Society aufgetreten ist. Dem jungen Mr. Sidis ein herzliches Willkommen.»
Vereinzeltes Klatschen im Saal, Dixon verlässt das Rednerpodest und setzt sich auf einen Stuhl neben einer Tafel, die für den Vortrag aufgestellt wurde. Einige Zuhörer husten, rutschen auf ihren Stühlen hin und her, um bequemer zu sitzen.
William rührt sich nicht. Er bleibt sitzen. Er betrachtet das leere Rednerpult, jemand hat eine Karaffe und ein Glas Wasser aufs Pult gestellt. Er sieht zur Tafel, sie ist sauber geputzt, aber in der untersten rechten Ecke hat der Schwamm nicht alles weggewischt, er sieht den unteren Teil von etwas, das eine Drei, Fünf oder Acht sein kann. Boris räuspert sich, aber William rührt sich nicht.
«Billy!», flüstert Boris.
William schaut wieder auf das Rednerpult mit der Karaffe und dem Glas Wasser.
«Billy, geh rauf. Die Leute warten.»
William sieht seinen Vater an. Einen Augenblick lang hofft er, Boris würde lächeln und sagen, er brauche nicht hinaufzugehen, und Boris würde anstelle von William ans Pult gehen, aber sein Vater knufft ihm in den Arm.
«Ja, Vater», sagt William.
Er will aufstehen, er stößt sich mit den Händen vom Sitz ab, aber er kommt nicht hoch, der Körper ist schwer, so unüberwindlich schwer.
«Billy, los jetzt!»
William versteht überhaupt nicht, woher er die Kräfte hat aufzustehen, aber die Muskeln in den Oberschenkeln heben ihn hoch, er steht wirklich auf. Eine synchrone Bewegung von Köpfen, die sich ihm zuwenden, geht durch das Publikum. So viele Menschen! So viele, die darauf warten, ihn reden zu hören! Er hat ein ziehendes Gefühl im Magen, er zittert, Arme und Hände zittern. Es sind sieben Meter bis zum Pult, sieben Meter Fußboden, die er zurücklegen muss, gebohnertes Parkett mit Fischgrätmuster, endlose Reihen von Pfeilmustern quer durch den Saal. Er blickt an sich hinunter, er hebt den Fuß, er sieht seine Schuhe, die nun den Boden berühren, er spürt die Blicke, sie sehen ihn, er macht einen Schritt und hebt nun den anderen Fuß, noch ein Schritt, irgendwo hinter ihm hustet jemand, Stuhlbeine schrammen über den Boden, seine Füße bewegen sich, noch ein Schritt, noch einer, und er hat das Podium erreicht, auf dem das Rednerpult steht, er steigt hinauf, einen Moment lang verblüfft, wie hoch es ist. Er geht darum herum, der Hausmeister hat zur Erhöhung eine Kiste hinter das Pult gestellt. Er steigt auf die Kiste und stellt sich auf die Zehenspitzen, hebt sich über den Pultrand und schaut durch den Saal. Er fühlt sich so erhoben, so weit über der Versammlung, es ist, als schwebte er, schwebte über all diesen Menschen da unten, ein Haufen Anzüge und Gesichter, er ist über sie erhoben, als säße er in einem Luftballon, der von der Erde aufsteigt, erhoben über ihre starrenden Blicke. Er kann sie von seinem schwebenden Rednerpult riechen, er riecht die Reste ihres Frühstücks, die sie aus ihrem Bart gebürstet zu haben meinen, den Kaffee, den sie getrunken haben, die entweichenden Darmwinde, die sie nicht in die Öffentlichkeit entschlüpfen zu lassen glauben. William sieht es vor sich, all diese belesenen Herren, die mit ihren feinen Sachen und Uhrenketten Darmwinde entweichen lassen, der Gedanke ist so komisch, und mit einem Mal muss er lachen, er kann sich nicht zurückhalten. Oben am Rednerpult lacht er vor den Professoren. Sie sehen ihn an, sie sind angespannt, Brauen werden in die Höhe gezogen, jemand schaut verlegen weg. William hört auf zu lachen, er schaut auf seinen Vater hinunter, Boris erwidert seinen Blick, dieser besorgte Blick in seinen Augen, Boris macht jetzt eine Bewegung mit der rechten Hand, vor und zurück, als wollte sie sagen «Nun fang an, Billy!» William weiß, dass er jetzt reden muss. Er öffnet den Mund:
«Ich hatte mir nicht vorgestellt, hier und jetzt eine Rede zu halten, ich meine, dass es jetzt sein sollte, aber ich wurde darum gebeten, und das möchte ich natürlich gern …»
William hört seine eigene Stimme. Sie bebt, dünn und hell in dem großen Festsaal mit den vielen angespannten Gesichtern.
«… aber nun bin ich einmal hier, in der Conant Hall, und ich möchte Ihnen gern einige Gedanken mitteilen, die ich mir über die vierte Dimension gemacht habe …»
Stille. Stille sickert aus den Gesichtern der Professoren. Sie bewegen sich nicht, sie atmen nicht, der Saal holt keine Luft, sie sitzen still und starren William an. William ist allein, er weiß, dass er so allein ist, dass ihm jetzt keiner helfen kann: nicht sein Vater, nicht Dixon, nicht Professor James, niemand kann ihm in diesem Augenblick helfen, in dem er schwebend vor der Stille im Saal steht. Er ist allein, nur er selbst kann ihm helfen, er ist allein in den schwarzen Knickerbockern, allein mit seiner hellen Stimme.
«Was ist die vierte Dimension?», sagt William. «Können wir überhaupt von einer vierten Dimension sprechen, wenn wir doch in den drei euklidischen Dimensionen, in denen wir leben, festsitzen? Wie können wir sie aus diesem dimensional begrenzten Blickpunkt aus definieren?»
Er lässt den Blick über die Zuschauer in der Conant Hall schweifen, sie sitzen noch immer still, lauschend, in Reihen, zu ihm gewandt, und er sieht sich selbst mit ihren Augen, ein Knabe am Rednerpult, ohne Manuskript, ohne Notizen, ein Knabe mit seiner kindlichen Stimme, der hinter dem Rednerpult auf einer Kiste steht, damit er darüber hinwegschauen kann, und zu einer Versammlung führender Wissenschaftler der Vereinigten Staaten spricht.
«Meine eigene Definition der vierten Dimension lautet: Sie ist ein euklidischer Raum, dem eine Dimension hinzugefügt wurde», sagt er. «Es sind die Größen in der dritten Dimension, projiziert in den Raum. Die Figuren der dritten Dimension, zum Beispiel der Kubus, werden als Seiten in den Figuren der vierten Dimension verwendet, und die Figuren der vierten Dimension können Konfigurationen genannt werden. Es ist nicht möglich, Modelle der Figuren in der vierten Dimension zu konstruieren oder sie sich geistig vorzustellen, aber es ist leicht, sie mit dem Satz des Euklid zu konstruieren. In diesem Satz ist F gleich die Fläche der Figuren, S ist gleich ihre Seiten, V ist gleich mit den Vertikalen, und M sind die Winkel. Das Theorem lautet F + S = V + M …»
Er hat angefangen, er spricht, William spürt die Kraft in sich, dass es jetzt strömt, dass er dem Strom der Worte, die aus seinem Mund fließen, nicht Einhalt gebieten kann. Er vergisst, dass er am Rednerpult steht, vergisst die Professoren, vergisst McGlenn mit den roten Haaren. Die Worte erfüllen ihn, er springt vom Pult und läuft zur Tafel, er sieht jetzt, dass in der unteren Ecke eine Acht stand, eine Sekunde lang kreisen seine Gedanken darum, welche Aufgabe mit einer Acht in der Ecke der Tafel geendet haben mag. Währenddessen fließen die Worte, und er greift nach einem Stück Kreide von der Ablage, schreibt in rasendem Tempo, die Kreide bricht, der Nagel des Zeigefingers kratzt über die Tafel, er schreibt mit dem Stummel weiter und überhört vollkommen das Quietschen der Kreide auf dem Tafelschiefer. Formel auf Formel, Potenzen auf Potenzen füllen die Tafel, während er redet. Etwas unbeholfene Zeichnungen von Figuren, die außerhalb der Mathematik nicht existieren können, nehmen vor den verblüfften Augen der Professoren Gestalt an. Keinen Augenblick zögert William bei der Deutung der Theorien, die er in der vergangenen Woche entwickelt hat, er spricht, spricht, spricht, und im Saal beugen sie sich vor, alle beugen sich vor, um zu hören, was der Junge sagt:
«Faktisch ist es möglich, beliebige Figuren aus der dritten Dimension zur Konstruktion vierdimensionaler Figuren zu verwenden», sagt William. «Diese Figuren nenne ich Polyhedrigone. Auf diese Weise ist es möglich, Figuren in der vierten Dimension mit hundertzwanzig Seiten zu konstruieren, Hecatonicosihedrigone genannt …»
An verschiedenen Stellen im Saal wird geflüstert, manche strecken die Hand in die Höhe, und Professor Hauptmann erhebt sich von seinem Platz.
«Junger Mann», sagt er, aber William hört den Professor nicht.
«Ebenso ist es möglich, Figuren mit sechshundert Seiten zu konstruieren, Hexacosihedrigone genannt, und man kann Parallelopedone errechnen, die …»
«Sidis!», sagt Professor Hauptmann, jetzt lauter.
William wendet sich von der Tafel ab.
«Mr Sidis, entschuldige, aber ich muss dich unterbrechen. Wo hast du die her?»
«Ich verstehe nicht, was Sie meinen, Sir», sagt William.
«Wo kommen sie her, diese … diese Hedrigone?»
«Aus der vierten Dimension», erklärt William.
Gelächter. Professor Hauptmann wedelt ärgerlich mit der Hand. «Ich meine, die Begriffe, die du anwendest. Ich unterrichte seit vierzig Jahren Geometrie, und natürlich kenne ich Hintons Tesserakte, aber deine Bezeichnungen … ich meine, sie sind mir noch nie über den Weg gelaufen, und ich bin sicher, dass ich da nicht der Einzige bin.»
Mehrere Zuhörer schütteln den Kopf.
«Nein, ich glaube, die gibt es nirgendwo», sagt William.
«Ich meine, in welcher Literatur hast du sie gefunden?»
«In keiner.»
«Willst du behaupten, es sind deine eigenen Definitionen?»
«Ja.»
Ein Gemurmel läuft durch die Reihen.
«Habe ich Ihre Frage damit beantwortet, Sir?»
Professor Hauptmann nickt und setzt sich. William dreht sich wieder zur Tafel um und fährt fort: «Mit dem Satz von Euler kann man errechnen, wie viele Seiten eine gegebene Figur hat. Einige Figuren in der vierten Dimension können mit diesem Satz freilich nicht erschaffen werden, sondern sie müssen untersucht werden, indem man Logarithmen anwendet. In vierdimensionalen Räumen werden oft Leerräume vorkommen, die ich auffülle, indem ich Polyhedrigone von passender Form hinzufüge. Ich glaube, dass meine Theorien für die polyhedralen Winkel der Dodesecahedronen von Wert sein können. Das kann, glaube ich, etliche Probleme in der elliptischen Geometrie lösen …»
William spricht, eine Stunde vergeht, er spricht, schreibt, erklärt, Kreidestaub rieselt von den eilig hingeschriebenen Zahlen, die Ärmel werden weiß von den hastigen Bewegungen, wenn er alte Formeln wegwischt, um Platz für neue zu schaffen. Etliche Zuhörer starren den Knaben an und schütteln ungläubig den Kopf.
Financial District, Boston 1944
Als William um 16.11 Uhr durch die Drehtür auf den McKinley Square kommt, empfängt ihn ein aschgraues Boston. Er ist überrascht, dass der Nebel so dicht ist, er ist wie eine Wand. Sie weicht zurück, wenn er auf sie zugeht, aber sie ist immer vor ihm, undurchdringlich. Er kann seine Hände sehen und seine Schuhe, aber der Platz ist verschwunden, mit Not erkennt er die parkenden Autos am Straßenrand. William geht nach rechts zur Boston State Street. Im Nebel weiß er nicht, wer oder was ihm entgegenkommt, aber er tastet sich nicht an der Hauswand entlang wie alle andern; wenn er die Straßenbahn um 16.23 Uhr erreichen will, ist dafür keine Zeit. Die nächste kommt 16.43, das hieße, er könnte zu seinem Termin mit Sharfman frühestens um 17.13 Uhr kommen, aber sie hatten 17 Uhr im Café abgemacht. Sharfman, der selber immer zu spät kommt und Termine verabscheut. Aber William will nicht zu spät kommen. Wenn er sich mit Sharfman verabredet, ist er immer pünktlich.
Er geht schneller, der Nebel hüllt ihn ein, er verströmt eine verblüffende Kälte. Mit der rechten Hand knöpft er den Mantel zu, den obersten Knopf zuerst, dann den nächsten, aber der dritte will nicht so recht. Der Hornknopf ist nass geworden und flutscht ihm durch die Finger, er schaut nach unten und versucht, ihn durchs Knopfloch zu bugsieren, aber der Knopf rutscht vorbei. Noch mal von vorn, er führt ihn behutsam auf sein Ziel zu, während er weitergeht, sein zügiges Tempo nicht drosselt, er zählt seine Schritte dabei. Obwohl er nichts sieht, weiß er, dass er in vier Schritten die Ecke Boston State Street erreicht haben wird. Und als er eben um die Ecke gebogen ist und die Boston State Street entlanggeht, gleitet der Knopf durch die ovale Öffnung und gleichzeitig kommt ihm etwas entgegen und trifft ihn hart an der Oberlippe. Er erkennt ein Gesicht, das Gesicht einer Schwarzen direkt vor ihm. Ihre Augen sind aufgerissen, erschrocken.
«Verzeihen Sie, Sir, entschuldigen Sie, Verzeihung! Ich habe Sie nicht gesehen! Sie kamen so plötzlich um die Ecke, und ich habe Sie überhaupt nicht gesehen. Haben Sie sich weh getan?»
Erst jetzt bemerkt er den Schmerz in der Lippe und am Schneidezahn. Mit der Zunge befühlt er die obere Zahnreihe, abgebrochen ist nichts, aber es tut weh.
«Nein, nein, schon gut», sagt er, «es war meine Schuld, ich hab nicht aufgepasst. Und Sie, haben Sie sich weh getan?»
«Nein, gar nicht. Es tut mir sehr leid, Sir!»
Die Frau tritt einen Schritt zurück, sie hat ihr Einkaufsnetz fallen lassen, und der Inhalt hat sich über den Bürgersteig ergossen. Sie bücken sich beide, um die Sachen aufzuheben: Gemüse, Brot, ein Portemonnaie, ein Päckchen von der Post, eine Zeitung. Im Fallen hat sich die Zeitung geöffnet, William greift danach, aber seine Hand hält mitten in der Bewegung inne, er starrt auf ein Foto, das sich über mehrere Spalten oben auf der ersten Seite erstreckt.
«Das ist sehr freundlich von Ihnen», sagt die Schwarze, aber William hört sie nicht. Das Foto zeigt eine alte Frau. Sie läuft auf den Fotografen zu, sie fuchtelt mit den Händen in der Luft, die flatternden Arme ziehen Lichtspuren hinter sich her. Sie rennt, ihr Gesicht ist verzerrt, panisch, verzweifelt, vor Angst, sie weint, der Mund ist offen, sie schreit, weinend und schreiend läuft sie eine Straße entlang. Hinter ihr stehen die Reste eines von Bomben getroffenen Gebäudes, es brennt an verschiedenen Stellen, die Flammen schlagen aus den Fensterhöhlen, werden zu leuchtenden Bögen und schwärzen die Mauern. Weiter oben ist eine Mauer zerstört, eine Wohnung ist entblößt: ein umgestürzter Tisch, ein Waschbecken, Stühle, die Leiche eines Mannes, alles entblößt vor dem großen offenen Himmel am oberen Rand des Fotos, ein Himmel voller Flugzeuge. Das Foto auf der Vorderseite der Zeitung enthält alles, die Frau, das Haus, die Flammen, die Zerstörung, die Flugzeuge: William hört sie, hört die Geräusche des Fotos, hört das Dröhnen der Flieger, das Schreien der Frau, die Bomben, er hört das Tosen der Flammen.
«Ist etwas, Sir?»
William hört die Stimme der Frau, fern, wie nach allmählichem Erwachen, sein Blick wandert von dem Foto auf die Schlagzeile darunter:
BISHER GRÖSSTER RAF-U. S.-ANGRIFF
AUF NAZIDEUTSCHLAND
HAMBURG IN RUINEN
HARVARD 1910
William legt die Kreide auf die Ablage unter der Tafel. Die Finger sind trocken vom Kreidestaub, er hat Durst, zwei Stunden hat er gesprochen, ohne zu trinken. Er tritt auf die Erhöhung hinter dem Rednerpult, und die Bewegung lässt das Wasser im Glas erzittern. Er nimmt das Glas, führt es zu den Lippen, das Wasser schmeckt wie kühles Silber. Dixon steht auf und stellt sich vor das Pult.
«Ja, ehe wir dem jungen Mr Sidis für diesen doch wirklich überraschenden Vortrag danken, gibt es noch Zeit für Fragen aus dem Publikum.»
Mehrere Anwesende heben den Arm. Dixon, der die meisten Mitglieder der mathematischen Gesellschaft mit Namen kennt, gibt dem Ersten das Wort. Ein Professor steht auf und fragt nach Einzelheiten in Williams Theorie, und William antwortet umgehend, keine Sekunde braucht er zum Nachdenken. Dann kommt der Nächste, William antwortet, und ein Professor nach dem anderen stellt seine Frage.
William reibt Kreide von seiner Hose, er hat Lust, die Hand ins Wasser zu stecken, um das Gefühl der Trockenheit wegzukriegen. Die Fragen ärgern ihn, er hat doch gesagt, was gesagt werden musste, es gibt da nichts hinzuzufügen, es war alles da. Und die Art und Weise, wie die Professoren fragen, lässt ihn auf dem Podium vor Ungeduld trippeln. Manchmal dauern ihre Fragen minutenlang, die Umständlichkeit ihrer Formulierungen, die akademischen Vorbehalte, die vielen Mathematikernamen, die sie nennen – nicht zum Aushalten! Und William antwortet, die Worte stürzen aus seinem Mund, mehrmals stolpert er darüber, weil sich seine Zunge und seine Lippen für seine Gedanken, Zahlen, Begriffe, Korrekturen von Fehlern oder logischen Mängeln in den Fragen nicht rasch genug formen. Einige sehen sich an und lachen gedämpft, weil sie Williams Argumentationsketten nicht folgen können. Er kann seine Ungeduld nicht kontrollieren, er fängt an, die Fragesteller zu unterbrechen, er wird unruhig, er kennt die Wörter in den nächsten Sätzen schon im Voraus, er weiß, worauf die Fragen hinauslaufen, er kann nicht warten, bis sie vollständig formuliert sind. Nur vereinzelte Fragen sind für ihn interessant, zum Beispiel als ein Professor wissen will, inwieweit auf subatomarem Niveau noch weitere Dimensionen existieren können. Der Rest ist banal, und es kommen noch mehr Fragen, immer noch mehr Fragen, ein Rausch ergreift die Mathematiker, sie präsentieren Probleme, mit denen sie sich in ihrer Forschung selbst beschäftigt haben, sie befragen William mit einem Eifer, als wäre der Bub da oben auf dem Podium ein lebendes Orakel.
Kurz bevor die Fragezeit vorüber ist, steht Professor Hauptmann auf und hebt den Arm.
«Mr Dixon, darf ich noch eine Frage stellen?», sagt er.
Dixon nickt.
«Ich könnte mir vorstellen, den jungen Sidis zu fragen: Hast du jemals von Hermann Minkowski gehört?»
William schüttelt den Kopf.
«Nein. Ach, das ist schade, ich bin nämlich sicher, dass dich Minkowskis letzte Abhandlung interessieren würde. Er ist Professor am Polytechnikum in Zürich, und ich habe die Ehre, mit ihm zu korrespondieren. Vor fünf, sechs Jahren schrieb ein Schüler von Minkowski, ein Herr Einstein, einen Aufsatz über die Relativität, in dem er eine Reihe von Berechnungen weiterentwickelte, die ursprünglich in Lorentz’ Elektrodynamik behandelt worden waren. Mein Freund Minkowski war so beeindruckt von der Arbeit seines Schülers, dass er einen Essay herausgab, in dem er ein auf vier Vektoren basierendes Konzept formuliert und die Hypothese aufstellt, dass die vierte Dimension zeitlich sei. Was sagst du zu diesem Gedanken? Ich meine, er steht ja im völligen Widerspruch zu deiner im Übrigen unterhaltsamen Darstellung und …»
William hebt die Hand und unterbricht Hauptmann. «Obwohl ich Mr Minkowski nicht kenne, möchte ich darauf hinweisen, dass es kein neuer Gedanke ist, die Zeit als Dimension aufzufassen, William Hamilton hat die gleiche Theorie aufgestellt: ‹Von der Zeit wird gesagt, sie habe nur eine Dimension, der Raum hingegen habe drei Dimensionen. Die mathematische Quaternion besteht aus beiden Elementen, in der technischen Sprache kann sie als Zeit plus Raum oder Raum plus Zeit bezeichnet werden: Und in diesem Sinne hat sie vier Dimensionen – oder involviert zumindest einen Bezug auf vier Dimensionen.›»
«Wo hat Hamilton das geschrieben?», fragt Hauptmann.
«In Elements of Quaternions, Seite 438, zweiter Absatz.»
«Hmm, hmm», macht Hauptmann. «Aber anstatt dieses oder jenes zu zitieren, kannst du mal zur Zeit als Dimension Stellung nehmen? Bist du einverstanden mit der Betrachtung der Zeit als Dimension?»
«Ich habe darüber nicht weiter nachgedacht», sagt William. «Ich meine, ich nehme zu den rein geometrischen Aspekten der vierten Dimension Stellung, und das ist ja alles ziemlich neu für mich, aber …»
«Ja, aber das verstehe ich vollkommen», ruft Hauptmann und wirft die Arme in die Luft. «Du brauchst auch nicht auf die Frage zu antworten, ich wollte dich nur über die Arbeit meines Kollegen informieren, ich erwarte selbstredend nicht, dass du …»
«Darf ich darüber nachdenken?», fragt William.
«Natürlich, natürlich», sagt Hauptmann.
William richtet seinen Blick nach oben, er schaut über die Versammlung auf die gegenüberliegende Wand. Am Ende des Saals zwischen den dichtgedrängten Studenten befindet sich eine Standuhr, er betrachtet die mondbleiche Scheibe, die Zeiger stehen auf elf und zwanzig. Die Zeit, die Zeit in diesem Moment. Er betrachtet die Scheibe und die Zeiger und stellt sich vor, dass das Uhrwerk durch den Saal tickt, stellt sich den langsamen Gang der Zahnräder vor, das Schwingen des Pendels im Herzen der Standuhr. Er spürt sie: die Zeit, die vergeht, die Zeit, die innehält, die Zeit, die Gestalt annimmt. Man sieht die Zeit nicht, und doch vergeht sie, plötzlich ist sie vergangen. Er sieht die Zuhörer in den hintersten Reihen, die Studenten, die hinten an der Wand stehen, wieder entdeckt er Nathaniel Sharfman. Sharfman sieht William an, er wartet wie alle anderen im Saal, aber im Unterschied zu den anderen spielt ein breites Lächeln auf seinen Lippen, er lacht William an, als amüsierte er sich über die ganze Situation, amüsierte sich darüber, dass William den ganzen Saal warten lässt, und Sharfmans Lachen steckt an. William muss selber lachen, ein Gemurmel entsteht im Saal.
«Mr Sidis», sagt Professor Hauptmann endlich. «Es war nicht meine Absicht, die Fragerunde anzuhalten, ich ziehe meine Frage zurück.»
Hauptmann setzt sich, das Geflüster erhebt sich aufs Neue, aber William bleibt stehen, stumm, er neigt den Kopf ein wenig, spürt die Uhr und die Zeit und den Raum, während Gedanken und Gedanken und Gedanken durch seinen Kopf wirbeln.
«Ich habe nachgedacht!», ruft er.
Im Festsaal der Conant Hall rührt sich niemand.
«Vielleicht ist es nicht brauchbar», sagt William, «aber hier ist, was ich denke: Eigentlich können wir uns die Zeit leicht als eine Art vierter Dimension im Universum vorstellen. Rein theoretisch jedenfalls. Wir müssen nur daran denken, dass diese Dimension eine andere Beziehung zu physischen Objekten hat. Wenn wir davon ausgehen, dass dies möglich ist, werden wir uns jedes Partikel als eine Art Faden vorstellen können, der in die zeitliche Dimension unendlich verlängert ist. Also von einer unendlichen Vergangenheit zu einer unendlichen Zukunft. Wir müssen ferner bedenken, dass darüber hinausgehende Messungen in der Zeit nicht mit räumlichen Messungen verglichen werden können. Wir können also nicht davon ausgehen, dass wir ein Netzwerk von Fäden in einem vierdimensionalen Raum haben, aber wir können es doch als mögliches Beispiel verwenden, um zu zeigen, was eine zweidimensionale Zeit ist. Tun wir das, hätten wir also einen vierdimensionalen Raum mit einem perfekten, stationären Gewebe voller Fäden, die auf alle möglichen Arten miteinander verwickelt sind. Gut. Wir müssen annehmen, dass die Enden dieses Gewebes in jeweils ihrer Richtung im Unendlichen verschwinden. Wenn wir nun eine dreidimensionale Haut durch dieses Gewebe hinunterbewegen, würde sich der Querschnitt der Fäden ändern und als Bewegung der Partikel erscheinen. Das würde den Eindruck eines Stroms von den höheren zu den niedrigeren Querschnittsarealen ergeben, was wiederum die Illusion einer fließenden und dreier stationärer Dimensionen erzeugte, mit anderen Worten, einer Dimension der Zeit und dreier Dimensionen des Raums. Dies ist vielleicht nicht die richtige Erklärung des Zeitbegriffs, aber ich hoffe, es illustriert, dass die beiden entgegengesetzten Richtungen der Zeit nicht verschieden sind von den beiden entgegengesetzten Richtungen im Raum. Die Zeit geht vorwärts und zurück. Vergangenheit-Zukunft ist ebenso gültig wie die physische Bewegung nach vorn und zurück.»
Ein Stimmengewirr breitet sich aus, Arme schießen in die Höhe, aber Dixon steht auf und hebt die Hände. «Ich bin sicher, dass wir dem jungen Mr Sidis noch viele Fragen stellen könnten, aber die Zeit ist vorangeschritten, wir müssen hier leider Schluss machen.»
Dixon wendet sich an William. William zögert. Was wird von ihm erwartet? Was soll er tun? Er sieht auf die Zuhörer, die ihn unbeweglich anstarren. Sie tun nichts. Sie sitzen bloß auf ihren Plätzen und gucken ihn an. Warten. Er sieht wieder zu Dixon hinüber und bemerkt, dass er eine leichte Neigung mit dem Körper macht. William folgt der Bewegung, er neigt sich vor, er verbeugt sich, dass die Stirn beinahe das Rednerpult berührt, so gebeugt steht er einige Sekunden, ehe er sich wieder aufrichtet.
Es ist still. Bloß eine Zehntelsekunde Stille, ehe der Applaus losbricht, ein Knistern von trockenen Händen und kurz darauf das dumpfe Gescharre der Stühle, die nach hinten geschoben werden. Sie erheben sich, die Professoren erheben sich vor William und schlagen die Handflächen in taktfestem Rhythmus zusammen. Ein «Bravo» steigt aus einer der Reihen, sogleich folgen weitere, «Bravooo», «Bravooo». William vernimmt ein Donnern, es vergeht ein Augenblick, ehe ihm klar wird, dass es die Zuhörer sind, die auf den Boden trampeln. Hinten in der letzten Reihe sieht er Sharfman, der seinen Daumen in die Höhe streckt. Die Zuhörer gleichen dem hingerissenen Publikum nach einer Opernpremiere, ein Gefühl von Ehrfurcht und Beklommenheit hat die Professoren, die Journalisten und Studenten ergriffen, sie beklatschen die Offenbarung, der sie beiwohnen durften, der schallende Applaus fliegt William entgegen. Er schaut auf die stehende Versammlung, spürt das Sausen, und er kann sich nicht enthalten zu lachen, er lacht. Er sieht seinen Vater an, der da unten sitzt. Auch Boris steht und applaudiert, und er nickt William zu, nickt seinem Sohn zu, und plötzlich kann William nicht mehr an seinem Rednerpult stehen bleiben, eine Last löst sich in ihm, sinkt durch den Körper, sinkt wie ein Bleilot durchs Seewasser, das Lot zerreißt die Sehnen und Glieder, die Muskeln lösen sich vom Skelett, er kann sich kaum noch auf dem Podium halten und springt hinunter, betritt den Saalboden, überquert die Pfeile des Fischgrätparketts, eilt auf Boris zu, legt die Hände fest um Boris und umarmt ihn. Boris klopft ihm ganz leicht auf die Schulter, schaut die Umstehenden an, er lacht verlegen. Ein dichter Kreis aus Anzügen und Uhrenketten bildet sich um sie, das Knallen klatschender Hände schmerzt auf Williams Trommelfell. Er hält Boris einige Sekunden fest, schnuppert die weiche Sanftheit der Baumwolle in sich hinein und fühlt, wie die Ruhe zurückkehrt.
Minuten vergehen, ehe der Beifall nachlässt, aber dann kommt die Kakophonie der Stimmen jäh wieder, die Professoren diskutieren über den Vortrag und über William. Einer nach dem anderen kommt und schüttelt Williams Hand und redet und redet, sie seien überwältigt, sagen sie, sie hätten nie etwas Derartiges erlebt; «ein Licht», «ein Genie» sind Worte, die sie in ihre Sätze flechten. William drückt ihre Hände, wie er es von Sarah gelernt hat, stets fest, aber er kann ihnen nicht in die Augen sehen, in ihren Blicken ist zu viel Druck, er schaut auf den Boden.
Physikprofessor Daniel Comstock vom Massachusetts Institute of Technology, der den Vortrag initiiert hat, bahnt sich einen Weg durch die Versammlung und stellt sich neben William und Boris, und nach ihm kommen die Professoren James und Dixon und stellen sich rechts und links an die Seite von William und Boris. Die ersten Blitze der Fotoapparate flammen über ihnen auf. Der Geruch brennenden Magnesiums sticht William in die Nase, ein grauer, hässlicher Geruch, er klemmt die Nasenflügel mit den Fingern zusammen.
«Hör auf, dir an die Nase zu fassen, Billy!» Boris flüstert mit unbeweglichen Lippen, er versucht, gegen die Explosionen anzulächeln.
«Aber das riecht so widerlich!»
«Hör auf damit, sie fotografieren uns.»
«Ich kann diese Fotografen nicht leiden.»
«Lass deine Nase los, Billy!»
William lässt seine Nase los und macht den Mund auf, um den Pulverdampf nicht riechen zu müssen, aber er dringt in den Mund und legt sich auf den Gaumen, und die Explosionen bleiben als hellrote Funken in den Augen sitzen, so dass er nicht mehr klar sehen kann. Die Journalisten schieben sich zwischen die Professoren. Als sie sich mit ihren Notizblöcken einen Platz erobert haben, macht Daniel Comstock ein Zeichen und bittet um Ruhe.
«Ich bin aufrichtig stolz, dass ich dem Vortrag unseres jungen Referenten beiwohnen durfte», sagt er. «Ich glaube, wir wissen alle, dass wir heute Zeuge von etwas Einmaligem gewesen sind. Und ich glaube, dass wir nach diesem Vortrag allem Geschreibsel der Presse, der junge Sidis leiere bloß eine einstudierte Lektion herunter, entschieden entgegentreten können. Seine Art zu denken zeugt von echtem Intellekt. Sein Denken ist nicht automatisch. Er stopft seinen Kopf nicht nur mit Tatsachen voll. Er denkt nach. Karl Friedrich Gauss ist sicher das einzige von allen Wunderkindern der Weltgeschichte, das William Sidis ähnelt. Ich prophezeie, dass der junge Sidis ein großer Wissenschaftler werden wird. Er wird neue Theorien entwickeln und neue Methoden erfinden, um astronomische Phänomene zu berechnen. Ich glaube, er wird in Zukunft ein großer Mathematiker, der Führende seiner Zunft.»
Beifälliges Murmeln.
«Was wird mit dem jungen Mann nun geschehen?», fragt ein Journalist, hinter den hellroten Funken in seinen Augen erkennt William den Frager, es ist McGlenn.
«Auf diese Frage sollte wohl eher der Vater antworten», sagt Comstock und wendet sich an Boris.
«Danke», sagt Boris. «Nun ist Billy ja eben in Harvard immatrikuliert worden, und wir sehen der Zeit entgegen, wo er die ersten Lehrkräfte des Landes treffen kann. Billy ist ja von Natur aus neugierig und möchte gerne dazulernen. Zunächst einmal wird er sich eine Zeitlang der Mathematik widmen …»
«Professor Sidis, William ist elf Jahre alt. Haben Sie und Ihre Gattin darüber nachgedacht, ob es für ihn vielleicht zu früh sein könnte, unter so vielen Studenten anzufangen, die viele Jahre älter sind?», sagt McGlenn, und während er spricht, sieht er William an, er sieht ihm direkt in die Augen.
«Nein, warum auch?», sagt Boris. «Billy ist ein gesunder Junge, und er braucht mehr Anreize, als er in Schulen mit Schülern seines Alters erhalten kann, und wie ich schon oft erwähnt habe, sind die amerikanischen Schulen unter aller Kritik.»
«Wie fühlt es sich an, Vater eines Genies zu sein? Sie müssen heute ein stolzer Vater sein», sagt ein anderer Pressevertreter.