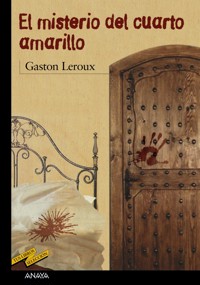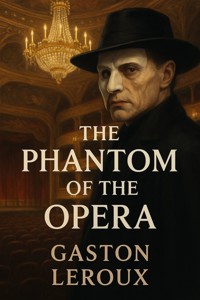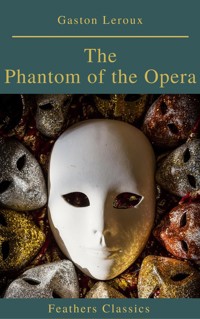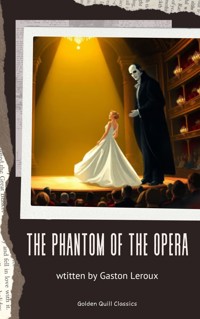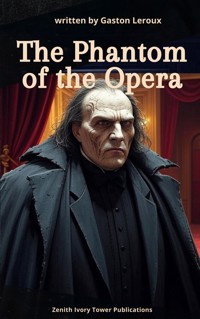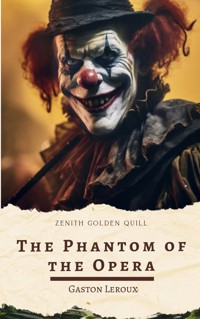5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anaconda Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In den Kulissen der Pariser Oper geht ein Phantom um. Geschickt verbirgt es sich den Blicken der Menschen, und doch nimmt es Einfluss auf das Bühnengeschehen, denn dank seiner Hilfe wird die Sängerin Christine Daée zum Star des Ensembles. Als das abstoßend hässliche Phantom sich ihr offenbart, kommt erst ein großes Erschrecken und bald darauf die Liebe ins Spiel – und löst eine komisch-turbulente Lawine von Ereignissen aus. Auf Leroux’ Roman gründet mit Andrew Lloyd Webbers Phantom der Oper das erfolgreichste Musical der Welt.
- Nicht das Musical, das Original! Spannender und schaurig-schön
- Vom hohen C bis in die düsteren Kellergewölbe der Pariser Oper
- Ein Buch und alles drin: Liebes- und Schauergeschichte, Kriminalroman und Klassiker der Weltliteratur
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Gaston Leroux
Das Phantomder Oper
Roman
Aus dem Französischenvon Rudolf Brettschneider
Anaconda
Titel der französischen Originalausgabe: Le Fantôme de l’Opéra (Paris: Pierre Lafitte 1910). Die Übersetzung von Rudolf Brettschneider folgt der Ausgabe Das Geheimnis des Opernhauses (Berlin: Ullstein 1928). Orthografie und Interpunktion wurden den Regeln der neuen deutschen Rechtschreibung angepasst.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2023, 2024 by Anaconda Verlag, einem Unternehmen der
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlagmotive: shutterstock.com / Elizabeta Lexa (Maske). –
shutterstock.com / Roberto Castillo (Muster). –
shutterstock.com / rvvlada
Umschlaggestaltung: www.katjaholst.de
Satz und Layout: Andreas Paqué, www.paque.de
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
Printed in the EU
ISBN 978-3-641-29760-2V002
www.anacondaverlag.de
Inhalt
Einleitung
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
Einleitung
Das Phantom hat wirklich existiert. Es war nicht bloß, wie man lange Zeit meinte, ein Hirngespinst der Künstler, ein Aberglaube der Direktoren, ein Schauermärchen, das den erregten Köpfchen der Damen vom Ballett oder ihrer Mütter, der Logenschließerinnen, der Garderobieren und der Concierge, entsprang.
Ja, es hat leibhaftig existiert, obgleich es sich ganz und gar die Allüren eines wirklichen Gespenstes zulegte.
Ich war von allem Anfang an, da ich die Archive der Académie Nationale de Musique nachzuschlagen begann, einerseits durch die seltsame Übereinstimmung der Phänomene, die man dem Phantom zuschrieb, andererseits über die mystischen und fantastischen Einzelheiten der tragischen Ereignisse überrascht, und so kam ich bald auf den Gedanken, dass man möglicherweise doch imstande sein könnte, das eine durch das andere auf vernünftigem Weg aufzuklären. Die Ereignisse datieren etwa dreißig Jahre zurück, und es würde nicht schwerfallen, auch heute noch im Foyer einen oder den anderen alten Herrn zu finden, der sich daran erinnert, als wäre die Sache erst gestern geschehen, an die geheimnisvollen und tragischen Umstände, die die Entführung der Christine Daaé begleiteten, das Verschwinden des Vicomte de Chagny und den Tod seines älteren Bruders, des Grafen Philippe, dessen Leiche man an dem steilen Rand des Teiches fand, der sich unter der Oper, gegen die Rue Scribe zu, ausbreitet. Doch keiner dieser Zeugen hatte bis heute eine Ahnung, dass diese schaurigen Ereignisse mit der fast sagenhaften Gestalt des Phantoms der Oper zusammenhingen. Bei einem Nachspüren, das sich alle Augenblicke an Begebenheiten stieß, die auf den ersten Blick ans Übernatürliche grenzten, kam ich der Wahrheit nur langsam näher.
Ich hatte mich viele Stunden lang in die »Erinnerungen eines Theaterdirektors« vertieft, ein unbedeutendes Buch dieses etwas zu skeptischen Herrn Moncharmin, dem während seines kurzen Engagements an der Oper das spukhafte Treiben des Phantoms ein Rätsel blieb und der sich so schnell wie möglich aus der Affäre zog, als er selbst das erste Opfer der Finanzoperation geworden war, die sich hinter den Kulissen der »Rätselhaften Entführung« abspielte.
Ärgerlich verließ ich die Bibliothek, als ich den liebenswürdigen Verwalter unserer Académie Nationale traf, der auf einem Treppenabsatz mit einem kleinen, lebhaften und koketten älteren Herrn sprach, dem er mich vergnügt vorstellte. Der Verwalter war über meine Nachforschungen unterrichtet und wusste, mit welcher Ungeduld ich vergeblich versucht hatte, das Verschwinden des Untersuchungsrichters der berühmten Affäre Chagny, des Herrn Faure, aufzuklären. Niemand hatte eine Ahnung, was aus ihm geworden war, ob er tot war oder sich noch am Leben befand. Und nun, als er von Kanada zurückkehrte, wo er fünfzehn Jahre lang gelebt hatte, war sein erster Weg in Paris nach dem Sekretariat der Oper, um sich eine Freikarte zu holen. Dieser kleine alte Herr war niemand anderer als Herr Faure.
Wir verbrachten mehrere Stunden des Abends miteinander, und er erzählte mir alle Einzelheiten der Affäre Chagny, soweit sie ihm selbst bekannt waren. Das ganze Beweismaterial deutete auf einen abnormalen Geisteszustand des Vicomte und auf einen zufälligen Unglücksfall seines älteren Bruders, dennoch blieb er der Überzeugung, dass hier ein grauenhaftes Verbrechen vorliege, das sich zwischen den beiden Brüdern wegen der Christine Daaé abgespielt habe. Er wusste mir nicht einmal zu sagen, was aus Christine und dem Vicomte geworden war. Und als ich ihm von dem Phantom sprach, lächelte er nur ironisch. Auch er war von den seltsamen Tatsachen unterrichtet, die die Existenz eines außergewöhnlichen Wesens zu beweisen schienen, das einen der geheimnisvollsten Schlupfwinkel der Oper zu seinem Wohnsitz auserwählt hatte, und auch die »Entführungsgeschichte« war ihm bekannt. Doch hatte er in all dem nichts gesehen, was die Aufmerksamkeit eines Gerichtsbeamten auf sich ziehen könnte, der mit der Aufklärung der Affäre Chagny betraut war, und er glaubte damit genug getan zu haben, dass er einige Minuten lang einem Zeugen Gehör schenkte, der sich plötzlich gemeldet hatte, um zu bekräftigen, dass er dem Phantom begegnet sei. Dieser Zeuge war ein Mann, den man in ganz Paris den »Perser« nannte und der allen Abonnenten der Oper wohlbekannt war. Der Richter hatte ihn einfach für einen Geisterseher genommen.
Man kann sich vorstellen, dass ich mich für diesen »Perser« sogleich lebhaft interessierte. Ich wollte um jeden Preis, wenn das noch möglich war, diesen wertvollen und originellen Zeugen wiederfinden. Mein Glück begünstigte mich wieder einmal, und ich entdeckte ihn bald in seiner kleinen Wohnung in der Rue de Rivoli, die er seit jener Zeit noch immer bewohnte und wo er fünf Monate nach meinem Besuch verschied.
Zuerst war ich natürlich misstrauisch, doch als der »Perser« mir mit kindlicher Offenherzigkeit alles erzählt hatte, was er selbst von dem Phantom wusste, und nachdem er mir alle Beweise, besonders aber die Korrespondenz Christine Daaés zur Verfügung gestellt hatte – Briefe, die volles Licht auf ihr entsetzliches Schicksal warfen –, war für mich kein Zweifel mehr möglich. Nein! Nein! Das Phantom war mehr als ein Märchen.
Ich weiß wohl, man wandte ein, dass die ganze Korrespondenz vielleicht gefälscht und möglicherweise in ihrem ganzen Umfang von jemandem fabriziert worden sei, dessen Einbildungskraft natürlich von den verführenden Anekdoten genährt wurde, doch es ist mir glücklicherweise gelungen, die Handschrift Christines auch außer diesem interessanten Briefbündel aufzufinden, was mich instand setzte, einen Vergleich anzustellen, der alle meine Bedenken zerstreute.
Schließlich kam noch die Aufforderung hoher Persönlichkeiten hinzu, die zur Affäre Chagny in engerer oder weiterer Beziehung standen oder mit der Familie befreundet waren, denen ich alle meine Dokumente vorgelegt, alle meine Beweismittel entrollt hatte. Ich habe von vielen Seiten die herzlichsten Ermutigungen erhalten und werde mir erlauben, an dieser Stelle einige Zeilen wiederzugeben, die der General D. seinerzeit an mich schrieb:
»Mein Herr!
Ich kann Ihnen nicht lebhaft genug zureden, die Resultate Ihrer Nachforschungen der Öffentlichkeit zu übergeben. Ich erinnere mich sehr wohl, dass einige Wochen vor dem Verschwinden der großen Sängerin Christine Daaé und vor der Tragödie, die im ganzen Faubourg Saint-Germain betrauert worden ist, im Foyer de la Danse viel von dem Phantom gesprochen wurde, und glaube, dass man auch nach dieser Affäre, die jedermann beschäftigte, viel davon gesprochen hat. Doch nun, da ich Ihren Ausführungen gefolgt bin, scheint es mir möglich, den Fall durch die Existenz des Phantoms zu erklären, und ich bitte Sie, mein Herr, uns noch mehr, uns alles über das Phantom zu entdecken. So geheimnisvoll dieses zu Anfang erscheinen mochte, es wird immer noch eher erklärlich sein als diese dunkle, von übelwollenden Menschen erfundene Geschichte, die uns weismachen will, dass zwei Brüder, die ihr ganzes Leben lang ein Herz und eine Seele gewesen waren, plötzlich zu erbitterten Todfeinden werden konnten.
Ich zeichne …«
Ich durchstreifte also aufs Neue, mein Aktenmaterial in der Hand, die weite Domäne des Phantoms, den furchtbaren Schauplatz, den es zu seinem Reich gemacht hatte, und alles, was meine Augen erblickten, alles, was mein Verstand entdeckte, bekräftigte in bewunderungswürdiger Weise die Dokumente des »Persers«, als ein höchst erstaunlicher Fund meine Arbeiten endgültig krönte.
Man erinnert sich, dass vor Kurzem, als man den Untergrund der Oper aufgrub, um die phonographischen Aufnahmen der Künstler dorthin zu leiten, die Hacke der Arbeiter einen Leichnam ans Licht förderte. Nun hatte ich mit einem Schlag den Beweis, dass dieser Leichnam der des Phantoms der Oper war!
Ich ließ diesen Beweis sogleich von dem Verwalter selbst überprüfen, und nun ist es mir gleichgültig, wenn selbst die Zeitungen berichten, man habe ein Opfer der Kommune aufgefunden.
Die Unglücklichen, die zur Zeit der Kommune in den Kellerräumen der Oper erschlagen worden waren, liegen keineswegs dort begraben. Es ist mir bekannt, wo man ihre Skelette finden kann: weit entfernt von dieser unermesslichen Gruft, wo man während der Belagerung alle möglichen Mundvorräte aufgespeichert hatte. Gerade durch die Suche nach den Überresten des Phantoms war ich auf diese Fährte gekommen und hätte sie ohne diesen unerhörten Zufall der Eingrabung menschlicher Stimmen niemals entdeckt.
Doch wir werden später noch auf diesen Leichnam zu sprechen kommen und auf alles Übrige, was mit ihm zusammenhängt. Nun aber möchte ich dieses Vorwort damit beenden, dass ich meinen allzu bescheidenen Komparsen herzlich danke, die mir eine so wertvolle Stütze waren und mit deren Hilfe es mir gelingen wird, vor den Augen des Lesers all diese Stunden der reinsten Liebe und des Schreckens bis in ihre kleinsten Details wiederaufleben zu lassen. Und das sind vor allem: der Herr Polizeibeamte Mifroid (der seinerzeit beim Verschwinden der Christine Daaé zur ersten Aufnahme des Tatbestandes gerufen wurde), Herr Sekretär Rémy, der Verwalter Mercier, der Gesangsdirektor Herr Gabriel und besonders auch Frau Baronin Castelot-Barbezac, die man unter dem Namen »die kleine Meg« kannte (und die sich dessen nicht schämt), der reizendste Stern unseres ausgezeichneten Ballettkorps, die älteste Tochter der ehrenwerten Frau Giry, der ehemaligen Logenschließerin, der auch die Loge des Phantoms zugeteilt war.
G. L.
I
An diesem Abend, an dem die Herren Debienne und Poligny, die demissionierenden Direktoren der Oper, ihre letzte Galavorstellung veranstalteten, war die Garderobe der Sorelli, eines der leuchtendsten Sterne am Himmel des Tanzes, im Nu von einem halben Dutzend der Damen vom Ballett überschwemmt, die nach dem »Polyeucte« eben von der Bühne abgingen. Sie stürzten sich in größter Erregtheit hinein, die einen mit etwas affektiertem und unnatürlichem Lachen, die anderen mit Ausrufen des Entsetzens.
Die Sorelli, die einen Augenblick allein zu sein wünschte, um die Abschiedsworte noch einmal zu memorieren, die sie sogleich im Foyer an die Herren Debienne und Poligny richten sollte, hatte ärgerlich diese wilde Horde hinter sich herstürmen sehen. Sie wendete sich nach ihren Kolleginnen um, erschreckt von dem tumultuarischen Spektakel. Die kleine Jammes – mit dem lieben Stumpfnäschen, den Vergissmeinnichtaugen, den Rosenwangen und dem Liliennacken – war es, die mit wenigen Worten, mit vor Angst zitternder Stimme den Aufruhr erklärte:
»Wir haben das Phantom gesehen!«
Und sie sperrte die Tür ab. Die Garderobe der Sorelli war von offizieller und banaler Eleganz. Ein großer drehbarer Spiegel, ein Diwan, eine Toilette und einige Kasten bildeten das nötige Mobiliar. An den Wänden hingen einige Stiche, Erinnerungen ihrer Mutter, die die schönen Tage der alten Oper in der Rue Le Peletier gekannt hatte.
Die Sorelli war sehr abergläubisch, und als sie die kleine Jammes vom Phantom sprechen hörte, schauerte sie leicht zusammen und sagte: »Gänschen!«
Und da sie eine der Ersten war, an Gespenster im Allgemeinen und an das der Oper im Besonderen zu glauben, wünschte sie sogleich näher unterrichtet zu sein.
»Ihr habt es gesehen?«, fragte sie.
»Wie ich Sie vor mir sehe«, antwortete stöhnend die kleine Jammes, die sich in einen Sessel hatte fallen lassen, da ihre Beine sie nicht mehr tragen wollten.
Und sogleich fügte die kleine Giry mit den Kirschenaugen, dem pechschwarzen Haar, dem dunklen Teint und dem schmächtigen Körperchen hinzu: »Ja, er war es, er ist schauderhaft hässlich!«
»Ja – o ja –«, tönte es von allen Seiten. Und sie plapperten alle durcheinander. Das Phantom war ihnen mit dem Aussehen eines Herrn im Gesellschaftsanzug erschienen, der plötzlich vor ihnen auf dem Gang aufgetaucht war – niemand wusste woher. Er hatte so plötzlich vor ihnen gestanden, dass man glauben konnte, er sei aus der Wand herausgetreten. »Ah –«, rief eine, die ihre Kaltblütigkeit noch so ziemlich beibehalten hatte, »– ihr seht das Phantom an allen Ecken!«
Und wirklich bildete das Phantom in der Oper seit einigen Monaten das Tagesgespräch, dieses Gespenst, das, schwarz gekleidet, wie ein Schatten das Gebäude von oben bis unten durchwanderte, das niemanden ansprach, das niemand anzusprechen wagte und das übrigens, sobald man es nur erblickte, verschwunden war, ohne dass man ahnte, wie oder wohin. Ganz geräuschlos schritt es dahin, wie es einem wahrhaftigen Gespenst geziemt. Anfangs hatte man gelacht und seine Späße über diesen Geist in der Kleidung eines Elegant oder eines Leichenträgers gemacht, doch die Legende des Phantoms nahm im Corps de Ballet bald ungeheure Dimensionen an. Jede behauptete, diesem übernatürlichen Wesen begegnet oder das Opfer seiner Hexereien geworden zu sein.
War das Phantom eine Zeit lang unsichtbar geblieben, so zeigte es seine Gegenwart oder sein Vorbeikommen durch drollige oder traurige Vorfälle an, für die es der Aberglaube fast regelmäßig verantwortlich machte. Hatte man einen Unfall zu beklagen, hatte eine von den Balletteusen der anderen einen Possen gespielt oder war eine Puderquaste in Verlust geraten, – alles wurde dem Gespenst in die Schuhe geschoben, dem Phantom der Oper.
Und wer hatte es im Grunde wirklich zu Gesicht bekommen? Man begegnete so vielen schwarz gekleideten Herren in der Oper, die keine Gespenster sind. Dieser aber hatte eine Eigentümlichkeit an sich, deren sich nicht jeder rühmen konnte: Er war ein Skelett.
Wenigstens behaupteten dies die Damen. Und natürlich hatte er auch einen Totenkopf.
War dies alles ernst zu nehmen? Tatsache ist, dass diese Vorstellung eines Skeletts aus der Beschreibung entstand, die Joseph Buquet, der Maschinenmeister, der es wirklich gesehen haben wollte, von dem Phantom entworfen hatte. Er war mit der mysteriösen Persönlichkeit auf der kleinen Treppe, die – hart an der Rampe – direkt zur Unterbühne hinabführte, buchstäblich zusammengeprallt, und er schilderte jedem, der es hören wollte, das Operngespenst mit folgenden Worten: »Es ist von einer unglaublichen Magerkeit, und sein schwarzer Anzug hängt schlotternd auf einem Knochengerüst. Seine Augenhöhlen sind so tief, dass man die unbeweglichen Augäpfel nur undeutlich sieht. Man sieht eigentlich nicht mehr als zwei große schwarze Löcher, wie bei einem Totenschädel. Seine Haut ist wie Pergament über die Knochen gespannt und ist nicht weiß, sondern schmutzig-gelb. Seine Nase ist so winzig, dass sie im Profil kaum sichtbar ist. Und das Fehlen dieser Nase macht einen schrecklichen Eindruck. Drei oder vier lange Flechten über der Stirn und hinter den Ohren bilden seinen ganzen Haarwuchs.«
Vergeblich hatte Joseph Buquet diese fremdartige Erscheinung verfolgt. Sie war wie durch Zauber verschwunden, und er war nicht imstande, ihre Spur wiederzufinden.
Der Maschinenmeister war ein ernster, gesetzter Mann mit wenig Fantasie und durchaus kein Trunkenbold. Seine Worte riefen Bestürzung und Interesse hervor, und sogleich fanden sich Leute, die ihrerseits erzählten, dass auch sie einem Schwarzgekleideten mit einem Totenschädel begegnet seien.
Die verständigen Leute, denen diese Geschichte zu Ohren kam, behaupteten zuerst, Joseph Buquet sei wohl das Opfer eines seiner Untergebenen geworden. Dann aber ereigneten sich Schlag auf Schlag so seltsame und unerklärliche Begebenheiten, dass selbst den ärgsten Spöttern Bedenken aufstiegen.
Ein Feuerwehrleutnant hat doch ein wenig Courage, er fürchtet sich nicht so leicht, er wird sich besonders vor dem Feuer nicht fürchten.
Nun hatte der infrage stehende Leutnant einen Inspizierungsgang durch die Unterbühne unternommen und sich dabei – wie es scheint – etwas von seinem gewöhnlichen Weg entfernt. Wenige Augenblicke später aber war er bleich, außer sich, zitternd und mit verstörtem Blick wieder auf der Bühne erschienen und der Mutter der kleinen Jammes fast ohnmächtig in die Arme gesunken. Und warum? Weil er in Haupteshöhe, doch ohne Körper, einen feurigen Kopf auf sich loskommen sah. Und ich wiederhole, dass ein Feuerwehrleutnant doch – weiß Gott – das Feuer nicht fürchtet. Dieser hieß Papin.
Das Ballettkorps war außer sich. In dem Augenblick, da sich ein Feuerwehrleutnant nicht schämte, in Ohnmacht zu fallen, konnte man den Koryphäen und den Ballettmädeln ihre Angst nicht verübeln, die sie die Flucht ergreifen ließ, so schnell sie nur ihre kleinen Füßchen tragen konnten, sobald sie an irgendeinem dunklen Loch in den schlecht erleuchteten Gängen vorüber mussten.
Das ging so weit, dass die Sorelli selbst, um das so schrecklichen Zaubereien verfallene Haus nach Möglichkeit zu schützen, am Tag nach dem Abenteuer des Feuerwehrleutnants, umgeben von allen Tänzerinnen und von dem ganzen Kinderschwarm des Balletts gefolgt, auf dem Tisch der Portierloge, die neben dem Administrationshof gelegen ist, ein Hufeisen anbrachte, das jeder – außer den Zuschauern –, der das Opernhaus betrat, berühren musste, ehe er seinen Fuß auf die erste Stufe der Treppe setzte. Und wer sich davon ausschloss, dem drohte die Gefahr, die Beute der dunklen Macht zu werden, die sich des Gebäudes von den Kellerräumen bis zum Speicher bemächtigt hatte.
Dieses Hufeisen, das ich – wie ja übrigens die ganze Geschichte – durchaus nicht erfunden habe, kann man noch heute an dem Tisch angenagelt sehen, wenn man die Oper durch den Administrationshof betritt.
Aus all dem gewinnt man leicht ein Bild von dem Seelenzustand der Damen an dem Abend, da wir mit ihnen in die Garderobe der Sorelli eindringen.
»Es ist das Phantom!«, hatte die kleine Jammes ausgerufen und die Unruhe der Tänzerinnen damit nur gesteigert. Ein banges Schweigen herrschte nun in der Garderobe, und man hörte nichts als das lebhafte Atemholen. Endlich murmelte Jammes, die sich mit allen Zeichen eines ungeheuchelten Schreckens in die hinterste Zimmerecke gestürzt hatte: »Hört doch!«
Und tatsächlich schien es allen, als wäre hinter der Tür ein Rascheln hörbar. Kein Schritt war zu vernehmen, man hätte meinen können, ein leichter Seidenstoff glitte über die Türfüllung. Dann blieb es still. Die Sorelli bemühte sich, weniger kleinmütig zu erscheinen als ihre Kolleginnen. Sie schritt auf die Tür zu und fragte mit unschuldiger Stimme: »Wer ist da?«
Doch niemand antwortete ihr.
Und da sie die geringsten ihrer Gesten von aller Augen beobachtet fühlte, zwang sie sich, mutig zu erscheinen, und rief sehr laut: »Ist jemand da hinter der Tür?«
»O ja, ja, gewiss ist jemand hinter der Tür!«, wiederholte Meg Giry, die sich heldenhaft an dem Tüllkleid der Sorelli festhielt. »Mein Gott, öffnet die Tür um alles in der Welt nicht!«
Doch die Sorelli, mit einem Dolch bewaffnet, den sie stets bei sich trug, wagte es, den Zimmerschlüssel umzudrehen und die Tür zu öffnen, während die Tänzerinnen bis in den Ankleideraum zurückflüchteten.
Die Sorelli spähte couragiert in den Gang hinaus. Er war völlig leer; eine Schmetterlingsflamme in ihrem Glasbehälter warf einen trüben, roten Schein in die umgebende Dunkelheit, ohne sie durchdringen zu können. Und mit einem tiefen Seufzer schloss die Tänzerin rasch die Tür. »Nein«, sagte sie, »es ist niemand draußen.«
»Und dennoch haben wir es gesehen«, beteuerte Jammes noch einmal und kehrte ängstlichen Schrittes zur Sorelli zurück. »Es muss irgendwo in der Nähe herumstreifen. Ich getraue mich nicht in die Garderobe zurück, um mich umzukleiden. Es wäre am besten, wir gingen sogleich alle miteinander ins Foyer hinunter, zur Abschiedsfeier, und kehrten dann alle zusammen zurück.«
Nach diesen Worten berührte das Kind andächtig den Korallenanhänger, der sie als Talisman vor allem Übel bewahren sollte. Und die Sorelli zeichnete ihr mit der rosigen Nagelspitze ihres rechten Daumens ein Andreaskreuz auf den Holzring am Goldfinger ihrer linken Hand.
Sie sagte zu den kleinen Tänzerinnen: »Kinder, ihr müsst euch beruhigen, das Phantom … niemand hat es vielleicht wirklich gesehen.«
»Doch, doch, wir haben es gesehen! Gerade vorhin haben wir es gesehen. Mit dem Totenschädel und dem schwarzen Anzug, wie an dem Abend, wo es Joseph Buquet erschien!«
»Und auch Gabriel hat es gesehen!«, fiel die Jammes ein. »Gestern erst, gestern Nachmittag – bei helllichtem Tag.«
»Gabriel? Der Gesangsmeister?«
»Aber freilich – haben Sie nicht davon gehört?«
»Und er trug seinen Frack am helllichten Tag?«
»Wer? Gabriel?«
»Aber nein – das Phantom!«
»Freilich trug er ihn!«, beteuerte die Jammes. »Gabriel selbst hat es mir gesagt. Gerade daran hat er es ja erkannt. Sehen Sie, die Geschichte trug sich folgendermaßen zu. Gabriel war im Büro des Regisseurs. Plötzlich tut sich die Tür auf, und der Perser kommt herein. Ihr wisst ja, dass der Perser den bösen Blick hat?«
»Ja – o ja –«, riefen die kleinen Tänzerinnen und streckten, sobald der Name des »Persers« gefallen war, Zeigefinger und kleinen Finger wie Hörner dem bösen Geschick entgegen, während Mittelfinger und Ringfinger vom Daumen festgehalten wurden.
»Und weil nun Gabriel abergläubisch ist«, fuhr die Jammes fort, »zugleich aber sehr höflich, so begnügt er sich, ganz ruhig seine Hand in die Tasche zu stecken und seine Schlüssel zu berühren, sobald er den Perser zu Gesicht bekommt … Nun gut! Sowie der Perser die Tür aufmacht, springt Gabriel von seinem Fauteuil auf und zum Kastenschlüssel hin, um irgendetwas Eisernes berühren zu können! Bei diesem Sprung zerriss er sich den ganzen Rockschoß und stieß in der Eile des Hinausgehens mit der Stirn an einen Gardinenhalter, wovon er jetzt noch eine riesige Beule trägt. Als er dann hastig zurückfuhr, riss er sich den Arm an dem Paravent auf, der neben dem Klavier steht. Er wollte sich auf das Klavier stützen, doch unglücklicherweise streifte er dabei an den Deckel, der ihm auf die Hand fiel und ihm die Finger einklemmte. Er stürzte wie ein Wahnsinniger aus dem Büro und eilte die Stiege in solcher Hast hinunter, dass er ausglitt und die ganze Treppe bis zum ersten Stock hinunterpurzelte. Eben in diesem Moment kam ich mit Mama vorbei. Wir eilten hin, um ihm aufzuhelfen. Er war ganz zerschunden und hatte das Gesicht so voll Blut, dass wir lebhaft erschraken. Bald darauf aber lächelte er wieder und rief aus: ›Ich kann Gott danken, dass ich so billig davongekommen bin!‹ Und darauf erzählte er uns sein ganzes Missgeschick, das nur aus seinem Entsetzen entsprang, als er hinter dem Perser das Phantom erblickt hatte, das Gespenst mit dem Totenschädel, wie es Joseph Buquet geschildert hat.«
Ein bestürztes Gemurmel folgte dieser seltsamen Erzählung, die die Jammes ganz außer Atem gebracht hatte. In solcher Eile hatte sie ihren Bericht hervorgesprudelt, als ob ihr das Phantom auf den Fersen sei. Die kleine Pause, die nun eintrat und während deren sich die Sorelli sehr nervös die Nägel polierte, wurde von der kleinen Giry mit zaghafter Stimme unterbrochen.
»Joseph Buquet täte gut daran, den Mund zu halten«, bemerkte sie.
»Ja, warum denn?«, fragte man von allen Seiten.
»Meine Mama – hat – es – gesagt«, stammelte die kleine Meg ganz leise, indem sie um sich sah, als fürchte sie, noch von anderen Ohren gehört zu werden.
»Und warum ist sie dieser Meinung, deine Mutter?«
»Pst – Mama sagt, dass das Phantom ärgerlich wird, wenn man zu viel von ihm spricht.«
»Und wie kommt deine Mama zu dieser Meinung?«
»Weil … nämlich … ah, nichts.«
Diese geheimnisvollen Andeutungen waren vortrefflich geeignet, die Neugierde der Damen aufs Äußerste zu spannen, die sich um die kleine Giry drängten und sie anflehten, sich deutlicher auszudrücken. Schulter an Schulter standen sie um sie herum.
»Ich habe geschworen, nichts zu sagen«, flüsterte Meg fast unhörbar. Doch sie ließen ihr keine Ruhe und versprachen, das Geheimnis so gut zu bewahren wie Meg selbst, die übrigens danach brannte, ihre Weisheit auszukramen, und endlich – die Augen auf die Tür geheftet – begann:
»Nun denn … wegen der Loge!«
»Welcher Loge?«
»Wegen der Loge des Phantoms.«
»Was? … Das Phantom hat eine Loge?«
Bei dem Gedanken, dass das Phantom seine Loge habe, konnten die kleinen Tänzerinnen die mit Entsetzen gemischte Freude ihres Erstaunens nicht zurückhalten. Ein allgemeines Stöhnen ging durch den Raum, und sie riefen: »Um Gottes willen, erzähle, erzähle!«
»Macht keinen solchen Lärm!«, befahl Meg. »Es ist die erste Rangloge Nr. 5, wisst ihr … die erste Proszeniumsloge links.«
»Unmöglich …«
»Es ist, wie ich euch sage. Mama ist dort Logenschließerin. Aber ihr schwört mir, darüber zu schweigen!«
»Aber ja! Doch erzähle nur weiter!«
»Nun gut. Das ist die Loge des Phantoms. Niemand hat sie seit über einem Monat betreten als das Phantom, und man hat sogar die Direktion beauftragt, diese Loge niemals mehr zu vermieten …«
»Wirklich? … Kommt das Phantom dorthin?«
»Nun, gewiss.«
»Und wer ist sonst noch dort?«
»Niemand sonst! Das Phantom kommt und bleibt ganz allein.«
Die kleinen Tänzerinnen sahen sich gegenseitig an. Wenn das Phantom in die Loge kommt, so müsste man es doch sehen, da es einen Frack hatte und einen Totenschädel. Das wollten sie auch Meg begreiflich machen, diese aber antwortete: »Das ist es ja gerade, das Phantom ist unsichtbar, es hat weder einen Anzug noch einen Kopf. Alles, was man über seinen Totenkopf erzählt hat und über ein feuriges Haupt, ist einfach erlogen. Es ist überhaupt nicht zu sehen. Man hört es nur, wenn es in der Loge ist. Mama hat es nie zu Gesicht bekommen, nur gehört, und sie muss es wissen, da sie ihm alle Abende das Programm gibt!«
Nun aber wurde es selbst der Sorelli zu bunt. »Meine kleine Giry, ich glaube, du hältst uns zum Narren!«
Da begann die kleine Giry zu weinen.
»Ich hätte besser getan, den Mund zu halten … Wenn nur Mama nichts davon erfährt. Joseph Buquet aber sollte sich nicht um Dinge kümmern, die ihn nichts angehen … Das wird ihn noch ins Unglück bringen … Mama hat es erst gestern wieder gesagt …!«
In diesem Augenblick wurden im Gange schwere und eilige Schritte hörbar, und eine keuchende Stimme rief: »Cécile! Cécile! Wo bist du?«
»Das ist Mamas Stimme!«, sagte die Jammes. »Was ist denn los?« Und sie öffnete die Tür. Eine würdige Matrone stürzte in die Garderobe und ließ sich ächzend in einen Fauteuil fallen. Ihre Augen rollten wie bei einer Irrsinnigen und funkelten unheilverkündend in ihrem krebsroten Gesicht.
»Welch ein Unglück!«, stöhnte sie. »Welch ein Unglück! …«
»Was ist geschehen … um Gottes willen …? Was gibt es?«
»Joseph Buquet …«
»Nun, was ist mit Joseph Buquet …?«
»Joseph Buquet ist tot!«
Die Garderobe widerhallte von lebhaften Äußerungen, von erstaunten Protesten, von bestürzten Fragen.
»Ja … eben fand man ihn im dritten Unterstock erhängt! Und das Fürchterlichste ist«, setzte die arme, würdige Dame – außer Atem – hinzu, »dass die Maschinisten, die ihn fanden, in der Nähe des Leichnams ein Geräusch gehört haben wollen – wie einen Totengesang!«
»Das ist das Phantom!«, entfuhr es der kleinen Giry, doch sie besann sich sogleich und hielt die Hände vor den Mund. »Nein! Ich will nichts gesagt haben … ich habe nichts gesagt!«
Rings um sie wiederholten alle ihre Kolleginnen mit leiser Stimme: »Ganz gewiss! … Das Phantom! …«
Die Sorelli war bleich geworden. »Ich werde nicht imstande sein, meine Abschiedsrede zu halten!«, sagte sie.
Jammes’ Mama gab ihre Meinung ab, indem sie ein kleines Glas Likör leerte, das herrenlos auf dem Tisch stand: »Dahinter muss das Phantom stecken! …«
In Wahrheit hat man niemals recht erfahren, auf welche Weise Joseph Buquet ums Leben gekommen war. Die Aufnahme des Tatbestandes ergab nichts anderes als Selbstmord. In den »Memoiren eines Theaterdirektors« erzählt Moncharmin, einer der Nachfolger der Herren Debienne und Poligny, die Nebenumstände des Selbstmords folgendermaßen:
»Ein peinlicher Unfall hat das kleine Fest gestört, das die Herren Debienne und Poligny aus Anlass ihres Abschieds veranstalteten. Ich befand mich im Direktionsbüro, als ich plötzlich Herrn Mercier – den Administrator – eintreten sah. Er war ganz verstört und erzählte mir, dass man eben im dritten Unterstock der Bühne, zwischen einem Balkengerüst und einer Dekoration des ›Roi de Lahore‹, den Leichnam eines Maschinisten entdeckt habe. ›Gehen wir ihn abschneiden‹, rief ich sofort. Während der Zeit, die ich brauchte, um die Stiege hinunterzulaufen und die Leiter des Bühnengerüstes hinunterzusteigen, hatte man den Erhängten bereits abgeschnitten, und die Schnur war verschwunden.«
Man sieht also, dass Herrn Moncharmin nicht die geringsten Zweifel über den Selbstmord aufstiegen. Ein Mann hat sich an einer Schnur erhängt, man hat ihn abgeschnitten, und die Schnur ist verschwunden. Und Herr Moncharmin findet dafür eine sehr einfache Erklärung. Er schreibt: »Das ganze Ballettkorps war im Haus, und Solisten und Ballettmädel hatten sich vermutlich schnell den Talisman gegen den bösen Blick geteilt.«
Nichts weiter. Man denke sich das ganze Ballettkorps die Gerüstleiter hinunterklettern und sich die Schnur eines Erhängten teilen, und das alles in geringerer Zeit, als man braucht, um es niederzuschreiben. Ist so etwas glaublich? Wenn ich mir dagegen den Platz, wo der Leichnam gefunden wurde, vergegenwärtige – im dritten Unterstock der Bühne –, so steigt in mir sogleich der Gedanke auf, dass irgendwer ein Interesse daran gehabt hat, die Schnur, nachdem sie ihren Zweck erfüllt hatte, schnell verschwinden zu lassen; und es wird sich noch zeigen, ob ich damit unrecht hatte.
Die Unglücksnachricht hatte sich bald im ganzen Haus verbreitet, denn Joseph Buquet war allgemein beliebt gewesen. Die Garderobe leerte sich allmählich, und die kleinen Tänzerinnen gingen, um die Sorelli geschart wie ängstliche Schäfchen um den Hirten, durch die schlecht erleuchteten Gänge und über die Stiegen, so schnell sie ihre kleinen rosafarbenen Beinchen tragen wollten, ins Foyer.
II
Auf dem ersten Treppenabsatz traf die Sorelli mit dem Grafen Chagny zusammen, der eben die Stiege hinaufschritt. Der Graf – sonst der ruhigste Mensch, den man sich denken konnte – schien in großer Aufregung zu sein.
»Ich bin auf dem Weg zu Ihnen«, sagte der Graf, der jungen Dame galant die Hand küssend. »Ach, Sorelli, ein herrlicher Abend! Und Christine Daaé: welch ein Triumph!«
»Unmöglich!«, fiel Meg Giry ein. »Vor sechs Monaten noch sang sie wie ein Blechtopf! Doch lassen Sie uns vorbei, mein lieber Graf«, sagte die kleine Ballettratte mit schnippischer Verbeugung, »wir gehen, Neuigkeiten über den armen Erhängten zu erfahren.«
In diesem Augenblick lief der Administrator geschäftig vorbei, blieb jedoch plötzlich stehen, als er diese Worte hörte. »Wie, Fräulein, Sie haben schon davon gehört?«, sagte er ziemlich brüsk. »Ich bitte Sie – sprechen Sie nicht davon. Und dass vor allem die Herren Debienne und Poligny nichts davon erfahren! An ihrem letzten Abend soll ihnen dieser Kummer erspart bleiben.«
Und sie begaben sich alle in das Foyer de la Danse, das bereits voll war.
Der Graf Chagny hatte recht. Dieser Gala-Abend übertraf alles Dagewesene. Die Bevorzugten, die ihm beiwohnten, erzählen noch heute begeistert ihren Kindern und Kindeskindern davon. Man denke, dass Gounod, Reyer, Saint-Saëns, Massenet, Guirand, Delibes nacheinander in eigener Person das Dirigentenpult bestiegen und die Aufführungen ihrer eigenen Werke leiteten. Unter den darstellenden Künstlern befand sich Faure und die Krauß, und an diesem Abend eroberte sich Christine Daaé, deren mysteriöses Schicksal ich in diesem Buch erzählen will, die Bewunderung und Begeisterung von ganz Paris.
Sie brachte zuerst einige Passagen aus »Romeo und Julia« zum Vortrag. Es war das erste Mal, dass die junge Künstlerin dieses Werk Gounods sang. Wer niemals Christine Daaé in der Rolle der Julia gehört hat, hat viel versäumt, er kennt nicht ihre kindliche Grazie, ihre Engelsstimme, er hat nie gefühlt, wie ihre Seele mit seiner eigenen entschwebt, über den Gräbern der Liebenden von Verona: »Seigneur! Seigneur! Seigneur! Pardonnez-nous!«
Doch das alles war nichts im Vergleich mit den fast überirdischen Tönen, die wir zu hören bekamen, als sie die Kerkerszene und das Schlusstrio aus »Faust« sang, in Vertretung der indisponierten Carlotta. Nie noch hatte man so etwas gehört oder gesehen!
Es war eine neue Margarete, die uns die Daaé offenbarte, eine Margarete von ungeahntem Glanz, von ungeahnter Größe. Der ganze Saal dröhnte von unerhörtem Beifallsjubel der begeisterten Zuhörer, während Christine schluchzend und halb ohnmächtig ihren Kolleginnen in die Arme sank. Man musste sie in ihre Garderobe bringen. Sie glich einer Toten.
Der Graf de Chagny hatte diesem Delirium in seiner Loge stehend beigewohnt und sich lebhaft an den Bravorufen beteiligt.
Der Graf de Chagny, Philippe-Georges-Marie, hatte damals ein Alter von genau einundvierzig Jahren. Er war von altem Adel und ein auffallend schöner Mann von mehr als mittelgroßer Statur und von sympathischem Äußeren. Trotz der harten Stirn und den etwas kalten Augen war er von ausgesuchter Höflichkeit gegen die Damen und ein wenig von oben herab gegen die Männer, die ihm seine gesellschaftlichen Erfolge nicht recht verzeihen konnten. Er war ein gutherziger Mensch, der viel auf seine ritterliche Ehre hielt. Durch den Tod des alten Grafen Philibert war er das Oberhaupt einer der berühmtesten und ältesten Familien Frankreichs geworden, deren Adelsbrief bis auf Louis le Hutin zurückging. Das Vermögen der Chagny war bedeutend, und als der alte Graf als Witwer starb, war es für Philippe keine kleine Arbeit, ein so großes Erbe zu verwalten. Seine zwei Schwestern und sein Bruder Raoul wollten nichts von einer Teilung wissen, und so lebten sie in Gütergemeinschaft und überließen Philippe alle Geldangelegenheiten, als hätte das Majoratsrecht nicht zu bestehen aufgehört. Als sich die beiden Schwestern – am gleichen Tage – verheirateten, erhielten sie ihre Anteile von ihrem Bruder ausbezahlt, nicht als ihr eigentliches Erbe, sondern eher als eine Mitgift, für die sie ihm ihren Dank aussprachen.
Die Gräfin Chagny, eine geborene Moerogis de la Martymière, starb bei Raouls Geburt, der zwanzig Jahre nach seinem älteren Bruder zur Welt kam. Er zählte zwölf Jahre, als der alte Graf verschied. Philippe beschäftigte sich viel mit der Erziehung des Knaben und wurde darin bewundernswert von seinen Schwestern unterstützt und später von einer alten Tante, der Witwe eines Seeoffiziers, die in Brest lebte und in dem jungen Raoul die Lust nach allem erweckte, was mit dem Meer zusammenhing. Dank der Vermittlung einflussreicher Gönner wurde er der offiziellen Expedition des »Requin« beigegeben, die im Eis des Polarmeers die Überlebenden der Expedition des »D’Artois« aufzusuchen bestimmt war, über die man seit drei Jahren keine Nachricht hatte. Augenblicklich genoss er einen längeren Urlaub, der noch volle sechs Monate dauern sollte.
Die Schüchternheit dieses jungen Seemanns – ja ich möchte fast sagen: seine Unschuld – war auffallend. Er schien eben erst den Kinderschuhen entwachsen zu sein. Wirklich hatte er sich, gehätschelt von den beiden Schwestern und seiner alten Tante, durch diese ausschließlich weibliche Erziehung fast engelhafte Manieren zugelegt, einen liebenswürdigen Charme, den bis dahin nichts zu trüben vermochte. Damals war er etwas mehr als zwanzig Jahre alt und sah aus wie achtzehn. Er trug ein blondes Bärtchen, hatte schöne blaue Augen, und sein Teint war rosig wie der eines jungen Mädchens.
Philippe verzog den jüngeren Bruder sehr. Er war stolz auf ihn und sah den Seekadetten am Beginn einer glänzenden Laufbahn in derselben Marine, in der einer ihrer Ahnen, der berühmte Chagny de la Roche, den Rang eines Admirals eingenommen hatte. Er benutzte den Urlaub des jungen Mannes dazu, um ihm Paris zu zeigen, das dieser, zum Mindesten was luxuriöse Vergnügungen und künstlerische Genüsse anlangte, so gut wie gar nicht kannte.
Der Graf war der Meinung, dass in Raouls Alter allzu viel Sittsamkeit auch nicht das Geeignetste sei. Philippe selbst war ein sehr ausgeglichener Charakter, er wusste Arbeit und Vergnügen im richtigen Maß zu verteilen, verlor keine Minute seine Haltung und konnte also unmöglich seinem Bruder ein schlechtes Beispiel geben. Er nahm ihn überall mit sich. Er zeigte ihm sogar das Foyer de la Danse. Ich weiß wohl, dass man sich erzählte, der Graf stünde mit der Sorelli in bestem Einvernehmen, doch schließlich konnte man es diesem Gentleman, der außerdem Junggeselle war und also, besonders seit seine Schwestern verheiratet waren, sehr viel freie Zeit hatte, nicht übelnehmen, wenn er nach dem Diner ein oder zwei Stunden in Gesellschaft einer Tänzerin verbrachte, die zwar nicht gerade eine Geistesleuchte war, gewiss aber die schönsten Augen der Welt hatte.
Endlich würde Philippe seinen Bruder vielleicht nicht hinter die Kulissen der Académie Nationale de Musique geführt haben, wenn dieser ihn nicht mehrfach mit sanfter Hartnäckigkeit darum ersucht hätte, ein Umstand, dessen sich der Graf später erinnern sollte.
Nachdem Philippe an diesem Abend der Daaé Beifall geklatscht hatte, wendete er sich zu Raoul um und bemerkte, dass dieser so auffallend bleich neben ihm saß, dass er darüber heftig erschrak. »Siehst du denn nicht«, hatte Raoul gesagt, »dass diese Frau einer Ohnmacht nahe ist?!«
In der Tat musste man auf der Bühne Christine Daaé stützen.
»Ich glaube gar, du wirst mir ohnmächtig«, sagte der Graf und beugte sich zu Raoul. »Was hast du denn nur?«
Doch Raoul war schon auf den Beinen.
»Komm«, sagte er mit zitternder Stimme.
»Wohin willst du gehen, Raoul?«, fragte der Graf, erstaunt über die Erregung seines kleinen Seekadetten.
»Komm … komm … ich habe sie noch nie so singen gehört.«
Der Graf betrachtete erstaunt seinen Bruder, und ein leichtes Lächeln spielte um seine Mundwinkel. »Bah …« Und gleich darauf fügte er hinzu: »Nun, so gehen wir!« Und er schien sehr vergnügt zu sein.
Sie befanden sich bald am Bühneneingang, wo sie in ein arges Gedränge kamen. Während sie nur langsam gegen die Bühne vorwärts kommen konnten, riss Raoul vor fieberhafter Unruhe seine Handschuhe in Stücke. Philippe war zu gutherzig, um sich über seine Unruhe lustig zu machen, doch er war nunmehr im Klaren, er wusste, warum Raoul so zerstreut war, wenn er mit ihm sprach, und warum er ein lebhaftes Interesse zeigte, das Gespräch immer wieder auf die Oper zu bringen.
Endlich waren sie auf der Ebene der Bühne.
Eine Unzahl von Herren im Gesellschaftsanzug drängte sich gegen das Foyer de la Danse und die Künstlergarderoben. In die Zurufe der Maschinisten mischten sich die lauten Befehle der Dienstleiter. Die Figuranten des letzten Bildes sind eben im Weggehen, die Statistinnen stoßen einen an, ein Kulissenwagen zieht vorbei, vom Schnürboden wird ein Hintergrund herabgelassen; dort wird ein praktikables Portal mit lauten Hammerschlägen befestigt, die Zurufe »Achtung! – Aufpassen!« klingen unaufhörlich wie die Drohung eines neuen Unfalls für Ihren Zylinder oder Ihre Rippen an das Ohr – es ist das gewöhnliche Leben und Treiben des Zwischenaktes.
An diesem Abend nun war die Verwirrung, das Durcheinander doppelt groß, Raoul aber couragierter denn je. Er bahnte sich mit kräftigen Ellbogen den Weg durch das Gedränge, hörte und sah nichts von dem, was um ihn vorging, und gab sich keine Mühe, die Zurufe der Maschinisten zu verstehen. Er fühlte nur zu gut, dass sein armes, unerfahrenes Herz ihm nicht mehr gehörte. An dem Tag, da er Christine, die er als kleines Kind gekannt hatte, wiedersah, ließ er es nicht unversucht, es gegen sie zu verteidigen. Eine süße Sehnsucht war über ihn gekommen bei diesem Wiedersehen, und er hatte gegen sie angekämpft; hatte er sich doch im Bewusstsein der Achtung vor sich selbst und vor seiner Treue zugeschworen, nie eine andere als seine zukünftige Gattin zu lieben, und er konnte natürlich keinen Augenblick an eine Verheiratung mit einer Sängerin denken. Doch dieser süßen Sehnsucht war eine wilde Leidenschaft gefolgt. Ein physischer und moralischer Schmerz. Es war ihm, als hätte man ihm die Brust aufgerissen, um ihm das Herz zu nehmen.
Graf Philippe hatte Mühe, ihm zu folgen. Noch immer lag ein leises Lächeln auf seinen Zügen.
Im Hintergrund der Bühne, hinter der Doppeltür, die nach den Treppen zum Foyer und zu den linksseitigen Souterraingarderoben führt, wurde Raoul von einem Dutzend Ballettratten aufgehalten, die eben aus ihrem Ankleideraum kamen und ihm den engen Gang versperrten. Mehr als eine lustige Bemerkung wurde von den geschminkten Mäulchen auf ihn abgeschossen, doch er achtete nicht darauf. Endlich hatte er sich durchgewunden und eilte nun durch einen dunklen Korridor, der von den Beifallsrufen der enthusiasmierten Bewunderer dröhnte. Ein Name übertönte allen Lärm: Daaé … Daaé! Der Graf, der hinter Raoul daherschritt, dachte bei sich: ›Der Schlingel kennt den Weg!‹ Und er fragte sich, woher wohl diese Ortskenntnis stamme. Er selbst erinnerte sich nicht, ihn jemals zu Christine geführt zu haben. Offenbar war er allein – auf eigene Faust – zu ihr gegangen, wenn der Graf wie gewöhnlich plaudernd mit der Sorelli im Foyer stand.
Der Graf schob seinen obligaten Besuch bei der Sorelli für einige Minuten auf und schritt die Galerie entlang, die zur Garderobe der Daaé führte. Und er konstatierte, dass er diesen Korridor noch niemals so besucht gesehen hatte wie an diesem Abend, an dem das ganze Haus in Aufregung war durch den fabelhaften Erfolg der Künstlerin und durch ihr plötzliches Unwohlsein. Das schöne Kind war nämlich noch nicht wieder zu sich gekommen, und man hatte nach dem Theaterarzt geschickt, der mittlerweile eintraf und sich durch das Gedränge einen Weg bahnte, gefolgt von Raoul, der ihm immer auf den Fersen blieb.
So langten der Arzt und der Verliebte gleichzeitig bei Christine an, die unter den Bemühungen des einen alsbald in den Armen des anderen die Augen aufschlug. Der Graf war mit vielen anderen auf der Türschwelle stehen geblieben, wo ein namenloses Gedränge herrschte.
»Meinen Sie nicht, Doktor, dass es angezeigt wäre, wenn diese Herren die Tür ein wenig frei ließen?«, fragte Raoul mit unbegreiflicher Kühnheit. »Es ist zum Ersticken heiß hier drinnen.«
»Sie haben vollkommen recht«, bestätigte der Arzt, und er ersuchte alle, die Garderobe zu verlassen, außer Raoul und der Kammerfrau. Diese betrachtete Raoul mit großen Augen und der aufrichtigsten Verblüffung. Sie hatte ihn noch niemals gesehen. Dennoch getraute sie sich nicht, ihn zur Rede zu stellen, und der Arzt war der Meinung, dass der junge Mann wohl ein Recht zu seinem Benehmen haben müsse. So also kam es, dass der Vicomte in der Garderobe blieb, als die Daaé aus ihrer Ohnmacht erwachte, während selbst die beiden Direktoren, die Herren Debienne und Poligny, die der Sängerin ihre Bewunderung auszudrücken wünschten, mit vielen befrackten Herren in den Gang hinausgeschoben wurden. Der Graf, dem es nicht besser ergangen war, wandte sich nach der Garderobe der Sorelli. Doch diese kam eben mit ihrer kleinen, angstbebenden Schar ins Foyer herunter, und der Graf begegnete ihr auf halbem Weg.
Christine Daaé hatte in ihrer Loge ein leises Stöhnen ausgestoßen, das von einem Seufzer beantwortet wurde. Sie wandte den Kopf, sah Raoul und zitterte. Sie lächelte dem Arzt zu, blickte auf die Kammerfrau und dann nochmals auf Raoul. »Mein Herr«, fragte sie diesen mit einer Stimme, die kaum mehr als ein Hauch war, »wer sind Sie?«
»Gnädiges Fräulein«, antwortete der junge Mann, kniete nieder und drückte einen heißen Kuss auf die Hand der Diva, »gnädiges Fräulein, ich bin das kleine Kind, das Ihre Schärpe aus dem Meer rettete.«
Christine sah noch immer den Arzt und die Kammerfrau an, und alle drei begannen zu lachen. Raoul wurde blutrot und erhob sich. »Mein gnädiges Fräulein, da Sie mich nicht erkennen wollen, wünschte ich sehr, Ihnen etwas unter vier Augen sagen zu dürfen, etwas, das Sie gewiss lebhaft interessieren wird!«
»Wenn ich mich etwas erholt habe, mein Herr … nicht wahr?« Und ihre Stimme zitterte … »Sie sind sehr liebenswürdig …«
»Doch gehen Sie jetzt«, sagte der Arzt mit dem freundlichsten Lächeln. »Ich will die Dame untersuchen.«
»Mir fehlt doch nichts!«, sagte Christine plötzlich mit ebenso ungewohnter wie unerwarteter Energie, stand auf und fuhr mit einer hastigen Handbewegung über die Augenlider. »Ich danke Ihnen, Doktor, ich habe ein wenig Ruhe nötig, das ist alles. Lassen Sie mich, bitte, allein! Gehen Sie alle – ich bin sehr nervös heute Abend.«
Der Arzt wollte einige Einwendungen machen, doch aus der Unruhe der jungen Dame gewann er alsbald die Überzeugung, dass das beste Heilmittel für ihren Zustand darin bestand, ihr nicht zu widersprechen. So entfernte er sich mit Raoul, der sehr verstimmt war, als er sich wieder im Korridor befand.
»Ich weiß nicht, was sie heute hat«, sagte der Arzt zu ihm, »sie ist sonst das sanfteste Geschöpf der Welt.« Und er verabschiedete sich.
Raoul blieb allein zurück. Weit und breit war jetzt kein Mensch zu sehen. Die Abschiedsfeier im Foyer de la Danse hatte ihren Fortgang genommen. Raoul dachte, dass die Daaé vielleicht wieder dorthin zurückkehren würde, und so blieb er ganz allein im Finstern stehen und wartete. Ja, er verbarg sich sogar in einer besonders dunklen Türnische. Noch immer fühlte er diesen brennenden Schmerz in seiner Brust. Er wollte, er musste der Daaé unverzüglich davon sprechen. Plötzlich öffnete sich die Tür der Garderobe, und er sah das Kammermädchen mit einigen Paketen