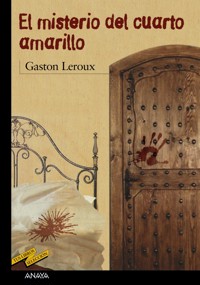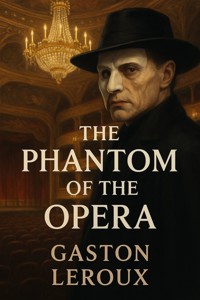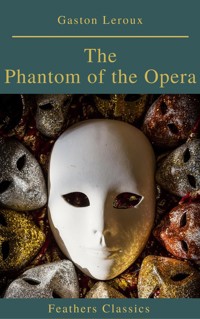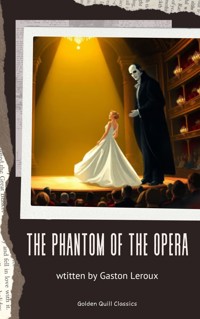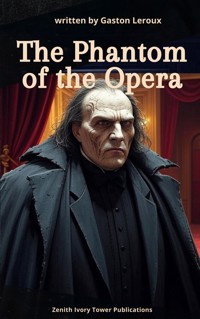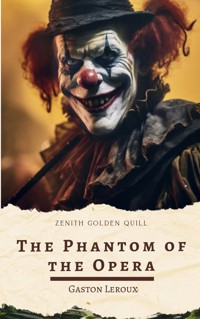Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der junge Ingenieur Raymond Ozoux reist in Begleitung seines Onkels nach Peru, wo er seine Verlobte Marie-Thérèse treffen will. Doch das fröhliche Wiedersehen ist von kurzer Dauer, denn Marie-Thérèse verschwindet spurlos, entführt von blutrünstigen Nachfahren der alten Inkas, die sie als Opfergabe für ihren Sonnengott vorgesehen haben. Während eine Revolution das Land erschüttert, entspinnt sich eine wilde Verfolgungsjagd durch die fantastischen Landschaften Perus auf der Suche nach der verlorenen Stadt der Inkas. Werden Raymond und seine Gefährten rechtzeitig ankommen, um Marie-Thérèse den Klauen des Hohepriesters Huascar zu entreißen? "Die Braut der Sonne" - hiermit zum ersten Mal auf Deutsch erhältlich - ist ein fantastischer Abenteuerroman, der den großen Hergé und seinen Tim-und-Struppi-Band "Der Sonnentempel" stark beeinflusst hat und in die Populärkultur eingegangen ist. Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Armin Öhri.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor:
Der französische Journalist und Schriftsteller Gaston Leroux (1868 bis 1927) erschuf mit ›Das Geheimnis des gelben Zimmers‹ einen Klassiker der Kriminalliteratur. Sein mit Abstand bekanntestes Werk jedoch ist ›Das Phantom der Oper‹, das mehrfach verfilmt wurde und in der Musicalversion von Andrew Lloyd Webber seinen Siegeszug um die Welt antrat. Der Abenteuerroman ›Die Braut der Sonne‹ liegt hier erstmalig in deutscher Übersetzung vor.
Der Herausgeber:
Der Schriftsteller und Herausgeber Armin Öhri, geboren 1978, lebt in Grabs im St. Galler Rheintal. Bekannt sind die historischen Kriminalromane um seinen Protagonisten, den jungen Tatortzeichner Julius Bentheim. Der Autor erhielt den ›European Union Prize for Literature‹, seine Werke wurden in mehrere Sprachen übersetzt, zuletzt ins Italienische und Griechische. In Spanien und Südamerika avancierten seine Titel zu Bestsellern und fanden sich auf diversen Jahresbestenlisten wieder.
Inhaltsverzeichnis
Erstes Buch
Die Ankunft eines Verehrers
Der Indianer Huascar betritt die Szene
Die Koketterie der Limanesinnen
Die Sonnenfeier rückt näher
Drei junge, lebendig eingemauerte Mädchen
Von wem stammte das Armband?
Eine Partie Boule mit Totenschädeln
Geister auf dem Balkon
Zweites Buch
Der Schatten des Eroberers
Ein Gespräch in dunkler Nacht
Erweist sich Huascar als grausame Heimsuchung?
Ein Geschenk von Atahualpa
»Lasst die Jungfrau der Sonne passieren!«
Drittes Buch
Man trifft auf den guten Natividad
Auf der Spur der roten Ponchos
»Man ermordet sie! Man ermordet sie!«
Die Señorita in den Händen der Mamaconas
Die Entführung des kleinen Cristóbal
François-Gaspards Skeptizismus
Viertes Buch
»Ich bin gekommen, um den Herrscher
»Rücken Sie meine Kinder heraus!«
Die Allmacht des Oviedo Runtu
Huascars Schwur, ein feierlicher Pakt
Das Wiederfinden von Onkel Gaspard
Im Haus der Schlange
Die Braut der Sonne zieht das Hochzeitskleid an
»Der Tote wird kommen! Hört zu!«
Fünftes Buch
Er trägt ein Kleid aus Fledermaushaut
Die Vorsichtsmaßnahmen des Narren Orellana
Der Festzug des Inti Raymi
Ein Schrei, der aus dem Himmel kommt
Im Labyrinth der Korridore der Nacht
Der Tempel des Todes
Der in seinem Licht sitzende Gott
Der Schwur der Kinder der Sonne
Die 1.000-jährige Königin auf dem Scheiterhaufen
Sechstes Buch
Die lebendig eingemauerte Marie-Thérèse
Wird sich das Granitgefängnis öffnen?
Alle Gräber ähneln sich
Raymonds Verzweiflung
Eine gesegnete Erscheinung
Der Hohepriester hat sein Wort gehalten
Ein Schwur, der nicht mehr zählt
War alles bloß ein Traum?
Tragische Wirklichkeit
Epilog
Nachwort des Herausgebers
Erstes Buch
Die Ankunft eines Verehrers
Kaum hatte das Schiff den Hafen von Callao erreicht, da wurde es schon, noch bevor es vor Anker ging, von einer Vielzahl schreiender und tyrannischer Bootsleute überfallen. Die Aufgänge, die Kabinen, die Salons waren in Sekundenschnelle angefüllt von diesem lästigen Gesindel, wie es die offiziell registrierten Gepäckträger waren, die für sich beanspruchten, alle Passagiere von Bord zu begleiten. Onkel François-Gaspard Ozoux1 (vom Institut de France, Abteilung für Inschriften und Schöne Literatur2) saß auf seinen Koffern, in denen er alle seine Dokumente und Gegenstände, die ihm für seine Gelehrsamkeit wichtig erschienen, fest mit Vorhängeschlössern verschlossen hatte, und verteidigte sich wie ein Tollwütiger.
Vergeblich versuchte man ihm klarzumachen, dass das Linienschiff nicht vor zwei Stunden zum Dock geschleppt werden könne; er klammerte sich an seine Schätze und schwor, dass ihn nichts von ihnen trennen würde. Diesen Dämonen zu erlauben, solch kostbares Gepäck auf ihre zerbrechlichen Boote zu werfen, diese Idee konnte ihm nicht von allein kommen. Dieses Angebot wurde ihm von einem großen jungen Mann unterbreitet, der von Natur aus nicht schüchtern gewesen sein dürfte, denn er zeigte keine Angst vor der Wut, die ein solch kühnes Angebot sofort in dem jähzornigen alten Mann auslöste. Raymond Ozoux zuckte bedächtig mit seinen Schultern, die einen Sportler neidisch gemacht hätten, und beschloss, seinen Onkel allein auf dem Schiff zurückzulassen. Er selbst hatte es derart eilig, dass er ohne zu zögern in eine Barke sprang, die auf seinen Befehl hin sofort zum Ufer ruderte.
Mit klopfendem Herzen sah Raymond das fabelhafte Land auf sich zukommen, das El Dorado seiner jungen Ambitionen, das Land des Goldes und der Legenden, das Peru von Pizarro3 und den Inkas! Und noch viel mehr für ihn, Raymond Ozoux, dessen Herz aufgeregt pochte.
Er ließ sich von der eintönigen Erscheinung des Ufers nicht desillusionieren. Es war ihm egal, dass die Stadt ohne Schönheit war und völlig flach auf Meereshöhe lag und dass sie beinah nicht über die Wellenkämme hinausragte. Türme, Glockentürme und Minarette, mit denen alte Städte den Reisenden von fern Willkommensgesten machten, all das fehlte hier. Sobald Raymond die Mole passiert hatte, interessierte er sich überhaupt nicht mehr für die modernen Bauten der Docks, die einen jungen Ingenieur, der gerade seinen Abschluss an der ›Centrale‹4 gemacht hatte, hätten anziehen können. Nichts davon schien ihn zu beschäftigen.
Auf seine Bitte hin hatte der Bootsmann ihm ungefähr die Stelle in der Stadt gezeigt, an der sich die Calle de Lima befand, und der Blick des jungen Mannes hatte sich nicht von dort abgewendet. Als er von Bord ging, nachdem er seinem Mann ein paar Centavos zugeworfen hatte, wehrte er konsequent den Ansturm von Führern, Dolmetschern, Hotelsuchern und Parasiten ab und schlug die angegebene Richtung ein. Bald erreichte er die Calle de Lima, welche die Grenze zwischen der Altstadt und den neueren Vierteln zu bilden schien. Oben, im Osten, gruppierte sich der Hochhandel mit seinen riesigen Gebäuden, seinen breiten und geraden Straßen, seinen französischen, englischen, deutschen, italienischen und spanischen Geschäften, die ohne Unterbrechung aneinanderschlossen. Unten hingegen herrschte das ganze Gewirr enger und bunter Straßen vor; die Kolonnaden, die Veranden rückten aufeinander zu und nahmen fast den gesamten verfügbaren Raum ein. Raymond hatte dieses Labyrinth betreten, bedrängt von Chinesen, flinken Trägern schwerer Lasten und von faulen Indianern. Ein paar Ranchos, ein paar Matrosenkabaretts öffneten ihre Türen zum kühlen Schatten dieses Viertels, das der junge Mann, der noch nie in Callao gewesen war, offenbar bestens zu kennen schien. An einer etwas komplizierten Kreuzung zögerte er kaum. Doch plötzlich blieb er abrupt stehen und lehnte sich, ein wenig blass, an die heruntergekommene Wand einer alten Hütte, deren halboffene Veranda eine weibliche Stimme zu ihm drängen ließ, jung, sehr musikalisch, aber auch sehr selbstbewusst, die gerade einem unsichtbaren Gesprächspartner auf Spanisch erklärte: »Schon, mein lieber Monsieur, es ist, wie Sie wünschen, aber zu diesem Preis können Sie nur Phosphatguano haben, der nur vier Prozent Stickstoff enthält! Und selbst dann …«
Die Diskussion im Inneren des Gebäudes dauerte noch ein paar Minuten, dann kam es zu einem Austausch von Höflichkeiten. Man vernahm, wie sich eine Tür schloss. Und Raymond, immer bewegter, machte ein paar Schritte in Richtung Veranda und spähte mit dem Kopf hinein. Da sah er eine junge Frau von einzigartiger Schönheit, aber mit einer gewissen Strenge in ihren Zügen. Zumindest, was die Beschäftigung anging, die im Moment ihre ganze Aufmerksamkeit fesselte und die darin bestand, große Kassenbücher durchzusehen und schnell Zahlen auf einem niedlichen Notizbuch zu notieren, das mit einer Kette an der schönsten Taille der Welt befestigt war. Nun, diese Beschäftigung, so vermuten wir, musste etwas mit dem Stirnrunzeln, der Betonung der Stirnlinie und der momentanen Härte des Profils zu tun haben. Abgesehen von ihrem bewundernswerten schwarzen Haar war an dieser Frau nichts von einer kreolischen Trägheit oder einer spanischen Schönheit zu erkennen. Aber was vorhanden war, das war der Helm einer Carmen5 auf dem Kopf einer Minerva, jener Minerva mit den blauen Augen, der Göttin der Weisheit und hervorragende Buchhalterin. Schließlich hob sie den Kopf.
»Marie-Thérèse!«
»Raymond!«
Sie ließ eine große grüne Kasse krachend zu ihren Füßen fallen und rannte zum Fenster. Schon hielt Raymond ihre Hände, um sie mit Küssen zu bedecken. Und sie lachte, sie lachte, lachte über das Glück, ihn zu sehen, so groß, so gutaussehend, so stark, mit seinem wunderschönen blonden Bart, der ihn wie einen goldenen Magier aus Assyrien6 aussehen ließ.
»Wie läuft das Guanogeschäft?«
»Nicht schlecht. Und wie geht es euch? Wir haben euch erst morgen erwartet.«
»Wir haben eine Etappe übersprungen.«
»Wie geht es meiner kleinen Jeanne?
»Oh! Meine Schwester ist erwachsen, sie bekommt ihr zweites Kind.«
»Und Paris?«
»Nun, als wir es das letzte Mal sahen, regnete es!«
»Und das Bistro7 Sacré-Coeur?«
»Wir waren nicht mehr dort, wie Sie sich vorstellen können, seit Sie …«
»Es scheint, dass die Besitzer es verkaufen werden?«
»Leider! Warum bin ich nicht reich genug, um es selbst zu erstehen! Wenn man mir bloß erlauben würde, den Salon zu behalten! Die kleine Ecke, in der wir saßen und auf Sie warteten, Jeanne und ich!«
»Ich erinnere mich gern an diese Zeit! Und Ihr Onkel, was haben Sie mit ihm gemacht?«
»Er ist immer noch an Bord! Will seine Sammlung nicht verlassen! Macht sich weiterhin Notizen mit dem Eifer eines Akademikers, der Amerika entdeckt. Aber wo ist die Tür, mein Gott, wo ist die Tür? Ich wage es nicht, durch das Fenster in Ihre Büros einzutreten. Und darüber hinaus störe ich Sie mit Ihren Konten.«
»Ja, Sie stören enorm! Biegen Sie um die Straßenecke, die erste Tür rechts. Und klopfen Sie, bevor Sie eintreten!«
Er stürmte vorwärts und fand einen Bogen zu seiner Rechten, der zu einem riesigen Hof führte, in dem eine ganze Schar chinesischer Kulis und Quichua8-Indianer in einer gewissen Aufregung umherwuselten. Lastwagen, die vom Hafen kamen, fuhren mit lautem Schrottgeräusch unter dem Bogen hindurch; andere Wagen verließen leer den Hof. Es herrschte ein großer Aufruhr von Dingen und Menschen im alles erstickenden Staub.
Begeistert murmelte der Ingenieur: »Sie ist diejenige, die für all das verantwortlich ist!« Und dann fand er sie auf der Schwelle ihres Büros, wo sie ihn mit glücklichem Lächeln erwartete.
Sie war es, die die Tür schloss, und sie legte ihre Stirn in Falten.
»Küssen Sie mich!«
Zitternd küsste er ihr Haar. Es war das erste Mal. Sie war viel weniger beunruhigt als er. Und als er dort stehen blieb und mit baumelnden Armen dastand und sie verzückt ansah, wie ein großer Idiot, der kein Wort mehr herausbringen konnte, war es wieder sie, die sagte: »Lieben wir einander?«
»Ah!«, sagte er und schloss seine Boxerhände ineinander.
»Nun gut, aber warum haben Sie das nicht früher gesagt?«
»Ist es etwa zu spät dafür?«, rief der arme Raymond verzweifelt.
»Nein, dessen können Sie sich gewiss sein, mein lieber Raymond. Ich habe gerade meinen vierten Verehrer abgewiesen, Don Alonso de Cuelar, aus der edelsten Partei Limas. Mein Vater ist fuchsteufelswild. Fragen Sie ihn also nicht nach Neuigkeiten!«
»Oh! Ich bitte um Verzeihung! Ja, ja, Neuigkeiten von Ihrem Papa und den kleinen … Ich weiß es nicht! … Ich weiß gar nichts mehr! … Ich bin hier, um Sie anzuschauen! … Ich bin dumm!«
»Sonst geht es ihm sehr gut, meinem lieben Papa. Er freut sich über Ihre Ankunft, besonders über die Ihres Onkels, denn Sie, mein armer Raymond, kommen nur als Bonus. Ja, er freut sich, einem Mitglied des Institut de France Gastfreundschaft zu gewähren. Einen ganzen Monat lang hat er in seinem Bekanntenkreis und vor der Geografischen Gesellschaft nur noch über dieses Ereignis gesprochen. Er wurde übrigens zu deren Sekretär ernannt. O ja, er ist beschäftigt, mein Vater! Er ist mit Archäologie beschäftigt! Er gräbt überall den Erdboden um, um die Knochen unserer Vorfahren zu finden. Er hat Spaß! Er amüsiert uns! Er war noch nie so jung und so fröhlich! Wenn Sie ihn erst besser kennen, werden Sie ihn lieben!«
»Aber momentan, sagten Sie, sei er wütend?«
»Ja, da ist was dran. Denn bin ich nicht alt genug zum Heiraten? 23 Jahre bald! Ja, Monsieur! Und hier scharwenzeln vier junge, hübsche und reiche Herren um mich herum, die er mir präsentiert und die ich zu seinem Verdruss ablehne! Wissen Sie, wie man mich in Lima nennt? Die Jungfrau der Sonne.«
»Was bedeutet das?«
»Meine liebe Tante Agnès und die alte Irène, die alle Sagen dieses Landes auswendig kennen, werden Ihnen das besser erklären als ich. Es scheint, als ob es sich dabei um etwas wie die Vestalin9 der Antike handelt.«
»Marie-Thérèse, Ihr edler Vater, der Marquis Cristóbal10 de la Torre, wird Monsieur Raymond Ozoux niemals als seinen Schwiegersohn akzeptieren.«
»Reden Sie doch keinen Unsinn! Mein Vater wird tun, was ich will. Überlassen Sie es mir, den Moment zu wählen, um ihn darauf vorzubereiten. Das ist alles, was ich von Ihnen verlange, mein Freund, und machen Sie sich keine Gedanken. Es wird keinerlei Probleme geben und in drei Monaten werden wir ganz prosaisch in San Domingo heiraten, sage ich Ihnen.«
»Aber ich habe keinen einzigen Sou!«
»Sie sind bei guter Gesundheit, wir lieben uns und ich schenke Ihnen Peru! Es gibt hier viel zu tun, wissen Sie, für einen Ingenieur! Sie werden sehen, ich habe mir schon Gedanken über Ihre zukünftige Arbeit gemacht. Wir werden zusammen nach Cuzco reisen.«
»Marie-Thérèse! Oh, Marie-Thérèse, wie ich Sie liebe und wie glücklich ich bin, es Ihnen zu sagen! Warum haben wir uns in Paris nichts davon gesagt?«
»Weil wir es schlicht nicht wussten. Man lebt Seite an Seite, man sieht sich fast jeden Tag. Wir denken, wir seien Freunde, gute Kameraden. Und dann trennt man sich. Schließlich lehren einen die Distanz und die Abwesenheit, dass man sich liebt.«
»Oh, ich wusste es schon, Marie-Thérèse, schon damals.«
»Ja, aber ich war es, die Sie darauf gebracht hat!«
Sie hielten einander an den Händen und verharrten so ein paar Augenblicke schweigend.
Plötzlich war ein lauter Tumult aus dem Hof zu hören, und fast sofort öffnete sich die Tür, aufgestoßen von einem der Angestellten, der verzweifelt schien. Als er jedoch den Fremden erblickte, blieb er stehen und sagte kein Wort. Marie-Thérèse befahl ihm zu sprechen. Raymond verstand ihn perfekt, denn er sprach Spanisch, und so erfuhr er von dem Unglück, das dem Volk widerfahren war: »Die Indianer kamen von den Inseln. Es gab einen Kampf zwischen den Indianern und den Chinesen. Ein Kuli kam dabei ums Leben, drei wurden schwer verletzt.«
Marie-Thérèse zeigte keinerlei Regung. Sie fragte in trockenem und rauem Ton: »Wo genau ist das passiert? Auf den nördlichen Inseln?«
»Nein, auf Chincha.«
»Also war Huascar nicht bei ihnen?«
»Doch, Huascar war da! Er kam mit ihnen zurück. Er ist hier.«
»So lass ihn reinkommen!«
Der Indianer Huascar betritt die Szene
Der Diener ging hinaus und machte ein Zeichen, worauf ein prächtiger Indianer das Büro betrat. So ruhig Marie-Thérèse auch wirken wollte, dieser hier war noch kaltblütiger als sie. Das junge Mädchen setzte sich an ihren Schreibtisch. Der Indianer ging ruhig auf sie zu und nahm mit einer edlen Geste seinen riesigen Strohhut ab. Er war ein Indianer aus Trujillo, also aus dem Land, wo sie am schönsten, am größten und am stärksten sind und wo sie alle behaupten, von Manco Cápac11 selbst abzustammen, dem ersten König der Inkas. Sein wunderschönes schwarzes Haar fiel ihm bis zu den Schultern und umrahmte ein rotkupferfarbenes Medaillenprofil. Sein Blick, der Marie-Thérèse fixierte, hatte eine seltsame Sanftheit, die Raymond sofort missfiel. Der Mann war in eine Art bunten Umhang gehüllt, den man Poncho nannte. Er trug ein Messer in der Scheide am Gürtel.
»Erzähl mir, was passiert ist«, sagte Marie-Thérèse streng, ohne auf die Begrüßung des Indianers zu antworten.
Letzterer zeigte bei dieser Begrüßung vor einem Fremden trotz seiner Gelassenheit einige Emotionen und begann, in der Quichua-Sprache zu sprechen. Aber sofort bat ihn das junge Mädchen, spanisch zu sprechen, und machte ihm in immer trockenerem Tonfall klar, dass man in guter Gesellschaft vor Dritten nicht eine Sprache sprechen sollte, die man nicht verstand. Während dieser Belehrungen runzelte der andere die Stirn und betrachtete Raymond einen Moment lang mit verächtlichem Hochmut.
»Ich warte!«, erwiderte Marie-Thérèse. »Deine Indianer haben mir einen Chinesen ermordet!«
»Der schändliche Sohn des Westens hatte gelacht, weil unsere Indianer zu Ehren des Viertelmondes ›Cohetes‹ losgelassen hatten.«
»Ich bezahle deine Indianer nicht dafür, dass sie ihre Zeit damit verplempern, Feuerwerkskörper anzuzünden!«
»Es war das edle Fest des Viertelmondes.«
»Ja, des Viertelmondes. Und dann gibt es noch den Halbmond und den Vollmond und die Sonne! Und die Sterne! Begleitet noch von allen katholischen Feiertagen! Deine Indianer hören nie auf zu feiern. Faule und Trunkenbolde, ich habe sie nur geduldet, weil sie deine Freunde waren, aber jetzt, wo sie meine nützlichsten Diener töten, was willst du, dass ich mit ihnen mache?«
»Die schändlichen Söhne des Westens sind nicht deine Diener. Sie mögen dich nicht!«
»Sie arbeiten.«
»Sie haben keine Würde! Sie sind Hundesöhne!«
»Sie tun mir einen Gefallen und ich beschäftige mich nur aus Mitleid mit Ihnen.«
»Mitleid!«
Der Indianer wiederholte das Wort, als würde er es ausspucken. Seine Faust, die den Poncho anhob, richtete sich in einer Geste der Drohung und Verzweiflung über seinen Kopf, und dann senkte er den Arm. Er ging zur Tür, aber bevor er sie öffnete, drehte er sich um. Und von dort richtete er ein paar kurze Sätze auf Quichua-Indianisch an Marie-Thérèse. Während er sprach, schienen seine Augen Flammen zu schießen. Schließlich warf er seinen Poncho über seine Schulter und ging hinaus.
Das junge Mädchen hatte nicht aufgehört, mechanisch mit ihrem Bleistift zu spielen.
»Gute Reise!«, meinte sie.
»Was hat er Ihnen gesagt?«
»Dass er weggehen würde und dass ich ihn nie wieder sehen würde!«
»Er besitzt ein furchterregendes Aussehen.«
»Diese Allüren, die er hat! Er nervt mich. Er gibt sich seiner Sache hin. Er meint, er habe alles getan, was in seiner Macht lag, um das Unglück zu vermeiden. Aber seine Mannschaft ist unmöglich. Ah! Diese Indianer! Was für ein Ärgernis! Dieser Stolz! Und man hat nichts davon. Ich will nur noch Chinesen anstellen.«
»Das zieht womöglich Probleme nach sich, seien Sie vorsichtig!«
»Was soll ich tun? Ich habe Huascars Indianern Obdach gewährt, wohlwissend, dass ich nicht auf ihre Arbeit zählen konnte. Jetzt töten sie meine Kulis! Sollen sie sich doch anderswo aufhängen lassen!«
»Und Huascar?«
»Er wird tun, was er will. Er wuchs bei uns im Unternehmen auf. Er vergötterte meine Mutter.«
»So muss es ihm wehtun, zu gehen?«
»Ja.«
»Und Sie tun nichts, um ihn zurückzuhalten?»
»Nein! Aber herrje, über all dem vergessen wir noch Ihren Onkel!«
Sie klingelte.
»Das Auto!«, befahl sie dem Diener. »Ah! Gut, und die Indianer?«
»Sie sind mit Huascar weggegangen.«
»Alle?«
»Alle.«
»Ohne Geschrei? Ohne zu murren?«
»Ohne ein Wort zu sagen«
»Sind sie zur Lohnkasse gegangen?«
»Nein, Huascar hatte es ihnen verboten!«
»Und die Kulis von den Inseln?«
»Die haben wir hier noch nicht gesehen.«
»Aber die Verwundeten, die Toten? Was hat man mit ihnen gemacht?«
»Die Chinesen haben sie bereits in ihre Quartiere transportiert.«
»Bewundernswerte Rasse! Jetzt aber schnell, das Auto!«
Sie hatte einen schicken Hut aufgesetzt und hastig ihre Handschuhe angezogen, denn sie war diejenige, die hinter dem Lenkrad saß. Sie fuhren mit hoher Geschwindigkeit hinab zum Kai. Er bewunderte die Geschicklichkeit, mit der sie jedem Hindernis auswich, die Sicherheit, mit der sie die Richtung vorgab, und die Klarheit ihrer kleinsten Bewegungen in einem Viertel voller Überraschungen. Ein livrierter Boy, der auf dem Trittbrett kauerte, zeigte keine Angst davor, dass sie die Mauern abreißen würde.
»Fahren Sie oft Auto in Peru?«
»Natürlich nicht! Es gibt ja fast keine Straßen. Besonders nützlich ist das Auto aber für meine täglichen Fahrten von Callao nach Lima, wohin ich natürlich jeden Abend zurückkomme. Dann ein paar Ausfahrten zum Meer, in Richtung der mondänen Ferienorte Ancón12 oder Corillos. Eine Sekunde, mein lieber Raymond!«
Sie stoppte sanft und winkte anmutig einem kleinen, rosafarbenen, lockigen Kopf zu, der aus einem Fenster zwischen zwei Blumentöpfen lächelte. Sie winkte, und der Kopf verschwand, um kurz darauf wieder auf den Schultern eines galanten alten Mannes in einer prächtigen Uniform zu erscheinen, der aus einer niedrigen Tür kam, wo er halb verdeckt blieb. Marie-Thérèse sprang auf das Pflaster und vertraute dem Lockenkopf kurz ein Geheimnis an, dann setzte sie sich zu Raymond ins Auto, drückte die Hupe und setzte ihren Weg in Richtung Hafen fort.
»Haben Sie den gesehen?«, sagte sie zu ihm. »Das war der Señor Inspector superior, der Polizeichef hier. Ich erzählte ihm von dem Vorfall. Alles wird gut, wenn es keine Beschwerden seitens der Chinesen gibt. Ich bin hier vorbeigekommen, weil ich sicher war, ihn anzutreffen.«
»Wessen Haus war das?«
»Das von Jenny der Hure13. Wir sind im Land der Liebe, mein werter Raymond!«
Sie kamen am Hafen an, und sie kamen nicht zu spät. Der Schlepper fuhr gerade in den Hafen ein und schleppte das Linienschiff der Steam Pacific Navigation Company, wo Onkel François-Gaspard dabei war sich Notizen zu machen: »Wenn man in den Hafen von Callao einläuft, wird man erschlagen von … usw. usw.«
Er korrespondierte mit einer der großen Zeitungen, und er hätte hören sollen, wie Marie-Thérèse enthusiastisch über »ihren Hafen« sprach: »60 Millionen, die ein französisches Unternehmen ausgab. Waren, die direkt vom Deck des Schiffes in die Eisenbahnwaggons gelangten. 51.500 Quadratmeter. Ja, Monsieur, mehr als 50.000 Quadratmeter Hafenbecken! Ah, dieses Darsena-Becken! Wie liebte sie es! Die Wiedergeburt Perus! Santiago besiegt! Chile besiegt! Die Niederlage von 187814 ist gerächt! Und San Francisco15 da oben muss sich jetzt benehmen!«
Raymond hörte erstaunt zu, als sie Zahlen zitierte wie ein Ingenieur und Gewinne berechnete wie ein Reeder. Was für ein tapferes kleines Gehirn, das sich bewundernswert organisierte, um ihm zu gefallen, ihm, der eigentlich die Vorstellungskraft sowohl bei Männern als auch bei Frauen hasste und der darüber hinaus zutiefst angeekelt war von der vagen Literatur seines Onkels und den fantastischen Hypothesen, auf denen dieser weiterhin aufbaute, um dereinst eine Universalgeschichte herauszugeben.
»Das alles wäre sehr schön«, fügte sie stirnrunzelnd hinzu, »wenn wir nicht noch mehr Dummheiten machen würden! Aber jetzt geht der Unsinn von Neuem los.«
»Welcher?«
»Die Revolutionen.«
Sie waren zum Kai hinuntergegangen und warteten darauf, dass das Schiff anlegte.
»Ah! Hier bei Ihnen auch!«, sagte Raymond. »Wir haben eine in Venezuela und eine andere in Guayaquil vorgefunden. Die Stadt wurde belagert. Ich weiß nicht mehr, welcher General, der dort 48 Stunden lang regiert hatte, sich auf den Marsch nach Quito vorbereitete, wo die legale Regierung blockiert war.«
»Ja, es ist wie eine Epidemie«, fuhr das junge Mädchen fort, »eine Epidemie, die derzeit in den Anden grassiert. Auch Bolivien bereitet Sorgen. Wir haben schlechte Nachrichten vom Titicacasee.«
»Du meine Güte! Das wird meine Geschäfte in Cuzco stören«, meinte Raymond, der sofort großes Interesse an dem Ereignis zu haben schien.
»Ja, ich wollte es Ihnen eigentlich nicht sagen. Das habe ich mir für morgen aufgehoben. Heute sollte alles glücklich sein. Aber das Umland von Cuzco ist in den Händen von Garcías16 Unterstützern.«
»Wer ist das, dieser García?«
»Auch einer, der einmal in mich verliebt war.«
»Aber alle waren schon einmal in dich verliebt, meine liebe Marie-Thérèse«
»Wie sehr die mich langweilen. Ah! Als ich aus Paris zurückkam! Verstehen Sie! Aus Paris! Beim ersten Präsidentenball, zu dem ich nach der Trauer meiner Mutter gehen konnte, da haben sie alle mir gegenüber Erklärungen abgegeben. Sie sind unerträglich, wie Kinder! Ein schrecklicher Kerl, dieser García, der gerade die Indianer rund um Ariquipa und Cuzco aufhetzt … Er will unseren Präsidenten ersetzen. Aber Veintemilla17 wird das nicht zulassen.«
»Hat man Truppen gegen ihn losgeschickt?«
»Ja, die beiden Truppen sind da. Aber sie kämpfen natürlich nicht.«
»Worauf warten Sie?«
»Man sagt, auf das große Inti-Raymi-Fest«18
»Was für ein Fest ist das?«
»Das Fest der Sonne bei den Quichuas. Diese Indianer, was für ein Gift! Sie sollten wissen, dass drei Viertel der Präsidenten- und Revolutionstruppen aus indianischen Abteilungen bestehen. Es ist ganz einfach. Also, Freunde und Feinde warten auf den Tag der Feierlichkeiten, um sich dann zusammen zu betrinken. Und es wird erwartet, dass García endlich nach Bolivien geht, aber in der Zwischenzeit wird der Preis für Guano drei Monate lang gesunken sein! Und ich müsste mich für meine Kalkulationen schämen. – Ah, guten Tag, Monsieur Ozoux! Hatten Sie eine gute Überfahrt?«
Sie sprach François-Gaspard an, der in der Nähe sein Notizbuch für sie schwenkte, wie er es sonst mit einem Taschentuch getan hätte. Der Dampfer legte an, und die Gangways wurden festgemacht. Sie stiegen an Bord. Marie-Thérèse umarmte freudig den guten alten Mann, der ihr während ihres Aufenthalts in Paris so väterlich als Fremdenführer gedient hatte. Und die erste Sache, die er wissen wollte, hatte auch schon sein Neffe gefragt: »Wie läuft das Guanogeschäft?«
Die Koketterie der Limanesinnen
Bei der Familie Ozoux hatte man sie so jung, so fröhlich, so unbeschwert, so wie ein kleines Mädchen kennengelernt, und dann musste sie nach dem Tod ihrer Mutter plötzlich den Entschluss fassen, in aller Eile nach Peru zurückzukehren, um eine der wichtigsten Konzessionen eines natürlichen Düngemittels zu verwalten, das immer mehr von diesen kostbaren Inseln verschwindet, die seit Langem den besten Guano der Welt produzieren.
Aber Marie-Thérèse konnte nicht vergessen, dass sie dort eine kleine Schwester und einen kleinen Bruder hatte, Isabella und Cristóbal, und sie kannte ihren Vater, der noch kindlicher war als die drei und der nur wusste, wie man Geld ausgab als großer Herr auf ihren Reisen nach Paris, all das Geld, das die Mutter verdient hatte.
Jene nämlich, Tochter eines Reeders aus Bordeaux, hatte den attraktiven Marquis Cristóbal de la Torre, der der peruanischen Gesandtschaft angehörte, in dem Moment geheiratet, als dieser charmante Adlige das größte Bedürfnis hatte, seinen angekratzten Ruf wiederherzustellen. Die Bekanntschaft entstand während der Badesaison am Meer bei Pontaillac. Im darauffolgenden Winter schiffte sich die Marquise nach Peru ein, wo sie zusätzlich zu ihrer Mitgift einen politischen Geist, geschäftliche Talente und eine ungewöhnliche kommerzielle Intelligenz mitbrachte, die sie zur großen Verzweiflung ihres Mannes dazu veranlasste, diese Guano-Angelegenheit zu übernehmen, während sich andere damit ruinierten, nach Gold zu suchen in einem Land, das zwar davon mehr aufwies als jede andere Nation, dem es aber damals an jeglichen Kommunikationsmöglichkeiten mangelte.
Da der Marquis jedoch erkannte, dass er mit beiden Händen aus einem sich ständig füllenden Fonds schöpfen konnte, vergab er seiner Frau, dass sie ihn so reich gemacht hatte, und als sie starb, war er nicht allzu überrascht, in ihrer Tochter die nützlichen Tugenden der Mutter wiederzufinden. Er ließ sie machen, was sie wollte, und war ihr unendlich dankbar, dass sie sich um alle ernsten Angelegenheiten kümmerte.
»Und wo ist er, mein guter Cristóbal?«, fragte Onkel François-Gaspard, während er das Verladen seines Gepäcks überwachte.
»Er erwartet Sie erst morgen. Dann wird es einen Empfang für Sie geben. Einen feierlichen Empfang, Monsieur Ozoux, der in der Geografischen Gesellschaft für Sie vorbereitet wird.«
Nachdem der Koffer mit den Dokumenten am Zollhäuschen sorgfältig registriert worden war, erklärte sich François-Gaspard bereit, in den Wagen einzusteigen, der mit voller Geschwindigkeit den Weg nach Lima nahm. Marie-Thérèse wollte vor dem Abend ankommen, der in diesen Regionen so schnell hereinbrach.
Nachdem sie an der Vorstadt mit ihren Lehmhäusern, die aus in der Sonne gebackenen Ziegeln bestanden, und einigen komfortablen Villen vorbeigekommen waren, passierten sie eine Art Sumpfgebiet, das mit Ginster und Schilf bedeckt war, durchsetzt mit Bananenhainen und Tamarisken in rötlichen Tönen sowie einer Ansammlung von Eukalyptus und Araukarienkiefern. Die Landschaft war von der Sonne versengt, von einer Dürre, die nicht durch den geringsten Regen abgekühlt wurde, was bedeutete, dass der Campo, der Lima und Callao umgab, nur wenig bezaubernd war. Etwas weiter sahen sie Hütten aus Bambus und Maisblättern.
Diese in diesem Teil Perus weit verbreitete Dürre hätte der Region das Aussehen einer unglaublichen Trostlosigkeit verliehen, wenn nicht von Zeit zu Zeit eine Hacienda aufgetaucht wäre, ein Bauernhof, umgeben von einer grünen Oase mit Zuckerrohrplantagen, Mais und Reisfeldern. Auf den tiefen Lehmwegen, die die Orte verbanden, glitten Konvois von Ochsen, Karren und Herden vorbei, die Hirten zu Pferd zur Farm zurückbrachten, und diese Lebendigkeit bildete einen unerwarteten Kontrast zur umgebenden Trockenheit. Onkel François-Gaspard machte sich trotz der Unebenheiten einer schlecht ausgebauten Straße Notizen. Ja, er machte sich tatsächlich Notizen! Bald erkannten sie an den Ausläufern der Kordilleren die Glockentürme und Kuppeln, die Lima wie eine muslimische Stadt aussehen ließen.
Sie kamen dort am Rimac an, einem Bach, über den sich schwarze Flusskrebsfischer beugten und einen großen Sack am Gürtel hinter sich herzogen, den sie ins Wasser tauchten, mit der Absicht, die Opfer am Leben zu halten. Raymond war begeistert: Er liebte Krebse. Als er Marie-Thérèse seine Völlerei gestand, fiel ihm der besorgte Blick des jungen Mädchens auf und er fragte sie nach dem Grund.
»Eine außergewöhnliche Sache«, sagte sie. »Wir sehen keine Indianer hier.«
Doch als sie in Lima ankamen, erreichten sie die berühmte Ciudad de los Reyes, die vom Konquistador gegründete Stadt der Könige. Marie-Thérèse, die Lima in seiner ursprünglichsten Form liebte, hatte die Koketterie, das Auto einen Umweg machen zu lassen, auch wenn das bedeutete, dass die Reifen auf den scharfen Kieselsteinen, die für ein großes Pflaster im Bett des Rimac gesammelt wurden, platt wurden. Und sie befanden sich sofort in einer sehr malerischen Ecke. Die Häuser verschwanden unter den an den Wänden befestigten Holzgalerien. Diese Galerien wirkten wie echte verzierte Kästen, geschmückt mit Netzen und Arabesken, sie waren wie kleine schwebende Räume und boten ein geheimnisvolles und kokettes Aussehen, das an türkische Moucharabis erinnerte. Nur war es dort, in ihrer Dunkelheit, nicht selten, die schönsten Gesichter der Welt zu sehen, entzückende Frauengesichter, die sich in keiner Weise versteckten. Die Limanesin ist für ihre Schönheit und Koketterie bekannt. In diese Viertel gingen sie hinaus, gehüllt in die Manta, diesen großen schwarzen Schal, der Kopf und Schultern umhüllt und den keine andere südamerikanische Frau so anmutig zu drapieren weiß. Ähnlich wie der maurische Haik zeigt die Manta nur zwei große schwarze Augen im Gesicht. Wenn sich dieser Unterschlupf manchmal ein wenig öffnete, konnte Raymond harmonische Gesichtszüge und einen matten Teint bewundern, der durch den geheimnisvollen Schatten, an dem er sich erfreute, weißer wurde. Der junge Mann verbarg seine Verzauberung nicht, was ihm eine Schelte von Marie-Thérèse einbrachte.
»Auf jeden Fall sind sie unter ihrer Manta so hübsch!«, sagte sie. »Ich werde euch auch ein paar Europäerinnen zeigen!« Und sie machte eine halbe Lenkradumdrehung, die sie zurück in die neuen Viertel führte, zu den breiten Straßen, zu den Spaziergängen, von denen aus man das herrliche Panorama des umliegenden Campo und der nahegelegenen Anden entdeckt. Sie überquerten den Paseo Amancaes, benannt nach der goldenen Blume, und dort hörte Marie-Thérèse nicht auf, Grüße zu erwidern. Sie befanden sich mitten im Adelsviertel. Dort wurde der schwarze Schleier der Limanesinnen wie in Paris durch Schminke ersetzt, denn die allzu dezente Maske der Mantas ist abends jeder vornehmen Frau verboten. Es war Zeit für den Spaziergang. An einer Eisdiele verweilten sie, um Helados zu essen und über Liebe, Lumpen und Politik zu plaudern. Sie kamen an der Plaza Mayor an, als die ersten Sterne am Horizont aufgingen. Es herrschte Gedränge, und die Autos fuhren langsam. Frauen, gekleidet wie für einen Ball, barhäuptig, mit einer Blume im Haar, wurden in Kutschen gezogen. Junge Leute, die sich in der Nähe eines Brunnens in der Mitte des Platzes versammelt hatten, lächelten und nickten einander zu.
»Das ist außergewöhnlich! Immer noch keine Indianer«, murmelte Marie-Thérèse.
»Sie kommen in diese Viertel?«
»Na ja, es gibt immer Leute, die kommen, um die Parade auf der Plaza Mayor zu sehen.«
Vor einem Café stand eine kleine Gruppe von Menschen gemischter Abstammung und betete. Die Namen von García und Veintemilla, dem Präsidenten der Republik, wurden mit mehr oder weniger freundlichen Kommentaren von einem zum anderen weitergegeben. Ein Händler stöhnte über die Angst, die er hatte, dass die Ära der Pronunciamientos19 wieder angebrochen sei.
Das Auto bog um die Ecke der Kathedrale und gelangte bald darauf in eine ziemlich enge Straße. Als Marie-Thérèse sah, dass der Weg frei war, erhöhte sie ihr Tempo ein wenig, blieb aber plötzlich stehen, ohne es vermeiden zu können, leicht auszuweichen. Sie hätte fast einen Mann zerquetscht, der jetzt regungslos und stolz in seinen Poncho gehüllt mitten in der Gasse stand. Sie erkannten den Indianer wieder.
»Huascar!«, rief sie wütend aus.
»Huascar bittet Sie,20 diesen Weg nicht zu gehen, Señorita.«
»Der Weg ist für alle da, Huascar! Tritt beiseite!«
»Huascar hat der Señorita nichts mehr zu sagen. Das Auto wird Huascar überfahren müssen!«
Raymond wollte eingreifen, aber Marie-Thérèse hielt ihn mit einer Geste zurück.
»Hör zu, Huascar, dein Verhalten ist ungebührlich«, sagte das junge Mädchen. »Kannst du mir sagen, warum wir in der Stadt keinen Indianer mehr zu Gesicht bekommen?«
»Die Brüder von Huascar tun, was sie wollen. Sie sind freie Männer!«
Sie zuckte mit den Schultern, schien nachzudenken, dann gab sie dem Bitten des Indianers nach und bereitete sich darauf vor, einen anderen Weg einzuschlagen. Kurz bevor sie losfahren wollte, drehte sie sich um und sagte nachdenklich zu dem Mann, der sich nicht bewegt hatte: »Bist du immer noch mein Freund, Huascar?«
Bei diesen Worten öffnete sich der Indianer etwas und hob den Blick zu den ersten Sternen, als wollte er dem Himmel bezeugen, dass Marie-Thérèse keinen größeren Freund auf Erden hatte als Huascar. Das war seine einzige Antwort. Das junge Mädchen rief ihm ein kurzes »Adios!« zu, und das Auto fuhr davon.
Sie blieb vor einem prächtigen Hotel stehen, dessen Concierge Marie-Thérèse entgegeneilte. Aber jemand anders war sogar noch schneller als er. Es war der Marquis Cristóbal de la Torre, dessen Kutsche ebenfalls gerade angekommen war. Er stieß wahre Freudenschreie aus, als er die Reisenden sah, die er erst für den nächsten Tag erwartet hatte. Er begrüßte François-Gaspard mit großspurigen Worten und zeigte ihm die Tür seines Hauses: »Steigen Sie aus, Señor, und ruhen Sie sich hier aus. Fühlen Sie sich wie zu Hause!«
Der Marquis war ein kleiner Mann von übertriebener Eleganz. Er war wie ein junger Mann gekleidet und verlor keinen Zentimeter seiner Größe, die er durch das Tragen von hochhackigen Stiefeln vorzutäuschen versuchte. Er war lebendig, bewegend, funkelnd. Wenn er sich bewegte, und es kam selten vor, dass er still blieb, leuchtete alles in ihm, an ihm und um ihn herum: seine Augen, seine schillernde Krawatte, sein Schmuck; und die Umgebung war wie erleuchtet. Diese einzigartige Aufregung hinderte ihn nicht daran, die schönsten Allüren der Welt zu zeigen und sogar in Zeiten, in denen andere, um dies zu erreichen, Ruhe, Distanziertheit und Strenge hätten zeigen müssen, ein großer Herr zu bleiben. Seine größte Freude war das Spielen extravaganter Spiele mit dem kleinen Cristóbal, seinem siebenjährigen Sohn. Sie schienen beide von der Schule geflüchtet zu sein und füllten das Haus mit ihren Purzelbäumen, während die kleine Isabella, die in ihr sechstes Jahr kam und das Zeremonielle liebte, sie pompös und mit den Manieren einer Infantin ausschimpfte.
Das Hotel des Marquis hatte die Besonderheit, halb modern, halb historisch zu sein. Es wies Ecken eines alten Hauses auf, ziemlich seltsam und unerwartet. Cristóbal hatte alte Abschnitte von Holzmauern, mehrere 100 Jahre alte Galerien, Stücke wurmstichiger Treppen, rustikale Möbel aus der Zeit der Eroberung, verzierte Wandteppiche, kurz alle Trümmer, die er in den verschiedenen Städten Perus gesammelt hatte, dorthin transportiert, wo seine Vorfahren gelebt hatten, und natürlich gab es zu jedem Objekt eine Anekdote, der der freiwillige Besucher nie entging. In dieser historischen Ecke wurden Onkel François-Gaspard und sein Neffe Raymond zwei alten Damen vorgestellt, die offenbar aus einem Gemälde von Velázquez21 gefallen waren und größte Schwierigkeiten hatten, aufzustehen. Tante Agnès und ihre alte Duenna22 Irène waren nach einer längst entschwundenen Mode gekleidet und schienen auch mit allen Antiquitäten ins Hotel gebracht worden zu sein. Die meiste Zeit verbrachten sie damit, sich Geschichten zu erzählen, um sich gegenseitig Angst zu machen. Alle Legenden Perus hatten in dieser Ecke Zuflucht gesucht, wo am Abend nach dem Abendessen die beiden Cristóbal – Vater und Sohn – sowie die kleine Infantin Isabella zitternd dazukamen, um ihnen zuzuhören, während Marie-Thérèse am anderen Ende des Raumes sich unter einer Lampe hingesetzt hatte, um ihre Korrespondenz mit den Guano-Lagerleuten auf den neuesten Stand zu bringen.
François-Gaspard verspürte eine unverfälschte Freude, als er diese alten Bilder von Neuspanien wieder lebendig fand, in einer Umgebung, in der er bereits das Gefühl hatte, seine gefährliche Fantasie entfaltet zu haben. Er war sofort der Freund der beiden Damen, nahm sich kaum die Zeit, sich umzuziehen, kam sofort zurück, um sie zu finden, und setzte sich beim Abendessen an den Tisch zwischen die beiden. Sie begannen bereits mit ihren Erzählungen, als Marie-Thérèse es für nötig hielt, über ernste Dinge zu sprechen und ihren Vater über den Vorfall mit den Indianern und den Chinesen informierte. Sobald sie erfuhren, dass Marie-Thérèse die Indianer vertrieben hatte, machte Agnès Vorbehalte und Irène beklagte sich. Sie behaupteten, das junge Mädchen habe sich am Vorabend der Inti-Raymi-Feierlichkeiten äußerst unvorsichtig verhalten.
Der Marquis stimmte ihnen zu. Und als er erfuhr, dass auch Huascar gegangen war, fuhr er auf. Huascar war dem Haus immer sehr ergeben gewesen. Was konnte bloß passiert sein, dass er es so plötzlich verließ?
Marie-Thérèse erklärte kurz, dass sie seit einiger Zeit mit Huascars Manieren unzufrieden gewesen sei und dass sie ihm dies klargemacht habe.
»Es muss etwas anderes sein«, meinte der Marquis. »Ich bin ganz und gar nicht zufrieden. Ich finde die Indianer nicht mehr in ihrer gewohnten Gleichgültigkeit. Da liegt etwas in der Luft, etwas um uns herum. Neulich hörte ich auf der Plaza Mayor, wie Mestizen seltsame Bemerkungen mit bestimmten Quichua-Häuptlingen austauschten.«
Die Sonnenfeier rückt näher
»Wie kommt es«, fragte Raymond, »dass wir seit Callao keine Indianer mehr getroffen haben und ich in der Stadt keinen einzigen gesehen habe?«
»Immer aus demselben Grund, Monsieur«, sagte die alte Agnès, »weil wir uns dem Fest nähern. Sie haben geheime Treffen. Sie verschwinden im Berg oder einfach in irgendwelchen Löchern, die nur sie kennen – in echten Katakomben wie die ersten Christen. Es bedarf nur eines Befehls aus wer weiß welcher verlorenen Ecke der Anden, um sie wie Schatten verschwinden und dann wie einen Heuschreckenschwarm wieder auftauchen zu lassen.«
»Meine Schwester übertreibt«, unterbrach der Marquis lächelnd, »und unter uns: Sie sind nicht allzu gefährlich.«
»Und dennoch bereitet Ihnen das Sorgen, Cristóbal, Sie haben es selbst gesagt!«
»Oh, ich glaube, dass sie durchaus in der Lage sind, sich auf unerwartete Manifestationen einzulassen.«
»Haben sie jemals rebelliert?«, fragte François-Gaspard. »Ich dachte, sie wären so dumm.«
»Das sind nicht alle. Ja, wir hatten ein paar Revolten, aber es war nie sehr ernst.«
»Sind sie zahlreich?«, fragte Raymond.
»Sie machen zwei Drittel der Bevölkerung aus«, antwortete Marie-Thérèse. »Aber unter uns gesagt, sind sie nicht dazu in der Lage, sich ernsthaft für etwas zu erheben, was über die Arbeit hinausgeht. Es war Garcías Abenteuer, das sie ein wenig aufwühlte. Wir haben zu lang geschwiegen. Was sagt der Präsident?«, fragte das junge Mädchen ihren Vater.
»Der Präsident ist darüber nicht allzu besorgt, es scheint, dass diese Aufregung alle zehn Jahre einmal auftritt.«
»Warum alle zehn Jahre?«, wollte Onkel Gaspard wissen, der sein Notizbuch hervorgeholt hatte.
»Weil es alle zehn Jahre bei den Quichua-Indianern ein größeres Sonnenfest gibt«, antwortete die alte Irène kopfschüttelnd.
»Und wo findet diese Feier statt?«, fragte Raymond.
»Nun, das können wir nicht genau sagen«, erklärte Tante Agnès mit leiser Stimme, als wollte sie ihren Zuhörern ein großes Geheimnis anvertrauen. »Es scheint, dass bei diesem Fest viele Opfer dargebracht werden. Die Asche der Toten wird in die Ströme gestreut, die auf ihren Wegen alle Sünden der Nation forttragen.«
»Bewundernswert!«, rief François-Gaspard. »Ich würde wirklich gern an dieser Feierlichkeit teilnehmen.«
»Seien Sie doch still, Monsieur!«, stöhnte die Tante und senkte ihren Kopf über ihren Teller. »Es gibt Menschenopfer bei diesem Dezennium des Sonnenfests!«
»Menschenopfer?«
»Hören Sie, was meine Tante spricht?«, sagte Marie-Thérèse lachend.
»Aber gewiss«, bestätigte der Onkel. »Wieso sollten wir dies nicht glauben? Bei den Sonnenfesten der Inkas waren diese Opfer üblich und meine Notizen und Dokumente, die Werke von Prescott23 und alles, was über Peru geschrieben wurde, bezeugen uns, dass die Quichua-Indianer, so wie sie die Sprache vergangener Zeiten bewahrt haben, auch die damaligen Sitten und Bräuche hochleben lassen.«
»Sie sind seit der spanischen Eroberung Katholiken geworden«, erwiderte Raymond.
»Oh, das! Ich gebe zu, das stört sie überhaupt nicht«, fuhr der Marquis fort. »Sie haben halt einfach zwei Religionen statt einer und sie vermischen deren Riten mit überraschender Unwissenheit.«
»Aber, was wollen sie denn überhaupt? Eine Rückkehr zur Regierung der Inkas?«
»Ob sie überhaupt wissen, was sie wollen?«, erwiderte Marie-Thérèse. »Vor der spanischen Eroberung waren unter der Regierung der Inkas alle – Männer, Frauen und Kinder – verpflichtet, entsprechend ihrer Kräfte und Fähigkeiten zu arbeiten. Seit er nicht mehr von der eisernen Disziplin der Sonnensöhne versklavt oder unterdrückt wird, hat der Indianer seine Freiheit nur noch dazu genutzt, sich der unbeschwertesten Faulheit hinzugeben. In diesem Zustand lassen ihn das Elend und die materielle Knechtschaft an den Wohlstand vergangener Zeiten erinnern und hinterhältig die Rückkehr der Herrschaft der Söhne von Manco Cápac fordern! Dies ist zumindest das, was ich aus Huascars Erklärungen zu verstehen glaubte. Worauf ich ihm antwortete, dass seine Brüder nicht glücklicher sein würden, wenn diese Zeiten wiederkämen, da sie die Arbeitsgewohnheit verloren hätten. Was mich betrifft, bin ich sehr froh, die Huascar-Bande losgeworden zu sein! Es hat mich zwar einen Chinesen gekostet, aber das war nicht allzu teuer.«
»Und stimmt es nun, dass es immer noch Menschenopfer gibt?«, insistierte Raymond.
»Aber nein, was für Geschichten!«, sagte Marie-Thérèse.
Tante Agnès und die alte Irène richteten sich an François-Gaspard.
»Marie-Thérèse weiß davon nichts. Sie ist in Paris aufgewachsen. Sie kann es nicht wissen. Lieber Monsieur Ozoux, hören Sie uns zu! Da gibt es nichts zu lachen. Es ist falsch, so zu lachen! Weil wir absolut sicher sind, hören Sie, absolut sicher – wir haben genug Beweise dafür, bei Gott! –, dass die Quichua-Indianer alle zehn Jahre, was bei den Inkas die größte Zeitspanne war, der Sonne eine Braut anbieten.«
»Was soll das heißen, sie bieten der Sonne eine Braut an?«, fragte der Onkel atemlos.
»Das ist doch klar, lieber Monsieur Ozoux. Sie opfern ihr heimlich eine junge Frau in Tempeln, die aus dieser Zeit stammen und in die wir Fremde nie eingetreten sind. Dies ist schrecklich, aber es ist gewiss!«
»Sie opfern eine junge Frau? Sie bringen sie um?«
»Aber ja doch! Sie töten sie. Sie töten sie, weil es für die Sonne ist.«
»Auf welche Art töten sie sie? Verbrennen sie sie?«
»Nein, nein! Es ist weit schrecklicher, Monsieur Ozoux, ja, noch schrecklicher. Der Scheiterhaufen war für viel weniger wichtige Zeremonien bestimmt! Aber in der Zehn-Jahres-Zeremonie des Inti Raymi muss es eine feindliche Jungfrau sein, die schönste, die sie finden können, und die edelste der feindlichen Rasse, die sie ihrer Sonne anbieten, und sie mauern sie lebendig im Tempel ihrer Sonne ein. Ja, lieber Monsieur Ozoux, es ist so, wie wir es Ihnen sagen.«
Marie-Thérèse konnte ihr Lachen über François-Gaspards Verwirrung nicht länger zurückhalten, die ihm das Aussehen eines verärgerten, in seinem Vergnügen gestörten Kind verlieh. Er glaubte immer noch, dass er die alten Frauen verteidigen musste. Alles, was sie sagten, stimmte jedenfalls vollkommen mit dem überein, was man über die Jungfrauen der Sonne wusste. Und er fand den Moment günstig, um seine Gelehrsamkeit unter Beweis zu stellen. Menschenopfer nämlich hatten bei den Inkas schon immer einen hohen Stellenwert. Manchmal wurden die Opfer dem Gott des jeweiligen Tages geopfert, manchmal dem König selbst – und oft waren diese Opfer Freiwillige.
Dies geschah während der königlichen Beerdigungszeremonie, bei der überall Blut und Tränen flossen. Unter den Frauen der Inkas gab es also jene, die sich selbst opferten.
»Prescott«, sagte Onkel François-Gaspard, »der zusammen mit Wiener24 derjenige ist, der das schönste Werk über das Reich der Inkas und die Eroberung Perus durch die Spanier geschaffen hat, dieser Prescott also erzählt uns, wobei er sich auf die vertrauenswürdigsten Zeugnisse beruft, dass mehr als 1.000 Diener, Ehefrauen und Mägde auf dem Grab des Monarchen geopfert wurden. Und es waren die rechtmäßigen Ehefrauen, die mit gutem Beispiel vorangingen, indem sie sich selbst kasteiten.«
»Ah! Verrückte Leute! Wirklich, Verrückte!«, rief Tante Agnès und faltete die Hände.
Die alte Irène bekreuzigte sich und murmelte ein Gebet.
Der Marquis übernahm das Wort, um François-Gaspard zu gratulieren.
»Das ist alles richtig, mein lieber Gastgeber«, meinte er, »und unsere Arbeit bei der Gesellschaft für Geografie und Archäologie wird Sie, wie ich sehe, sehr gut informiert vorfinden. Umso besser, wir produzieren nur die beste Arbeit. Wenn Sie möchten, werde ich Sie morgen nach Ihrem Empfang zu meinen letzten Ausgrabungen rund um Ancón mitnehmen, und dort werden Sie sehen können, dass der Inka tatsächlich mit seinen wertvollsten Werkzeugen und seinen Frauen begraben wurde, die ihm in die verzauberten Häuser der Sonne folgen sollten.«
»Was genau war das?, fragte Raymond, »diese ›Jungfrau der Sonne‹?«
»Die Jungfrauen der Sonne«, fuhr François-Gaspard mit kindlicher Freude fort, »oder auch ›die Auserwählten‹, wie sie genannt wurden, waren junge Mädchen, die sich dem Dienst der Gottheit verschrieben hatten und schon im zarten Alter von ihrer Familie getrennt und in Klöstern untergebracht wurden, wo sie unter der Leitung bestimmter älterer Matronen, Mamaconas, untergebracht waren, die innerhalb der Mauern dieser Klöster gealtert waren. Unter diesen ehrwürdigen Führerinnen wurden geweihte Jungfrauen in die Natur ihrer religiösen Pflichten eingewiesen. Sie beschäftigten sich mit Spinnen und Sticken und webten aus der schönen Wolle der Vikunja-Kamele Behänge für die Tempel sowie Stoffe für die Inkas und für ihre Einrichtung.«
»Oh«, sagte die alte Irène und nickte mit dem Kopf, »ihre Aufgabe bestand vor allem darin, über das Heilige Feuer zu wachen, das zum Raymi-Fest entzündet wurde.«
»Ja, ja, ich weiß«, stimmte der Akademiker zu. »Sie lebten völlig isoliert. Von dem Moment an, als sie das Kloster betraten, verzichteten sie auf alle Beziehungen zur Welt, sogar zu ihrer Familie und ihren Freunden. Nur der Inka und die Coya, wie man die Königin nannte, durften das geweihte Gehege betreten. Ihre Moral wurde sorgfältig überwacht und jedes Jahr wurden Besucher geschickt, um die Institutionen zu inspizieren und über den Stand ihrer Disziplin zu berichten.«
»Und wehe der unglücklichen Frau, die von einer Intrige betroffen war!«, rief Tante Irène. »Nach dem strengen Gesetz der Inkas musste sie lebendig begraben werden, und die Stadt oder das Dorf, zu dem sie gehörte, wurde dem Erdboden gleichgemacht und ›mit Steinen besät‹, als wollte man sogar die Erinnerung an ihre Existenz auslöschen.«
»Perfekt!«, stimmte François-Gaspard zu.
»Süßes Land«, meinte Raymond ironisch.
»He, mein Junge, das beweist, dass es bewundernswert zivilisiert war, da man dort sogar in den Zeremonien seiner Tempel die Bräuche des alten Roms findet! Ah! Als Christoph Kolumbus25 das Ufer erreichte, wo er nur schlecht bewaffnete Wilde sah, ahnte er nicht, dass sich hinter diesen Urstämmen auf der anderen Seite des Meeres eine ganze Welt mit eigenen Bräuchen, Denkmälern und ihrer Geschichte befand. Mit eigenen Gesetzen und Eroberungen, zwei Völker: das der Azteken in Mexiko und das der Inkas in Peru, die mit der mediterranen Zivilisation hätten konkurrieren können. Es ist, als ob ein Prinz aus dem Osten die antike Welt entdeckt hätte, indem er die Steppen Skythiens26 berührte. Er hätte in seine Staaten zurückkehren können in dem Glauben, er hätte nur eine Wüste gesehen, und er hätte nicht geahnt, dass dahinter die römische Welt steckte!«
»Trotzdem war Kolumbus ein wenig blockiert«, sagte Raymond schüchtern. »Ein wahrer Eroberer, der seine Eroberung gar nicht sah, stellen Sie sich das einmal vor!«
»Dieser Ruhm war Pizarro und Cortés27 vorbehalten!«, rief der feurige Marquis.
»Ja, sie sind gekommen, um alles zu zerstören …«, begann der Onkel.
Zum Glück hörte ihn Cristóbal nicht und er stoppte rechtzeitig, denn unter dem Tisch war ihm Marie-Thérèse, die ihm gegenübersaß, auf den Fuß getreten. Er verstand und biss sich auf die Lippen. Einer der ersten aus der Familie de la Torre, ein Vorfahr des Marquis nämlich, hatte Pizarro damals bei seiner Zerstörung begleitet.
Die beiden alten Damen hatten ein so unkatholisches Urteil über dieses Unterfangen gehört, das in ihren Augen vor allem ein Vorgehen der wahren Religion gegen die Ungläubigen gewesen war, dass sie etwas beunruhigt darüber waren. Aber Marie-Thérèse sah zu und widersprach den beiden Alten mit ihren Geschichten über gute Frauen.
»Das ist alles sehr schön«, sagte sie, »beweist aber keineswegs, dass es diese Menschenopfer auch heute noch gibt!«
»Ah! Unglückliches Kind, einzig Sie zweifeln noch daran«, weinten sie zusammen.
»Wer hat sie je gesehen?«
Drei junge, lebendig eingemauerte Mädchen
Tante Agnès schüttelte den Kopf: »Schauen Sie, in meiner Jugend hatte ich eine alte Quichua-Dienerin vom Ufer des Titicacasees, die mir erzählte, wie sie über einen Zeitraum von 30 Jahren hinweg beim zehnjährigen Inti-Raymi-Festival mit eigenen Augen gesehen habe, wie drei junge Mädchen lebendig eingemauert wurden.«
»In welcher Stadt?«, fragte Raymond.
»In Lima.«
»Das wäre bekannt!«, antwortete Raymond, der sich über die Gesichtsausdrücke der beiden alten Frauen sehr amüsierte und von Marie-Thérèse geschickt dazu gedrängt wurde, sie zu necken.
»Aber es ist ja bekannt, mein junger Herr!«, beharrte die Tante. »Wir kennen sehr gut die Namen der letzten beiden jungen Mädchen, die vor 20 Jahren lebend im Sonnentempel eingemauert wurden, und das andere vor zehn Jahren.«
»Ja, ja, wir kennen sie! Wir kennen sie!«, wiederholte Cristóbal lachend.
»Da gibt es nichts zu lachen, mein Herr Bruder«, knurrte Agnès.
Und die Duenna wiederholte mit tieferer Stimme: »Nein, nein! Da gibt es wirklich nichts zu lachen!«
Aber Cristóbal wurde immer fröhlicher.
»Lasst uns um sie trauern, diese armen Kinder!« Und er stöhnte auf. »Aus Liebe zu ihren Eltern. Ach, in der Blüte ihres Lebens sind sie von uns gegangen!«
»Bruder, können Sie uns erzählen, wie Amélia de Vargas und Maria-Christina d’Orellana verschwunden sind?«
»Ja, ja! Er soll es uns sagen!«, stimmte Irène zu.
»Wir alle sind jetzt hier und wollen es erfahren. Wir warten darauf«, antwortete der Marquis.
»Bitte sprechen Sie ernsthaft, mein Bruder. Sie kannten unsere Amélia de Vargas.«