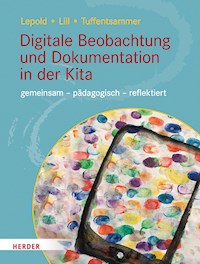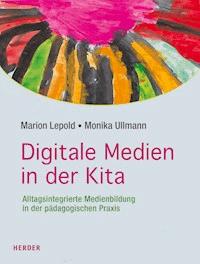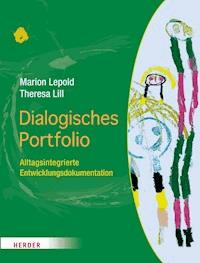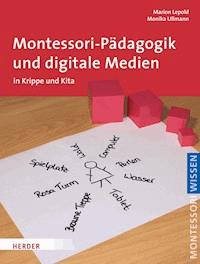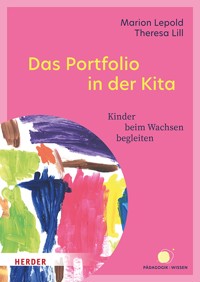
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Die Portfolio-Arbeit in der Kita ist weit mehr als nur Dokumentation – sie ist ein Werkzeug, um Kinder aktiv in ihre Entwicklung einzubinden und sie auf ihrem Weg zu stärken. Dieses Buch zeigt praxisnah, wie pädagogische Fachkräfte Portfolios als dialogische Methode im Alltag umsetzen und damit Kinder, Familien und Teams gemeinsam Bildungsprozesse gestalten können. Von der Beobachtung über die Dokumentation bis hin zur Reflexion bietet es Impulse, wie Portfolios lebendig und partizipativ gestaltet werden. Fundiert und praxisorientiert zugleich, liefert es Anregungen für nachhaltige und individuelle Entwicklungsbegleitung, bei der Kinder nicht nur wachsen, sondern auch an sich selbst glauben lernen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 133
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Aus Umweltschutzgründen wurde dieses Buch ohne Folie produziert.
Überarbeitete Neuausgabe 2025
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2017
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlagkonzeption und -gestaltung: Sabine Hanel, Gestaltungssaal
Fotos: S. 8: © Marilyn Nieves / GettyImages, alle anderen: Thomas Lepold, Milena Schmidt
Illustrationen: Benedikt Dietrich
Papierstruktur im Innenteil: © Charunee Yodbun – shutterstock
Satz: Sabine Hanel, Gestaltungssaal
E-Book-Konvertierung: Newgen Publishing Europe
ISBN Print 978-3-451-39744-8
ISBN E-Book (EPUB) 978-3-451-83724-1
ISBN E-Book (PDF) 978-3-451-83728-9
Inhalt
Vorwort
1. Eckpfeiler der Portfolio-Arbeit in der pädagogischen Praxis
1.1 Was ist Portfolio?
1.2 Qualitätskriterien des Portfolios
1.3 Der Portfolio-Prozess
2. Portfolio als Entwicklungsdokumentation
2.1 Bildungsprozesse beobachten
2.2 Wahrnehmendes Beobachten
2.3 Subjektivität von Beobachtungen
2.4 Ressourcenorientierte Beobachtung
2.5 Dimensionen von Portfolios
3. Die Perspektive der Kinder aufnehmen: Portfolio im Dialog
3.1 Kinder als Subjekte ihrer Bildungsbiografie
3.2 Rahmenbedingungen
3.3 Haltung der pädagogischen Fachkraft in Portfolio-Dialogen mit Kindern
3.4 Anlässe für Portfolio-Gespräche
3.5 Sprechanlässe schaffen
4. Elemente des Portfolios: Entwicklung sichtbar machen
4.1 Entwicklungs- und Bildungsprozesse von Kindern
4.2 Gestaltungsmittel
5. Die Portfolio-Arbeit begleiten und gestalten
5.1 Rolle(n) der pädagogischen Fachkraft
5.2 Dialog zwischen den pädagogischen Fachkräften
5.3 Zusammenarbeit mit den Familien im Rahmen der Portfolio-Arbeit
6. Einführung der Portfolio-Methode
6.1 Zeitleiste
6.2 Konzeptionserweiterung
6.3 Leitlinienentwicklung
6.4 Vorbereitung der Umsetzung
6.5 Erprobung und Reflexion
Literaturverzeichnis
Vorwort
In den vielen Jahren, in denen wir Kindertageseinrichtungen in der Portfolio-Arbeit begleitet haben, ist uns immer wieder aufgefallen, wie viel Potenzial in dieser Methode steckt – weit mehr, als nur Entwicklungsschritte zu dokumentieren. Ein Portfolio kann ein lebendiger Ort sein, an dem Kinder ihre Erfolge, ihre Interessen und auch Herausforderungen sichtbar machen. Es ist ein Raum, in dem sie nicht nur ihre Kompetenzen weiterentwickeln, sondern auch innerlich wachsen – in ihrem Selbstbewusstsein, ihrem Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und ihrer Selbstwirksamkeit.
Dabei ist es entscheidend, das Portfolio mit Leben zu füllen, indem die Kinder aktiv einbezogen und ihre Perspektiven ernst genommen werden. Das bedeutet, nicht nur ihre Erlebnisse und Lernerfahrungen festzuhalten, sondern sie im Dialog dazu einzuladen, diese Erlebnisse zu reflektieren und als Teil ihres eigenen Wachstumsprozesses zu verstehen. Wenn Kinder erkennen, was sie bereits geschafft haben, und sich bewusst mit ihren eigenen Entwicklungsschritten auseinandersetzen, dann werden sie stolz und mutig – bereit, sich auf neue Herausforderungen einzulassen.
Mit diesem Buch möchten wir pädagogische Fachkräfte dabei unterstützen, genau diese Kraft des Portfolios zu nutzen: als Mittel, um Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten und sie in ihrem Selbstvertrauen und ihrer Selbstständigkeit zu bestärken. Es bietet praxisnahe Impulse, wie Bildungsprozesse sichtbar und greifbar gemacht werden können – immer mit dem Ziel, dass Kinder sich in ihren Portfolios wiederfinden und in ihrem Wachsen unterstützt werden.
Wir hoffen, dass dieses Buch pädagogischen Fachkräften als wertvolle Orientierung dient und wünschen Ihnen inspirierende Momente bei der Umsetzung einer lebendigen, dialogischen Portfolio-Arbeit, die Kinder aktiv beim Wachsen begleitet.
Marion Lepold & Theresa Lill
1.
Eckpfeiler der Portfolio-Arbeit in der pädagogischen Praxis
Die Themen in diesem Kapitel sind
→ Definition des Begriffs »Portfolio« im Kontext der pädagogischen Arbeit
→ Bedeutung des Dialogs bei der Portfolio-Arbeit
→ Qualitätskriterien der Portfolio-Arbeit
→ Aufbau des Portfolio-Prozesses
Die Portfolio-Arbeit ist eine weit verbreitete Methode in der Kita-Praxis. Sie dient zur Dokumentation der individuellen Entwicklung eines Kindes und zeigt dessen Stärken und Interessen. Doch was steckt genau hinter der Arbeit mit dem Portfolio? Und was bedeutet Portfolio-Arbeit für die pädagogischen Fachkräfte, die Kinder und deren Familien?
1.1 Was ist Portfolio?
Ein Portfolio wird zumeist ganz allgemein als eine Sammlung von Dokumenten beschrieben. So ist das Portfolio im pädagogischen Kontext eine zielgerichtete Sammlung von Dokumenten – sowohl der Kinder als auch der pädagogischen Fachkräfte und Eltern bzw. Bezugspersonen des Kindes. Es fließen Beobachtungsergebnisse der Erwachsenen und die Werke der Kinder zusammen und machen dadurch die Bildungsprozesse und Entwicklungsverläufe eines Kindes sichtbar. Bildungsgelegenheiten und wie sich das Kind darauf eingelassen hat, werden im Portfolio beschrieben. Kinder, pädagogische Fachkräfte und Familien haben so die Möglichkeit, eigene Handlungen und Vorgehensweisen kontinuierlich zu reflektieren und zur Grundlage von nächsten Schritten zu machen. Durch die Auseinandersetzung mit dem Portfolio werden Bildungsprozesse analysiert und begleitet, was wiederum eine Anpassung der Bildungsumgebung an die Bedürfnisse der Kinder ermöglicht.
MERKE
Der Begriff Portfolio kommt aus dem Italienischen und leitet sich von »portafoglio« ab. Dieses Wort setzt sich zusammen aus dem Verb »portare« (= tragen) und dem Nomen »foglio« (= Blatt).
Das Portfolio ist ein pädagogischer Prozess, der sich über die gesamte Kita-Zeit (im Idealfall auch noch darüber hinaus) erstreckt. Und dieser Prozess lebt von und durch den Dialog von pädagogischen Fachkräften, Eltern und dem Kind.
1.1.1 Portfolio im Dialog
Beim dialogischen Portfolio geht es um eine gesunde Balance zwischen Portfolios über das Kind (= Portfolio-Einträge der pädagogischen Fachkraft sowie der Familie des Kindes) und Portfolios von Kindern (= Sammlung von Einträgen der Kinder). Der Anspruch des dialogischen Portfolios besteht darin, die Sichtweisen aller Beteiligten einfließen zu lassen und so ein umfassenderes Bild über die Entwicklung jedes einzelnen Kindes zu erhalten.
Abb. 1: Portfolios über Kinder – Portfolios von Kindern
in Anlehnung an Prof. Michaela Rißmann
Ein ausgewogenes Portfolio umfasst sowohl Einträge, die die Perspektive der Kinder im Fokus haben, als auch Portfolio-Einträge der pädagogischen Fachkraft über das Kind. Es gilt, die fachliche Perspektive zu ergänzen und so den Horizont des Kindes zu erweitern. Auch das Alter des Kindes spielt dabei eine Rolle. Je jünger ein Kind ist, desto mehr ist es Aufgabe der Fachkraft, zu dokumentieren. Mit wachsender Selbstständigkeit des Kindes sollte die pädagogische Fachkraft ihre Rolle reflektieren und dem Kind Raum für seine eigene Dokumentation einräumen.
Es hängt vom (Entwicklungs-)Alter des Kindes und seinen individuellen Fähigkeiten ab, inwieweit und auf welche Art und Weise seine Sichtweisen in die Beobachtung einfließen können. Mit einem älteren Kind kann man tatsächlich reflektierte Gespräche führen, bei kleinen Kindern gilt es, vor allem auch auf deren nonverbale Äußerungen zu achten. Ein Dialog wird nicht nur durch Worte, sondern auch ganz ausschlaggebend durch Mimik und Gestik geführt (siehe dazu Kapitel 3.3).
In den Dialog treten bedeutet außerdem nicht nur, dass die pädagogischen Fachkräfte mit den Kindern ihre Beobachtungsergebnisse besprechen und sie dann gegebenenfalls um die Perspektive der Kinder erweitern. Der Dialog kann bereits den Moment der Beobachtung maßgeblich bestimmen. Es ist nicht zwingend erforderlich, dass sich die Fachkraft als Beobachterin immer ruhig verhält und sich vom Geschehen distanziert. Auch in der Interaktion mit den Kindern kann man vieles beobachten und entdecken (siehe auch Kapitel 3.4).
1.2 Qualitätskriterien des Portfolios
Der Portfolio-Arbeit liegen verschiedene Qualitätskriterien zugrunde. Diese stellen sicher, dass das pädagogische Ziel, die Entwicklung des Kindes zu dokumentieren und Reflexionsprozesse anzustoßen, erreicht wird.
1.2.1 Individualität
Der Fokus bei der Portfolio-Arbeit liegt darauf, die Individualität des Kindes, seiner Entwicklungsprozesse und Interessen sichtbar zu machen. Für das Kind sind die Auseinandersetzung mit seinem Portfolio und der fortlaufende Dialog ein elementarer Bestandteil der Persönlichkeitsentwicklung. Es wählt aus, welche Handlungen und welche Werke für es von Bedeutung sind, und entscheidet selbst, was Bestandteil seines individuellen Portfolios werden soll. Dadurch bringt das Kind seine Persönlichkeit und Interessen zum Ausdruck. Indem die pädagogischen Fachkräfte diese Entscheidungen ernst nehmen und das Kind aktiv in den Prozess einbeziehen, erfährt das Kind Wertschätzung. Die Darstellung der eigenen Kompetenzen steigert das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen des Kindes. Ein so gelebtes Portfolio lässt das Kind Selbstwirksamkeit erfahren und erkennen, dass seine individuellen Leistungen und Interessen von Bedeutung sind.
Im Gegensatz dazu sind andere Beobachtungsverfahren oft standardisiert und lassen wenig Raum für die individuelle Vielfalt eines Kindes. Sie zeigen zwar bestimmte Entwicklungsschritte oder Kompetenzen auf, erfassen jedoch nicht die einzigartigen Interessen, Stärken und persönlichen Fortschritte eines jeden Kindes. Portfolio-Einträge hingegen ermöglichen einen viel differenzierteren und persönlicheren Blick. Durch die Vielfalt an Dokumentationsmethoden – ob Zeichnungen, Fotos, Kommentare oder kreative Werke – werden die individuellen Vorlieben und Kompetenzen des Kindes sichtbar. So wird es möglich, die Entwicklung jedes Kindes ganzheitlich und individuell nachzuvollziehen und wertzuschätzen.
1.2.2 Qualitätskriterium Facettenreichtum
Facettenreichtum als Qualitätskriterium ist ein weiteres Merkmal, das die Einzigartigkeit eines Kindes sichtbar macht. Dabei steht hier das Facettenreichtum bei der Dokumentation im Vordergrund. Ein breites Spektrum an Dokumentationsmethoden ermöglicht es, die Vielfalt und Einzigartigkeit des Kindes in verschiedenen Facetten zu erfassen und sichtbar zu machen. Je facettenreicher die Methoden, desto umfassender und lebendiger wird das Bild, das von der Entwicklung des Kindes gezeichnet wird. So kann ein Foto oder eine Zeichnung die kreativen Ausdrucksmöglichkeiten des Kindes zeigen, während ein Zitat des Kindes Aufschluss über seine sprachlichen Fähigkeiten und seine momentanen Gedanken und Gefühle gibt. Beobachtungen der Fachkräfte wiederum können wichtige Entwicklungen im sozialen Miteinander oder im Lernverhalten aufzeigen. Auch die Perspektiven der Bezugspersonen, wie Eltern oder andere Erwachsene im Umfeld des Kindes, tragen dazu bei, das Bild weiter zu vervollständigen.
Durch den Einsatz vielfältiger Methoden wird sichergestellt, dass nicht nur einzelne Momente festgehalten werden, sondern dass auch längere Entwicklungsprozesse, die Interessen, Fähigkeiten und Herausforderungen des Kindes sichtbar werden. Diese multiperspektivische Herangehensweise ist entscheidend, um die individuellen Stärken und Potenziale des Kindes in all ihren Dimensionen zu erfassen und zu fördern (siehe Kapitel 4).
1.2.3 Unmittelbarkeit
Ein qualitativ hochwertiges Portfolio zeichnet sich auch durch Unmittelbarkeit aus, denn es ist wichtig, dass das Kind einen direkten Bezug zu den Inhalten hat. Das bedeutet, dass die Zeitspanne zwischen der dokumentierten Situation und dem Einzug dieser in das Portfolio so kurz wie möglich sein sollte. Umso präsenter die Situation ist, umso besser kann es dem Kind gelingen, einen Bezug zu dem Portfolio-Eintrag herzustellen. Hinsichtlich der knappen Ressourcen werden in der Praxis ab und an Fotos von verschiedenen Situationen gesammelt, um dann, wenn entsprechend Zeit ist, mehrere Portfolio-Einträge gesammelt zu erstellen. Dieses Vorgehen ist aufgrund der vielfältigen Aufgaben im pädagogischen Alltag nachvollziehbar, jedoch hinsichtlich des Qualitätskriteriums »Unmittelbarkeit« wenig zielführend.
Eine Lösung für dieses Dilemma bieten digitale Medien. Diese können pädagogische Fachkräfte beim Erstellen der Portfolio-Einträge enorm unterstützen. Nicht nur, dass die Einträge wesentlich schneller fertiggestellt sind und es den Kindern dadurch leichter fällt, einen Bezug zu dem Portfolio herzustellen. Die Einträge können auch sehr leicht gemeinsam mit dem Kind im Geschehen angefertigt werden. Das Kind ist dadurch von Anfang bis Ende in die Portfolio-Arbeit involviert (siehe Abbildung 3). Hierfür gibt es verschiedene Portfolio-Apps für Kindertageseinrichtungen. Bei der Auswahl einer Anwendung ist besonders auf die Datenschutzbestimmungen des jeweiligen Anbieters zu achten.
Abb. 2: Digitale Möglichkeiten in der Portfolio-Arbeit
Eine weitere Möglichkeit, die Unmittelbarkeit trotz geringer Ressourcen sicherzustellen, ist es, die Anzahl der Einträge zu reduzieren und den Fokus auf die Qualität zu legen. Statt viele Einträge zu erstellen, kann es effektiver sein, weniger, aber dafür detaillierte und aussagekräftige Dokumentationen zu gestalten. Selbst ein bis zwei Einträge pro Halbjahr können, wenn sie sorgfältig und gemeinsam mit dem Kind erarbeitet werden, wertvolle Einblicke in die Entwicklung des Kindes geben. Pädagogische Fachkräfte sollten sich bewusst Zeit nehmen, um ausgewählte Momente gezielt festzuhalten und diese im Dialog mit dem Kind zu dokumentieren. Dabei ist ein gut begleiteter Eintrag, der im direkten Bezug zum Erlebten steht und die Reflexion des Kindes einbezieht, oft wertvoller als eine Vielzahl an Einträgen, die ohne Tiefe oder Kontext festgehalten werden.
1.2.4 Zugänglichkeit
Für eine qualitativ hochwertige Umsetzung der Portfolio-Methode ist es entscheidend, dass die Kinder jederzeit einen direkten Zugang zu ihrem Portfolio haben. Dieser Zugang ermöglicht ihnen, selbstständig und unabhängig von einem Erwachsenen ihre eigene Entwicklungsgeschichte stets dann zu betrachten, wenn sie es möchten. Idealerweise sind die Portfolio-Ordner in einem Gruppen- oder Funktionsraum untergebracht, wo sie für die Kinder leicht erreichbar sind. So bietet es sich an, die Ordner in einem offenen Regal auf Augenhöhe der Kinder zu platzieren.
Dies ist dabei nicht nur aus pädagogischer Sicht sinnvoll, sondern schützt auch die Privatsphäre der Kinder besser, als wenn die Ordner im Flur untergebracht sind, wo schneller einmal unkontrolliert darauf zugegriffen werden könnte.
Manchmal bestehen Bedenken, dass Portfolio-Seiten, gerade bei Krippenkindern, durch das selbstständige Blättern und »Herausziehen« des Ordners kaputt gehen können. Um die Langlebigkeit der Portfolio-Ordner zu unterstützen, können die einzelnen Seiten in Klarsichthüllen geschützt werden. So werden die Seiten nicht direkt beschädigt. Selbstverständlich können auch hier deutliche Gebrauchsspuren entstehen. Wechselt man hier die Perspektive, so sieht man nicht ein beschädigtes Portfolio, sondern einen Beleg für das Interesse des Kindes und die Auseinandersetzung mit dem Portfolio.
Auch hier können digitale Medien unterstützen. Werden die Portfolio-Seiten digital erstellt, z. B. mit einem Textverarbeitungsprogramm wie Word, hat dies den Vorteil, dass einzelne Seiten nochmals neu ausgedruckt werden können, falls sie beschädigt wurden.
Damit die Zugänglichkeit auch bei digitalen Portfolios gewährleistet ist, braucht es zum gegenwärtigen Stand der technischen Möglichkeiten weiterhin den analogen Portfolio-Ordner mit den Ausdrucken der digitalen Einträge. Eine gute Möglichkeit ist es, den Portfolio-Eintrag unmittelbar nach der Erstellung auszudrucken, damit ihn das Kind selbstständig in seinen Portfolio-Ordner heften und jederzeit darauf zugreifen kann.
1.2.5 Partizipation
Partizipation ist nicht nur ein gesetzlicher Auftrag, sondern ein zentrales Qualitätsmerkmal der Portfolio-Arbeit. Dabei ist es Auftrag der pädagogischen Fachkräfte, den Rahmen für eine kind- bzw. entwicklungsgerechte Umsetzung zu schaffen. Das bedeutet, die Kinder zu beteiligen, ohne sie zu überfordern.
Kinder sind neugierig und möchten aktiv an der Gestaltung ihrer Umgebung teilhaben. Durch die Portfolio-Arbeit erhalten sie die Möglichkeit, ihre eigenen Ideen und Meinungen zu äußern und diese in die Dokumentation ihrer Entwicklung einzubringen. Diese Form der Partizipation ist nicht nur ein Grundbedürfnis, sondern trägt auch wesentlich zur Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit der Kinder bei.
Indem die Kinder aktiv in die Gestaltung ihrer Portfolios einbezogen werden, entwickeln sie ein Bewusstsein für ihre eigene Handlungsmacht. Sie lernen, dass ihre Entscheidungen einen Einfluss auf ihre eigene Lern- und Lebenswelt haben und können sich als aktive Mitglieder ihrer Gemeinschaft erleben.
MERKE
Die Perspektive der Kinder trägt dazu bei, Missverständnissen vorzubeugen.
1.3 Der Portfolio-Prozess
Die Portfolioarbeit ist keine einmalige Aktivität, vielmehr stellt sie immer einen Prozess dar.
Abb. 3 Portfolio-Prozess mit pädagogischer Handlungsplanung
Der Portfolio-Prozess ist ein zyklischer und dynamischer Ablauf, der darauf abzielt, die Entwicklung des Kindes umfassend zu begleiten und zu dokumentieren. Dieser Prozess gliedert sich in sechs aufeinanderfolgende Schritte, die sich kontinuierlich wiederholen.
Der Portfolio-Prozess startet damit, dass Beobachtungen gemacht werden bzw. eine Situation erlebt wird (1). Dies bildet den Ausgangspunkt für die Dokumentation im Portfolio (2). Darauf folgt eine Reflexion dieses Portfolio-Eintrages (3); dazu gehören sowohl die Reflexion mit dem Kind über sein eigenes Portfolio als auch ggf. Gespräche mit Eltern zum Portfolio ihres Kindes. Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte ist es, Schlussfolgerungen für die pädagogischen Prozesse (4) zu ziehen. Auch hier können die Kinder dialogisch partizipieren und ihre Perspektive einbringen. Diese Schlussfolgerungen gilt es dann im pädagogischen Alltag umzusetzen (5). In der Folge werden neue Situationen und Entwicklungen beobachtet und dokumentiert (6), was den Prozess wiederum erneut anstößt.
(1) Beobachtung und Erlebnis
Der Prozess beginnt mit einer Beobachtung oder einer erlebten Situation. Pädagogische Fachkräfte nehmen aufmerksam wahr, wie sich das Kind in unterschiedlichen Kontexten verhält, welche Interessen es zeigt und wie es mit seiner Umgebung interagiert. Auch die Erlebnisse und Eindrücke des Kindes selbst, also dessen Perspektive, können Ausgangspunkt der Portfolio-Arbeit sein.
(2) Dokumentation im Portfolio
Auf der Grundlage der Beobachtungen oder eines Erlebnisses wird der nächste Schritt eingeleitet: die Dokumentation im Portfolio. Hierbei wird das Erlebte festgehalten, beispielsweise in Form von Fotos, Texten oder auch Zeichnungen, die das Kind erstellt hat. Diese Dokumentation erfolgt dialogisch, indem das Kind aktiv in den Prozess eingebunden wird und die Gelegenheit bekommt, das Erlebte mit eigenen Worten oder Darstellungen zu schildern. Dies stärkt die Partizipation und ermöglicht eine authentische Abbildung der Sichtweise des Kindes.
(3) Reflexion
Die nächste Phase ist die Reflexion. Hier tauscht sich die pädagogische Fachkraft mit dem Kind über den Portfolio-Eintrag aus. Es geht darum, das Erlebte nochmals zu besprechen, Zusammenhänge zu erkennen und die Sicht des Kindes zu erfassen. Ebenso können Gespräche mit den Familien geführt werden, um deren Perspektive und Einschätzung einzubeziehen. Die Reflexion kann auch im Team erfolgen, um verschiedene Eindrücke und Meinungen zu einem vollständigen Bild zu verknüpfen. So entsteht ein umfassendes Verständnis für die Entwicklung des Kindes und die pädagogische Fachkraft erhält wertvolle Informationen für die weitere Planung.