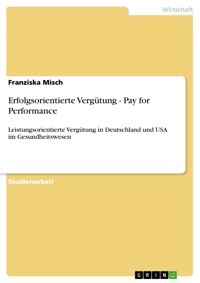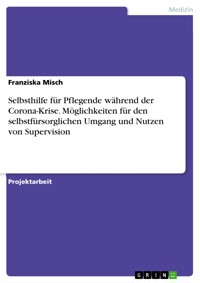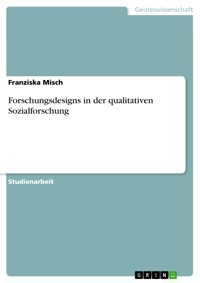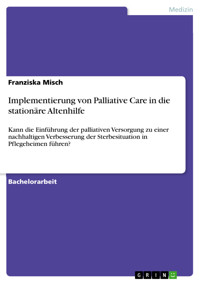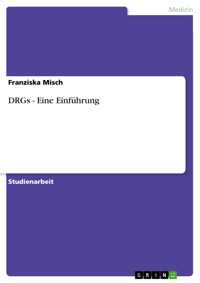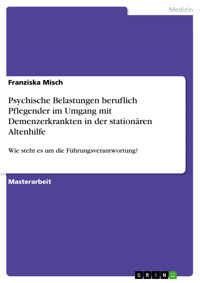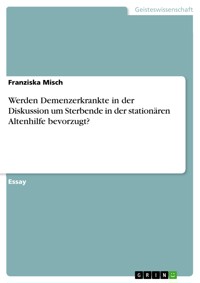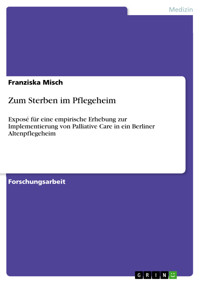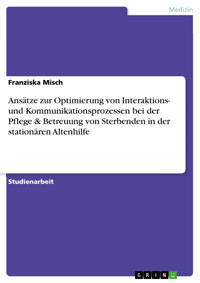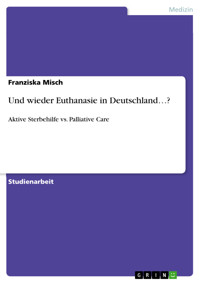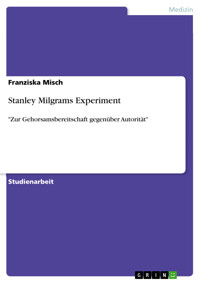15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Pflegewissenschaft - Pflegemanagement, Note: 1,3, Alice-Salomon Hochschule Berlin , Veranstaltung: Pflegewissenschaften, Sprache: Deutsch, Abstract: Mittels meiner Arbeit stelle ich das Psychobiographische Pflegemodell von Erwin Böhm vor. Ich gehe dabei auch auf die kulturellen, historischen und sozialen Hintergründe der Theorie ein. In der Folge wende ich einzelne Aspekte der Theorie auf die vier zentralen Begriffe Mensch; Gesundheit/ Krankheit; Umgebung/ Umwelt und Pflege an. Im Anschluss stelle ich kurz einige biographische Daten vor, um den Kontext, in dem die Theorie entwickelt wurde, zu verdeutlichen. Des Weiteren habe ich einen Schwerpunkt auf die Vorstellung der Pflegediagnosen nach Böhm, basierend auf seinem Pflege(-prozess)-modell zur psychobiographischen Pflege, gesetzt. Zum Abschluss versuche ich die Ansätze der Böhmschen Theorie mittels eines kurzen, aber prägnanten Beispiels aus meiner eigenen Praxis verdeutlichen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2008
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhalt:
1. Einleitung
2. Biographische Daten zu Erwin Böhm
3. Definitionen/ Begriffsklärungen
3.1. Demenz/ demenzielle Erkrankungen
3.2. Psychobiographie
3.3. Psychische Anteile vs. Kognitionen
3.3.1. Thymopsyche
3.3.2. Noopsyche
3.4. Aktivierende/ Re-Aktivierende Pflege nach Böhm
3.5. Übergangspflege und differentialdiagnostischer Ausgang
3.6. Pflegepersonen
4. Interaktions-/ Erreichbarkeitsstufen
5. Analyse und Evaluation des Modells
6. Biographieforschung
6.1. Die Wurzeln des Menschen
6.2. Der Stamm – Charakterbildung
6.3. Die Äste – das Verhalten und Handeln
6.4. Copings und Altenbetreuung
7. Pflegediagnosen nach Böhm
7.1. Die Komponenten der Pflegediagnosen
7.2. Pflegepolitische Bemerkungen zu den Pflegediagnosen
8. Praxisbeispiel
9. Zusammenfassung/ Schlussfolgerungen
Literaturverzeichnis:
1. Einleitung
Erwin Böhm, der Begründer des Psychobiographischen Pflegemodells, beschäftigte sich „mit einer Neuorientierung der geriatrischen Krankenpflege (…), um das Los der Patienten, aber noch mehr jenes der Betreuer zu erleichtern“. (Böhm 1994, S. 7) Ein zentraler Ansatz seiner Theorie stützt sich auf Fördern durch Fordern, das heißt, „Pflegen mit der Hand in der Hosentasche“. (Vgl. Böhm 19962) Er meint, darin liege die Schwierigkeit. Die meisten Menschen glauben, dass die Alten, die ihr Leben lang gearbeitet haben, das Recht hätten, sich auszuruhen. Fatal an dieser Einstellung sei jedoch, dass die Menschen dadurch dem natürlichen Prozess des Verfalls durch das Altern hingegeben und damit „zu Tode gepflegt“ würden. (Vgl. Böhm 19962) Böhm interpretiert dieses Phänomen als gesellschaftlich etabliertes Problem der Menschen. Es handelt sich damit meinem Verständnis nach nicht um ein persönliches oder individuelles Problem der einzelnen Pflegekraft. Es handelt sich eher um ein Phänomenen unserer Gesellschaft. Böhm sagt, uns würde es leid tun, den Menschen eigene Aktivitäten zuzumuten, sie allein ihr Bett machen zu lassen oder allein zu essen. (Böhm 19962, S. 11) „Im Umgang von Mensch zu Mensch hemmt meistens die Gefühlsbremse das rationelle Gas-geben. Man weiß (…), dass in der Altenbetreuung Fördern durch Fordern das Richtige wäre; was tut man aber, man legt den Alten in ein Bett, weil es gefühlsmäßig wehtut, wenn man ihn durch die Gegend jagen muss.“ (Böhm 19962, S. 11) Böhm publizierte, dass die eigene Erziehung (die der Pflegeperson) und dessen Normen und Werte einen entscheidenden Einfluss auf die Betreuung alter (kranker) Menschen und das Verhalten ihnen gegenüber haben. Seine These lautet demzufolge, die Voraussetzung, sich mit anderen Menschen zu beschäftigen, sei die kritische Auseinandersetzung mit sich selbst. (Vgl. Böhm 19962, S. 15)