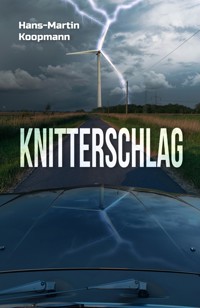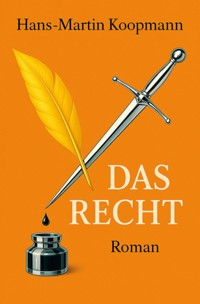
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Hamburg 2004. Das Recht beschränkt unser Handeln, nicht aber unser Denken, sagt Aldo, auf dem Höhepunkt seiner steilen Anwaltskarriere angekommen. Hier trifft er auf Lenny, der das Böse noch von Angesicht kennengelernt hat und ihn mit liebenswürdiger Unerbittlichkeit in die Pflicht nimmt, dies nun ebenfalls zu tun. Dann macht Aldo einen schweren Fehler und kommt dafür in die Hölle, wo schon die Nazis warten, und dass endlich ihre Stunde schlägt. Ihre letzte Stunde. Verrückte Polizisten, dumpfe und charmante Nazis, singende Fallschirmjäger, nachdenkliche Kampfpiloten, schöne Frauen, schnelle Autos - und ein großer schwarzer Hund. Es ist nicht leicht, ein Held zu sein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans-Martin Koopmann
DAS RECHT
ROMAN
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.dnb.de abrufbar.
Copyright © 2025 Hans-Martin KoopmannAlle Rechte vorbehalten.
Umschlag- und Layoutdesign: www.4h-digital.deCovermotiv: Hans-Martin Koopmann, „Das Recht“
Kontakt:Hans-Martin Koopmann c/o 4H DIGITALLars HützFischerstr. 49, 40477 Dü[email protected]
Dem Andenken meines Vaters Menne Koopmann (1939 - 2023), der DAS RECHT sehr schätzte.
Vorwort
Seit ich vor rund 35 Jahren zum ersten Mal in die ansteigenden Weiten des Bochumer Hörsaalzentrums Ost eintauchte, bestimmt das Recht mein Leben – Tag für Tag, und jeden Tag aufs Neue.
Als Praktiker ist mein Begriff des Rechts naturgemäß transzendental geprägt: Idee von Gerechtigkeit, aber auch Machtmittel und Kulturtatsache – Recht als strategische Größe, Recht und Politik, Recht und Gewalt, Ende des Rechts. Und wenn ich mir erlaube, hier grundsätzliche Fragen meines Fachs zu stellen und zu beantworten, dann am liebsten als ein moderner Sindbad, der abends mit den anderen am Lagerfeuer einer Oase Rast hält:
Höret, Brüder, was mir auf meinen vielen Reisen widerfahren ist!
DAS RECHT ist mein zweiter Roman – und zugleich der zweite Teil einer einheitlichen, zusammenhängenden Geschichte. Erzählt wird der Rest jenes 16. Mai 2004, an dem mein erster Roman, KNITTERSCHLAG, endet. Beide Bücher lassen sich auch unabhängig voneinander lesen. Doch dann bleiben die Antworten aus, die sie einander auf ihre offenen Fragen geben. Ich empfehle es daher nicht.
KNITTERSCHLAG und DAS RECHT beschließen mein literarisches Erzählen von Recht und Gerechtigkeit. Mein nächstes Buch wird ein Kinderbuch sein.
Hamburg, im Juni 2025
HMK
Er war ganz versunken, und das so plötzlich, und doch so unerreichbar. Diese Abgeschiedenheit, Abgeschnittenheit gar, die doch zugleich ein Schweben war, ein wohliges Kribbeln, und Ahnung, dass die Zeit nun stille stand in ihm. Aber die Zeit stand doch niemals still, oder? Der Zweifel verursachte ein störendes Gefühl, das der Wohligkeit seines Schwebens und Ahnens zuwiderlief, wie gegen den Strich. Dass sie in seinem Innern stille stehen mochte und doch möglicherweise fortschreite außer sich, das wollte er nicht. Anderseits, nur dieser kurze Augenblick noch, er war so schön, hier, tief drinnen, im Auge der Zeit. Vielleicht musste er sein Zweifeln ebenfalls als ein Schweben begreifen, was ja gewissermaßen auch nahe lag, sein Zweifeln ein Schweben. Und tatsächlich, auf einmal konnte er sich in ihr bewegen und zu fernen, vergangenen Orten begeben. Sein Hamburger Referendariat, die Anwaltsstation. Und ein goldener Kugelschreiber. Ganz beiläufig hatte sein Ausbilder den Waterman aus der Innentasche des Sakkos hervorgenommen und ihm zum Abschied überreicht. Mit Autorität und Selbstverständlichkeit, so wie ein Läufer den Staffelstab an den Nächsten weitergibt. Wie sehr war er doch überrascht und berührt gewesen von dieser Geste. Gleichwohl wunderte er sich seiner Gedanken an Dr. Ernst Herold und dessen verständnisvolle Gelassenheit, fast schon väterliche Milde, gerade jetzt. Und ihm war, als sei auf einmal auch Dr. Herold zugegen und nicke ihm freundlich zu. Ja. In seiner Versunkenheit lächelte er zurück, den goldenen Waterman und dessen kühle Schwere in seiner Hand. Doch dann war der Augenblick vorbei. Leicht stieß er mit dem edlen Kugelschreiber an den Rand seines Wasserglases und, KLING, ein wunderlicher, heller Klang fuhr schwingend durch den Raum.
Das Recht, sagte er leise, fast flüsterte er, das Recht begrenzt unser Handeln, nicht aber unser Denken.
In diesem Augenblick erhellte ein Blitzlicht seine Züge und das Klacken einer Spiegelreflexkamera sprengte die Stille.
BLITZKLACK!
Eine Fotografin hatte sich herangepirscht und eine Aufnahme gemacht. Er hob nun seinen Blick. Sie hätte Unruhe bringen können, doch nicht ihm, nicht an seinem Tag, nicht im fetten Licht der Nachmittagssonne, das durch die weiten Fensterfronten fiel und den Saal umfing wie ein gleißendes Gold.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Alle waren gekommen, nein, Dr. Seltzer fehlte, er selbst hatte ihn nach Frankfurt auf eine Fortbildung im Bankenrecht geschickt, aber der kannte das, was er nun zu sagen hatte, ohnehin aus eigener Anschauung und Übung. Sonst waren alle da, die Partner, die angestellten Anwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer nebst einer kleinen Abordnung aus dem Frankfurter Büro. Auch die Sekretärinnen fanden sich am Rande der Weitläufigkeit des Konferenzsaals der Hamburger Dependance von Himmelreich & Young. Und selbst das Stammhaus aus dem fernen Boston, Massachusetts, hatte sich hochkarätig vertreten lassen durch den ebenso betagten wie scharfsinnigen Dr. Leonard Teller, der Bufatzers Vortrag, Das große Spiel - Kybernetische Sequenzierung anwaltlicher Aufgaben, in deutscher Originalfassung hören und dann, wieder zuhause, den anderen davon berichten sollte.
Ich begrüße Sie alle sehr herzlich, hier, mitten im schönen Hamburg, an diesem herrlichen Sonntagnachmittag, und in unseren neuen Räumen.
Dass man einen Vortrag am besten mit einem guten Witz einleitet, hatte Bufatzer wohl gehört, doch verstand er sich nicht auf Witze, und auf gute schon gar nicht, leider. Und überhaupt: niemand hier erwartete Lustigkeit. Somit hielt er es für das Beste, sich selbst keinen Zwang anzutun und ohne Umschweife zum Punkt zu kommen.
Ausgangspunkt meines Gedankengangs, so hub er an, sind zwei altbekannte Vorgaben des Rechts für die Fallbearbeitung, die jedem Rechtsanwalt geläufig sind, nämlich deren strikte Ausrichtung an rechtlichen Anspruchsgrundlagen und die anwaltliche Maxime des sichersten Wegs, den er zur Vermeidung unbeschränkter persönlicher Haftung stets zu beschreiten hat.
Meine These hierzu lautet, dass diese Vorgaben bei komplexen Lebenssachverhalten Denkschranken errichten und dadurch wertvolle Chancen kosten, und dass sie eine dynamische Auseinandersetzung in einen statischen Konflikt überführen. Das Ergebnis, mit einem Wort: Erstarrung, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Erstarrung. Erfolgreiche Anwaltsarbeit muss diese Erstarrung vermeiden oder doch zumindest überwinden können. Und wie das gehen kann, darüber wollen wir heute sprechen.
Nur soviel vorweg: Es braucht Herz und Verstand, aber auch Rückgrat und Seele, die alle zusammenwirken in einem vitalen, atmenden System.
Und es braucht einen Plan.
Er machte eine kurze Pause und hob seinen Blick.
BLITZKLACK!
Aber Schritt für Schritt: Zunächst, woher kommt die Erstarrung?
Die Antwort lautet: Wir selbst haben sie uns auferlegt! Seit nahezu unvordenklichen Zeiten lernt jeder, aber wirklich jeder deutsche Jurist an der Universität und beim Repetitor eine eiserne Grundregel des Zivilrechts, eine unumstößliche Leitfrage, die sein juristisches Denken von da an bestimmt bis zu dem Tag, an dem er seine Anwaltszulassung zurückgibt und in den Ruhestand tritt.
Diese Leitfrage lautet: Wer will was von wem woraus - und sie bedeutet, bedeutet bekanntlich, dass eine geschriebene oder ungeschriebene Anspruchsgrundlage zu suchen und zu finden ist, kraft deren der Mandant von seinem Gegner etwas mit Recht verlangen kann. Gängige Beispiele wären vertragliche Ansprüche auf Zahlung des Kaufpreises oder die Erbringung von Dienstleistungen, anderseits aber auch gesetzliche Vorschriften wie etwa über den Schadensersatz oder die Herausgabe von Sachen. Entscheidend ist, dass sowohl dieses Etwas als auch seine Voraussetzungen jeweils durch Gesetz und Recht vorgegeben werden. Die Leitfrage und das damit einhergehende Denken in Anspruchsgrundlagen liefern für die Schulfälle der juristischen Ausbildung, also durchweg anschauliche, einfach gelagerte Rechtsfälle, zuverlässige und in der Regel auch brauchbare Ergebnisse.
Wieder machte Bufatzer eine Pause, dieses Mal, um die Wirkung der Leitfrage auf die Anwesenden zu sondieren, die diese ja aus der eigenen Ausbildung und Berufstätigkeit kennen mussten, jedenfalls soweit sie Juristen waren. Die meisten indes schauten ihn mit mehr oder weniger ausdruckslosen Mienen an, so als teilten sie seine Einschätzung von deren Bedeutung für ihre Arbeit nicht unbedingt. Vielleicht warteten sie aber auch nur auf eine Pointe. Nur Dr. Leonard Teller aus Boston, Massachusetts, schien konzentriert mitzuschreiben und musste schon von daher für jede Pause dankbar sein, die Bufatzer einlegte.
Dem gegenüber ist das Gebot des sichersten Wegs haftungsrechtlich motiviert und geschärft: Der Rechtsanwalt - aber übrigens auch der Steuerberater - muss bei der Erfüllung seiner Pflichten gegenüber dem Mandanten und zur Erreichung des von diesem vorgegebenen Rechtsschutzziels immer den sichersten Weg beschreiten. Tut er dies nicht, haftet er für jeden durch die damit einhergehende Erhöhung des Risikos verursachten Schaden persönlich und unbegrenzt. Dies erscheint auf den ersten Blick vernünftig, denn schließlich hat sich der Mandant - man könnte auch von dem Auftraggeber sprechen - dem Rechtsanwalt anvertraut und wünscht keine Experimente auf seine Kosten. Tatsächlich jedoch handelt es sich bei dem Gebot des sichersten Wegs um eine Blickverengung und Denkschranke. Aber wie ich eingangs sagte: Das Recht begrenzt unser Handeln, nicht aber unser Denken.
Bufatzer hielt inne. Wieder nahm er den vor ihm liegenden Kugelschreiber und stieß tönend gegen sein Wasserglas.
KLING.
Das Anliegen des Mandanten ist existentiell, sagte er, seine Ansprüche sind es nicht.
Er räusperte sich.
Daher sind wir radikal aufgefordert, uns zu lösen von Anspruchsgrundlagen und sicherstem Weg. Stattdessen fragen wir schlicht: Was will der Auftraggeber überhaupt, also nicht, was-von-wem-woraus, sondern ganz einfach, was überhaupt? Oft wird er es selbst nicht so genau wissen, sich gar etwas vormachen. Die Frage nach dem Anliegen ist hochkomplex, vertrackt, sie kann sehr viel weiter gehen als der vorfindliche Katalog rechtlicher Anspruchsgrundlagen aus Vertrag und Gesetz. Vor allem aber ist ein persönliches Anliegen etwas qualitativ Anderes als ein rechtlicher Anspruch, wenn es auch im Ergebnis Überschneidungen geben mag - wie übrigens meist im Leben.
Finden wir eine geeignete Anspruchsgrundlage, die dem Mandanten seinen Wunsch erfüllt, umso besser. Leicht verdientes Geld. Und wenn nicht? Und wenn nur zum Teil? Hier liegt eine weitere Gefahr des klassischen Ansatzes, die nämlich, anhand der Vorgaben einer nur leidlich passenden Anspruchsgrundlage falsche Schwerpunkte zu setzen und das Gesamtanliegen des Auftraggebers damit gleichsam von Beginn an auf Abwege zu führen.
Dem Auftraggeber dürfte es übrigens völlig einerlei sein, aufgrund welcher rechtlichen Anspruchsgrundlage er gegebenenfalls seine Ziele durchsetzen kann. Anderseits, wenn wir ihm lapidar oder gar schulterzuckend mitteilen, dass eine geeignete Anspruchsgrundlage nach sorgfältiger - und natürlich kostspieliger - Prüfung für ihn leider nicht existiere, dann wird er mit Recht enttäuscht sein und vielleicht sogar bereuen, uns überhaupt gefragt zu haben.
Soweit, liebe Kolleginnen und Kollegen, darf es nicht kommen, und zwar schon deswegen nicht, weil wir es uns mit einer derartigen Antwort erkennbar zu leicht machen. Bitte bedenken Sie, dass der Auftraggeber - und zwar gerade auch im wirtschaftsrechtlichen Mandat - womöglich in schweren persönlichen Problemen steckt, davon bedrückt wird und vielleicht sogar überwältigt zu werden droht. Er erwartet, mehr noch, er setzt vielleicht seine letzte Hoffnung darauf, dass wir von Himmelreich & Young sein Anliegen verstehen und ernst nehmen. Hierfür, und nur hierfür, ist er bereit, viel Geld zu bezahlen, und dieses Hierfür muss mehr sein als das mechanische Abklappern aller in Frage kommenden Anspruchsgrundlagen.
Wieder nahm Bufatzer einen Schluck Wasser. Dann fuhr er fort.
Aber was mehr könnten wir ihm oder ihr bieten? Wie Sie sich erinnern werden, sprach ich von einem atmenden System. Denn soweit wir es mit dynamischen Prozessen zu tun haben und deren Dynamik für uns nutzen wollen, müssen wir diese als solche ernst nehmen und nachführen: Wir müssen sichten, auswerten, wir müssen entscheiden und schließlich wirken. Sichten - Auswerten - Entscheiden - Wirken, oder, in einem lustigen kleinen Kunstwort: SAUSEWIRK.
Mit diesen Worten ergriff er abermals seinen goldenen Kugelschreiber und stieß damit an den Rand des Glases. Und da er zwischenzeitlich abgetrunken hatte, ertönte dieses Mal ein Klang hellerer Färbung.
KLING.
Wir benötigen ein zyklisches, ein atmendes System, sagte er und ließ den Blick schweifen.
Und wir bekommen es auch, und zwar mit einem verblüffend simplen Kniff: Wir hören einfach nicht damit auf, zu sichten, auszuwerten, immer neu zu entscheiden und angepasst zu wirken. Dabei stellen wir fest, dass wir es mit einem Zyklus aus vier Schritten zu tun haben, die insgesamt zwei Phasen zugeordnet werden können: Innewerdung und Außenwirkung. Sichten, auswerten und entscheiden - das ist Innewerdung, Wirken ist Außenwirkung.
Kybernetische Sequenzierung, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist ein atmendes, ein periodisches Wechselspiel von Innewerdung und Außenwirkung: Innewerdung - Außenwirkung, Innewerdung - Außenwirkung.
Er sah er seine Zuhörer an und unterstrich seine Worte, indem er die Fingerspitzen bei der Innewerdung auf seine Brust legte und diese Geste dann, bei der Außenwirkung, nach seinen Zuschauern hin öffnete.
Innewerdung - Außenwirkung. Und so weiter. Beide Sphären sind indes scharf voneinander abgegrenzt.
Doch beginnen wir mit der Innewerdung. Er stieß an sein Glas.
KLING.
Wie gesagt, Innewerdung, das ist Sichten, Auswerten und Entscheiden.
Erfolgreich sichten erfordert zunächst, bedeutet vor allem, sich von der rechtlich vorgeprägten, gleichsam konditionierten Sachverhaltsaufklärung zu lösen und stattdessen ein viel umfassenderes Lagebild zuzulassen und in den Blick zu nehmen. Was ist bisher geschehen? Jedes Detail kann wichtig sein und muss daher auf geeignete Weise dokumentiert werden, und zwar unter möglichst exakter zeitlicher Zuordnung. Gibt es Aktenstücke oder sonstige Unterlagen, Briefe, E-Mails, SMS-Nachrichten, Verbindungsnachweise und so weiter? Der Auftraggeber wird ein strukturiertes Lagebild regelmäßig nicht vorlegen können, aber er wird umso mehr beeindruckt sein, wenn wir das professionell und zielstrebig für ihn erledigen. Wichtig ist in dieser Phase, den Auftraggeber durch beharrliches Nachfragen dazu zu bringen, uns alles, was er hat, vorzulegen. Das allein kann lange Tage in Anspruch nehmen. Gleichwohl wird der Auftraggeber sich bei alldem ernst genommen fühlen und neue Zuversicht schöpfen.
Wieder hatte Bufatzer zu seinem goldenen Kugelschreiber gegriffen und sein Wasserglas erklingen lassen.
KLING.
In einer ersten Auswertungsphase fügen wir dann all das in streng chronologischer Ordnung neu zusammen. Plötzlich erkennen wir, wie Komplexität sich reduziert, was Ursache war, was Wirkung, was vielleicht nur Zufall, Koinzidenz. Zugleich werden sich Fragen aufdrängen, die wir in einem zweiten Auswertungsschritt sorgfältig und möglichst genau formulieren und zunächst gesondert dokumentieren.
Sodann gehen wir das chronologisch geordnete Lagebild Wort für Wort durch und schauen auf alle, aber wirklich alle Personen, die darin vorkommen. Jede dieser Personen erhält sodann ein eigenes Dossier, auch wenn dieses zunächst nicht viel mehr als deren Namen enthalten mag.
Besonderes Augenmerk gilt dabei naturgemäß dem Gegner, bei dem gründlich nach seinen Motiven und Absichten, seinen Sehnsüchten, Träumen und Wünschen, aber auch nach seinem Weltbild im Allgemeinen oder dem Bild von sich selbst im Besonderen zu fragen und zu forschen ist.
Das Bild von sich selbst gehörte zu seinen Lieblingsthemen. Bufatzer hatte zur Auflockerung immer eine Reihe mehr oder weniger passender Anekdoten auf Lager, die sich über sein Berufsleben angesammelt hatten. Die schlüpfrigen hatten sich oft als die wirkungsvollsten erwiesen. Man war schließlich in Deutschland. Eine davon war die Escort-Anekdote. Spontan streute er sie ein, auch wenn die meisten seiner Hamburger Kollegen sie schon kannten, teils gar noch aus eigenem Miterleben:
Einmal, Bufatzer versuchte, möglichst vielsagend zu schmunzeln, stand in einem großen Verfahren eine trauernde Witwe auf der Gegenseite, von der man hinter vorgehaltener Hand zu erzählen wusste, dass sie in ihrem vorigen Leben eine russische Edelprostituierte gewesen sei und sie nun, nachdem ihr reicher Kurzzeit-Gatte nach dreiwöchiger Ehe verschieden war, um einiges reicher und ausgestattet mit einem neuen, gar nicht mehr russischen und sogar recht klangvollen Namen. Hiermit verband sich der Anschein einer treu-biederen deutschen Witwe und guten Mutter - wobei die Kinder freilich von früheren Männern stammten.
Einige männliche Zuhörer grinsten, andere sahen beiseite, als sein Blick sie streifen wollte. Dr. Teller aus Boston, Massachusetts, hatte damit aufgehört, sich Notizen zu machen. Mit geschlossenen Augen saß er da, wohl, um Bufatzers kleinen Exkurs zur Auffrischung seiner Kräfte zu nutzen.
Der Auftraggeber drängte auf vollständige Demaskierung und Bloßstellung der Gegnerin. Die Lageanalyse hatte indes ergeben, dass dergleichen über das Ziel hinausgeschossen und somit kontraproduktiv gewesen wäre. Es genügte vollauf, die Kürze der Ehe und die russische Herkunft in Nebensätzen durchscheinen zu lassen. Der Rest erfolgte dann im Kopfkino der gutbürgerlichen Richter, und zwar larger-than-life, das dürfen Sie glauben, meine Damen und Herren. Was hatten wir getan? Die Chancen der Dame gemindert? Nein. Die Richter mochten sich ihren Teil gedacht, sich möglicherweise in ihren spießigen Vorurteilen bestätigt gesehen und allenfalls ein wenig geschmunzelt haben. Aber allein deswegen weicht doch kein Richter, der bei Trost ist, vom Pfad der Rechtmäßigkeit ab. Vielleicht haben sie ja auch nur genervt mit den Augen gerollt angesichts dieses rechtlich völlig unerheblichen Sachvortrags. Nein, entscheidend war hier etwas ganz anderes: Dass wir das Bild zerstört hatten, nachhaltig zerstört hatten, das die Dame von sich selbst pflegte und gezeichnet sehen wollte, ihre eigene kleine Lebenslüge zerschlagen, an der sie sich festhielt, so wie wir alle uns irgendwie an unseren eigenen kleinen Lebenslügen festhalten, und zwar oft genug, ohne es überhaupt zu merken.
Jetzt stutzte Bufatzer, als sei er über die eigenen Worte gestolpert, in eine kleine Pause hinein sozusagen, die dadurch entstand, was aber außer ihm selbst niemand bemerkte. Ebenso wenig dies kleine, bohrende Unbehagen, das da ganz plötzlich in ihm aufkeimte. Lebenslügen - hatte er nicht von Lebenslügen gesprochen, an denen sich alle irgendwie festhielten? Was waren denn seine kleinen oder gar nicht so kleinen Lebenslügen? Rasch schüttelte er den Gedanken wieder ab. Jetzt nicht, nicht jetzt!, so sagte er sich im Stillen, aber streng, schüttelte sich kaum merklich und stolperte zurück in seinen Vortrag.
Damit einher ging letztlich eine merkliche Abnutzung des Gegners, dem es von da an nach seiner Wahrnehmung genommen war, entsprechend dem eigenen Bild von sich selbst aufzutreten und der sich stattdessen auf seine vorige Existenz zurückgeworfen sah, die er eigentlich schon für überwunden gehalten hatte. Vergessen Sie nie: Jeder träumt von gesellschaftlicher Anerkennung, besonders aber diejenigen, welche von sich selbst genau wissen, dass diese ihnen nach den Tatsachen nicht zusteht, etwa weil sie ihr Vermögen mit unsauberen Mitteln ergaunert haben. Die Raubritter von gestern, sie wollen die Adligen von morgen sein. Einmal wohlhabend geworden, sind diese Damen und Herren bereit, für den schönen Schein sehr hohe Summen einzusetzen und entsprechend verstört, am Boden zerstört gar, wenn dieser schöne Schein, dieses fabrizierte Bild von sich selbst, allen Mühen zum Trotz doch an der Wirklichkeit zerbricht. Aber bitte verzeihen Sie mir diesen kleinen, launigen Exkurs und lassen mich in der Schrittfolge der kybernetischen Sequenzierung fortfahren.
Bufatzer räusperte sich abermals. Dann nahm er seine goldene Lesebrille ab und rieb sich mit dem Handrücken über die Augen. Auf einmal war er sich seiner Escort-Anekdote selbst nicht mehr so sicher, fand sie gewöhnlich, schmierig, sogar irgendwie schäbig. Versuchte nicht jeder drittklassige Winkeladvokat, jeder Anfänger, seinen Gegner in ein schlechtes Licht zu rücken oder gar in den Dreck zu ziehen? War das, was er soeben zur Illustration des eigenen, angeblich doch so revolutionären Ansatzes zum Besten gegeben hatte, nicht vielmehr kümmerliches Armutszeugnis desjenigen, dem jedes Mittel recht war? Weil ihm die Sachargumente fehlten? Dies war nun nicht gerade der Punkt, den er gesetzt wissen wollte. Gut, in dem Beispiel hatte er seinen Auftraggeber davon abgebracht, Klartext zu reden. Soviel immerhin. Doch was änderte das schon groß?
Hinzu kam dies kleine bohrende Unbehagen, das nicht weggegangen war, und das ihn selbst betraf. Lebenslügen.
Verzeihen Sie bitte, sagte er daher noch einmal, und nun ganz ohne die Arroganz und Scheinheiligkeit von noch vor ganz Kurzem. Er nahm einen Schluck Wasser. Dann setzte er die Brille wieder auf und justierte sorgfältig deren Sitz auf seiner Nase.
Doch dann geschah etwas Unerwartetes: Es meldete sich spontan-initiativ zu Wort der Equity-Partner Dr. Rüdiger Bildat aus Frankfurt am Main, der an diesem Abend als Gast zugegen war. Zwar waren Wortmeldungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch gar nicht vorgesehen, doch streng genommen meldete sich Dr. Bildat aus Frankfurt auch gar nicht zu Wort, er ergriff es einfach. Bufatzer, noch peinlich berührt vom eigenen Vortrag und auf abgründige Weise erschüttert von diesem Anderen, Verborgenen, war es nicht unrecht. Und so ließ er den Gast gewähren.
So einen Fall hatte ich auch einmal, sagte dieser, sichtlich amüsiert. Auch bei mir war es auch eine wohlhabende Witwe - aber ohne Migrationshintergrund, und älter. Älter. Leider.
Dr. Bildat legte eine beredte Pause ein und ließ nun seinerseits den Blick süffisant schweifen. Die Leute sahen ihn erwartungsvoll an, waren sein Publikum. Sichtlich genoss er den Augenblick.
Für diese verfolgte ich einen ebenso namhaften wie aussichtslosen Herausgabeanspruch und hatte mir, nunja, wir können hier ja offen reden, ein recht stattliches Erfolgshonorar ausbedungen, nämlich, gegen überschaubare Ausgleichszahlung, einen Dreiundsechziger E-Type Lightwight. Einen Lightweight also, sagte er mit bedeutungsschwangerem Tonfall und mit nach oben gerecktem rechtem Zeigefinger, wenn Sie wissen, was ich meine.
Niemand wusste es. Bildat war es einerlei.
Kurz gesagt drehte ich den Fall, gewann und ließ mir qua Vollmacht den Jag herausgeben. Dann wies ich die vereinbarte Zahlung an die besagte Dame an. Drei Monate später: Kollegenpost. Sie wünscht Herausgabe des Erlangten gemäß Auftragsrecht.
Ich erst mal baff, das können Sie glauben. Schließlich stand der Wagen längst in meiner Garage, zugelassen auf meine Frau!
Ich rief den Kollegen an, das sei anders besprochen gewesen und so weiter. Das Übliche. Und was soll ich Ihnen sagen: der Kollege ließ nicht locker, als hätte die Alte jetzt ihm den Lightweight versprochen. Nun war guter Rat teuer.
Bufatzer versuchte, einigermaßen taktvoll auf seine Armbanduhr zu blicken: Die Zeit lief.
Ich probierte dies und das. Alles ohne Erfolg. Schließlich bekam ein Referendar von mir heraus, dass die Alte Mitglied im Kuratorium des regionalen Freundeskreises „Das bedrohte Kulturgut Osthessen“ war. Diesen Umstand flocht ich ganz unschuldig in mein nächstes Schreiben ein und hörte nie wieder von der Sache. Bis heute übrigens.
Er lachte.
Ein wirklich gutes Beispiel, sagte Bufatzer, der die Initiative somit zurückerlangte. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Bildat.
Tatsächlich hatte das Beispiel gerade gezeigt, dass man auch ohne unnötige Zerstörung, minimalinvasiv sozusagen, zum Ziel gelangen konnte, wenn man es, wie seinerzeit offenbar Dr. Bildat, nur sensibel genug anstellte. In seinem eigenen Beispiel war dies anders gewesen, so dass der Kollege im Grunde die Armseligkeit von Bufatzers kleiner Prostituiertenepisode noch deutlicher hervortreten ließ. Er würde diese nie wieder bringen, soviel war jedenfalls sicher. Jetzt galt es, nur schnell zurück zu kehren zu seinem eigenen Redetext. Wo war er doch gleich stehen geblieben? Das Bild von sich selbst, ja.
Er verharrte für einen weiteren Augenblick. Dann nahm er den goldenen Kugelschreiber zur Hand und stieß damit gegen sein Glas, um einen neuen Gedanken einzuläuten.
KLING.
Wer schreibt, der bleibt, meine sehr verehrten Damen und Herren, und Grundlage unseres Systems ist, wie ich ja bereits darlegte, die Verschriftlichung eines lebensweltlichen Sachverhalts. Dies erscheint, für sich betrachtet, für den Juristen zumal, weder neu noch ungewöhnlich. Doch ist es wie so oft im Leben: der erste Schein trügt.
Zwar ist das traditionelle Wirkmittel - und zugleich Code des Rechts - das geschriebene Wort und dessen Auffassung durch die Gemeinschaft der Rechtskundigen. Doch wie schreibt der Rechtsanwalt? Richtig, er schreibt gar nicht, allenfalls unterschreibt er.
Der Rechtsanwalt sitzt in seinem Zimmer und diktiert.
Zu seiner Zeit hatte Dr. Herold immer wieder anekdotisch zum Besten gegeben, die schmale Doktorarbeit einst seiner Sekretärin diktiert zu haben. Wenigstens keine Tippfehler. Ja, so war er gewesen. Immer ehrlich und aufrichtig. Ein Vorbild eben. Bufatzer betrachtete dessen Waterman in seiner Hand. Aber halt, er war im Begriff, sich in seinen Gedanken zu verlieren. Der Rechtsanwalt diktiert, ja. Er diktiert.
Das hat erwiesenermaßen den Vorteil zumeist nachvollziehbarer Gedankengänge. Was schon einmal laut daher gesagt und gehört wurde, das wird in aller Regel nicht völlig unverständlich sein. Der diktierte Text unterliegt somit zunächst einer Selbstkontrolle durch den Rechtsanwalt und - nicht zu vergessen - dem kritischen Ohr einer guten Sekretärin.
Bufatzer sah von seinem Manuskript auf und suchte im Raum nach Frau von Fleischer. Ah, da stand sie. Er nickte ihr zu und lächelte sie freundlich und dankbar an.
Hinzu kommt, wie wir alle wissen, der wichtige Aspekt der Beschleunigung: Routiniertes Diktieren ist nach meiner Erfahrung rund dreimal so schnell wie geübtes Selberschreiben.
Das alles ist gut, meine Damen und Herren, es ist sogar sehr gut. Vor allem ist Verständlichkeit eine hohe Tugend, und wir Rechtsanwälte genügen in dieser Hinsicht traditionell höchsten Ansprüchen, und zwar entgegen böswillig kolportierten Vorurteilen, die anders lauten.
Die Frage ist jedoch, auf welcher Stufe die Verschriftlichung einsetzt, einsetzen sollte. Bitte bedenken Sie, wir reden hier von einer Schwelle, von einem Übergang von Sinneseindrücken und freischwebenden, flüchtigen Gedanken zu deren verbindlichen Fixierung. Ich meine, dass die mit dem Schriftsatzdiktat einhergehende traditionelle Schwellensetzung - wie schon zuvor das traditionelle Wer-Will-Was-Von-Wem-Woraus oder auch dieses hasenfüßige Gebot des sichersten Wegs - den hochkomplexen Lagen unserer Beratungstätigkeit nicht mehr gerecht wird, und zwar schlicht und ergreifend deswegen, weil sie erst viel zu spät erfolgt. Der traditionell arbeitende Rechtsanwalt begeht also im hochkomplexen Wirtschaftsmandat gleich zwei Kardinalfehler: Als erstes verengt er seinen Blick vorschnell auf das Rechtliche, auf die sogenannten Anspruchsgrundlagen und damit auf die greifbaren Prozessverhältnisse. Er gelangt auf diesem Wege zwar zu einer Vereinfachung, doch ist diese, wie gezeigt, nicht selten durch rechtlich induzierte Erwägungen geleitet, die letztendlich fallfremd sind. Solches Denken entfernt, ja, es entfremdet den Anwalt von dem eigentlichen Anliegen seines Auftraggebers. Der zweite Kardinalfehler besteht darin, dass er, ausgehend von der trügerischen Sicherheit dieser rechtlich induzierten Schwerpunktbildung gleich risikoavers auf den vermeintlich sichersten Weg schielt und alle anderen, womöglich hochinteressanten Gestaltungen vorschnell ausblendet, vielleicht sogar unbewusst ausblendet. Solcherart in seinem Denken deformiert, wird er weitere sachfremde Vereinfachungen vornehmen, die dann, oft mühsam genug, in das Schriftsatzdiktat Eingang finden. Vor der Herausforderung, quasi aus dem Stehgreif hochkomplexe wirtschaftliche Zusammenhänge aus einer mehr oder weniger freischwebenden Gedanken- und Mitgedankenwelt gleich in Schriftsatzform zu gießen, wird er schon aus schierer Notwendigkeit gern den Vereinfachungen des Wer-Will-Was-Von-Wem-Woraus oder auch den Verlockungen des vermeintlich sichersten Wegs nachgeben und am Ende froh sein, überhaupt einen irgendwie kunstgerechten Schriftsatz zuwege gebracht zu haben: Zwar alle Anspruchsgrundlagen gesehen und alle Risiken gemieden, aber das Anliegen des Auftraggebers aus den Augen verloren, und zwar weit ab von der Ideallinie.
Die letzten Worte sprach er mit Nachdruck und erhob dazu warnend den Zeigefinger. Dann machte er eine kleine, rhetorische Pause.
Es kann aber nicht immer der sicherste Weg beschritten werden, zumal dann nicht, wenn man besondere Ziele erreichen möchte. Wir müssen unsere Risikoscheu ablegen, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir müssen bereit sein, zu wagen!
Für einen Augenblick fixierte er sein Publikum. Auch dieser Punkt war ihm wichtig. Die Leute hörten ihm zu, gewiss, so viel meinte er in ihren Mienen lesen zu können. Aber folgten sie ihm auch auf seinem Weg? Man würde sehen. Einstweilen senkte er den Blick in sein Manuskript und fuhr fort.
Unser System, SAUSEWIRK, vermeidet diese Fallstricke, indem es die Schwelle der Verschriftlichung zurückverlegt, und zwar so weit wie möglich zurückverlegt. Es wird von Anfang an geschrieben und es wird immerfort geschrieben, und zwar ohne Unterlass. Das fördert nicht nur die intellektuelle Durchdringung der Lage, sondern führt auch dazu, dass sich auch die Arbeit, die niemals das Licht der Schriftsätzlichkeit erblicken wird, auf derselben Ebene geistiger Durchdringung bewegt, nämlich der Ebene der Schriftlichkeit. Dies ist einerseits sicherlich kostspieliger Mehraufwand, anderseits jedoch sichert dieser Mehraufwand letztlich bereits den entscheidenden Vorsprung des Auftraggebers gegenüber seinen Gegnern.
Bufatzer machte eine kurze Pause und vergewisserte sich insbesondere, dass er seinen Ehrengast, Dr. Teller aus Boston, Massachusetts, noch nicht verloren hatte. Der indes schien konzentriert und ganz in seine Aufzeichnungen vertieft, mit denen er offenbar schon bald zu dem Referenten aufgeschlossen hatte und den Blick interessiert wieder auf diesen richtete. Bufatzer nickte und setzte seinen Vortrag fort.
Als Nächstes erweitern wir den Kreis der Innewerdung, freilich noch ohne diesen zu verlassen, bitten den Auftraggeber zum Lagevortrag und präsentieren ihm die Ergebnisse unserer Arbeit. Als wesentliche Leistung dieser Phase vermitteln wir ihm die nachhaltige Reduktion von Komplexität: Die Lage erscheint in ihrer größtmöglichen Einfachheit. Und das im guten Sinne: Wie eingangs gesehen, führt ja auch das traditionelle Denken in Anspruchsgrundlagen zu einer Vereinfachung des Sachverhalts, dies jedoch mit vom Recht vorgegebener Schwerpunktbildung, also letztlich durch Blickverengung, die mit der hier verfolgten, von der Sache selbst induzierten Schwerpunktbildung nicht begriffsnotwendig übereinstimmt. Uns aber muss es ganz entscheidend um die zutreffende, zielführende, mithin allein richtige Schwerpunktbildung gehen, also um die Vermeidung von Blickverengung und Schwerpunktverfälschung.
Unter Umständen haben wir tagelang an dieser ersten Präsentation gearbeitet, die, liebe Kolleginnen und Kollegen, noch keine einzige juristische Überlegung enthält. Im Gegenteil haben wir alles Juristische bewusst ausgeblendet oder doch zumindest zurückgestellt, um unser Denken möglichst unvoreingenommen und frei davon zu halten. Denn, Sie werden sich erinnern, das Recht begrenzt unser Handeln, nicht aber unser Denken.
Wenn es uns gelungen ist, dem Auftraggeber die Inhalte unserer Präsentation erfolgreich zu vermitteln, ist die Zeit gekommen, ihn nach seiner Absicht zu befragen. Die Reduktion von Komplexität, also die bis hierhin wesentliche Leistung unserer Beratung, wird ihm dabei helfen, mehr noch, sie wird ihm dazu verhelfen, sein eigenes Interesse nun deutlicher zu erkennen und sich auf eine Absicht festzulegen. Es ist auch gut möglich, dass er sein Vorhaben nun, da er klarer sieht, fallen lässt. Das ist legitim und für uns Ausweis erfolgreicher Arbeit, insbesondere dann, wenn seine ursprünglichen Motive irrational waren und er dies nun erkennt. Jedenfalls wird er uns dankbar sein, denn im Zweifel haben wir ihm auf diese Weise sehr viel Geld gespart. Er wird auch in diesem Fall nicht bereuen, die Anwaltsfirma Himmelreich & Young eingeschaltet zu haben und uns sogar weiterempfehlen.
Im besten Fall jedoch wird er mit frischem Mut und Elan an seinem Vorhaben festhalten und wir haben eine griffig formulierte Absicht, mit der wir weiterarbeiten können. Diese Absicht steht von nun an allem anderen voran, wir formulieren sie so gut es geht und fügen sie unserer Dokumentation an geeigneter Stelle prominent hinzu. Die Dokumente in ihrer Gesamtheit, also Absicht des Auftraggebers und Lagebild, die Dossiers aller Beteiligten sowie, soweit schon vorhanden, unsere Thesen, Annahmen und Ableitungen sind die Eckpunkte eines interdisziplinären Handlungsplans, der fortan das Rückgrat unserer kybernetischen Sequenzierung bildet.
Mit diesen Worten ließ Bufatzer erneut sein Wasserglas erklingen.
KLING.
Und wenn wir es über diese Klippe geschafft haben, beginnt für uns und unseren Auftraggeber endgültig das große Spiel. Ziel wird es von nun an sein, die Absicht des Auftraggebers umzusetzen. Die Umsetzung hängt von unserer Planung und den anzutreffenden Umständen ab, lässt sich schwer verallgemeinern. Irgendwie, würde ich in erster Näherung sagen.
Er hatte sich verzettelt, nicht mehr rechtzeitig in seinen Sprechtext zurückgefunden, lachte ein wenig unbeholfen und zuckte mit den Schultern. Vielleicht wirkte darin auch der Misserfolg der Escort-Anekdote noch ein Stück weit nach.
Egal wie, sagte er dann. Fatalerweise.
All das war improvisiert. Insbesondere das Egal-Wie war ihm sozusagen herausgerutscht, Überspitzung gewesen, ein Risiko mithin, eine spürbare Inkonsistenz, und in letzter Konsequenz meinte Bufatzer es nicht so, wollte selbst durchaus und ja auch ausdrücklich auf dem Boden des Rechts bleiben, das ja nach seiner Ausgangsthese das Handeln sehr wohl begrenzte. Aber seine Zuhörer sollten doch zumindest versuchen, ihr Denken davon zu befreien, so dass ihm das eingegangene Risiko hier wohl akzeptabel erschienen sein muss, aus didaktischen Gründen sozusagen, oder wie es sonst eben war, wenn einem etwas herausrutschte. Zugleich meinte er aus den Augenwinkeln und mit schlagartigem Unbehagen beobachtet zu haben, wie Dr. Leonard Teller aus Boston, Massachusetts, innehielt mit seinen Aufzeichnungen, gerade so als gelänge ihm das Mitdenken nicht mehr begleitend, sondern erforderte vorübergehend all seine Ressourcen. Die kleine Improvisation war ihm wohl nicht entgangen. Und hatte es auch für den Rest dieses Augenblicks oder Wimpernschlags den Anschein, als wolle sich alles wieder legen und Dr. Teller zu seiner Mitschrift zurückkehren, so legte er seinen Kugelschreiber dann schließlich doch zur Seite, richtete sich in seinem Stuhl auf und sah Bufatzer geradewegs in die Augen.
Wie meinen Sie das?
Tellers Frage, vorgetragen mit einem leichten ungarischen Akzent, mit dem er sein Wiedereinfinden in die deutsche Sprache sozusagen bekleidete und der sich vor allem in der Betonung jeder einzelnen Silbe manifestierte, hatte den Ball zurück auf das Spielfeld geworfen.
Bufatzer war konsterniert. Da er an dieser Stelle improvisiert hatte, also nicht vorbereitet war, hätte Teller sich keine ungünstigere Gelegenheit für seine Intervention aussuchen können. Wahrscheinlich war sie ihm genauso herausgerutscht wie zuvor Bufatzer das Irgendwie-Egal-Wie. Nun aber stand beides im Raum und ließ sich nicht mehr beiseiteschieben oder gar ungeschehen machen. Dr. Teller versuchte es gleichwohl.
Oh, bitte verzeihen Sie mir meine vorlaute Zwischenfrage, die wir natürlich auch gern zurückstellen können, sagte er freundlich und offenbarte neben dem muttersprachlich-ungarischem Akzent nunmehr zusätzlich eine weitere Einfärbung, die dem Umstand geschuldet war, dass er sein langes und erfolgreiches Berufsleben an der nordamerikanischen Ostküste zugebracht hatte.
Wir waren ja, glaube ich, noch gar nicht bei den Fragen angelangt.
Aber er, Aldo Bufatzer, war nicht irgendwer, sondern International Partner bei Himmelreich & Young, und Dr. Leonard Teller aus Boston, Massachusetts, war erstrecht nicht irgendwer. Of Counsel zwar, also gewissermaßen emeritiert, aber immer noch eine große Anwaltspersönlichkeit und graue Eminenz. Zudem war er der Mann, den man eigens nach Hamburg entsandt hatte, um über die Ergebnisse dieses Vortrags, der in diesem Augenblick stattfand, zu berichten. Er hatte keine Wahl, musste etwas begründen und verteidigen, das eigentlich gar nicht seiner Überzeugung entsprach. Nicht das erste Mal in meinem Berufsleben, dachte er und räusperte sich.
Bitte erlauben Sie mir, verehrter Herr Dr. Teller, dass ich für meine Antwort ein klein wenig aushole.
Weiter ausholen. Warum eigentlich? Warum sagte er nicht einfach, wie es war: Dass das Recht ja durchaus und jedenfalls unser Handeln beschränke, dass er überspitzt hatte, um zum Nachdenken anzuregen, vielleicht sogar, dass es ihm in seiner schlussendlichen Zuspitzung nur herausgerutscht war? Doch das tat Bufatzer nicht, als sei er nicht nur Dr. Teller, sondern auch sich selbst schuldig, weiter auszuholen.
Das Recht ist kein geschlossenes System, es wandelt sich nicht aus sich selbst heraus, sondern auf Einwirkung von außen hin. Im Detail ist es widersprüchlich, fehleranfällig und unterliegt der ständigen Gefahr der Beherrschung durch Mittelmaß, Nichtbeachtung und Verrohung. All das kann zwar kein vernünftiger Mensch wollen, es ist aber leider trotzdem so. Zwar begrenzt dieses Recht, wie wir gerade gehört haben, unser Handeln. Aber was ist das Recht? Stellt es eine absolute, unüberwindliche Grenze dar? Nein, denn man kann es, im Guten sozusagen, gestalten und im Bösen missachten oder sogar brechen. Davon, dass das so ist, leben wir nicht zuletzt als Rechtsanwälte.
Einige im Raum lachten zustimmend, während Dr. Teller immerhin milde lächelte und ermunternd nickte.
Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist eine offene Flanke des Rechts. Eine weitere offene Flanke des Rechts besteht in seiner Unschärfe, die es mit allen menschlichen Denkvorgängen gemeinsam hat. Alles menschliche Denken und Streben mündet letztlich in Unschärfe.Was meine ich damit? Wie man hört, ist Eindeutigkeit selbst in den sogenannten exakten Wissenschaften ein Desiderat, das unerreichbar bleibt. Stattdessen Unschärfe, Anomalien, Paradoxien allenthalben. Das alles gilt natürlich auch im Recht, das ja zumindest für uns Rechtsanwender streng genommen überhaupt keine Wissenschaft ist, sondern eine Kunst.
Dr. Teller lächelte zwar nicht mehr, doch nickte er mit Entschiedenheit zu Bufatzers letzten Worten, was dieser mit Erleichterung zur Kenntnis nahm.
Denken Sie etwa nur an die Abgrenzung von grober Fahrlässigkeit und bedingtem Vorsatz. Wird-Schon-Gutgehen versus Sei‘s-Drum, den bösen Erfolg billigend in Kauf nehmen - meine Damen und Herren, das sind doch alles bloß grobe Faustregeln, die nur bei einigermaßen eindeutigen Sachverhalten wirklich greifen. Und wer sich die Mühe macht und in die dicken Bücher der großen Gelehrten unseres Faches schaut, der findet statt einer groben Faustregel dann fünf feinere Faustregeln oder eine zwanzigfältige Kasuistik, deren Anfang man vergessen hat, noch ehe man zum Ende gelangt ist.
Wiederum zustimmendes Lachen im Saal. Bufatzer lächelte zufrieden.
Also, sagte er mit wieder erstarkter Autorität, gerade so, als wolle er vermöge dieses einen Wortes die soeben erfahrene Zustimmung für sich als Guthaben verbuchen.
Dann räusperte er sich und fuhr fort.
Weitaus profanere Unschärfen, zum Teil handelt es sich auch schlicht um Unwägbarkeiten, ergeben sich beispielsweise auf prozessualer Ebene im Zusammenhang mit der Beweislast. Wen sie trifft, der muss liefern. Aber im Grunde wissen wir nichts, gar nichts. Wir wissen nicht, was geschehen ist. Auch der Auftraggeber weiß es nicht unbedingt. Der Zeuge weiß es, vielleicht. Hoffentlich erinnert er sich, und, erinnert er sich richtig? Der Mensch vergisst ja so schnell! Gut möglich auch, dass seine Erinnerung längst mit Versatzstücken ganz anderer Erlebnisse verunreinigt und damit für Beweiszwecke unbrauchbar ist. Das ist dann der menschliche Faktor.
Und weiter mit dem menschlichen Faktor. Wie weiß doch gleich der Volksmund: Zwei Juristen - drei Meinungen. Im wahren Kern dieser bösartigen kleinen Floskel erkenne ich wieder die Unschärfe, die der eine eben so und die andere anders interpretiert - oft mit schwerwiegenden Folgen. Oder nehmen Sie die Person des Richters, auf die man trifft, die unserer Sache mehr oder weniger gewogen sein kann. Das ist ein ganz großer Unsicherheitsfaktor, den wir, denke ich, alle aus eigener Erfahrung kennen, und zwar im Guten wie im Bösen.
Sie sehen, auch die alte Anwaltsrede, dass man vor Gericht und auf hoher See in Gottes Hand sei, kommt nicht von ungefähr. Sie sollte aber auch niemals leichtfertig daher gesagt werden, und schon gar nicht, um damit gegenüber dem Auftraggeber eigene Schwächen zu kaschieren oder gar die eigene Unlust, die Sache zu übernehmen oder weiter voranzutreiben. Das bitte nicht! Erfolgreiche Anwaltsarbeit erfordert nämlich auch, nicht vorschnell gerichtliche Hilfe in Anspruch - und damit die genannten Unwägbarkeiten in Kauf - zu nehmen. Zu diesem Punkt werde ich später in meinem Vortrag zurückkehren.
Eine der unbequemsten und am beharrlichsten verleugneten, in westlichen Gesellschaften gar tabuisierten offenen Flanken des Rechts ist jedoch die politische Macht und ihre Ausübung. Schauen Sie nur auf unser europäisches Zollrecht. Ist es in irgendeiner Weise legitim, ein und dieselbe Warenart unterschiedlich zu besteuern, je nach dem, aus welchem Ursprungsland sie stammt? Manchmal vielleicht, regelmäßig jedoch nicht. Ein anderes Beispiel: Ausfuhrerstattungen. Warum hatte Brüssel über lange Jahre mit Milliarden von Steuergeldern landwirtschaftliche Qualitätsprodukte drastisch, das heißt, weit unter Produktionskosten, verbilligt, wenn diese in bestimmte Länder der sogenannten Dritten Welt exportiert worden waren? Entwicklungshilfe? Wohl kaum, wenn man bedenkt, dass auf diesem Wege die fragilen lokalen Landwirtschaften systematisch zugrunde gerichtet wurden, und zwar mit verheerenden Folgen für die betroffenen Menschen dort. Nein, meine Damen und Herren, der Grund war böse: Destabilisierung, die Verteidigung eigener Macht und eigenen Einflusses und vielleicht sogar Schaffung oder Erhalt fragwürdiger Faustpfänder im Ringen um internationale Handelsabkommen, und zwar gar nicht gegenüber diesen bemitleidenswerten Drittweltstaaten sondern gegenüber ganz anderen Staaten, China etwa. Und unsere ruhmreiche Kanzlei Himmelreich & Young hat noch bis vor ganz Kurzem einen großen Bissen von diesem vergifteten Kuchen abbekommen, indem wir gierige Exporteure gegenüber dem Hamburger Hauptzollamt vor Gericht vertreten und dann und wann sogar herausgehauen haben.
Oder nehmen Sie den neuen, naja gut, den nicht mehr ganz so neuen Paragraphen 299 unseres Strafgesetzbuchs über die Strafbarkeit der Bestechung privater Angestellter selbst im Ausland zum Schutze des internationalen Wettbewerbs. Natürlich schmieren unsere Auftraggeber irgendwelche unbekannten zentralasiatischen Betriebsleiter, um an Aufträge zu gelangen. Und wenn sie es nicht tun, dann tun es andere. Und wenn andere es tun, dann verliert der Wirtschaftsstandort Deutschland Umsatz, dann gehen hier in Hamburg Arbeitsplätze verloren. Und warum ist das Recht gleichwohl so wie es ist? Weil, verzeihen Sie mir, verehrter Herr Dr. Teller, weil es unsere amerikanischen Freunde von Brüssel so verlangt haben und man sich dort willig irgendwelchen übergreifenden Interessen unterworfen hat, die von außen völlig intransparent sind.
Dr. Teller zog die Augenbrauen hoch, wenn auch kaum merklich. Hier direkt angesprochen worden zu sein, missfiel ihm, in diesem Ton zumal. Was hatte er damit zu tun, und: Stimmte es überhaupt, was dieser Bufatzer da sagte, über seine amerikanischen Freunde? Unerhört eigentlich. Er würde darauf zurückkommen. Aber nicht jetzt, so besann er sich schnell, denn er wollte ihn nicht schon wieder unterbrechen, zumal er den Anlass für diese neuerliche Entgleisung ja gewissermaßen auch noch selbst gegeben hatte, mit seiner ersten Unterbrechung. Unterbrechungen machten es nur schlimmer, so schien es. Also schloss er einfach die Augen und wartete ab, dass es irgendwie weiterginge, ohne Unterbrechung. Bufatzer indes, noch ganz im Schwunge des eigenen Gedankens und gelungenen Arguments, hatte von all dem nichts bemerkt.
Das Recht der Wirtschaftsteilnehmer ist weithin amoralisch, so redete er weiter, zum Teil ist es unmoralisch, böse sogar - und zwar von Staats wegen, und soweit dies so ist, wird es durch den bloßen Umstand seiner formellen Kodifikation zwar vielleicht legalisiert, jedoch wohl schwerlich legitimiert. Trotzdem spielen wir mit, wollen in der ersten Reihe sitzen, wenn zum großen Reibach geblasen wird - und werden damit selbst systemerhaltend und staatstragend. Und dies ironischerweise auch dann, wenn wir den Staat verklagen, wenn wir gegen ihn obsiegen gar - solange wir nur nach seinen Regeln spielen.
Erst jetzt blickte er wieder von seinem Manuskript auf und hinein in die Runde.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrter Herr Dr. Teller, Sie alle wissen, dass ich derartige Ketzereien außerhalb dieser heiligen Hallen nicht sagen würde. Musste mein kleiner, noch dazu unvorbereiteter und gänzlich improvisierter Exkurs auch punktuell und holzschnittartig bleiben, so kann doch an einer Tatsache überhaupt kein Zweifel bestehen: Dass am Ende des Tages das Recht keine absolute, sondern eine strategische Größe ist. Es liegt also nicht per se ein moralischer Unwert darin, gegen das Recht zu verstoßen. Meist wird es so sein, zwingend indes ist es keinesfalls. Unsere Aufgabe als Anwälte, als unabhängige Organe der Rechtspflege, besteht also gegebenenfalls darin, dem Auftraggeber vor Augen zu führen, was es heißen kann, sich mit strategischen Größen über Kreuz zu legen. Doch eines habe ich mir immer gesagt, bevor ich meinem Auftraggeber gegenübertrat: Ich bin kein Staatsanwalt und erst recht kein Richter. Ich bin Rechtsanwalt. Und als solcher werde ich Sie niemals für etwas verurteilen, das Sie getan haben - und erst recht nicht für etwas, das Sie nicht getan haben.
Alles andere ist Unschärfe.
Bufatzer machte eine Pause und nahm einen Schluck Wasser. Er hatte sich zurückgehalten, die Radikalität seiner Ansichten zum Verhältnis von Rechtsanwälten, Staatsanwälten und Richtern nur angedeutet. Unschärfe? Tatsächlich war sein Blick auf die anderen Berufsgruppen der Rechtspflege von äußerster Schärfe geprägt. Wohl arbeiteten sie alle im großen Weinberg des Rechts, doch eben in unterschiedlichen, ja ganz unvereinbaren Funktionen, deren ewiger Antagonismus, wiewohl eingehegt durch die Regeln des fairen Verfahrens, doch immer spürbar und gegenwärtig war, und jedes falsche Einvernehmen Verrat.
Dann fasste er sich wieder und riss sich selbst mit einem vernehmlichen Räuspern aus den abschweifenden Gedanken.
Verehrter Dr. Teller, ich hoffe, Ihre Frage somit zumindest näherungsweise beantwortet zu haben. Bitte verzeihen Sie mir meine Bemerkung, die Sie zum Einhaken bewog, denn sie war in ihrer Verkürzung frivol, Ihre Nachfrage indes mehr als berechtigt. Erlauben Sie mir nun, dass ich fortfahre.
Er blickte ihn an.