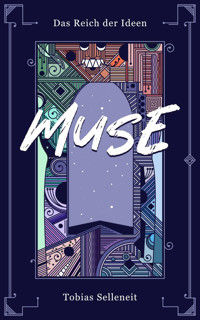
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Als Laura Kowalczyk an ihrem 30. Geburtstag verkatert aufwacht, ist die Welt nicht mehr dieselbe. Graue Häuserfassaden sind bunt gestrichen und spießige Nachbarn zu Street Artists mutiert. Dann lernt sie Kalle kennen, den nur sie sehen kann und der behauptet eine Muse zu sein. Musen reisen zwischen dieser Welt und dem Reich der Ideen hin und her, doch nun sind sie in unserer Welt gefangen und inspirieren unfreiwillig die gesamte Bevölkerung. Während die Menschen en Masse versuchen sich selbst zu verwirklichen, pflügen bald mythische Kreaturen mit hoher Zerstörungswut durch Lauras Nachbarschaft. Gemeinsam mit Lauras bester Freundin Özge und dem Einzelgänger Andi suchen Kalle und Laura nach der Ursache für die ungewöhnlichen Ereignisse. Sie merken bald, dass nicht weniger als die Realität selbst auf dem Spiel steht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 478
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Prolog
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
- 10 -
- 11 -
- 12 -
- 13 -
- 14 -
- 15 -
- 16 -
- 17 -
- 18 -
- 19 -
- 20 -
- 21 -
- 22 -
- 23 -
- 24 -
- 25 -
- 26 -
- 27 -
- 28 -
- 29 -
- 30 -
- 31 -
- 32 -
- 33 -
- 34 -
- 35 -
- 36 -
- 37 -
- 38 -
- 39 -
- 40 -
- 41 -
- 42 -
- 43 -
- 44 -
Epilog
Danksagung
Über den Autor
Tobias Selleneit
Das Reich der Ideen
MUSE
Roman
© 2025 Tobias Selleneit
Website: tobiasselleneit.de
Covergrafik von: Simon Hanke
2. Auflage
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: Tobias Müller, c/o COCENTER | Koppoldstr. 1, 86551 Aichach, Germany .Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
Für alle, die sich fragen,
ob sie den Kuss der Muse herbeisehnen
oder fürchten sollen.
***
Für Manu,
ohne Dich hätte ich
so vieles gar nicht geschafft.
***
Für Simon,
Du hast aus meinen Worten
die Farben herausgezaubert.
Prolog
Matsch und Schlamm quälen sich aus dem Profil der schweren Stiefel. Die nasse Erde begräbt Grashalme unter sich, die sie bis vor Kurzem noch genährt hat. Jeden einzelnen Schritt zwingt ER diesem unebenen Gelände förmlich auf. Es fühlt sich an, als wäre ER nicht willkommen, als würde sich die Umwelt hier gegen SEINE bloße Präsenz stemmen. Und gerade deswegen fühlt ER sich gut. Jeder entwurzelte Grashalm, jedes zerrissene Stück Moos ist ein kleiner Sieg. Endlich.
Seitdem ER hierhergebracht wurde, war alles, was SEINE Augen erblickten, ein Symbol SEINER Demütigung. Jeder weitere Tag ein zusätzlicher Nagel im Fleisch SEINER Existenz. Wie sehr ER sich wünscht, all dem endlich zu entkommen. Doch noch ist ER nicht am Ziel.
Je weiter ER nach oben steigt, desto weniger erklärt sich der schlammige Boden bereit, IHN weiterhin zu tragen. Immer tiefer sinkt ER ein, als würde die Erde IHN verschlingen wollen und dann doch nach wenigen Zentimetern den Appetit verlieren.
Der steile Anstieg vor IHM versperrt IHM den Blick auf den Horizont. Vereinzelte grüne Flecken verteilen sich auf matschigem Braun und scheitern dabei, der Szenerie Farbe zu verleihen. Stattdessen betonen sie die Trostlosigkeit der restlichen Landschaft eher noch: Ein bisschen Moos hier, Büschel von Gras dort. Nur wenige Meter hinter IHM steht tatsächlich ein Baum. Einsam, alt und knorrig und insgesamt mehr tot als lebendig.
Der Himmel über IHM ist so grau wie der Nebel, der sich hier die Täler entlang zieht.
ER zieht seinen linken Stiefel erneut mit einem nassen Reißen aus dem Matsch, wuchtet SEINEN Fuß auf einen nassen Felsen und greift mit der rechten Hand in die nasse Erde über SICH. Eine letzte Kraftanstrengung. ER ist oben.
SEINE Stiefel sinken nun so tief in den Boden, dass ER sie ausziehen müsste, um sich aus dem Griff des Schlammes zu befreien. ER steht auf einer schmalen Ebene, hinter IHM der Anstieg, den ER gerade hochgestiegen ist, und vor IHM – weniger als einen Schritt entfernt – ein Abgrund.
Wobei, ist das wirklich ein Abgrund? Nach unten, nach oben und nach vorne ist einfach alles unbestimmt und grau. Der Untergrund endet zwar abrupt wie eine Klippe am Meer, doch unter sich hört ER kein Wasser rauschen und keine Wellen an Felsen klatschen. ER kann dort auch keine Schlucht erkennen und kein Tal. Es gibt keine Formen, hinter dem Grau erkennt ER kein Land. Es gibt nicht einmal Anzeichen für die Existenz eines dahinter. Dort, wo sich nach aller Logik der Himmel befinden sollte, erkennt ER weder Sonne noch Wolken.
ER starrt weiter in das Grau. Lange und intensiv und unablässig. Dann erkennt ER Schemen. ER grinst.
- 1 -
Der Morgen für Laura beginnt mit Kindergeschrei und einem Mordskater.
Die Kinder spielen vor dem Wohnblock, in dem sich ihr Apartment befindet, und gehören vermutlich zu irgendwelchen Nachbarn. Der alkoholbedingte Kater allerdings ist ihr eigener. Verstärkt wird dieser – neben dem Kinderlärm, der durch ihr gekipptes Fenster zu ihrem Bett dröhnt, noch zusätzlich durch die Sonne, die ihr Licht erbarmungslos in Lauras Gesicht wirft. Die Helligkeit treibt ihre Augen, nach einem kläglichen Versuch sie zu öffnen, direkt in den Rückzug. Ein rötliches Licht drückt sich allerdings weiterhin grell und bedrohlich durch ihre geschlossenen Lider.
Die Stimmen erwachsener Menschen mischen sich unter die schrillen Töne der Kinder. Laura kann Ooohs und Aaahs hören. Was ist da draußen los?
Doch bevor Laura auch nur daran denken kann, diese Frage zu beantworten, drängt sich ihr Kater wieder in den Vordergrund. Genauer: Die Geschmackskombination von schalem Bier und kaltem Rauch auf ihrer Zunge. Ihr Magen fühlt sich plötzlich seltsam leicht an. Sie braucht Wasser, wenn sie eine Katastrophe verhindern will.
Sie öffnet ihre Augen wieder einen kleinen Spalt – nur so viel, dass sie die Umgebung um sich herum erahnen kann – und richtet ihren Oberkörper vorsichtig auf. Alles dreht sich. Sie platziert beide Füße fest auf dem Boden, in der Hoffnung, dass sie die Welt, die sich um sie herum zu drehen scheint, ein kleines bisschen abbremsen. Sie schließt ihre Augen erneut und tauscht die Farben der Welt gegen das leuchtende Rot der Innenseite ihrer Lider.
Die Kinder vor dem Haus streiten sich nun in einer Sprache, die Laura nicht versteht. Sie lachen, schrill und glücklich, wie nur Kinder lachen. Kurz darauf beginnen sie laut, Tiergeräusche nachzuahmen.
Laura nimmt einen tiefen Atemzug. Erstmal klarkommen. Ein – und aus. Und ein – und aus. Es bringt nichts. Alles dreht sich weiter und ihr Magen fühlt sich an, als würde er wie ein Heliumballon in ihr schweben. Sie versucht sich abzulenken, indem sie die Tiere errät, die die Kinder imitieren. Sie erkennt recht sicher das stakkatohafte Gekreische eines Schimpansen. Dann der Versuch eines gefährlichen, tiefen Brüllens, bedingt erfolgreich ausgeführt mit einer hohen Kinderstimme. Ein Löwe?
Laura muss würgen und das Ratespiel ist abrupt vorbei. Reflexhaft schießt ihre linke Hand vor ihren Mund, während die rechte sich an den Bettrahmen krallt. Sie seufzt erleichtert: Falscher Alarm.
Laura öffnet nun gegen alle Widerstände tatsächlich ihre Augen, hält den Schock der Helligkeit aus, und steht auf. Sie wankt in Richtung Küchenzeile, wo sich der rettende Wasserhahn befindet, während die Gesetze der Schwerkraft gegen sie arbeiten. Ihr Laminat-Boden könnte in diesem Moment auch der Trickboden von einem Jahrmarkt-Spiegelkabinett sein, bei dem sich die einzelnen Platten in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Der Unterschied scheint marginal.
Sie erreicht die Küchentür, hält sich an deren Rahmen fest und sammelt die Kraft für den Weg zum Wasserhahn. Mit einem großen Schritt überwindet sie die Küchenfliesen, krallt sich mit der linken Hand an der Arbeitsplatte fest, zieht mit der rechten den Hebel am Wasserhahn bis zum Anschlag nach hinten und das kalte Nass beginnt zu fließen. Sie platziert ihren Mund unter dem Hahn und nimmt einen Schluck kaltes Wasser, als sie eine weitere Welle der Übelkeit überkommt. Sie trinkt weiter. Zumindest müsste das Wasser doch eine physische Barriere sein gegen alles, was in die andere Richtung der Speiseröhre wandern möchte. Doch die Taktik geht nicht auf. Sie übergibt sich direkt in das Spülbecken.
Zu ihrem Glück übernimmt das fließende Wasser automatisch viel der Reinigungsarbeit. Sie richtet den Wasserstrahl mit ihrer Hand in die abgelegeneren Regionen der Spüle, um die Reinigung zu vervollständigen und senkt dann ihren Kopf erneut unter den Wasserhahn um ihren Mund mit kaltem Wasser auszuspülen und im Anschluss das freigewordene Magenvolumen mit dem kühlen Nass aus dem Wasserhahn zu füllen.
Sie stellt sich aufrecht hin mit dem Gefühl, etwas vollbracht zu haben, und sieht direkt das Handy, das sie aus unerfindlichen Gründen gestern Nacht in der Küche hatte liegen lassen. Sie wirft einen Blick auf das Display. Drei Prozent Akku, siebzehn Anrufe in Abwesenheit, fünfundzwanzig Nachrichten – und ein freundlicher Hinweis ihres Mobiltelefons, dass sie ihren heutigen Wecker verpasst hat und der nächste Alarm in gut achtzehn Stunden klingelt. Es ist Mittwoch, der 15. Mai, 11:48 Uhr.
In ihrer Magengegend macht sich schnell ein sinkendes Gefühl bereit, das nichts mit ihrer Übelkeit zu tun hat: Es war ihr katerbedingt so schwergefallen, überhaupt zu existieren, dass sie weniger elementare Wahrheiten für den Moment vollkommen verdrängt hatte: Es ist ihr dreißigster Geburtstag. Und sie hätte vor fast drei Stunden in der Arbeit erscheinen müssen. Laura stöhnt. Happy fucking Birthday.
Normalerweise bedeutet arbeiten mit Kater für Laura automatisch Home-Office. Aber zuhause arbeiten ist heute keine Option. Zum einen ist Mittwoch der wöchentliche Teamtag, der ihrem Chef Tim besonders am Herzen liegt, zum anderen, weil es an dem eigenen Geburtstag schnell so wirkt, als würde man gar nicht arbeiten wollen – vor allem wenn man die letzten drei Stunden nicht erreichbar war. Zu guter Letzt hat sie heute einen Termin mit ihrem Chef. In persona. Im Büro. Sehr viele Gründe nicht daheim im Bett zu katern.
Panik. Das Geburtstagskind versucht, sich auf das Wichtigste zu konzentrieren. Sie atmet noch einmal tief durch und die dadurch entstehenden gustatorischen und olfaktorischen Eindrücke machen ihr schnell klar, was die wichtigsten zwei Punkte sind: Zähneputzen und Duschen. Laura geht ins Bad und wirft einen kurzen Blick in den Spiegel. Sie erschrickt vor ihrem Spiegelbild.
Bleiche Haut und dunkle Ringe unter den Augen lassen sie mehr tot als lebendig aussehen. Wäre das charakteristische Muttermal unter ihrem Ohr nicht gewesen, sie wäre sich wohl nicht mal sicher gewesen, dass sie wirklich sich selbst im Spiegel betrachtet. Aber dieser beinahe sternförmige Fleck begleitet sie schon, seit sie auf dieser Welt ist. Außerdem erkennt sie ihre Klamotten sofort, denn anscheinend war sie mit denselben Sachen eingeschlafen, mit denen sie auch gestern Abend unterwegs war. Traurigerweise ist ihr das bis gerade eben nicht einmal aufgefallen. Sie zieht sich aus und wirft ihre Klamotten auf den Boden.
Die Dusche ist eine Katzenwäsche, die nur dem Ziel dient, Rauchpartikel und Alkoholausdünstungen von der Haut zu waschen. Ihre Haare allerdings muss sie einshampoonieren, denn die riechen so stark nach Rauch, dass ihr jedes Mal übel wird, wenn sich eine Strähne auch nur kurz unter ihrer Nase verfängt.
Nach der Dusche folgt ein sehr vorsichtiges Putzen ihrer Zähne, bei dem Laura unbedingt vermeiden möchte mit der Zahnbürste Würgreflexe auszulösen. Doch der Aufwand stellt sich schnell als verschwendet heraus, denn der scharfe Geschmack der Mundspülung bringt sie kurz darauf dazu, sich über die Toilettenschüssel zu beugen und das vor wenigen Minuten zugeführte Wasser schneller als geplant wieder in den städtischen Kreislauf zurückzuführen.
Also trinkt sie erneut einige Schlucke frisch aus dem Hahn, hoffentlich diesmal mit nachhaltigerer Wirkung. Sie muss an Sisyphus denken. Wasser rein, Wasser raus – und wiederholen. Sie wirft einen kurzen Blick in den Spiegel und erschrickt weniger vor ihrem Spiegelbild als noch vor der Dusche. Immerhin. Sie sieht noch immer furchtbar aus. In Rekordgeschwindigkeit platziert sie Concealer unter ihren Augen und trägt Labello auf ihre rissigen Lippen auf. Sie blickt wieder in den Spiegel – besser wird’s nicht.
Sie greift sich die erstbesten Klamotten, die irgendwie fürs Büro angemessen sind – die meisten davon vom Fußboden – schnappt sich die Handtasche von gestern Abend, wirft ihre Schlüssel hinein und stürmt mit nassen Haaren aus der Wohnung – nur um wenige Sekunden später die Wohnungstür wieder aufzusperren. Sie hat ihr Handy liegen gelassen. Das kann sie dann im Büro laden.
Als Laura schließlich vor ihre Haustür tritt, steht sie plötzlich und unerwartet im Urwald.
Das liegt nicht an der angenehmen frühsommerlichen Wärme, sondern an ihrem Hauseingang. Die einzelnen Zugänge zu Lauras Wohnblock sind von Glasscheiben umgeben, die einen wohl vor Regen und Sturm schützen sollen, während man nach seinem Schlüssel kramt.
Auf diesen Scheiben ist mit Hilfe von Fensterfarben über Nacht ein ganzer Dschungel entstanden. Laura grinsen bunte Frösche zwischen grünem Gras an, Schlangen und Affen hängen kopfüber von Bäumen und Leoparden lugen tückisch hinter Gestrüpp hervor.
Diese Tiere hatten die Kinder vorhin also nachgeahmt. Ein Leopard, kein Löwe! Laura fragt sich kurz, ob die Kinder auch gleich die Urheber sein könnten, verwirft den Gedanken aber schnell wieder. Viel zu detailliert sind die Werke, die das Glas schmücken, die Perspektiven viel zu verspielt. Sie blickt sich um und versucht in der Nähe des Hauses einen Hinweis auf Künstler oder Künstlerin zu entdecken – vielleicht steht da ja noch jemand mit grüner Farbe an den Händen. Aber es ist niemand zu sehen. Auch die spielenden Kinder scheinen sich nun woanders zu vergnügen.
Ihr Hauseingang ist nicht der Einzige, der bemalt wurde. Die drei anderen Eingangsbereiche ihres circa 80 Meter langen Wohnblockes sind auf genau die gleiche Art verziert.
Sie läuft auf ihrem Weg zur U-Bahn an allen dreien vorbei und ist fasziniert von den Farben und Motiven, die sich von Hauseingang zu Hauseingang ergänzen, aber nicht wiederholen. Die Versuchung ist groß, trotz Kater und Verspätung weiter stehen zu bleiben und die Details zu erkunden – denn so wie sie ihren Block und ihren Hausmeister kennt, werden die bunten Scheiben sicher nicht lange in ihrem bemalten Zustand bleiben. Eventuell taucht zuerst ein passiv-aggressiver Brief an den Künstler auf dem schwarzen Brett des Hauses auf, die Scheiben schnellstmöglich wieder zu säubern – und kurz darauf folgt eine Reinigung durch den Hausmeister selbst. Oder der Brief wird übersprungen. Das Hasenbergl, Lauras Viertel am Münchner Stadtrand, genießt einen eher verwegenen Ruf in der Stadt. Seit Jahrzehnten erzählt man sich Geschichten über Gewalt, Kriminalität und Armut. Die Realität ist aber, dass die alteingesessenen Bewohner zu Lauras Leidwesen oft genauso spießig sind wie die Hausherren und –damen im wenige Kilometer entfernten Vorort.
Laura schafft es am letzten Hauseingang vorbei, ohne anzuhalten – nur um gleich um die Ecke wieder verführt zu werden: Frau Bednarz aus dem sechsten Stock platziert eine selbstgehäkelte Bommel-Mütze auf einem der rot-weißen Poller, die die Feuerwehreinfahrt ihres Blocks markieren. Auf der Stange selbst umrahmt eine angeklebte Plastik-Brille aufgeklebte Wackelaugen. Gemeinsam mit der Mütze wird aus dem Poller ein rot-weiß-gestreifter Waldo wie auf den Suchbildern.
Lauras Blick bleibt auf der Frau und ihrer Kreation hängen, doch sie schafft es weiterzugehen. Die Dame ist mindestens 60 Jahre alt – und macht jetzt Street Art? Hat sie nicht letztens im Aufzug noch lauthals über den bunten Sticker einer Amateur-Band geschimpft, den jemand vor den Hauseingang geklebt hatte? Laura grüßt freundlich, geht an der schweigenden Frau Bednarz vorbei und tritt auf die Straße. Was sie dort sieht, bringt sie dann doch dazu, anzuhalten.
Auf den Hausfassaden der Block- und Plattenbauten, die hier in der Gegend üblicherweise auf einem Farbspektrum von dreckigem Beige bis Betongrau liegen prangen nun fast überall bunte Graffiti oder sogar Skizzen für ganze Wandgemälde. Lauras Mund bleibt offen stehen.
Nicht nur ihr Viertel, sondern ganz München ist schließlich meist kein freundlicher Ort für jegliche Art von Kunst, die man nicht als Wertanlage bunkern und potenziell weiterverkaufen kann. Ein Fakt, der sie schon als kunstaffine Design-Studentin sehr gestört hat. Nun sieht sie auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen Mann mit Gasmaske im Gesicht, der eine riesige Skizze an einer gelbbeigen Wand mithilfe einer Spraydose und überraschend viel Gefühl in seinem Handgelenk kunstvoll ausfüllt. Sie tritt ein bisschen näher heran und überlegt, die Straße zu überqueren und ihn anzusprechen. Ist er Teil eines Kunstkollektivs, das in einer Guerilla-Aktion beschlossen hat, das Hasenbergl von einem Tag auf den anderen zu verschönern? Hat er keine Angst vor der Münchner Polizei?
Der aktuelle Zeitdruck, nicht noch später zur Arbeit zu kommen, und vor allem das mehr als flaue Gefühl in ihrer Magengegend beim Einatmen der Farb-Dämpfe sogar auf diese große Entfernung sagen ihr, dass sie sich stattdessen lieber beeilen sollte, in die Arbeit zu kommen. Schweren Herzens geht sie weiter zur U-Bahn – mit einem bewussten Tunnelblick erreicht sie ihr Ziel.
Als der blau-lackierte Zug einfährt und die Türen sich öffnen, stehen eng gedrängte Menschenmassen in den Gängen. Normalerweise ist es hier am Stadtrand angenehmer in die U-Bahn zu steigen, aber ab und an spucken verspätete und überfüllte S-Bahnen in Feldmoching ihre Fahrgäste in Massen in die U2. Laura zwängt sich in den nicht vorhandenen Raum zwischen eng beieinanderstehenden Körpern. Diese erzwungene Nähe in U-Bahnen fand sie schon immer unangenehm, aber nach Corona blieb ihr immer ein zusätzliches Gefühl der Unhygiene. Nicht hilfreich in ihrer aktuellen Situation.
Die Türen piepen bereits ihre warnende „Wir schließen jetzt“-Kakophonie, als ein kräftiger Mann in letzter Sekunde hindurchspringt. Er scheint vor seinem Sprung nicht registriert zu haben, wie voll die U-Bahn ist. Jedenfalls stößt er mit seinem massigen Körper schwungvoll gegen mehrere Menschen, die vermutlich nur deswegen nicht umfallen, weil der Platz dafür fehlt. So schiebt er die weiteren Passagiere nur noch enger zu- und aneinander. Diese reagieren mit leisem, passiv-aggressivem Gemurmel und weisen ihm in unbewusster Schwarmdynamik einen Platz direkt neben Laura zu.
Der Mann ist vielleicht so alt wie sie, er könnte aber auch 20 oder 40 sein. Genauere Einschätzungen fallen Laura zum einen schwer, weil sein Gesicht, der untere Teil bedeckt von einem löchrigen Bart und der obere von strähnigem Haar, seltsam alterslos ist. Zum anderen hat er gerade einen offensichtlich schweißtreibenden Trip zur U-Bahn-Türe hinter sich – und seine Achsel verbreitet genau auf Höhe von Lauras Nase einen höchst unangenehmen Geruch. Für eine kurze Sekunde wünscht sie sich zurück zu ihrer Covid-Infektion, die zwar sonst sehr milde verlaufen ist, aber ihren Geruchs- und Geschmackssinn für eine ganze Weile sehr effizient eliminiert hat. Die bis eben noch präsente Freude und Aufregung über das ungewohnt bunte Hasenbergl weichen sofort der Sorge um ihren flauen Katermagen.
Laura konzentriert sich darauf, sich nicht auf ihren Kater zu konzentrieren. Ihre Augen suchen Ablenkung, bleiben aber wieder bei dem schwitzigen Mann hängen – besser gesagt bei seinem T-Shirt-Aufdruck: Halbnackte Anime-Mädchen räkeln sich in diversen anatomisch unmöglichen Posen.
Laura schließt die Augen und versucht sich an einen anderen Ort zu träumen. Ihr letzter Urlaub fügt sich vor ihrem inneren Auge zusammen. Schnappschüsse von sich mit einer frischen Kokosnuss in der Hand vor den Kalksteinfelsen in der Halong-Bucht. Sie springt von einem Boot ins warme Wasser. Sie schmeckt das Salz auf ihrer Zunge.
Der Bahnführer bremst kraftvoll an der nächsten Station, überrascht damit die in Gedanken versunkene Laura – und das dritte Newtonsche Gesetz platziert ihr Gesicht direkt dort, wo sie am wenigsten hinwollte: Lauwarm und feucht heißt sie der Stoff unter der Achsel des Anime-Mannes willkommen. Reflexhaft vermeidet es Laura, durch die Nase zu atmen, doch die Aromen sind zu stark. Statt salzigem Meerwasser schmeckt sie nun salzigen Schweiß. Die U-Bahn kommt mit einem kleinen zusätzlichen Ruck zum Stehen. Laura entfernt ihr Gesicht aus dem Feuchtgebiet vor sich und muss hörbar würgen.
Die Angst der Mitreisenden vor frischem Erbrochenen teilt die Menschenmasse vor ihr wie Moses das rote Meer. War der Bereich zwischen den Türen bis gerade eben noch so voll, dass sich Laura kaum rühren konnte, bildet sich nun blitzschnell ein Durchgang.
Sie stürmt durch diese persönliche Rettungsgasse durch die frisch geöffneten Türen. Die Hand hat sie fest vor den Mund gepresst, um ihrem Mageninhalt so zumindest eine weitere Barriere zu bieten, sollte er sich die Freiheit frühzeitig erkämpfen können.
Doch der letzte kleine Sieg gehört ihr: Sie schafft es noch bis zum nächsten Mülleimer. Dort hinein übergibt sie sich geräusch- und leidvoll. Ein piepsendes Störgeräusch direkt danach lässt Laura kurz aufblicken. Sie sieht, wie die Türen sich schließen und die U-Bahn im Anschluss langsam und doch uneinholbar davonfährt. Sie realisiert, dass sie nochmal zehn Minuten später kommen wird und übergibt sich erneut.
Erst nach dem dritten Mal fällt ihr auf, dass ihr Tiefpunkt dieses noch jungen Tages musikalisch begleitet wird.
Eine Akustikgitarre hallt durch den U-Bahnhof, dazu singt eine Männerstimme einen Text in einer Sprache, die Laura nicht kennt. Vielleicht gälisch? Sie blickt sich um und sieht einen muskulösen Mann. Sein leicht rötlicher Vollbart, das mit der Maschine getrimmte Haupthaar und seine krumme Nase komplettieren eher das Bild eines Türstehers als eines Sängers. Daran ändert auch das weiße Hemd nicht viel, dessen hochgekrempelte Ärmel und offene Kragenknöpfe den Blick auf tätowierte Unterarme und eine reichlich behaarte Brust freigeben. Der harmonische Klang der Saiten und eine gefühlvolle, fast zerbrechliche Singstimme stehen dazu in einem faszinierenden Kontrast.
Die U-Bahn-Station leert sich, doch der Sänger singt unbeirrt weiter. Es scheint ihn nicht zu stören, dass ein signifikanter Teil seines Publikums mit dem Kopf über einem Mülleimer hängt.
- 2 -
Laura tritt mit einer frisch gebrühten Tasse Kaffee auf ihren kleinen Südbalkon. Sie denkt über den seltsamen und ereignisreichen Geburtstag am Vortag nach. Sie hat es noch ins Büro geschafft. Aber was dort dann passiert ist, lässt sie noch immer den Kopf schütteln.
Die Sonne scheint ihr ins Gesicht und Laura schließt genussvoll die Augen. Die Strahlen haben schon viel Kraft für einen Maimorgen und sie spürt eine angenehme Wärme auf ihrer Haut. Wenn Laura nicht verkatert ist, ist die Sonne ihre Freundin.
Sie nimmt einen Schluck Kaffee und öffnet die Augen langsam. Der Blick nach vorne lässt direkt vermuten, dass dieser Tag ebenso ungewöhnlich weitergehen wird.
Der Münchner Norden ist, im Gegensatz zu vielen anderen Teilen der dicht besiedelten Stadt, recht weitläufig angelegt. Weite Freiflächen erstrecken sich zwischen großen Häuserblöcken, die eine 60er-Jahre-Sozialromantik ausstrahlen. Ein nahezu perfektes Beispiel dieser eigenwilligen Bauplanung findet sich vor Lauras kleinem Balkon. Eine Grünfläche, auf der Kinder durch Verbotsschilder erfolglos vom Fußballspielen abgehalten werden sollen, direkt gefolgt von einem großen asphaltierten Parkplatz, bevor ein achtstöckiger Wohnblock ihren Ausblick beendet.
An diesem Morgen jedoch ist der Blick auf diesen Parkplatz ein anderer: Strahlend blaue Grundfarbe bedeckt den Asphalt. Weiße Highlights erzeugen die Illusion von Wellen und Gischt. Um die Autos herum deuten gelbe Flecken einzelne Sandbänke an, damit auch die Vehikel sich in das Gesamt-Kunstwerk einpassen. Auf einer Freifläche in der Mitte des Parkplatzes wiederum türmt ein Hügel aus echtem Sand, an dessen höchstem Punkt eine aufblasbare Palme herausragt.
Auf dem Wohnblock hinter dem Parkplatz verschönert derselbe Blauton die Fassade, so dass sich die Strandszene auf das massive Gebäude verlängert. Auf Höhe der Hochparterre-Fenster wechselt der Ton in ein Himmelblau, durchsetzt mit weißen Schäfchenwolken anstatt mit Gischt und Sand. Vor diesem Horizont tummeln sich aufgemalte Segelschiffe und Delfine im Meer – und Laura meint sogar ein Bananenboot zu erkennen, das sie an längst vergangene Familienurlaube erinnert. All das zieht sich ungefähr drei Meter in die Höhe, bis das Haus wieder zu seinem ursprünglichen Farbton – einem ausgeblichenen Gelb – zurückkehrt.
Was sie sich gestern schon gedacht hat, muss wahr sein: Es ist eine Guerilla-Künstlergruppe unterwegs, die das graue Hasenbergl ein bisschen aufmischt. Vielleicht sogar die ganze Stadt? Gestern auf dem Weg nach Hause ist sie in eine U-Bahn gestiegen, deren komplette Außenseite so bemalt war, dass der Zug aussah wie ein gigantischer chinesischer Drache. War es in anderen Bereichen der Stadt ähnlich? Sie ist gestern Nacht direkt aus Sendling zurück ins Hasenbergl gefahren und hat nicht viel mehr gesehen als die U-Bahn von innen.
Laura entsperrt ihr Telefon, das sie ohnehin zum Morgenkaffee mit auf den Balkon genommen hat, und fängt an, via Google und Social Media nach Informationen zu suchen. Tatsächlich klickt sie sich recht schnell durch viele Fotos und Bilderstrecken von hunderten weiteren brandneuen Kunstwerken. Diese scheinen nicht nur in ihrer Nachbarschaft aufgetaucht zu sein. Auch München scheint nicht der einzige Ort zu sein. Diese Aktion ist groß. Unter Hashtags wie #ArtExplosion2024, #SpontaneousMurals oder #May15Art finden sich Kunstfotos aus der ganzen Welt. Alle Fotos wurden innerhalb der letzten gut 30 Stunden hochgeladen. Laura ist fasziniert. Zu einer möglichen globalen Künstlergruppe, die dahintersteckt, findet sie aber nichts außer Spekulationen. Laura erkennt überdurchschnittlich oft Deutschland und München auf den Fotos und schließt daraus, dass hier ein Schwerpunkt der Aktion sein muss und die Gruppe aus der Stadt kommen könnte. Ein elektrifizierendes Gefühl, Teil von etwas Großem zu sein, fließt durch ihren Körper.
Kurz ploppt die Frage in ihren Kopf, wie Frau Bednarz‘ Kunstwerk da reinpasst, aber vielleicht hat sie sich ja auch einfach spontan mitreißen lassen? So oder so: Ein Spaziergang durch ihr frisch angemaltes Viertel wäre ein guter Start in den Tag. Zumal er ihr gestern mit all der Hektik verwehrt geblieben war.
Als erstes beschließt sie, zu dem Strandkunstwerk vor ihrem Balkon zu gehen. Schon nach wenigen Metern erkennt sie Details, die von ihrem Haus aus noch von Bäumen verdeckt waren. So ist auch der Gehweg vor dem Parkplatz Teil des Strand-Kunstwerks – inklusive Sonnenschirme, Liegestühle und ein bisschen echtem Sand.
Sie merkt, wie sich ganz unwillkürlich ein Lächeln auf ihrem Gesicht breitmacht. Ein Pop-Up Kunstwerk direkt bei ihr vor der Haustür! Und dazu noch so ein aufwändiges und durchdachtes. Sie macht ein paar Fotos und öffnet anschließend WhatsApp, um die Bilder direkt an Özge zu schicken.
Als sie den Chat-Verlauf öffnet, muss sie lachen. Gestern hatten Özge und Laura nur zwei Nachrichten ausgetauscht: Ein GIF von einer Kinder-Cartoon-Figur mit Augenringen und Drei-Tage-Bart, die sich leiderfüllt ihren Kopf hält, und – als Antwort von Özge – das GIF einer Frau, die sich mehrere Kissen mit Klebeband um den Kopf gebunden hat. In diesem bewegten Stummfilmchen wandert ihr Haupt dann in sichtbarem Leid auf die Tischplatte zu. Darüber steht in großen Lettern: „NO MORE DRINKING“.
Mit Özge und ein paar weiteren Freunden hatte Laura in ihren dreißigsten Geburtstag reingefeiert und Özge war die Einzige, die länger als bis fünf Minuten nach Mitternacht geblieben ist. Bedeutend länger – was schließlich in ihrem absurden Kater gipfelte.
Bevor sie die Fotos abschickt, sieht Laura in der Status-Anzeige über dem Chat, dass Özge online ist. Sie ruft sie direkt an. Ein Unding für so viele in ihrem Alter, aber bei Özge ist das etwas anderes.
„Frau Demir!“, ruft sie in den Hörer.
„Frau Kowalzcyk… Na, wieder fit?“ Özges Stimme klingt gut gelaunt, aber noch immer übernächtigt.
Laura lacht.
„Oh ja. Es geht inzwischen besser. Auch wenn ein einzelner Tag nicht mehr ganz zur Katererholung reicht. So ist das mit 30.“ Sie atmet tief ein und fährt fort, um ihr Leid mit ihrer besten Freundin zu teilen. „Özge, ich sag’s Dir, gestern war so ein beschissener Tag. Abgesehen davon, dass ich schon auf dem Weg ins Büro in einen U-Bahn-Mülleimer gekotzt habe… in der Arbeit wurde es noch schlimmer. Was für ein Geburtstag.“
„Du hast was!? Klingt ja nach einem passenden Einstand für die dirty thirty.“ Özge lacht dreckig.
„Oh Gott, ja… erstmal Monsterkater und dann bin ich viel zu spät ins Büro gekommen – statt neun Uhr war es einfach nach eins am Nachmittag.“
Laura ignoriert Özges erneutes Lachen nach diesem Satz und spricht weiter.
„Und außer einem kleinen Yes-Törtchen mit einer nicht angezündeten Kerze auf meinem Platz war einfach niemand da. Niemand. Wir sind eigentlich zu fünft in dem Raum.“
„Waaas? Also voll umsonst noch ins Büro gehetzt?“, fragt Özge überrascht.
„Na ja um halb zwei hatte ich einen Termin mit Tim. Ich sollte ihm meinen Entwurf für die neuen Flyer zeigen, die wir in Hotels deutschlandweit auslegen wollen.
Also setze ich mich an meinen Schreibtisch, ignoriere meine E-Mails und schaue, dass ich in zehn Minuten das bisherige Konzept so weit fertig mache, wie es geht. Danach hole ich mir erstmal einen Kaffee, bevor ich zu Tim ins Büro gehe. Und rate mal, wen ich auf dem Weg zur Kaffeemaschine treffe: Wieder Niemanden! Ich schaue also von Büro zu Büro und insgesamt sind anstatt der üblichen 30 Kollegen zum Teamtag vielleicht fünf im Office.“
„Aber Tim war natürlich da?“, Özge weiß aus verschiedenen Erzählungen, wie sehr Lauras Chef für seine Arbeit lebt. Er hat schon öfter Kolleginnen und Kollegen von ihr als freizeitorientiert bezeichnet, weil sie pünktlich zum Feierabend gingen – und in das Wort jeweils so viel Verachtung gepackt, als hätte er kurz zuvor herausgefunden, dass sie das Büro verlassen, um BDSM-Orgien mit Hundewelpen aufzusuchen.
„Selbstverständlich ist er da. Also gönn ich mir einen großen Schluck Kaffee, um zumindest halbwegs klar im Kopf zu sein, hol meinen Laptop und gehe rein in sein Büro. Und er schaut mich erstmal an wie ein Auto, dann kommt sein typisches und ultra-falsches Chef-Lächeln. Boah, wie ich es hasse. Und er dann so:
‚Laura, wie kann ich Dir helfen?‘“
Laura ist inzwischen geübt darin, die aalglatte Stimme mit dieser betont kumpelhaften Betonung ihres Chefs nachzuahmen.
Sie fährt fort:
„Ich sage ihm natürlich, dass wir einen Termin hatten – und er sagt mir, dass er den doch abgesagt hatte. Ob ich meine Mails nicht gelesen hätte. Und dann, ohne meine Antwort abzuwarten:
‚Heute ist ein fantastischer Tag, es liegt so eine Energie in der Luft. Fühlst Du die auch?‘ Dazu hat er so komische Bewegungen mit seiner Hand in der Luft gemacht wie so ein esoterischer Heiler.
‚Ich dachte mir, wir müssen das alles nochmal neu denken. So richtig frisch anfangen. Aber wenn Du jetzt schonmal da bist, zeig mir doch, was Du vorbereitet hast.‘
Und ich zeige ihm mein Zeug und er nur so:
‚Das ist genau, was ich meine. Das ist alles so gefangen in den Grenzen unserer Corporate Identity. Das sieht alles immer so gleich aus. Wir brauchen was Frisches abseits vom CI. Outside the Box!‘“
„Hat er nicht gesagt!“ fällt Özge Laura aufrichtig empört ins Wort.
„Doch. Und sonst ist er halt derjenige, der alles, was seiner Meinung nach nicht zu 100 Prozent CI ist, sofort im Keim erstickt.“
Laura muss an eine Situation denken, als sie frisch bei Tropical Spa angefangen hatte, einer deutschlandweiten Kette von Wellness-Salons. Frisch aus der Uni, zwei Bachelor in der Tasche – einen in Theaterwissenschaft und einen in Kommunikationsdesign – wusste sie, dass es an der Zeit war Geld zu verdienen. Ein Bürojob als Grafik Designerin wäre doch bestimmt die perfekte Mischung aus Business und Kreativität. Sie machte Überstunden und setzte sich sogar zuhause nochmal hin und füllte die ihrer Meinung nach leblose Corporate Identity mit Farbe und Leben. Als sie Tim ihre neuen Ideen vorgestellt hatte, hat er sie abgeschmettert:
„Laura, das sieht bestimmt super aus, aber wir müssen nicht toll aussehen, die Leute müssen uns wiedererkennen. Na ja. Zwei Bachelor machen noch keinen Meister. Das wird schon noch.“
Özges Stimme holt Laura zurück aus ihrer Erinnerung: „Und was war jetzt mit Deinen Kolleginnen und Kollegen?“,
„Was meinst Du?“
„Na wo waren die? Du sagtest doch, das Büro war so leer.“
„Ach ja, stimmt“, nimmt Laura den Faden ihrer eigenen Geschichte wieder auf. „Ja, das habe ich Tim auch gefragt. Und er sagt so ganz leger, dass heute viele gefragt hätten, ob sie früher gehen können. Und weil sie alle so wahnsinnig inspirierte Arbeit abgeliefert hätten – er hat wirklich das Wort inspiriert benutzt – hätte er da auch nichts dagegen gehabt. 85 Prozent der Leute in unserem Büro sind gestern einfach mal gegangen, bevor ich überhaupt gekommen bin. Was ist denn los? Na ja, umso weniger schlechtes Gewissen habe ich, dass ich heute im Home-Office bin und erstmal durch die Straßen spaziere. Vor allem, weil ich gestern dann noch an meinem Geburtstag bis nach zehn Uhr nachts im Büro gesessen bin, um für Tim etwas Frisches zu erarbeiten. Hat mir dann auch direkt für heute Früh den Call eingestellt, um meine Ideen zu besprechen. In einer Stunde ist es so weit. Da will man was kreatives Arbeiten, weil die normale Business-Welt so abschreckend wirkt – und dann hat man denselben Scheiß, nur mit Shit Pay und Shit Hours… Alter, ich sag’s Dir: Was für ein Tag gestern. Ich bin heimgefahren und direkt ins Bett gefallen.“
Özge lacht, aber Laura kennt sie gut genug, um zu wissen, dass in diesem Lachen viel Empathie mitschwingt.
„Egal“, wechselt Laura das Thema. „Konzentrieren wir uns auf das Positive. Heute ist ein wunderschöner Tag. Hier am Hasenbergl geht es grade irgendwie richtig ab mit Street Art und so. Ist das bei Dir in Schwabing auch so?“
„Ehrlich gesagt war ich, seitdem Du reingefeiert hast, echt nicht viel draußen… gestern gekatert im Home-Office und heute einfach auch direkt wieder einen Blocker in meinen Kalender eingestellt. Manchmal hat es schon Vorteile, ein bisschen höher auf der Karriereleiter zu stehen. Dann schauen einem nicht mehr alle ständig so auf die Finger.“
Laura schüttelt den Kopf und ist kurz froh, dass Özge sie nicht sehen kann. Ihre Freundin verdient mehr als das doppelte von ihr – und arbeitet scheinbar weniger als die Hälfte. Beneidenswert.
„Irgendwie nervt mich grade die Arbeit ein bisschen“, hängt Özge nach einer kurzen Pause an.
„Willkommen im Club.“
„Nein ernsthaft. Ich hab grade echt nicht so viel Bock auf das alles. Weißt Du eigentlich, wie lange es her ist, dass ich an meinem Buch weitergeschrieben habe?“
Laura muss überlegen, wovon Özge spricht. Sie ist sich sicher, dass Özge schonmal ein Buch erwähnt hat, an dem sie arbeitet, aber das muss Jahre her sein. Worum ging es nochmal? Irgendwas mit Özges Studium, oder? Was politisches?
Laura will nachfragen, was es mit diesem Buch auf sich hat. Doch dann fordert etwas anderes ihre Aufmerksamkeit. Ein Mann vor ihr schafft es, so ungünstig auf dem Bürgersteig neben einem der Liegestühle zu stehen und dabei Löcher in die Luft zu starren, dass er den Weg trotz seiner schmächtigen Statur beinahe komplett blockiert.
Laura drängt sich vorbei und murmelt währenddessen mit einer für sie angemessenen Portion Passiv-Aggressivität:
„Entschuldigung, darf ich da bitte durch? Danke!“
Was dann folgt, erwischt Laura vollkommen unerwartet. Kaum sind die Worte aus ihrem Mund, schnellt der Kopf des Mannes mit halsbrecherischer Geschwindigkeit zu ihr herum. Doch das ist nicht, was sie direkt aus dem Konzept bringt. Es sind die Augen, die sie nun anstarren.
Sie sind grün. Wobei, das wird dem Ganzen nicht gerecht. Lauras Augen sind grün, aber im Vergleich zu den Iriden, die sie gerade fixieren, erinnern die ihren eher an einen leicht schlammigen, mit bräunlichen Flecken durchsetzten Sumpf. Das Grün vor ihr ist smaragdfarben, rein – und es scheint förmlich zu leuchten. Und diese Augen starren sie zwischen weit aufgerissenen Lidern an, als wäre sie ein Wesen aus einer anderen Welt.
„Fünf Jahre!“
Özge hat anscheinend beschlossen sich eine Frage selbst zu beantworten, die Laura schon wieder vergessen hat. Özge ignoriert Lauras verwirrtes Schweigen und fährt fort:
„Fünf Jahre habe ich da nicht mehr dran geschrieben. Dabei war das mal mein Herzensprojekt. Am besten gleich mein Durchbruch als Autorin. Die klassische Karriere nur ein vermutlich unvermeidbarer Plan B. Ironisch, wenn man das Thema des Buches bedenkt. Aber in diesem Plan B bin ich aktuell so wahnsinnig uninspiriert. Das muss sich ändern.“
Laura beschleunigt ihre Schritte, um sich schnell von der unerwarteten Intensität von Blick und Situation zu entfernen.
Özge schüttet ihr gerade ihr Herz aus und sie will darauf reagieren. Sie versucht sich geistig in das Gespräch mit Özge zurückzufinden. Und sie will weg von diesen Augen. Doch bevor sie etwas zu Özge sagen kann, unterbricht eine Stimme hinter ihr diesen Versuch:
„Halt, warte!“
Laura überlegt einfach weiterzugehen – entscheidet sich dann aber doch dagegen. Sie ist geistig sowieso raus dem Gespräch mit ihrer besten Freundin.
„Özge, tut mir wirklich leid, hier will jemand was von mir! Lass uns nachher nochmal telefonieren.“
Sie legt auf – steckt das Telefon aber nicht weg, um schnell jemanden anrufen zu können, falls der Fremde noch seltsamer wird – und dreht sich um.
Der Mann wirkt zumindest physisch harmlos. Er ist nicht besonders groß, sogar ein Stückchen kleiner als Laura, und dabei sehr schlank. Das Gesicht zeigt keine Anzeichen von Bartwuchs und ist zart geschnitten. Die androgyne Erscheinung setzt sich bei seinen Klamotten fort – vor allem aber wirken die aus der Zeit gefallen. Beige, weite Hosen, die Laura unfachmännisch als Leinen identifiziert und die einfache wildlederne Schuhe überdecken. Dazu kommt ein locker sitzendes Oberteil, dessen Kragen seinen Hals verdeckt und bis hin zur Brust geschnürt und nicht geknöpft ist. Diese Klamotten wären auch an einem Mittelaltermarkt passend gewesen.
„Du kannst mich sehen“, sagt ihr Gegenüber.
Seine Stimme ist weniger androgyn als seine Erscheinung. Nicht außerordentlich tief, aber Laura liest sie klar als männlich. Sein Tonfall klingt forsch – und noch etwas anderes schwingt mit, das Laura nicht ganz einordnen kann. Klingt er genervt? Nein, das ist es nicht.
„Wie kann ich Ihnen helfen?“, fragt Laura.
Laura siezt eigentlich niemanden, wenn es nicht gerade der Arbeitskontext verlangt. Doch ein bisschen sprachliche Distanz kann nicht schaden, wenn es schon an sozialer mangelt.
„Du kannst mich sehen“, sagt der Mann nochmal. Er atmet tief durch und Lauras Eindruck verstärkt sich, dass der Mann genervt vonihr ist.
„Das ist… korrekt?“, gibt Laura zurück, in einer Mischung aus Spott und ehrlicher Verwirrtheit.
„Du solltest mich nicht sehen.“
Laura hat eigentlich ein Herz für die leicht verrückten Menschen, die einem jede Großstadt immer mal wieder vor die Füße spuckt. Solche Menschen interessieren sie. Dennoch ist sie enttäuscht, dass sich das Gespräch offensichtlich schon nach so kurzer Zeit im Kreis dreht.
„Warum sollte ich dich nicht sehen können? Du stehst direkt vor mir.“
„Ich verstehe.“ Wieder atmet der Mann tief durch. „Ich versuche es anders. Ich bitte um Verständnis, dass ich es nicht gewohnt bin, solche Konversationen zu führen. Oder überhaupt mit Menschen zu sprechen.“
Das glaubt Laura sofort.
„Du solltest mich nicht sehen können. Aber Du siehst mich. Das muss etwas bedeuten. Verstehst Du das?“ Die grünsten Augen der Welt leuchten sie weiterhin an, als würde die Sonne durch Buntglas strahlen und verleihen seiner rhetorischen Frage eine hohe Intensität.
„Warum sollte ich dich nicht sehen können?“, fragt Laura erneut. Zu ihrer Verblüffung mischt sich inzwischen auch Neugier, worauf der Fremde denn bitte hinauswill – egal wie verrückt die Begründung am Ende ist.
Er atmet erneut tief ein, als müsste er einem Idioten die einfachste Sache der Welt erklären und dafür das letzte bisschen Geduld zusammenkratzen. Durch dieses Einatmen erkennt sie, was die ganze Zeit im Tonfall des Mannes mitschwingt. Der Mann ist nicht unbedingt genervt, aber etwas sehr Artverwandtes: Bei diesem kleinen Mann dringt Arroganz durch jede seiner Poren. So als wäre der bloße Akt mit Laura zu sprechen schon unter seiner Würde.
Dann sagt er den Satz, der Lauras Leben für immer verändern wird:
„Ich bin eine Muse.“
- 3 -
Die Treppenstufen knarzen bei jedem Schritt, den Andi macht. Früher, vor allem, als er gerade neu eingezogen war, war das noch ein echtes Problem. Nach dem Tod seiner Eltern wollte er vor allem allein sein, aber jedes Mal, wenn er sich beispielsweise etwas zu essen aus der Küche im Erdgeschoss holen wollte, kam seine Oma angehumpelt wie ein alter Kater, wenn man eine Dose Katzenfutter öffnet. Egal wo sie im Haus war – sie hörte das Knarzen der Treppen, die von seinem Zimmer nach unten führten, und Andi konnte sich auf lange, unfreiwillige Umarmungen einstellen, die nach Zigaretten und abgestandenem Alkohol rochen. Doch ihre Hüfte war schon damals nicht mehr sehr mobil, weswegen sie es vermied, zu ihm nach oben zu kommen. Dort konnte er allein sein, so oft und solange er wollte. Recht bald hatte er einen kleinen Essensvorrat in seinem Zimmer angelegt. Seine eigene Welt unter dem Dach, sogar mit dem Luxus eines eigenen Badezimmers ausgestattet, entwickelte sich schnell zu einem echten Rückzugsort.
Über die Jahre hatte das Alter dem Körper seiner Oma einige weitere Gebrechlichkeiten aufgeladen, darunter ein schlechtes Gehör. Die natürliche Alarmanlage dieses alten Hauses tut ihren Zweck also schon lange nicht mehr. Trotzdem wird Andi diese Assoziation wohl für immer behalten – genau wie den Fakt, dass er sich außerhalb seines Zimmers eigentlich nie wohl fühlt. Die Welt da draußen ist nicht für ihn gemacht. Das hat er auch gestern erst wieder gesehen. Doch daran möchte er jetzt nicht denken. Er zwingt er sich, sich auf den Moment zu konzentrieren. Das fällt ihm leicht, denn er hat Hunger.
Die gähnende Leere innerhalb des kleinen Kühlschranks in seinem Zimmer treibt ihn dazu, seine Komfortzone ein kleines Stück zu verlassen.
Im Flur im Erdgeschoss angekommen fällt sein Blick automatisch auf den Weidekorb neben der Eingangstür, in dem seine Oma das Altglas aufbewahrt. Seit gestern sind zwei neue Flaschen Wein und eine Flasche Williams-Christ-Birne dazugekommen. Er hofft, dass sie zumindest an der Schnapsflasche mehrere Tage getrunken hat – ansonsten wäre das tatsächlich eine neue Qualität ihres Trinkverhaltens.
Er geht am Weidenkorb vorbei in die 70er-Jahre Holzküche und öffnet den Kühlschrank. Der Anblick enttäuscht. Einige offene Gläser hausgemachte Marmelade, deren Alter er nur erraten kann, ein offenes Tetra Pak H-Milch, eine Flasche Weißwein (natürlich) und aus irgendwelchen Gründen drei offene Einmachgläser Essiggurken.
Andi seufzt leise. Seit gestern Abend hat er nichts außer einer Tüte billiger Käsebällchen-Snacks gegessen. Dabei hatte er sich die ganze Nacht durch reddit gescrollt und Youtube-Videos angesehen. Am Ende bestellte er sogar ganze Bücher auf seinen eBook-Reader zu Themen, die ihm auf reddit und YouTube nicht tiefgehend genug besprochen wurden. Bücher über Astrophysik, Sci-Fi- und Fantasy-Fandoms – und verrückterweise sogar ein Buch über die Geschichte der Magie, ein Thema dass ihm eigentlich noch querer im Kopf sitzt als Horoskope, Homöopathie und ähnlicher Firlefanz. Aber nachdem er einen reddit-Kommentar zu dem Thema gelesen hatte, sind gestern seine Gedanken losgaloppiert und haben stundenlang über die Ununterscheidbarkeit von Magie und moderner Technik nachgedacht. Eine solche Begeisterung für ein Thema – oder generell Begeisterung für irgendwas, wenn er ehrlich zu sich ist – hat er schon Jahre nicht mehr gefühlt.
Andi nimmt sich eines der Essiggurken-Gläser aus dem Kühlschrank. Wie alt ist das? Ist es noch gut? Andi schraubt es auf und riecht daran. Es riecht nach Essig. Andi weiß nicht, was er erwartet hat. Er zuckt mit den Schultern, stellt das Glas auf den Küchentisch und schließt die Kühlschranktür.
Die Erinnerung an letzte Nacht fasziniert ihn noch immer. Es war, als hätte jemand einen Schalter in seinem Kopf umgelegt und er wollte plötzlich alles wissen und alles verstehen. Die Welt erschien ihm bunt und spannend und inspirierend. Als die ersten zarten Ausläufer der Morgensonne den Himmel von schwarz zu blau färbten ist er schließlich über seinem eBook-Reader eingeschlafen. Und auch jetzt kann er es kaum erwarten weiterzulesen.
Den eBook-Reader hatte ihm seine Oma vor Jahren geschenkt in der Hoffnung, endlich etwas gefunden zu haben, dass einen Bildschirm hatte (und damit ihrer Meinung nach Andi automatisch gefallen musste) und trotzdem keine Zeitverschwendung war (schließlich las man ja Bücher). Andi hatte das Geschenk jahrelang vernachlässigt. Gestern Abend musste er das Gerät erstmal aus dem Zustand der kompletten Entladung befreien, bevor er es nutzen konnte.
Er nimmt sich eine Kuchengabel aus der Schublade und fischt damit ein Gürkchen aus dem Glas. Er ist sich noch immer unsicher. Wieder riecht er daran. Wieder riecht es nach Essig. Er muss an Einsteins Definition von Wahnsinn denken: „Immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten.“
Er wägt seine Optionen ab und wirft die eben mit der Gabel erlegte Beute wieder zurück in die Essig-Salz-Dill-Lösung.
Wo ist denn seine Oma? Vielleicht ist zufällig etwas von ihrem Frühstück übriggeblieben, das es aus irgendwelchen Gründen noch nicht zurück in den Kühlschrank geschafft hat.
Er wandert von der Küche zurück in den Flur und folgt diesem in das Wohnzimmer. Auch hier keine Spur von ihr.
„Oma Sybille?“
Keine Antwort.
„Oma?“
Gerade als er sich fragt, ob sie vielleicht zum Einkaufen gegangen ist, um den leeren Kühlschrank wieder aufzufüllen, hört er ein Stöhnen im Garten. Hat sie sich wehgetan? Was macht sie überhaupt im Garten?
Schnellen Schrittes durchquert er das Wohnzimmer mit der dunkelgrünen Cord-Couch, den alten Jagdgewehren seines Opas und dem Röhrenfernseher, der bedeutend älter ist als Andi selbst und den sich seine Oma akut weigert wegzuwerfen.
„Der lafft do no suppa“, ist ihr Standardsatz zu dem Thema, mit diesem starken münchnerischen Akzent, den Andi kaum verstand, als er damals hergezogen ist. Wie fremd damals alles war im Stadtteil Feldmoching. Wie einsam. Und wie wenig sich bis heute geändert hat.
Er erreicht die Terrassentür, die leicht offensteht, reißt sie auf und stürmt fast aus dem Haus in den Garten. Doch seine Oma ist nicht gestürzt. Im Gegenteil:
Sie steht an der Hecke, eine große Gartenschere in behandschuhten Händen, und streckt sich unter lautem Stöhnen, um an eine schwer erreichbare Stelle zu kommen. Um sie herum liegen haufenweise Äste und Zweige verschiedener Größe, die sie offensichtlich in den letzten Stunden von der ehemals sehr ungepflegten Hecke geschnitten hatte. Sie blickt gegen die Sonne, als sie sich zu Andi umdreht – und trotz eines großen Sommerhutes, der Schatten über ihr Gesicht wirft, kneift sie ihre Augen zusammen. Andi kommt es vor, als würde sie 20 Jahre jünger aussehen als noch am Vortag.
„Wos schaugst‘n wia a Reh wenn‘s blitzt?“
Andi braucht ein paar Sekunden um sich von dem ungewohnten Anblick zu erholen.
„Ich habe ein Stöhnen gehört und dachte, Du wärst vielleicht gestürzt oder so.“
Er wendet sein Gesicht leicht Richtung Boden, verunsichert durch die eigene Fehleinschätzung.
„Ah ge, so a Schmarrn. I bin a oids Weib und hob mi g‘streckt. Da kimma soichane Laute scho amoi vor. Mia huift ja koana.“
Andi fühlt sich direkt angegriffen, dabei war Gartenarbeit wirklich nichts, wobei seine Oma jemals Hilfe gebraucht hätte. Schlicht, weil er sich nicht erinnern kann, dass sie jemals im Garten gearbeitet hätte, seitdem er vor inzwischen 14 Jahren in ihr Haus gezogen war. Ihr Garten ist in dieser Zeit beinahe komplett verwildert – in so einem Ausmaß, dass Andi vor seinem Fenster schon Spaziergänger hatte reden hören, dass es eine Schande sei, dass in einer Stadt mit einem so hohen Wohndruck wie München einzelne Häuser offensichtlich seit Jahren einfach leer stehen.
„Seit wann arbeitest Du denn überhaupt im Garten?“
„I woas ned. Hob mia gestern scho denkt, dass da wieder amoi was gmacht g’hert. Und heit hob I mia moane Handschuh o’zogn und hob oafach o‘gfangt.“
Sie lehnt die große Gartenschere gegen das, was von der Hecke übriggeblieben ist, und wendet sich dann nochmal Andi zu.
„Des war amoi a Idee für di, was moanst? Oafach mal was doa? Ned imma nua vor Deim Computer sitz‘n bis‘d viereckade Augn kriagst. Bist Du grod erst aufg‘standn? Mei Bua, es is Nomidog.“
Andi weiß gar nicht, wie er auf den wenig subtilen Angriff reagieren soll. Was will er auch sagen? Es stimmt ja: Besonders viel hatte er in den letzten Jahren nicht gemacht. Nach dem Abi hatte er kaum noch Gründe gehabt, sein Zimmer zu verlassen.
„Duasd ma den Gfoin und ramst die Äst‘ zam? Des muas I mit moane fost achzig Jahr dann wirkli nimma mach‘n. I fahr mit am Bus in‘ Baumarkt und kauf a ba Bleami.“
Andi ignoriert die Aufforderung seiner Oma und folgt ihr stattdessen ins Haus.
„Du fährst in den Baumarkt? Was ist denn los mit Dir? Seit wann sitzt Du nicht einfach auf der Couch, bewegst Dich keinen Millimeter und schaust in diese Antiquität, die Du Fernseher nennst?“
In seinen Gedanken fügte Andi noch still hinzu …und trinkst Obstler, Wein und Bier, bis Du noch besoffener bist, als Du mit diesem Dialekt ohnehin immer klingst?
Tatsächlich hatte er schon kurz nachdem er nach München gekommen war die Theorie aufgestellt, dass sich der bayerische Zungenschlag schlicht entwickelt hatte, weil die Leute so viel tranken, dass Lallen irgendwann zum sprachlichen Standard wurde.
Seine Oma ignoriert ihn. Auch das ist neu. Eigentlich ist sie immer für einen Streit gut. Sofern sie sich noch artikulieren kann.
Stattdessen geht sie schweigend durch das Wohnzimmer direkt in den Flur, der zum Hauseingang führt, und schnappt sich das rote Tuch, das wie immer auf einer Kommode neben der Schlüsselschale liegt. Seit einer Operation an der Schilddrüse vor einigen Jahren prangt auf ihrem Hals eine recht dominante Narbe, die sie mit diesem Halstuch verbirgt, sobald sie das Haus verlässt.
Sie bindet sich das Tuch um, schnappt sich mit einem gezielten Griff ihre Schlüssel, steckt sie in ihre Handtasche und geht aus der Tür.
Andi bleibt perplex im Haus zurück.
- 4 -
„Ich bin eine Muse.“
Die Intensität seiner grünen Augen und der vollkommen humorlose Gesichtsausdruck verleihen dem Satz eine Gravitas, die Laura für ein paar Sekunden vergessen lässt, wie absurd diese Aussage ist.
Sein Hemd verwandelt sich vor ihrem inneren Auge in ein waberndes weißes Tuch, das wie auf einem Renaissance-Gemälde eine Brust nur unzureichend bedeckt und die andere gar nicht. Laura muss lachen.
„Eine Muse? Soll ich Dich Kalliope nennen?“ Sie überlegt kurz. Dann schiebt sie hinterher: „Oder lieber gleich Kalle?“ Sie kichert leise über ihren eigenen schlechten Witz. Eine Muse namens Kalle – das ist ihrer Meinung nach schon einen Lacher wert. Bei ihrem Gegenüber starrt sie weiterhin in ein vollkommen regungsloses Gesicht.
„Ja, eine Muse. Wobei die generische Geschlechtszuschreibung, die Eure Kultur meiner Gattung gibt, wohl vor allem auf Einsamkeit und Wunschdenken diverser Kunstschaffender zurückgeht. Genau wie euer Ausdruck, dass ein guter Künstler von der Muse geküsst worden sei. Zu meinem Glück habe ich noch niemanden mit meinen Lippen berühren müssen, um ihn oder sie zu inspirieren. In der Regel reicht meine bloße Anwesenheit vollkommen aus.“
Laura will antworten, doch schon vor dem ersten Wort spricht der kleine Mann weiter.
„Ich bitte dich, mir zuzuhören. Auch wenn mit Menschen zu sprechen aufgrund mangelnder Übung bestimmt nicht zu meinen Stärken zählt: Ich habe in meinem Leben hunderte Dichter und Schriftsteller inspiriert – und wenn deren Geschichten auch nur ansatzweise das Verhalten echter Menschen widerspiegeln, dann reagieren die allermeisten Menschen sehr skeptisch auf Dinge, die sie sich nicht erklären können und die ihrem Weltbild widersprechen. In der Literatur wird dieser Unglaube dann recht schnell aufgelöst, um den Leser nicht zu langweilen und die Handlung schnell voranzubringen – und in Deinem Fall, so hoffe ich, um mir Zeit und Geduld zu sparen.“
Seine Nüchternheit irritiert Laura. Zwar ist ihr klar, dass dieser Mann verrückt ist, aber genauso weiß sie, dass es wenige Dinge gibt, die gefährlicher sind als Verrückte, die ihrem eigenen Wahn uneingeschränkt glauben. Sie ist froh um das Handy in ihrer Hand. Sie wischt unauffällig über das Display, um den Bildschirm zu entsperren. Unterdessen fährt der Mann, den sie Kalle getauft hat, in seiner gestelzten Art mit seinem Monolog fort:
„Schau Dich um. Das letzte Mal, als ich auf diesem Boden gestanden bin, war hier noch keine Stadt. Diese hat erst einige Kilometer weiter südlich begonnen.“
Kalle streckt seinen Arm aus und deutet an Lauras Haus vorbei in Richtung Osten.
„Dafür stand ungefähr dort, wo heute – wie ich vorhin gesehen habe – ein Supermarkt ist, eine große Hütte, in der sich ein Wildhüter um die Hasenbestände für die königliche Jagd kümmerte. In derselben Hütte fertigte ein sehr begabter Förstersohn Holzschnitzereien an, den ich regelmäßig besuchte. Leider hat sein Vater seine Werke meist verbrannt, um den Herd zum Kochen oder zum Heizen zu befeuern. Das hielt er wohl einen handfesteren Anwendungsbereich von Holz.“ Er seufzt leidend.
„Ich habe mich ein wenig in meiner Anekdote verloren. Der Punkte ist: Ich war lange nicht in dieser Gegend. Dennoch bin ich mir recht sicher, dass es hier heute ganz anders aussieht als es das beispielsweise noch vor einer Woche getan hat. Oder auch nur vorgestern. Wahrscheinlich war es hier weniger bunt, weniger Kunstwerke an den Wänden…?“
Er blickt an Laura vorbei auf den improvisierten Strand.
„Und vermutlich weniger Sand auf den Straßen?“
Laura antwortet nicht.
„Ich bin bei weitem nicht die einzige Muse. Und tatsächlich scheint es so, als wären aktuell sehr viel – zu viele – hier unterwegs. Und die Auswirkungen sollten auch für dich direkt ersichtlich sein: Statt einiger weniger Auserwählter scheint nun Jedermann inspiriert zu sein. Egal ob sie der bildenden Kunst frönen, sich als Schriftsteller verdingen oder sonstigen Passionen nun mit Verve nachgehen, denen unter normalen Umständen keine Inspiration durch Musen zuteilgeworden wäre. So gut wie jeder Mensch ist – um zu diesem furchtbaren Bild zurückzukehren – von der Muse geküsst.“
Kalle macht eine kleine Pause. Laura fragt sich, ob ihr Gegenüber so angeekelt von dem sprachlichen Bild ist, dass er sich erstmal sammeln muss. Dann spricht er weiter:
„Und das Schlimmste ist: Wir können nicht zurück.“
„Zurück wohin?“ Laura ist klar, dass sie die Wahnvorstellungen des Mannes mit ihrer Nachfrage aufwertet. Aber hey, eine gute Geschichte ist eine gute Geschichte.
„Hast Du Dich jemals gefragt, woher Ideen kommen?“
Laura hat auf einer Party mal mit einer Journalistin gesprochen. Die hat ihr mal sehr wortreich erklärt, dass die schlechteste Frage, die man jeder Art von Künstler stellen kann „Woher nehmen Sie ihre Ideen?“ lautet. Doch Laura verbeißt es sich, diese Anekdote zu teilen. Stattdessen schüttelt sie langsam ihren Kopf und bemüht sich, einen interessierten Gesichtsausdruck aufzusetzen.
„Es gibt eine zweite Seite zu dieser Welt. Die Seite, in der wir uns gerade aufhalten ist die, die du kennst. Mehr oder weniger rationale Menschen, die versuchen sich in einer mehr oder weniger rationalen Welt zurecht zu finden.
Die andere Seite dagegen ist… anders. Und auf dieser Seite hier vollkommen unbekannt. Auch wenn ich mal feststellen durfte, als ich einen meiner intellektuelleren Schützlinge begleitet habe, das Konzept „Reich der Ideen“ auf einer philosophischen Ebene stattzufinden scheint. Aber ich greife mir selbst schon wieder vor und schweife gleichzeitig ab. Verzeihung.“
Laura reagiert nicht – und verzichtet auch auf den Hinweis, dass Platons Ideenlehre mehrere tausend Jahre alt ist – und sicher weit davon entfernt „vollkommen unbekannt“ zu sein. Kalle fährt fort:
„Auf dieser anderen Seite jedenfalls findet sich ein Ort, der mit „Reich der Ideen“ ganz gut beschrieben ist. Dort sammeln sich alle Ideen der Menschen in ihrer reinen, wilden Form. Ohne eingezwängt zu sein zwischen Buchseiten oder ewig bewegungslos auf einer Leinwand.
Diese beiden Welten sind voneinander abhängig. Würde man die Verbindung kappen, wäre diese Seite, auf der wir uns gerade befinden, ohne jegliche Inspiration und Kreativität, ich würde sogar behaupten ohne übergreifenden Austausch von Gedanken und Ideen. Was das bedeutet, kannst Du dir, als jemand der fest zu dieser Seite gehört, wohl selbst am besten ausmalen.“
Sie erinnert sich an die Vorlesung, in der sie mit Platons Ideenlehre zum ersten Mal in Berührung gekommen war. Kalles Worte hatten eine Erinnerung in ihr Bewusstsein gespült. Im Lehrplan ihres Bachelors Kommunikationsdesign gab es gleich im ersten oder zweiten Semester eine Vorlesung namens „Philosophie und Kommunikation“, die einen groben Überblick über verschiedene Großtheorien und philosophische Konstrukte gab. Begriffe wie kulturelles Gedächtnis, Schlagworte wie „Geschichte des Diskurses“ und Namen wie Foucault schießen ihr recht ungeordnet in den Kopf – doch sie erinnert sich, welchen Stellenwert der Austausch von Ideen für fast alle großen Denker und deren Theorien hatte.
Kalle fährt fort:
„Auf der anderen Seite ist die Abhängigkeit noch essentieller. Denn alles dort kommt von hier, von Euch Menschen. Das gilt für neue Ideen und Gedanken genauso wie für existierende. Wenn ein obskures Fabelwesen oder eine antike Gottheit in Vergessenheit gerät, so denkt niemand an sie. Und eine Idee, an die niemand denkt, hört schlicht auf zu existieren.
Deswegen braucht es den Austausch zwischen den beiden Seiten dieser Welt, obwohl sie strikt getrennt sind. Und die einzigen Wesen, die diese Grenze überqueren können, oder besser konnten, sind wir – die Musen.“
Wieder bohren sich die grünen Augen in ihr Bewusstsein, als würden sie die Wichtigkeit seiner Worte untermalen wollen. Laura möchte mit den Wahnvorstellungen des Mannes nicht weiter interagieren. Aber die Geschichte ist andererseits verdammt gut. So gut, dass sie sogar vermutet, dass der Mann vielleicht nur ein Schriftsteller ist, der ein paar Ideen an ihr ausprobieren möchte. Ein ungewollter Sparringspartner, quasi. Laura will mehr hören. Sie fragt also die erste Frage, die ihr in den Sinn kommt:
„Und was hat das mit mir zu tun?“
Kalles Schultern verlieren ihre Anspannung. Ein leiser Seufzer der Enttäuschung entfleucht Kalles Mund. Laura fühlt sich zurückversetzt zu Schulzeiten, wenn sie Fragen stellte, die ihre Lehrer als besonders dumm empfanden.
Doch auch wenn Geduld ihm offensichtlich nicht die Wiege gelegt worden ist: Kalle richtet sich schnell wieder auf und führt seine Erklärung fort.
„Millionen, vielleicht Milliarden Menschen können aktuell unsere Präsenz unterbewusst fühlen. Alle fühlen sich irgendwie inspiriert und motiviert – aber niemand weiß, dass wir da sind. Niemand kann uns hören, sehen oder auch nur riechen. Das konnten sie noch nie. Über tausende Jahre nicht. Und dann kommst Du. Du unterhältst Dich mit mir, als wäre ich irgendein Mensch von der Straße, ausgerechnet am Tag, nachdem wir hier angespült wurden. Das muss etwas bedeuten, auch wenn ich nicht sicher bin, was.“
Laura hebt ihre Augenbrauen, dann muss sie lachen. Sie ist sich jetzt fast sicher, dass hier jemand eine Geschichte an ihr ausprobiert.
„Eine Auserwählten-Story? Das ist jetzt aber schon ein bisschen klischeehaft. Immerhin hast Du keine Prophezeiung oder sowas erwähnt, das wäre wohl zu viel des Guten. Aber ich muss sagen, das Grundkonzept Deiner Geschichte ist super. Die Prämisse gefällt mir, habe ich so bisher noch nicht gehört.“
Kalles Mundwinkel wandern leicht nach oben. Doch der abschätzige Gesichtsausdruck, der daraus folgt, lässt sich höchstens sehr wohlwollend als Lächeln bezeichnen.
„Niemand hat etwas von Auserwählten gesagt. Meiner Einschätzung nach bist du sogar ein beinahe archetypischer Mensch. Aus einer Erklärung heraus fast nichts zu verstehen, aber gleich zu denken, du wärst irgendwie auserwählt – das wirkt sehr menschlich auf mich. Du bist ein Hinweis. Eine Spur. Sonst nichts.“
Laura antwortet nicht auf den Tadel, allerdings weicht sie den stechend-grünen Augen diesmal aus und blickt an Kalle vorbei. Ein Teenager klebt über die Scheinwerfer eines parkenden Autos überdimensionierte künstliche Wimpern, die er anscheinend aus Pappmaché gebastelt hat. Von einem der Balkone eines naheliegenden Wohnblockes spielt jemand Trompete, deren melancholisch-blecherne Melodie durch die Straßenzüge und Häuserschluchten hallt.





























