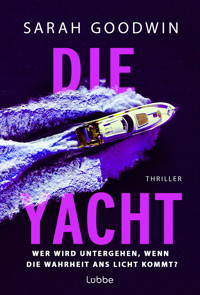9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein perfides Katz-und-Maus-Spiel in einem verlassenen Bergdorf
Mila und ihr Mann Ethan sind auf dem Weg zur Hochzeit ihrer Schwester in einem luxuriösen Skigebiet in den Alpen. Doch dann bleibt ihr Mietwagen plötzlich stehen und springt nicht mehr an. Zu Fuß machen sich Mila und Ethan auf den Weg zurück zu dem letzten Ort, an dem sie vorbeigekommen sind. Als sie ihn endlich erreichen, finden sie dort lediglich verlassene Hütten vor. Da der Schneefall immer stärker wird, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als in eine Hütte einzubrechen und dort die Nacht zu verbringen. Als Mila am nächsten Morgen aufwacht, ist Ethan verschwunden. Und sie ist ganz allein. Oder etwa nicht? Denn schon bald nimmt sie dunkle Schatten zwischen den Bäumen wahr ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
INHALT
ÜBER DAS BUCH
Ein perfides Katz-und-Maus-Spiel in einem verlassenen Bergdorf
Mila und ihr Mann Ethan sind auf dem Weg zur Hochzeit ihrer Schwester in einem luxuriösen Skigebiet in den Alpen. Doch dann bleibt ihr Mietwagen plötzlich stehen und springt nicht mehr an. Zu Fuß machen sich Mila und Ethan auf den Weg zurück zu dem letzten Ort, an dem sie vorbeigekommen sind. Als sie ihn endlich erreichen, finden sie dort lediglich verlassene Hütten vor. Da der Schneefall immer stärker wird, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als in eine Hütte einzubrechen und dort die Nacht zu verbringen. Als Mila am nächsten Morgen aufwacht, ist Ethan verschwunden. Und sie ist ganz allein. Oder etwa nicht? Denn schon bald nimmt sie dunkle Schatten zwischen den Bäumen wahr …
ÜBER DIE AUTORIN
Sarah Goodwin ist Engländerin. »Stranded – Die Insel« ist ihr erstes Buch. Neben der Schreiberei liebt sie es, sich mit Büchern kritisch auseinanderzusetzen, und betreibt einen Podcast. Sie lebt im ländlichen Hertfordshire.
S A R A H G O O D W I N
THRILLER
DASRESORT
DU KANNST NICHTENTKOMMEN
Aus dem Englischen übersetztvon Dr. Holger Hanowell
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © Sarah Goodwin 2023
Titel der englischen Originalausgabe:
»The Resort«
Originalverlag: AVON, a division of HarperCollinsPublishers Ltd
First published in Great Britain by HarperCollinsPublishers 2023
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2024 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln
Textredaktion: Dr. Frank Weinreich, Bochum
Umschlaggestaltung: Manuela Städele-Monverde
Einband-/Umschlagmotiv: © Helbert Ruiz/gettyimages; © Capchure/gettyimages
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7517-4770-7
luebbe.de
lesejury.de
Diesen Romanwidme ich meiner tapferen undwunderschönen Mum.
PROLOG
Ich liebe das Geheimnisvolle. Und genau darum sollte es auf dieser Reise gehen. Einem Rätsel auf der Spur sein, einem Mythos, all diesen Geistergeschichten und unerklärlichen Phänomenen. Dieser Ort birgt so viele Geheimnisse. Seine Geschichte, die entweder von Gewalt oder Unglücksfällen bestimmt wurde – vermutlich von beidem –, hat überall ihre Spuren hinterlassen.
Wenn es wirklich Geister gibt, dann frage ich mich, was diese hier gesehen haben mögen. Was für Storys sie wohl erzählen würden, wenn ich sie nur hören könnte. Vielleicht könnten sie mir einige meiner Fragen beantworten oder mich zu neuen Fragen inspirieren.
Vielleicht hätten sie mich gewarnt.
Der Boden unter meinen Füßen ist nur von einer leichten Schneedecke überzogen, noch nicht gefroren. Die Stiefelsohlen rutschen in dem Schneematsch, als ich loszulaufen versuche. Unter den Bäumen und ohne den Mondschein ist es stockdunkel, ich kann kaum zwei Fuß vor mir sehen. Ich bin längst erschöpft von dem langen Weg, und die Muskeln rebellieren spürbar und verlangen, dass ich stehen bleibe. Ich muss weiter, aber die Angst wird irgendwann meine Kraft lähmen. Es ist so schwierig, voranzukommen. Ich strauchele, rutsche weg, meine Beine schmerzen.
Ob ich immer noch verfolgt werde? Ich kann nichts hören. Nur das Blut, das in meinen Ohren rauscht. Und das Keuchen, das panikartige Luftholen. Ich drehe den Kopf, schaue mich um, erhasche einen Blick auf einen Schatten zwischen den Bäumen und wende mich wieder ruckartig mit einem Wimmern ab. Oh Gott! Die schemenhafte Gestalt macht sich noch nicht einmal die Mühe, mich schnell zu verfolgen. Ganz so, als wäre mein Fluchtversuch vollkommen nutzlos, und nur ich weiß es noch nicht.
Die Blockhütten sind im morgendlichen Frühnebel nur zu erahnen. Eben jene Hütten, in denen ich mich wenige Stunden zuvor eifrig umgeschaut habe. Auf der Suche nach Hinweisen. Jetzt, als ich mich die Stufen zur Veranda hinaufwuchte und die Tür hinter mir zuknalle, frage ich mich, welche Hinweise ich für die nächste Person zurücklassen werde, die das Pech hat oder dumm genug ist, hierherzukommen.
Ich drücke mich mit meinem Gewicht gegen die Tür, schiebe den Riegel vor und bereite mich innerlich darauf vor, sie zuzuhalten. Womöglich hatte ich einen gewissen Vorsprung, sodass niemand gesehen hat, dass ich in dieser Hütte verschwunden bin? Doch unmittelbar nach diesem Gedanken wird mir klar, dass ich Spuren im aufgeweichten Boden hinterlassen haben muss. Fußabdrücke, die genau zu meinem Versteck führen. Zu einem Ort, an dem mich selbst ein Kind finden würde, geschweige denn …
Ich lausche angestrengt auf Schritte oder Stimmen. Mit zusammengepressten Lippen zähle ich im Stillen. Ich bin bei zehn, dann bei zwanzig, und nach sechzig Sekunden wird mein Herzschlag ein klein wenig ruhiger. Bin ich vielleicht doch entkommen? Bestimmt war der Vorsprung nicht sonderlich groß. Höchstens ein paar Sekunden, als ich mich vorhin umgeschaut hatte. Andererseits … möglicherweise bin ich nicht die Einzige, die von hier fliehen wollte? Vielleicht hat mir diese schemenhafte Gestalt gar nicht nachgestellt, sondern wollte sich selbst davonstehlen?
Ich wünschte, ich hätte meine Tasche bei mir, das Handy, das da drin liegt. Die GPS-Daten. Irgendetwas, das mir hilft, von hier wegzukommen, um Hilfe zu holen. Aber ich hatte die Tasche abgestellt, um meinem Rücken etwas Ruhe zu gönnen, und genau in diesem Moment sah ich das Blut. Frisches Blut, das am Boden dampfte und die dünne Schneedecke besprenkelte. Mir wird übel, wenn ich nur daran denke. Das Blut und die Laute, die dieser Mann von sich gab. Das Entsetzen und der Schmerz in seinem Gesicht.
Dann höre ich etwas. Schritte auf der Veranda, langsam und zielstrebig. Ein Schauer erfasst mich und lässt mich zusammenzucken, und obwohl ich instinktiv weiß, dass ich die Tür zuhalten muss, weiche ich zurück. Ein knarrendes Geräusch, ein Klicken. Einen Moment lang bilde ich mir ein, ein schwarzes Auge zwischen den verzogenen Holzbrettern zu sehen. Dann nichts als Schmerz.
KAPITEL 1
Zum Flughafen zu kommen war wie immer anstrengend. Ich hatte die halbe Nacht wachgelegen, aus Angst, ich könnte den Wecker nicht hören. Die andere Hälfte der Nacht beherrschten Albträume, dass ich längst verschlafen hätte und dann aus Versehen zum falschen Flughafen gefahren sei. Nicht gerade ein entspannter Einstieg. Ethan schlief natürlich wieder wie ein Stein, es war ja auch nicht die Hochzeit seiner Schwester, zu der wir wollten. Anders als ich brauchte er sich nichts zu beweisen.
Letzten Endes wachte ich eine halbe Stunde vor dem Wecker auf und kam zu dem Schluss, dass ich es nicht länger aushielt. Während Ethan also noch schlief, schlich ich auf Zehenspitzen herum und zog mir bequeme Sachen für den Flughafen an, Leggins und einen Hoodie. Im billigen Neonlicht des Badezimmers sah ich schon wie der wandelnde Tod aus. Extra für die Hochzeit hatte ich mir die Haare schneiden und färben lassen – ein dunkelblonder, gestufter Fransenschnitt, der zerzaust und trotzdem cool aussehen sollte. Da ich aber gerade erst das Bett verlassen hatte, sahen die Haare einfach nur platt und erbärmlich aus.
Ich brühte Tee auf, trank eine Tasse und schaute hinaus auf die verwaiste Straße. Tja, ganz leer war die Straße nicht, denn auf der anderen Seite sah ich zwei Ratten, die in einem umgekippten Müllbehälter wühlten. Jedenfalls so lange, bis eine Seemöwe aufkreuzte, die Ratten verscheuchte und anfing, einen schwarzen Müllsack aufzureißen. Andere beobachten frühmorgens vielleicht Rehe, die sich vom Waldrand lösen und den Morgentau trinken – aber nicht in Bristol. Ich zupfte an meiner Nagelhaut herum und fragte mich, ob ich nicht besser noch zur Maniküre gegangen wäre.
Kurz vor der Weckzeit schlich ich zurück ins Schlafzimmer, mit einer Tasse Tee für meinen Mann. Er öffnete müde die Augen, schielte zum Wecker, seufzte und nahm die große Tasse entgegen. Als er sich mit einer Hand über das Stoppelkinn rieb, konnte ich das Tattoo an seinem Rippenbogen sehen. Ein verblasstes Flash-Art-Skelett aus Jugendzeiten. Wir trugen beide ziemlich peinliche Hautverzierungen, von denen man die meisten zum Glück gut verbergen konnte. Ich wuschelte ihm einmal durch seinen dunklen Haarschopf und sagte so was wie: »Verdammte Hochzeiten, für die man so weit anreisen muss.«
Wir hatten ein Taxi bestellt, das allerdings zehn Minuten zu spät kam. Auf dem Weg zum Flughafen von Bristol waren die Straßen schon ziemlich voll, weil irgendwo in der Nähe ein Oldtimer-Treffen stattfand. Normalerweise hätte es mir Spaß gemacht, so viele altmodische Autos und Motorräder auf einem Haufen zu sehen, aber nicht an diesem Tag. Selbst der Anblick eines echten Omnibusses brachte mich nicht dazu, vor Freude zu jauchzen. Dafür war der Tag wirklich nicht geeignet. Zumindest nicht, solange man sich an einen strikten Zeitplan halten muss.
»Im nächsten Jahr sollten wir einen eigenen Stand bei dem Oldtimer-Treffen haben«, sagte Ethan, als mehrere alte VW-Bullis an unserem stehenden Taxi vorbeifuhren. »Ich wette, die stehen auf gute alte Vinylplatten.«
Ich nickte, schrie aber innerlich, der Verkehr solle gefälligst wieder normal fahren.
Als wir endlich am Flughafen eincheckten und in Richtung Security gingen, hyperventilierte ich fast schon. Ethan hatte vergessen, sein Handy aus dem Handgepäck zu nehmen, und deshalb mussten wir eine Extrarunde drehen, das Handy rauskramen und noch einmal durch den Körperscanner. Zum Glück hatte er nicht seine Doc Martens an. Wenn er die Schnürbänder noch auf- und wieder zumachen gemusst hätte, wäre ich schier wahnsinnig geworden. Während wir warteten, schaute ich auf die riesigen Uhren im Terminal und merkte, dass ich mich immer weiter verspannte. Wenn ich zu spät bei Jess’ Hochzeitswoche ankäme, würde ich mir das nie verzeihen. Sie würde mir das vermutlich auch nicht verzeihen, obwohl sie nie etwas sagen würde.
Schließlich ließen wir den Security-Bereich hinter uns und gelangten in den Teil des Terminals, der nicht mehr so stressig war. Aber meine innere Unruhe ließ kaum nach.
»Möchtest du vielleicht einen Kaffee?«, fragte Ethan unschlüssig und blickte auf mein nervös wippendes Bein.
»Lieber Tee.«
Erst als er weg war, fiel mir ein, dass ich eine Wasserflasche dabeihatte. Sie war natürlich leer, so verlangten es die Vorschriften am Flughafen, aber ich wollte mir für den Flug was zu trinken holen. Das war wieder eine meiner »Marotten«, wie Ethan immer sagte, denn ich trank nicht gern aus gekauften Flaschen. Einmal hatte ich nämlich in der Weihnachtszeit in einem Supermarkt gejobbt und gesehen, wie Ratten über die aufgestapelten Getränke flitzten. Verdammt, es musste doch irgendwie möglich sein, noch einen Drink auf die Schnelle zu bekommen, ehe wir weitermussten. Ich öffnete meine Tasche, konnte die Flasche aber nicht finden. Offenbar hatte ich sie in Ethans Tasche gestopft, als ich das Hochzeitsgeschenk in meiner verstauen musste. Zumindest das hatte ich nicht vergessen. Selbst bei dem Gedanken, das Geschenk nicht dabeizuhaben, wurde mir ein bisschen übel.
Also gut, an Bord würde es ja wohl Wasser geben. Und das bekam man doch gratis, oder?
Ich war angenehm überrascht, als Ethan mit zwei Pappbechern Tee und meiner Wasserflasche zurückkam.
»Oh, du hast daran gedacht?«, sagte ich und nahm dankbar die volle PET-Flasche.
»Die Pflicht eines Ehemanns«, verkündete er und tippte sich an einen imaginären Hut. »Ich habe dir Eistee mitgebracht, weil die Leute vor dem Wasserspender Schlange standen. Aber der Eistee ist in der Flasche, weil ich ja weiß, wie zimperlich du sein kannst.«
»Ist ja noch besser.« Ich gab ihm einen Kuss auf die Wange. Für eine Weile entkamen wir dem stressigen Trubel des Terminals und nippten in einer Oase der Ruhe an unseren Heißgetränken. Dann hörten wir, dass unser Gate offen sei, und machten uns wieder auf wie müde Rennpferde zum dritten Start des Tages unsere Taschen hinter uns her schleifend.
Der Flug nach Bayern dauerte weniger als zwei Stunden. Nicht, dass es von Belang gewesen wäre, weil wir selbst auf einem Zwanzig-Stunden-Flug Economy gebucht hätten. Wir konnten uns schlichtweg nichts anderes leisten. Jedenfalls noch nicht. Mein Erbe hing noch in der Luft, und ich wollte nicht darüber nachdenken, was es bedeuten würde, wenn das Geld endlich käme. Was es für mich und für mein Verhältnis zu Jess bedeuten würde, meine ich. Denn dieses Geld hatte von Anfang an all das symbolisiert, was zwischen mir und meiner Schwester ungeklärt war. Die Kluft in unserer Beziehung, randvoll mit Pfundmünzen.
Da ich auf keinen Fall darüber nachdenken wollte, stöpselte ich meine Kopfhörer ein und lauschte einem Hörbuch für Kinder, das mich seit meinem fünften Lebensjahr begleitete. Ich brauchte etwas, das mich beruhigte, jene vertraute Story mit einem Sprecher, dessen Stimme und Tonfall ich in- und auswendig kannte. Ethan und ich, wir mochten beide alte Dinge, fanden sie auf seltsame Weise tröstlich. Denn wenn ein Uranglas oder eine Schellackplatte Jahrzehnte ohne einen Kratzer überdauerte, dann konnten wir alles überstehen. Das hatte Ethan seinem Eheversprechen hinzugefügt.
»Mist, jetzt habe ich meine …«, fing Ethan an, doch da zog ich bereits ein zweites Set Earbuds aus meiner Tasche. »Danke.«
»Wenigstens vergisst du immer dieselben Dinge«, sagte ich.
Ich nippte weiter an meinem Eistee und lehnte mich zurück gegen die Kopfstütze. Die schlaflose Nacht holte mich mit Wucht ein, und ehe ich mich versah, berührte mich Ethan sanft am Arm. Mühsam setzte ich mich aufrecht hin, während er mir die Stöpsel aus den Ohren zog.
»Wir sind da«, sagte er und schien es lustig zu finden, dass ich verwirrt dreinblickte. »Du hast nicht mal geschnarcht. Ich hab dich noch nie so tief schlafen sehen.«
Ich stupste sein Knie an, die Stirn spielerisch gerunzelt. Immer noch verschlafen half ich mit, unsere Taschen aus den Fächern zu holen, und dann warteten wir geduldig im Mittelgang darauf, die Maschine verlassen zu können. Die Luft im Freien war kalt, und ich schlang beide Arme um meinen Körper und wünschte, ich hätte meine dicke Jacke angezogen, ehe ich die Taschen schulterte. Ich konnte jetzt schlecht auf die Schnelle versuchen, sie anzuziehen. In Bristol hatte mir die Verzögerung bei der Security schon gereicht, also fand ich mich mit der Kälte ab, anstatt zu bedauern, dass ich unser Zeug nicht intelligenter gepackt hatte.
Der Flieger gehörte zu jenen kleinen Maschinen, die nie direkt am Terminal andocken. Stattdessen steht man in der kalten Morgenluft auf dem Asphalt und wartet auf den Shuttle-Bus. Ich wollte nichts anderes, als so schnell wie möglich zu unserem Mietwagen zu kommen und auf dem Beifahrerplatz zu schlafen.
Endlich durchquerten wir den Terminal und sahen schon das kleine Büro auf dem Parkplatz, auf dem reihenweise polierte Autos standen, die Sitze mit Schutzhüllen versehen. Ich wartete, während Ethan im Büro den Papierkram erledigte, dann kam er wieder heraus und besah sich unser Auto. Kein besonders tolles Modell; keine Sitzheizung, auch kein spezielles Soundsystem. Nur ein Allerweltsauto ohne Sonderausstattung. Wir hatten sogar unser altes Navi von zu Hause mitgenommen, damit wir nicht eins dazubuchen mussten. Ich hoffte bloß, dass die Karten immer noch aktuell waren. Bei dem Gedanken, wir würden vielleicht das Resort-Hotel nicht finden, überkam mich ein Anflug von Panik. Hatte Ethan daran gedacht, die Updates für unser Navi zu überprüfen? Würde letzten Endes ein fehlerhaftes Navi unsere Planung zunichtemachen?
Ich sah auf meinem Handy nach, wie spät es war. Wir lagen noch gut in der Zeit. Allerdings hatte ich gehofft, wir hätten ein kleines Zeitpolster. Es war nämlich sehr wichtig, dass wir nicht zu spät kamen. Dieses eine Mal durfte ich nicht zu spät kommen. In den letzten Jahren hatte ich Jess schon oft genug hängen lassen. Und dazu sollte es diesmal auf keinen Fall kommen. Alles sollte perfekt sein für ihre Hochzeitswoche.
»Wir müssen bald tanken«, moserte Ethan, als wir den Parkplatz der Autovermietung verließen. »Die haben nur ein bisschen reingetan. Die werden das Auto mit weniger als einer Vierteltankfüllung zurückbekommen, das kannst du mir glauben. Oder ich schiebe die Karre zurück auf den Parkplatz, mit dem letzten Tropfen Sprit. Eine scheiß Abzocke ist das!«
Er brummelte vor sich hin wie jeder Engländer, der Urlaub macht, während uns das Navi zur nächsten Tankstelle leitete. Ich hatte schon Mühe, die Augen offen zu halten, obwohl eine Landschaft an uns vorbeiflog, die dann doch ein klein wenig anders als zu Hause aussah. Andere Logos und andersfarbige Verkehrsschilder, die Pflanzen am Straßenrand sahen anders aus als die in England, und im Radio gab es natürlich deutsche Moderatoren und deutschsprachige Werbung zwischen amerikanischen Popsongs.
An der Tankstelle kramte Ethan eine Paper Wallet aus seiner Tasche und gab mir ein paar Euro.
»Möchtest du ein paar Snacks für die Fahrt?«, fragte er. »Und kannst du mir einen Kaffee mitbringen und, oh, Zigaretten?«
Ich nickte.
»Das Feuerzeug nicht vergessen!«, rief er mir nach.
Ich ging in den Shop und nahm Sandwiches, Schokoriegel und Chips mit. Im hinteren Bereich gab es Kaffeeautomaten, aber damit kam ich nicht klar. Entweder waren das die kompliziertesten Maschinen, die ich je gesehen hatte, oder ich war noch so benebelt, dass ich es einfach nicht kapierte. Meine Münzen fielen dauernd durch, und egal, was ich drückte, es kam kein Becher heraus, um gefüllt zu werden. Daher beschloss ich, Ethan stattdessen einen Energy Drink mitzubringen. Anders als ich hatte er kein Problem damit, aus einer Dose zu trinken; trotzdem würde ich sie vorher für alle Fälle mit einem antibakteriellen Tuch abwischen.
Mit den Zigaretten war es am schlimmsten, weil ich auf die Packung zeigen musste, die ich haben wollte, auch auf das billige Feuerzeug. Die Frau hinter dem Tresen versuchte, nett zu sein, aber ich kam mir so dämlich vor. Ich hätte wenigstens ein Buch mit den Standard-Redewendungen im Deutschen mitbringen sollen. Als ich den Shop verließ, brannten meine Wangen.
»Ich habe übrigens noch die hier«, sagte Ethan und zog zwei eingeschweißte Waffeln aus der vorderen Tasche seines Kapuzenpullis aus Biobaumwolle, als ich zum Auto zurückkam. »Sie brachten sie an die Plätze, während du …« Er warf den Kopf in den Nacken und schnarchte pfeifend.
»Du hast gesagt, ich habe nicht geschnarcht!«
»Ich wollte deine Gefühle nicht verletzen. Die Frau in der Reihe vor uns hat die ganze Zeit versucht, dich zu ersticken. Ich musste noch zwei Flugbegleiter holen, um sie von dir wegzuzerren.«
»Du bist ein Held.«
Ethan grinste und steckte sich für später eine Zigarette hinters Ohr.
Derweil gab ich ins Navi die Adresse ein, die Jess mir geschickt hatte. Ihre Hochzeit fand in einem Ski-Resort statt, und sie bezahlte den Aufenthalt dort für uns – Unterkunft, Essen, alles. Sogar mein Kleid und Ethans Anzug, beides wartete vermutlich schon auf uns. Wir mussten nichts anderes tun, als pünktlich anzukommen. Ich wollte das nicht versauen. Nach der Berechnung des Navis würden wir sogar etwas früher als vereinbart eintreffen, wenn auch nicht so früh, wie ich es eigentlich geplant hatte. Wir hatten eine Verzögerung bei der Landung, und danach hatten uns die Schlangen im Terminal noch mal Zeit gekostet. Insgesamt hatten wir eine Stunde verloren. Hoffentlich würden wir ein bisschen während der Fahrt aufholen. Denn sonst hätten wir gerade noch Zeit, uns vor dem Willkommensdinner frisch zu machen, von dem Jess mir erzählt hatte, als ich sie letzte Woche angerufen hatte.
Ich nahm einen Schluck aus meiner Flasche und hoffte, dass mein Outfit fürs Dinner nicht zu sehr in der Tasche zerknittert wurde. Aber neben Jess würde ich sowieso wie ein Stück Dreck aussehen. Ich denke, sie hatte auf Reisen immer ein Bügeleisen dabei, vielleicht sogar ein Set zur Textilreinigung. Jess wurde immer als »natürliche Schönheit« beschrieben; weiches, dunkles Haar, große, dunkle Augen und makellose Haut, ohne etwas dafür tun zu müssen. Die Art von Frau wie gemacht für Perlenohrringe und Shiftkleider. Die Art von Kleidern, die teuer und professionell aussehen. Ich bin diejenige, die sich ständig die Haare anders färbt, die etliche verheilte Piercings und schlecht gemachte Tattoos am unteren Rücken und den Beinen hat. Wann immer ich Jess getroffen habe, sah sie perfekt aus, mit ebenso perfektem Nagellack. Bei mir hielt Nagellack höchstens einen Tag, dann fing ich an, ihn abzukratzen. Aber das war sowieso keine große Sache. Vielleicht wurde ich nur deshalb panisch, weil wir uns zum ersten Mal seit der Beerdigung von Angesicht zu Angesicht sehen würden. Dies sollte ihre Woche sein, ihr großer Tag. Da ich aber, ehrlich gesagt, selbst an einem guten Tag nicht mit ihr mithalten konnte, brauchte ich mir auch keine Gedanken über mein Äußeres zu machen.
Wir fuhren so geschmeidig über die Straßen der Stadt, es fühlte sich fast so an, als wären wir gar nicht unterwegs. Es dauerte nicht lange, und mir fielen die Augen zu. Mit der Stirn lehnte ich an der Scheibe des Beifahrersitzes und verpasste etliche Passagen der Songs, die im Radio gespielt wurden.
Ethan stellte die Musik leiser und tätschelte dann sanft mein Knie. Das Navi meldete sich wieder und sagte, er müsse bei der nächsten Möglichkeit links abbiegen. Ich schloss die Augen, erleichtert, dass wir es rechtzeitig schaffen würden. Diesmal würde ich meine Schwester nicht enttäuschen.
KAPITEL 2
Ein Ruck ging plötzlich durch das Auto, sodass ich mit dem Kopf gegen die Scheibe der Beifahrertür knallte. Mein Mund war ganz trocken, meine Lider schwer wie Blei. Wie lange mochte ich geschlafen haben? Ich erinnerte mich an die Auffahrt zur »Autobahn«, wie die Deutschen sagen. Danach musste ich fest eingeschlafen sein. Jetzt hatte ich dieses Gefühl, das einen überkommt, wenn man mittags zu lange in stickigen Räumen schläft: leichte Kopfschmerzen, als hätte man zu wenig getrunken.
»Sind wir schon da?«, brachte ich schlaftrunken hervor.
»Noch … nicht ganz«, erwiderte Ethan nach einer langen Pause, die mir verriet, dass irgendetwas nicht stimmte.
Bewusst öffnete ich die Augen und musste dann blinzeln, als ich die grelle schneeweiße Welt um uns herum wahrnahm. Überall Schnee, und die untergehende Sonne, die von der weißen Schicht reflektiert wurde, tat mir in den Augen weh. Seufzend schloss ich die Augen wieder.
»Mila?«, fragte Ethan über das Geräusch der Scheibenwischer hinweg.
Ich seufzte wieder, riss die Augen auf und schaute auf die vor uns liegende Straße. Auch die war schneebedeckt und wurde auf beiden Seiten von hohen Bäumen gesäumt. Mächtige dunkle Kiefern, deren Anblick in all dem Weiß recht beruhigend wirkte, obwohl die ausladenden Äste vom Gewicht des Schnees nach unten gedrückt wurden. Immer wieder löste sich ein großer Klumpen von den Zweigen und fiel auf unser Dach, während wir langsam weiterfuhren – durch ein Schneetreiben aus dicken Flocken.
»Wo sind wir?«, wollte ich wissen, setzte mich aufrecht hin und streckte die Hand nach der Wasserflasche aus. Meine Lippen waren trocken wie Papier.
»Tja … also, die Sache ist die: Ich bin mir nicht ganz sicher …«, sagte Ethan.
Mit einem Mal war ich hellwach. Von jetzt auf gleich.
»Wie meinst du das? Was sagt denn das Navi?« Ich sah meinen Mann an.
Er nagte am Winkel der Unterlippe, hatte die Augen zusammengekniffen und starrte auf die Straße vor uns. Klare Anzeichen, dass er unsicher und überfordert war. Erst jetzt wurde mir klar, was in meiner unmittelbaren Umgebung im Auto fehlte: die künstliche Stimme des Navis. Mein Blick huschte zu dem Gerät, aber der Bildschirm war schwarz. Keine Karte, keine Richtungsangaben. Es hatte den Geist aufgegeben.
»Das Ding ist vor einer halben Stunde plötzlich ausgefallen. Bis dahin bin ich immer auf der angegebenen Strecke geblieben. Wir müssten doch fast beim Resort sein, oder?«
»Hat es gesagt, dass du immer geradeaus fahren sollst, ehe es ausgegangen ist?«
»Nein … zuletzt sollte ich dem Streckenverlauf folgen, ich weiß aber nicht mehr, wie weit. Und was ich danach machen sollte, weiß ich nicht. Es gab zwar ein paar Abzweigungen, aber auf keinem der Schilder stand etwas von diesem Resort-Hotel. Daher hielt ich es für das Beste, auf dieser Straße zu bleiben.«
Ein ungutes Gefühl nistete sich in meinem Magen ein. Ein Gefühl, das mir bestens vertraut war. Es war dieses unangenehme Prickeln, das sich immer dann bemerkbar machte, wenn mir wieder einmal klarwurde, dass ich zu einem wichtigen Termin zu spät kommen würde. Und wie Ethan immer so gerne betont, traf das auf fast alle meine Termine zu. Ich gehörte einfach zu der Sorte Mensch, die so gut wie nie pünktlich ist. Aber an diesem Tag durfte das nicht passieren. Immerhin ging es um Jess’ Hochzeit, und ich hatte schon genug angerichtet, um ihr das Event zu verderben. Da hatte es dieses unselige Missverständnis bei Petes Handy gegeben …
»Wie spät ist es?« Ich warf einen Blick auf die Digitalanzeige des Armaturenbretts und fluchte. »Wir müssten ja schon seit einer Stunde da sein! Gottverdammt! Ich muss sie anrufen.«
»Aussichtslos – hab ich schon versucht. Ich wollte die App auf meinem Handy aktivieren. Kein Empfang hier oben. Wir können nicht telefonieren, und wir haben kein Internet.«
Ich schnappte mir mein Handy aus der Tassenhalterung zwischen den Vordersitzen und starrte auf das Display. Kein einziger Balken.
»Na toll!« Ich löste das Navi von der Windschutzscheibe und schüttelte es. Als würde das etwas ändern!
»Bleib ruhig, die Hochzeit ist ja erst in ein paar Tagen. Heute Abend ist nur das Willkommensdinner. Sie wird das schon verstehen.«
»Das macht doch alles nur noch schlimmer! Jess hat ja immer Verständnis für alles und betont jedes Mal, es sei keine große Sache. So ist sie eben. Aber das ist ihre spezielle Woche – das bin ich ihr schuldig, nach all dem … was passiert ist.«
»Das mit Pete war nicht deine Schuld«, sagte Ethan sanft. »Ihr war klar, warum du etwas sagen musstest.«
Ich seufzte. Pete war der Verlobte meiner Schwester. Ist es immer noch. Aber vor ein paar Monaten hatte ich aus Versehen sein Handy und nicht meins genommen und Nacktbilder auf dem Display gesehen. Nacktbilder, die ihm gleich mehrere Frauen geschickt hatten. Was mich ziemlich überraschte, weil Pete eigentlich wie ein Erdkundelehrer aussieht, mit seinen karierten Oberhemden und dem brav gescheitelten, hellbraunen Haar. Ethan und ich fragen uns oft, ob er wohl seine Jeans bügelt, mit Bügelfalte.
Für mich war damals klar, dass ich es Jess brühwarm erzählen musste. Sie war am Boden zerstört, fast hätte sie die ganze Hochzeit abgeblasen und sich von Pete getrennt, obwohl die beiden seit Jahren ein Paar waren. Sie waren länger zusammen als Ethan und ich. Inzwischen hatte Pete sie überzeugen können, dass er keine der Nachrichten geöffnet hatte, aus Angst, es wäre Malware. Er dachte, es wäre alles nur Spam, trotzdem hatte er ihr nichts von diesen Fotos erzählt. Aber letzten Endes verzieh Jess ihm, und mir blieb nicht viel anderes übrig, als ihm auch zu verzeihen. Ich hatte Pete immer gemocht, aber nach diesem Vorfall war unser Verhältnis ziemlich angespannt. Noch bevor Mum und Dad starben. Und vor Mums Beerdigung.
»Ich wünschte, ich hätte nie etwas gesagt.« Ich beobachtete, wie die Scheibenwischer die Schneeflocken entfernten. »Wahrscheinlich denkt sie, dass ich ihr alles mit Absicht verderben will.«
»Aber so denkt Jess doch nicht«, versuchte Ethan mich zu beruhigen. »All das ist jetzt Vergangenheit. Ihr beiden seid alles, was von eurer Familie übrig ist – und das weiß sie. Und sie weiß auch, dass dich keine Schuld trifft bei euren Eltern.«
Ja, ich wusste das; vor ein paar Monaten hatte ich es sogar geglaubt. Aber seit der Beerdigung war für mich nichts mehr selbstverständlich. Ethan konnte nicht wissen, was zwischen Jess und mir an jenem Tag passiert war, und ich hatte nicht die Kraft, es ihm zu erzählen.
Sogar lange vor all diesen Ereignissen hatte ich schon immer das Gefühl gehabt, dass ich Jess etwas schuldig war, dass ich ihr gegenüber etwas wiedergutmachen musste. Als ich zur Welt kam, war meine Schwester schon fünf Jahre alt. Ich war ein Frühchen mit jeder Menge gesundheitlicher Probleme gewesen, und sie musste schon in jungen Jahren Verantwortung übernehmen und mir oft helfen. In unserem ganzen bisherigen Leben war nichts, was sie machte, auch nur annähernd so wichtig oder interessant wie das, was ich tat – zumindest aus Sicht unserer Eltern. Sie verhätschelten mich und verließen sich stets darauf, dass Jess als ältere Schwester schon alles richtig machen würde. Und das tat sie auch, aber es war immer so, dass unsere Eltern es sowieso von ihr erwarteten, und daher lobten sie Jess nur selten. Ich hatte all die Zeit zu meiner großen Schwester aufgeschaut, zu dem Mädchen, das gut fünf Jahre älter als ich war. Sie war das blühende Leben. Und als ich dann älter wurde, fing ich an, zu begreifen, wie ungerecht sich unsere Eltern ihr gegenüber verhalten hatten.
Jetzt würde sie endlich ihren Pete heiraten. Ich glaube, sie hat diese Hochzeit nur deshalb so lange hinausgezögert, weil sie nicht wollte, dass Mum und Dad ihre Feier mit meiner verglichen. Entweder das, oder sie hatte Bedenken, ich könnte als Erste mit einem Enkelkind um die Ecke kommen und ihr die Schau stehlen. Natürlich nicht mit Absicht, aber es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass ich Jess aus Versehen eine Sache versaute. Jetzt brauchte man sich keine Sorgen zu machen, dass Mum oder Dad Jess’ Hochzeit nicht genug Bedeutung beimaßen. Aber ich wusste, wie enttäuscht meine Schwester war, dass unsere Eltern nicht dabei sein würden. Sie waren beide in den letzten acht Monaten gestorben, erst Dad, dann Mum.
Nach ihrem Tod wurde die Situation zwischen Jess und mir noch komplizierter. Meine Eltern hatten mir neunzig Prozent ihres Besitzes vermacht, weil »ich eine Familie gründete und das Geld deshalb nötiger hatte.« Noch hatte ich das Geld nicht erhalten, aber das war eine reine Formalität. Ich wollte es mir mit Jess teilen, aber inzwischen war ich mir nicht mehr so sicher, ob sie überhaupt noch etwas von mir annehmen würde.
»Sieht wie ein Ortsschild aus«, hörte ich Ethan sagen, der mich in meinem Gedankengang unterbrach. Ich folgte seinem Blick und sah ein Schild, allerdings handelte es sich nicht um ein modernes Ortsschild. Wir befanden uns ja auch inzwischen tief in den Alpen. Das Schild bestand aus einem grob behauenen Stück Holz, das jemand an einen Baumstumpf genagelt hatte. Dem Licht der Scheinwerfer nach zu urteilen, war das Holz grau und verwittert, als hinge es dort schon seit Jahrzehnten. Vielleicht sogar länger. Als Ethan langsamer fuhr, konnte ich im Schneetreiben gerade so den Ortsnamen auf der verwitterten Oberfläche erkennen: Witwerberg.
»Vielleicht haben die Leute dort eine Karte, oder jemand erklärt uns, wo wir hinmüssen«, sagte Ethan.
»Ich bin mir nicht sicher, ob uns das weiterhilft. Wir sprechen doch beide kein Deutsch.«
»Ich vertraue auf das deutsche Bildungssystem. Die Lady bei der Autovermietung sprach ein besseres Englisch als ich«, hob Ethan hervor. »Außerdem – wenn die dort WiFi haben, kann ich eine Karte übers Handy runterladen.«
Ethan bog von der Hauptstraße ab, und mein Blick ging in eine unbestimmte Ferne, meine Angst wurde ein wenig von dem Gedanken verdrängt, dass wir es schaffen würden. Zwar nicht rechtzeitig, aber wir würden zumindest irgendwann während des Dinners ankommen und den ersten Abend nicht komplett verpassen. An diese Hoffnung klammerte ich mich.
Ich sah, wie die Straße vor uns schmaler wurde. Die Bäume zu beiden Seiten der Fahrbahn schienen zum Greifen nahe. Auf meiner Seite begann der schneebedeckte Grund abzufallen, und schon bald folgten wir dem Straßenverlauf über einen steilen Bergkamm. Weit unter uns konnte ich in einer tiefen Senke Schneewehen erahnen, auch ein paar dunkle Flecken, die ich für Kaninchen hielt. Schwer zu sagen in der zunehmenden Dunkelheit. Die Reifen rutschten ein wenig auf der Fahrbahn, und ich biss die Zähne zusammen, aber wir fuhren langsam weiter, und kurz darauf gelang es mir, mich zu entspannen.
Ich atmete bewusst lange aus und versuchte, die innere Anspannung loszuwerden. Ich war geradezu versessen darauf, diesmal nicht zu spät zu kommen. Rechtzeitig da zu sein, um sicherzustellen, dass Jess die perfekte Hochzeit erlebte. Das war ich ihr schuldig, nach all den Jahren, in denen mein Leben immer Vorrang gehabt hatte. Sie hatte eine perfekte Hochzeit verdient, und endlich einmal sollte sie im Mittelpunkt aller Aufmerksamkeit stehen. Jetzt lag es an mir, dafür zu sorgen, dass sie den schönsten Tag ihres Lebens hatte, und hier kam ich nun, mehr als eine Stunde zu spät, gleich am ersten Tag einer ereignisreichen Woche, die Jess geplant hatte.
Die hypnotisierenden Scheibenwischer wurden langsamer. Ich blinzelte, weil ich mir nicht sicher war, ob ich mir das nur einbildete. Dann begann das Auto plötzlich zu stottern und verlor an Fahrt, bis es schließlich ganz stehen blieb.
»Fuck!«, entfuhr es Ethan. »Fuck, fuck, fuck!« Er drosch aufs Lenkrad ein, dann drehte er den Zündschlüssel im Schloss. Ein Röcheln des Motors. Noch einmal. Dann nichts mehr. Das Auto stand einfach nur da, nichts rührte sich. Die Kälte draußen vertrieb in kürzester Zeit die Restwärme im Innern. Lautlos fiel der Schnee auf die Windschutzscheibe, Flocke um Flocke wurde das restliche Tageslicht ausgeblendet.
Ethan hatte ziemlich gefasst auf mich gewirkt, als er erzählte, das Navi sei ausgefallen, doch jetzt sah er aus, als würde er jeden Moment vor Wut das Lenkrad abreißen. Wieder und wieder drehte er den Zündschlüssel, aber nichts tat sich.
»Was ist bloß los?« Meine Frage war dämlich. Der Blick auf die Tankanzeige verriet mir, dass der Tank noch mehr als halb voll war.
»Ich weiß es nicht. Warte mal«, sagte Ethan, löste den Gurt und stieß die Fahrertür auf. Ein eisiger Luftstoß wirbelte Schnee ins Auto, und ich zuckte unwillkürlich zusammen. Der Hoodie und die Jacke, die mir im Umfeld des Terminals gute Dienste erwiesen hatten, waren nicht gemacht für Schneestürme in den Alpen. Ethan, der nur seinen Kapuzenpulli trug, war ausgestiegen und schlug die Tür zu. Unmittelbar darauf raubte mir die Motorhaube die Sicht auf die Windschutzscheibe. Ich hörte, wie Ethan im Motorraum herumhantierte und vor sich hin murmelte. Ich hatte keinen Schimmer, was er da machte. Wir kannten uns beide nicht sonderlich gut mit Autos aus. Als wir noch ein eigenes Auto hatten, konnte ich nur Öl oder Kühlwasser nachfüllen. Ethan war noch schlimmer als ich: Einmal hatte er Diesel statt Benzin getankt, sodass wir irgendwann unterwegs mitten auf dem M5 liegen geblieben waren. So gesehen, war es für mich keine Überraschung, als er die Haube wieder zuschlug und zurück ins Auto stieg, bibbernd vor Kälte.
»Ich habe keine Ahnung, was mit dieser Scheißkarre ist. Vielleicht hat sich etwas gelöst, als ich über diesen Huckel fuhr, von dem du aufgewacht bist.« Er versuchte noch einmal, den Motor anzulassen, doch nichts geschah. »Ob’s die Batterie ist?«
»Okay«, sagte ich und zwang mich, ruhig zu bleiben. »Lass uns in dieses Dorf gehen und jemanden holen, der unsere Batterie überbrückt. Das macht man doch, wenn eine Batterie platt ist, oder?«
Ethan zuckte mit den Schultern. »Schätze, ja. Aber wir wissen nicht, wie weit es noch bis ins Dorf ist.«
»Dann sollten wir uns lieber warm einpacken.«
Unsere Taschen waren im Kofferraum, und wir brauchten einen Moment, bis wir beim Durchwühlen des Gepäcks Schals und Mützen gefunden hatten, die wir natürlich nicht im warmen Auto getragen hatten. Ethan zog seinen Mantel an, ich schnappte mir als Erstes meine Handschuhe und wünschte, ich hätte gefütterte Leggins angezogen oder wenigstens eine richtige Hose. Mit der Mütze und der dicken Jacke war mir ein bisschen wärmer, aber mein Unbehagen nahm von Minute zu Minute zu. Es wurde immer später und später, wir würden das Dinner verpassen, und ich konnte Jess nicht einmal anrufen, um ihr alles zu erklären. Was sie jetzt wohl dachte? Dass mir nicht viel an der Feier lag und ich mir keine Mühe gab, pünktlich zu erscheinen? Oder glaubte sie, ich würde überhaupt nicht kommen?
»Hey«, sagte Ethan, und ich schaute zu ihm auf. Ich merkte, dass ich Tränen in den Augen hatte. Wenn ich frustriert war, kamen mir immer schnell die Tränen. »Wir schaffen das schon noch. Versprochen.«
»Okay.« Ich zwang mich, langsamer zu atmen und ruhiger zu werden. Dann legte ich meine Hand in seine und spürte, wie er meine Finger sacht, aber aufmunternd drückte.
Wir hatten keinen Rucksack dabei, deshalb stopfte ich meine Wasserflasche und die Snacks von der Tankstelle in meine Handtasche, dazu die billige Taschenlampe, die wir im Handschuhfach gefunden hatten. Solche Dinger bekam man in Ein-Pfund-Läden an der Kasse; nicht gerade die Art Lampe, auf die man sich im Ernstfall verlässt. Über den schneebedeckten Bäumen hatte der Himmel ein tiefes, dunkles Blau angenommen, das allmählich in Schwarz überging. Der Abend brach an, und wir hatten immer noch keine Ahnung, wie weit entfernt dieses Witwerberg lag und ob wir es überhaupt zu Fuß bis dorthin schaffen konnten.
Dicht nebeneinander stapften Ethan und ich die schmale Bergstraße hinauf und ließen den liegen gebliebenen Mietwagen zurück.
KAPITEL 3
An diesem Tag lernte ich, dass die Nacht sehr schnell hereinbricht, wenn es keine Straßenbeleuchtung oder einladend erleuchtete Häuser gibt, die der Dunkelheit Paroli bieten. Es dauerte nicht lange, und wir stolperten durch den Schnee, immer dem schmalen Lichtkegel der Taschenlampe nach. Völlige Dunkelheit hatte uns umschlossen, und ich erschrak bei jedem noch so kleinen Geräusch: Schnee, der von Ästen fiel, knarrende Bäume im Wind, Zweige, die unter unseren Schuhsohlen knackten. Ich hatte mich nicht groß über den Ort informiert, an dem die Hochzeit stattfinden sollte, aber auf der Website des Resort-Hotels gab es eine generelle Warnung vor Wölfen. Natürlich hatte ich keine Ahnung, wie oft man diese Tiere hier in den Bergen tatsächlich sah, aber im Stockdunkeln dachte ich nicht über Wahrscheinlichkeiten nach. Nur über Fangzähne.
Ethan bestand darauf, unmittelbar vor mir zu gehen, damit ich mich auf dem unebenen Untergrund an seinen Fußspuren orientieren konnte. Er scherzte oft, ich sei der Typ, der über die eigenen Füße stolpert, aber im Augenblick fand ich das überhaupt nicht lustig. Insbesondere dann nicht, als ich mit einem Fuß durch dünnes Eis brach, in einer Furche hängen blieb und mir den Knöchel verstauchte. Ich ging zu Boden, mein Schrei hallte von den Bäumen wider.
»Mila!« Ethan half mir auf, aber es war schon zu spät. Ich zuckte zusammen, als ich den lädierten Fuß aufsetzte. »Ist er gebrochen oder verstaucht?«
»Verstaucht, denke ich. Mist!«
»Hast du an Schmerztabletten gedacht?«, fragte er.
»Ja, die müssen irgendwo sein. Lass uns versuchen, das Dorf zu finden, dann suche ich nach den Tabletten, sobald ich mehr Licht habe.«
Ich stützte mich bei ihm ab, und gemeinsam humpelten wir weiter, kamen aber wesentlich langsamer voran als zuvor. Wie weit waren wir von der Zivilisation entfernt?
Auf dem Schild, auf dem Witwerberg stand, hatte ich keine Kilometerangabe gesehen. War das Dorf so nah, dass es keiner Angabe bedurfte, oder waren schicksalsträchtige Worte wie »20 Kilometer« im Laufe der Zeit verblichen? Wie in einem Horrorstreifen, wenn die glücklosen Teenager genau den Bereich des Schilds übersehen, der von einer losen Planke verdeckt wird: »Lebensgefahr – Betreten verboten.«
Wir sprachen beide kaum. Ich denke, wir waren zu sehr damit beschäftigt, endlich dieses Dorf zu erreichen, und lauschten auf den kleinsten Hinweis von Zivilisation: Motorengeräusche, zu laut eingestellte Fernseher, Stimmen. Aber wir hörten rein gar nichts. Mir war kalt, mein Knöchel schmerzte, außerdem war ich absolut verzweifelt, dass wir zu spät zu Jess’ Dinner kommen würden, ganz zu schweigen von meiner Angst, in der Dunkelheit auf Wölfe zu stoßen.
Wir waren gefühlt eine Ewigkeit unterwegs, aber es war so still um uns herum, dass keine Ortschaft in unmittelbarer Nähe sein konnte. Meine dünnen Leggins nützten gar nichts gegen die Kälte, im Gegenteil, sie sogen den feuchten Schnee geradezu auf, sodass mir noch kälter wurde, weil mir der Stoff auf der Haut klebte. Genauso verhielt es sich mit meinen Turnschuhen: Im Terminal waren sie bequem gewesen, jetzt waren sie nass. Ich stellte mich innerlich auf einen langen, schmerzhaften Weg ein, als wir den höchsten Punkt einer kleineren Anhöhe überwanden und vor uns eine Siedlung erahnten. Ein kleines Dorf, genauer gesagt.
Die Straße, die an dieser Stelle nicht mehr als ein Pfad war, schlängelte sich an dem Ort vorbei, ganz so, als wolle sie die traurige Ansammlung von Gebäuden meiden. Ethan leuchtete mit seiner Taschenlampe mal hierhin, mal dorthin. Die wenigen Behausungen, die wir sahen, bildeten einen Halbkreis. In der Mitte stand ein altertümlich anmutender Ziehbrunnen aus Stein mit einer Holzkonstruktion und einem dicken, quer verlaufenden Balken, in den man professionell den Namen »Witwerberg« geschnitzt hatte. Hätte ich diesen Schriftzug nicht gesehen, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass dies der Ort sein sollte, den wir suchten. Der Ort, auf dem all unsere Hoffnung ruhte.
Wir sahen insgesamt sechs Behausungen, besser gesagt Blockhütten mit langen Dachtraufen und geschlossenen Fensterläden. Beim Anblick dieser schneebedeckten Hütten dachte ich spontan an Kuckucksuhren und dekorative Miniatur-Weihnachtsdörfer für Kinder. Jede Hütte hatte eine Veranda, einige mit Schnitzwerk und verzierten Querbalken. Aber in diesem Moment dachte ich nicht in erster Linie daran, wie urig und volkstümlich diese Blockhütten aussahen. Alles, was ich wahrnahm, waren sechs Behausungen, die in völliger Dunkelheit dalagen. Nicht in einer der Hütten brannte Licht. Und als ich im Schein der Taschenlampe genauer hinsah, fiel mir auf, dass einige Fensterläden schief in den Angeln hingen. Mehr noch, die an etlichen Stellen eingesunken Dächer und die morschen Holzstufen der Veranden erzählten ihre ganz eigene, unwillkommene Geschichte: Dieser Ort war verlassen. Vielleicht hatte hier oben schon seit hundert Jahren niemand mehr gelebt.
»Mist«, sagte Ethan. »Das kann doch nicht wahr sein … das hier ist eine Geisterstadt.«
Ein eiskalter Windstoß erfasste uns. Ich zitterte am ganzen Leib und spürte, wie mir die Kälte bis auf die Knochen ging. Ich musste so schnell wie möglich ins Warme. Wir beide mussten raus aus diesem Frost.
»Ich kann nicht mehr«, sagte ich, »wir müssen irgendwo Schutz suchen.«
Ethan sah mich einen Augenblick an und nickte dann. Ich ahnte, dass es ihm widerstrebte, die Suche nach einer belebten Ortschaft aufzugeben. Er war so voller Tatendrang, wahrscheinlich wäre er die ganze Nacht weiter durch den Schnee gestapft, wenn ich mir nicht den Knöchel verstaucht hätte. Diese Willenskraft war der Grund, warum wir unser Auskommen hatten. Denn Ethan hatte sich voll reingehängt, als wir unseren Plattenladen und Reparaturservice eröffneten. Unmittelbar nach der Uni hatten wir zunächst mit einem Marktstand angefangen, aber inzwischen hatten wir eine richtige Ladenfront. Ich wünschte nur, wir beide könnten ein Auto so leicht reparieren, wie es uns mit einem Plattenspieler fiel.
»Hier drüben«, sagte Ethan und brachte mich zu der ersten Blockhütte. Anders als ihr direkter Nachbar sah sie intakt und stabil aus. Zumindest das Dach schien nicht eingefallen zu sein. Ethan ließ mich am Geländer der Veranda zurück und versuchte, die Tür aufzumachen. Mit seinem ganzen Gewicht stemmte er sich dagegen und drückte die Klinke herunter. Die Tür bestand aus stabilem Holz, das im Laufe der Jahre von Feuchtigkeit aufgequollen war. Als die Tür schließlich nachgab und aufschwang, kam aus dem Innern der Hütte ein Geruch von Moder und Verfall. Ich hörte lautes Rascheln und hoffte, dass es nur trockenes Laub war, das im jähen Luftzug aufgewirbelt wurde. In unserer angespannten Lage konnte ich mich nicht auch noch mit Ratten befassen.
Ethan leuchtete ins Innere. Ich hatte schon erwartet, dass die kleine Blockhütte fast leer wäre, aber soweit ich das beurteilen konnte, befand sich rein gar nichts mehr darin. Nicht einmal ein zerbrochener Stuhl oder ein weggeworfenes Buch waren übrig. Wer auch immer zuletzt hier gelebt haben mochte, hatte alles mitgenommen. Der Fußboden war übersät von trockenen Kiefernnadeln, Laub und Staub. Eines der Fenster war nur noch ein klaffendes Loch, die Läden entweder abgefallen oder sie hingen schief in den Angeln; am gegenüberliegenden Fenster waren sie fest verschlossen. An der Wand gegenüber der Eingangstür befand sich ein offener Kamin mit einem kleinen, völlig verrosteten Rost.
»Wie gemütlich«, murmelte ich vor mich hin. Es sollte lustig klingen, war aber nichts als ein müder Scherz. Ethan hatte die Hütte betreten und blickte sich finster um, als wäre dieser verlassene Ort das Schlimmste an unserer total verfahrenen Situation.
Jetzt betrat auch ich die Hütte und merkte, dass unter all den Nadeln und Laub auf dem Fußboden eine Art Matte lag, die aber so dünn war, dass man nicht von einem Teppich sprechen konnte. Es kam mir eher wie unidentifizierbares verrottendes Gewebe vor, das sich mit all dem Schmutz zu einer Einheit verbunden hatte. Die Schicht auf dem Fußboden dämpfte meine Schritte, als ich in die Hütte humpelte und sofort Halt an der Wand suchte.
»Wir brauchen Holz, um ein Feuer zu machen«, sagte Ethan. »Mein Feuerzeug ist in deiner Handtasche, oder?«
»Ja, das erste Mal, dass ich froh bin, dass du rauchst«, sagte ich, und diesmal hatte ich mit meinem Versuch, lustig zu klingen, zumindest ein klein wenig Erfolg.
Ethan gab ein Schnauben von sich, ehe er sich mir zuwandte und halb entschuldigend sagte: »Ich muss die Taschenlampe leider mitnehmen. Ist es okay für dich, hier im Dunkeln zu bleiben?«
»Klar«, log ich. »Ich versuche, ein Feuer in Gang zu bringen mit all dem trockenen Laub hier drinnen.«
»Also gut, ich bin nur kurz drüben bei den anderen Hütten und guck nach, ob es da lose Bretter oder so was in der Art gibt, die wir benutzen könnten. Und gleich versuche ich, das offene Fenster dort zuzumachen. Damit die Wärme drinnen bleibt. Setz dich ruhig und nimm Schmerztabletten gegen den verstauchten Knöchel.« Schon war er zur Tür hinaus und nahm die einzige Lichtquelle mit, die wir hatten.
Vorsichtig schob ich mit meinem lädierten Fuß die Schicht aus Laub und was auch immer weg, ließ mich dann langsam nach unten sinken und setzte mich auf die freie Fläche. In eine halbwegs sitzende Position zu kommen tat ein bisschen weh, aber ich war froh, meinen Knöchel entlasten zu können. Ich hatte mich ganz in der Nähe des offenen Kamins auf den Boden sinken lassen und fing nun an, trockene Kiefernnadeln und Laub auf dem Rost im offenen Kamin aufzuschichten, wobei ich inständig hoffte, jetzt bloß nichts Lebendiges zu berühren. Dann tastete ich in meiner Tasche nach dem Feuerzeug. Ich würde Ethan nie wieder die Hölle heiß machen, weil er rauchte, so viel stand fest.
Es dauerte eine Weile, und zweimal verbrannte ich mir die Finger, aber schließlich bekam ich ein kleines Feuer zustande, das leider ziemlich qualmte. Jetzt zahlte es sich also aus, dass ich früher oft verbotenerweise Lagerfeuer im Wald gemacht hatte, um mit Freunden etwas zu trinken. Mein Material bestand hauptsächlich aus Laub und ein paar kleineren Zweigen vom Fußboden, aber erste, zarte Flämmchen brannten. Langsam gab ich Nadeln dazu, auch ein paar alte Kassenbelege aus meiner Tasche, während ich auf Ethans Rückkehr wartete. Er war mittlerweile schon ziemlich lange fort, und ich hörte auch nichts mehr von ihm. Ich redete mir ein, dass ich ihn gehört hätte, wenn er angegriffen worden wäre. Seine Hilferufe – oder Schreie.
Ich versuchte, ruhig zu bleiben, öffnete meine Wasserflasche und nahm zwei Ibuprofen, weil mein Knöchel angeschwollen war, und Paracetamol gegen den Schmerz. Abgesehen von der Wasserflasche mit dem Eistee hatten wir noch Ethans Energy Drink und die Snacks, die wir für unterwegs mitgenommen hatten. Sandwiches, Chips, Schokoriegel und ein paar eingeschweißte Waffeln aus dem Flugzeug. Ich hatte eigentlich zu viel eingekauft, aber das kam uns jetzt zugute. Auf diese Weise hatten wir genug Brennstoff für unsere Körper, damit wir in der Nacht nicht auskühlten.
Immer noch keine Spur von Ethan. Ich schaute erneut aufs Handy. Er hatte seins mitgenommen. Weiterhin weder 4G noch Empfang. Mein Akku war weniger als halb voll, weil ich im Auto eingeschlafen war und ihn nicht aufgeladen hatte. Na, großartig. Ich beschloss, die Taschenlampen-Funktion nicht zu nutzen, um den Akku zu schonen.
Bei einem unerwarteten Geräusch hinter mir fuhr ich herum.
»Ich bin’s«, rief Ethan von draußen und versuchte offenbar, die Fensterläden von dort zu schließen. »Augenblick.«
Kurz darauf kam er herein, unterm Arm einen Stapel Holz. Ein paar Bretter und einige Rundhölzer, an denen sich schon Moos und Flechten gebildet hatten.
»Da ist noch mehr, doch ich wollte nicht zu lange fortbleiben. Das hier müsste aber auch reichen, um uns heute Nacht warm zu halten. Oh, prima, du hast ja schon ein Feuer gemacht.« Er legte etwas feuchtes Holz in den Kamin, daher qualmte es noch mehr als zuvor. Gemeinsam schauten wir auf die kümmerlichen Flammen und hofften, dass das Holz von draußen Feuer fing. Als die Flammen schließlich größer wurden, seufzten wir beide vor Erleichterung.
Ethan zog die nassen Handschuhe aus und wärmte seine Hände. »Gibt’s noch Sandwiches?«
»Rindfleisch mit Meerrettich oder Schinken und Käse?«
»Hälfte, Hälfte?«
Wir teilen uns die Sandwiches und aßen mit Heißhunger. Sie waren fast gefroren, weil sie so lange in meiner Handtasche gelegen hatten, und sorgten leider nicht dafür, dass ich ein warmes Gefühl im Bauch bekam. Dennoch, wir konnten wenigstens etwas gegen den Hunger tun. Ich merkte, dass Ethan immer noch genauso besorgt wie ich war, denn er machte nicht die üblichen Scherze: Dass ich nämlich kein Problem damit hatte, Sandwiches aus Plastikverpackungen zu essen, aber nicht aus PET-Flaschen trinken wollte. Düster kaute er vor sich hin, sagte keinen Ton und stierte gedankenversunken ins Feuer.
Ich musste an Jess denken und an das Willkommensdinner, das inzwischen wohl vorüber war. Was dachte meine Schwester jetzt gerade? Vielleicht versuchte sie, mich zu erreichen. Womöglich ahnte sie, dass etwas schiefgelaufen war, und hatte ein paar Leute losgeschickt, um nach uns zu suchen? Ich wollte es glauben, aber vermutlich dachte sie bloß, dass ich zu spät kam, wie gewöhnlich eben. Bestimmt dachte sie, dass wir zu spät am Flughafen angekommen waren oder den Flug verpasst hatten. Und wenn sie mich übers Handy nicht erreichte, musste sie davon ausgehen, dass wir noch in der Luft waren. Gott, mir war klar, dass ich mich noch lang und breit bei ihr zu entschuldigen hatte, sobald wir am Resort ankamen. Okay, nichts auf unserer Reise war wirklich meine Schuld, aber es fühlte sich trotzdem so an. Dabei hatte ich mir so sehr vorgenommen, diesmal alles richtig zu machen. Vorbei!
»Hey«, sagte Ethan und unterbrach mich in meinen sorgenvollen Gedanken. »Jess wird das alles schnell wieder vergessen, sobald sie weiß, was passiert ist. Außerdem können wir an der Rezeption eine tolle Geschichte erzählen.«
»Ich will aber keine tolle Geschichte – ich möchte, dass sie eine perfekte Hochzeit hat. Mit einer Geschichte, wie du es nennst, stehe ich nur wieder im Rampenlicht – ›Oh, seht euch nur Jess’ mitgenommene Schwester an, die viel zu spät kommt und eine total verrückte Story parat hat!‹ Das ist ihr Tag, deshalb soll es nicht wieder um mich gehen, denn früher ist es immer nur um mich gegangen.«
»Also gut, morgen holen wir Hilfe, lassen uns zum Resort fahren, bleiben gelassen und halten uns zurück. Wir hatten eine Verspätung, aber jetzt sind wir ja da, und alles läuft wie geplant.«
»Versprochen?«
»Versprochen!«, sagte Ethan und legte den Arm um mich. »Morgen sieht die Welt anders aus, und diese Nacht wird uns wie ein schlechter Traum vorkommen.«
Ich seufzte, wusste aber, dass er recht hatte. So gut wie jedenfalls. Normalerweise wusste Ethan immer genau, was er sagen musste, aber diesmal konnte er nicht wissen, was zwischen Jess und mir gelaufen war, als wir uns das letzte Mal gesehen hatten. Aber das war buchstäblich Schnee von gestern. Fast. Ich musste nur dafür sorgen, dass nicht wieder irgendetwas passierte, das ihr die Hochzeit vermiesen könnte.
Während das Feuer neben uns prasselte, machten wir es uns auf dem harten Boden bequem und versuchten, etwas Schlaf zu finden. Trotz des langen Nickerchens im Auto war ich erschöpft. Mein Knöchel pochte, und ich konnte kaum noch die Augen offen halten. Normalerweise schlief ich erst ein, wenn ich mich mindestens fünfmal von einer Seite auf die andere gewälzt hatte, und in Hotelbetten störte mich die kleinste Unebenheit der Matratze. Aber nachts als Nervenbündel durch den Schnee zu stapfen raubt einem die Kraft. Ich schlief so schnell ein, der klamme Fußboden der Blockhütte hätte genauso gut eine teure Memory-Foam-Matratze sein können.
Das Letzte, an das ich mich erinnern kann, war, dass Ethan sich an mich kuschelte und mit dem Kopf an meiner Schulter schlief. Ich weiß noch, dass ich Gott dankte, dass mein Mann bei mir war und in der schlimmsten Nacht meines Lebens beruhigend auf mich einwirkte. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie ich die letzten zwölf Stunden ohne ihn geschafft hätte.
KAPITEL 4
»Mummy!«
Ich hörte Jess schreien und Mums lautes Rufen. Alles war so plötzlich passiert. Eben war ich noch hoch oben im alten Apfelbaum und schüttelte die Äste, damit die besten Äpfel zu Boden fielen. Ich konnte einen am Rücken spüren, rund und hart. Sie machten so tolle Geräusche, wenn sie ins Gras plumpsten. Ich machte nicht so ein Geräusch.
Mum tauchte neben mir auf, sah auf mich herab. Mein Kopf schmerzte, und ein Bein brannte wie Feuer. Ich musste an die schroffe graue Rinde gekommen sein. Die Finger taten mir immer noch weh, weil ich mich so krampfhaft an einem Ast festgehalten hatte.
»Was ist passiert?«, fragte Mum und tastete mich überall ab. »Jessica, ich habe dir gesagt, dass du aufpassen sollst. Ihr wisst, dass ihr nicht auf diesen Baum klettern dürft – das ist zu gefährlich.«
»Aber ich hab doch aufgepasst!«, rief Jess. »Sie hat gesagt, sie holt einen Saft, und ich hab den Swingball aus dem Schuppen geholt.«
»Ich glaube, da ist nichts gebrochen«, sagte Mum. »Aber lauf und hol deinen Dad, Jess, damit er sie ins Krankenhaus fahren kann. Vielleicht hat sie eine Gehirnerschütterung.«
Ich hörte, wie die Gummisohlen von Jess’ Sandalen quietschten, als sie zurück zum Haus lief.
»Millie, du weißt doch, dass der alte Baum gefährlich ist. Letztes Jahr ist ein größerer Ast abgebrochen. Hat Jess dir denn nicht gesagt, dass du nicht klettern sollst?« Sie strich mir das Haar aus der Stirn.
»Sie …« Ich hielt inne und dachte an mein neues Fahrrad in der Garage. Ich hatte es erst seit zwei Tagen. Würden sie es mir wegnehmen, wenn sie herausbekamen, dass ich es mir mit dem Fruchtsaft anders überlegt hatte und stattdessen einen Apfel haben wollte? Dass ich Jess drüben im Schuppen gesehen hatte und dachte, dass sie es schon nicht mitbekommen würde, wenn ich nur schnell genug auf den Baum kletterte?
»Und?«, drängte Mum mich. »Hat sie es dir nicht gesagt?«
»Sie hat gesagt, ich soll ruhig auf den Baum klettern.«
Mum gab einen verärgerten Laut von sich und schüttelte den Kopf. Ich spürte, wie sich mir der Magen drehte. Jetzt war sie stinksauer auf Jess. Dabei hatte ich nur gewollt, dass sie nicht sauer auf mich war.
Dad und Jess kamen zusammen zurück, Dad hatte sofort ein Erste-Hilfe-Buch und eine Taschenlampe mitgebracht, mit der er mir in die Augen leuchtete. Währenddessen sah ich, wie Mum meine Schwester am Arm packte und ihr mit erhobenem Zeigefinger drohte.
Jess suchte meinen Blick, sie war verdutzt und hatte Tränen in den Augen. Ich sah in das Licht der Taschenlampe.
Sie brachten mich ins Krankenhaus, um alles abzuklären, danach kauften sie mir auf dem Heimweg ein Happy Meal. Ich fragte, ob wir noch ein zusätzliches Spielzeug für Jess mitnehmen könnten, weil Beanie-Baby-Woche war. Mum lobte mich und sagte, ich sei eine rücksichtsvolle Schwester, daraufhin gab mir die Dame an der Kasse ein extra Spielzeug.
Zu Hause war Jess in unserem Zimmer, und ich gab ihr den Baby-Hummer. Ich ließ ihn über das Kopfkissen krabbeln und tippte Jess’ Nasenspitze mit den kleinen Scheren an. Ihre Augen waren gerötet vom Weinen, und all die Tiere aus der Beanie-Baby-Kollektion lagen auf dem Fußboden, wo Jess sie hingeworfen hatte.
»Hallo, ich bin Pinchy«, sagte ich. »Er ist ein Zwilling.«
Jess schniefte noch, nahm den kleinen Hummer aber und ließ ihn über meinen Arm bis zu meinem Hals laufen. Es kitzelte. Dann kramte sie das alte Aquarium hervor, um Pinchy und Snapper ein Haus zu bauen. Ich hörte, dass Dad unterdessen draußen die tiefer liegenden Äste des Apfelbaums absägte. Ich fühlte mich schlecht, weil Jess und ich jetzt nicht mehr Vater, Mutter, Kind unter dem Baum spielen konnten. Aber zumindest war sonst wieder alles normal.
KAPITEL 5
Die Kälte weckte mich.
Ich öffnete die Augen, und das Erste, was ich sah, waren das leere Kaminrost und die Asche unseres Feuers. Irgendwann in der Nacht war es ausgegangen. Ich stieß einen Seufzer aus und machte mir bewusst, dass einer von uns hätte wach bleiben müssen, um das Feuer zu schüren. Jetzt war es wieder saukalt in der Blockhütte. Außerdem hatten wir das ganze Holz verbraucht, das Ethan am Abend zuvor geholt hatte. Nun, viel war es ohnehin nicht gewesen. Also müsste wieder einer von uns losziehen und weiteres Brennmaterial holen, wenn wir es warm haben wollten, ehe wir überlegten, was wir tun wollten. Als ich die Zehen bewegte, spürte ich, dass meine Turnschuhe immer noch feucht waren. Die Socken hatten sich mit geschmolzenem Schnee vollgesogen. Widerlich!
Ich versuchte, mir vorzustellen, was für Optionen wir nun hatten, und da mich das Gefühl beschlich, dass dieser Tag unüberwindbar war, schloss ich verzweifelt die Augen. Sollten wir wieder zurück zum Auto gehen und noch einmal versuchen, den Motor anzulassen? Oder besser in dieser verlassenen Hütte warten, in der Hoffnung, dass Hilfe unterwegs war? Oder sollten wir ganz woanders hingehen? Ich bewegte meinen lädierten Fuß und verspürte augenblicklich einen stechenden Schmerz. Okay, woanders hinzugehen, das kam also nicht infrage. Na, toll.
Erst da merkte ich, dass ich Ethans Wärme nicht mehr am Rücken spürte. Mühsam setzte ich mich aufrecht hin und versuchte, das Pochen in meinem Knöchel zu ignorieren. Doch der Schmerz ließ sich nicht ausblenden und vertrieb die Benommenheit vom Aufwachen. Ethan war fort? Aber wo steckte er bloß?
»Ethan?« Meine Stimme war ein Krächzen.
Keine Antwort. Draußen vor der Hütte hörte ich ihn auch nicht. War er wie gestern bei den anderen Hütten auf der Suche nach Holz und außer Hörweite? Ich kämpfte gegen meinen rasenden Puls an und griff nach der Packung mit Schmerztabletten. Meine Wasserflasche war leer, daher musste ich die Dinger so runterschlucken. Und die ganze Zeit redete ich mir gut zu, nur die Ruhe zu bewahren. Ethan würde jeden Moment zurückkommen, mit Brennholz und einem Plan, wie wir wieder aus diesem Schlamassel herauskämen.
Aber er kam nicht zurück, Feuerholz hin oder her. Länger als beabsichtigt hockte ich in der Kälte, bis ich das Warten nicht mehr aushielt. Ich rappelte mich auf, stützte mich mit einer Hand an der Wand ab und humpelte dann zur Tür, die nur angelehnt war. Draußen auf der Veranda lehnte ich an dem Holzgeländer und blickte mich um, auf der Suche nach meinem Mann. Ich schaute von einer Blockhütte zur anderen, sah aber nirgendwo eine Spur von ihm.
»Ethan!«, rief ich in die Stille. Meine Stimme wurde von den hohen Bäumen ringsumher zurückgeworfen. Wenn sich jemand irgendwo bei den paar Blockhütten aufhielt, konnte er mein Rufen nicht überhören. Aber nach wie vor keine Antwort.
Einen Moment stand ich halb benommen da und hörte nichts anderes als meinen unregelmäßigen Atem. Mein Herz raste, das Blut rauschte mir dumpf in den Ohren. Was, wenn ihm auf der Suche nach Holz irgendwas zugestoßen war? Vielleicht war er in einer der Blockhütten mit einem Fuß durch den morschen Fußboden gebrochen und hatte sich verletzt. Oder ein Deckenbalken war heruntergekracht, und jetzt lag Ethan irgendwo bewusstlos in einer der Hütten. Für mich gab es nur eine einzige Erklärung, warum er nicht antwortete: Weil er dazu nicht in der Lage war. Ich durfte keine Zeit verlieren. Ich musste nach ihm suchen.