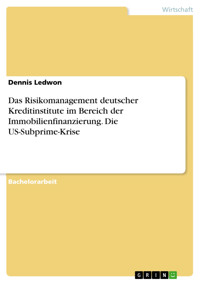
Das Risikomanagement deutscher Kreditinstitute im Bereich der Immobilienfinanzierung. Die US-Subprime-Krise E-Book
Dennis Ledwon
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,3, DIPLOMA Fachhochschule Nordhessen; Abt. Hannover (Diploma), Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Risikomanagement deutscher Kreditinstitute im Bereich der Immobilienfinanzierung unter Berücksichtigung der US-Subprime-Krise. Die Subprime-Krise hat gezeigt, wie wenig sich die Verantwortlichen Banker in deutschen Banken mit den Risiken ihrer Geschäfte auseinandergesetzt haben. Während der Aufarbeitung der Hintergründe zur US-Subprime-Krise fielen im Zusammenhang mit deutschen Banken solche Stichwörter wie „inkompetent“ oder „Geld-hungrig“, oft traf auch beides zu. Obwohl jede Bank eine Art von Risikomanagement besessen hat, kann der Umgang der Wirtschaftsakteure mit diesem Management-Segment nur als eine Farce bezeichnet werden. Erst nach dem Platzen der Immobilienblase in den USA und der hieraus folgenden Finanz- und Wirtschaftskrise rückte das Immobilien-Risikomanagement in den Fokus wissenschaftlicher und praxisrelevanter Untersuchungen. „Studien von ERNST & YOUNG, FUNK RMCE, RÖDL & PARTNER UND WEISS-MANN & CIE. belegen, dass die Notwendigkeit des Risikomanagement in der Praxis immer mehr Beachtung findet. Jedoch mangelt es an der Umsetzung und Etablierung in den Unternehmensstrukturen.“ In dieser Arbeit soll einerseits untersucht werden, wie deutsche Banken in Immobilien investieren und wie sie mit dem einhergehenden Risiko umgehen, andererseits soll untersucht werden, welche Rolle deutsche Banken im Rahmen der US-Subprime-Krise gespielt haben. Diese Arbeit geht der Forschungsfrage nach, inwieweit sich das Immobilien-Risikomanagement deutscher Banken seit der verheerenden Immobilienkrise vor ein paar Jahren verändert hat. Ein weiterer Fokus soll auf die momentanen Entwicklungen in China gelegt werden, da dort ein Pendant zur US-Subprime-Krise heranwächst. „Moody's warnte laut einem Bericht der Financial Times davor, dass der Zusammenbruch der chinesischen Immobilienbranche die Weltwirtschaft beeinträchtigen würde.“ An dieser Stelle kann schon vorweg genommen werden, dass sich in Hinsicht auf das Risiko im Bereich der Immobilienfinanzierung nur erschreckend verändert hat und dies soll im Zuge dieser Arbeit am Beispiel des chinesischen Immobilienmarktes aufgezeigt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Vorgehensweise
1.3 Moderne Geldtheorie
2. Aktivitäten deutscher Kreditinstitute in der Immobilienfinanzierung
2.1 Tätigkeitsfelder
2.1.1 Private Immobilienfinanzierung
2.1.2 Gewerbliche Immobilienfinanzierung
2.1.3 Direktinvestitionen
2.2 Rendite und Risiko
2.2.1 Zielgröße Rendite
2.2.2 Zielgröße Risiko
2.3 Besonderheiten und Risiken der Immobilienfinanzierung
3. Die US-Subprime-Krise
3.1 Ursachen
3.2 Verlauf
3.3 Die Rolle deutscher Banken in der Finanzkrise
3.3.1 Deregulierung des deutschen Finanzmarkts
3.3.2 Das Beispiel Sachsen LB
3.4 Folgen
3.4.1 Schuldner in den USA
3.4.2 Das Beispiel Pforzheim
4. Das Risikomanagement in der Immobilienfinanzierung
4.1 Risiko- und Chancenmanagement
4.1.1 Die Begriffe Risiko und Chance
4.1.2 Risikomanagement oder Chancenmanagement
4.1.3 Risiko- und Chancenkultur
4.1.4 Rechtliche Aspekte
4.1.5 Eine Analyse von Risiko- und Chancenkultur
4.2 Eigenheiten des Immobilien-Risikomanagements
5. Möglichkeiten zur Steuerung des Risikos
5.1 Unterschiedliche Arten der Ansätze
5.1.1 Die ursachenbezogene Risikoauffassung
5.1.2 Die informationsorientierte Risikoauffassung
5.1.3 Die entscheidbezogene Risikoauffassung
5.1.4 Die wirkungsbezogene Risikoauffassung
5.1.5 Kritische Betrachtung der Risikoauffassung
5.1.6 Formale Definitionen von Risiko und Chance
5.2 Tendenzen des Risikomanagements in der Immobilienfinanzierung
6. Lehren aus der US-Subprime-Krise
6.1 Reformansätze
6.2 Wenige Veränderungen und neue Gefahren
6.2.1 China als potentielle Gefahr der Zukunft
6.2.2 China als Wirtschaftsstandort
6.2.3 Deutsche Direktinvestition in China
6.2.4 Direktinvestitionsrecht
7. Fazit
8. Quellenverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Problemstellung
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Risikomanagement deutscher Kreditinstitute im Bereich der Immobilienfinanzierung unter Berücksichtigung der US-Subprime-Krise. Die Subprime-Krise hat gezeigt, wie wenig sich die Verantwortlichen Banker in deutschen Banken mit den Risiken ihrer Geschäfte auseinandergesetzt haben. Während der Aufarbeitung der Hintergründe zur US-Subprime-Krise fielen im Zusammenhang mit deutschen Banken solche Stichwörter wie „inkompetent“ oder „Geld-hungrig“, oft traf auch beides zu. Obwohl jede Bank eine Art von Risikomanagement besessen hat, kann der Umgang der Wirtschaftsakteure mit diesem Management-Segment nur als eine Farce bezeichnet werden. Erst nach dem Platzen der Immobilienblase in den USA und der hieraus folgenden Finanz- und Wirtschaftskrise rückte das Immobilien-Risikomanagement in den Fokus wissenschaftlicher und praxisrelevanter Untersuchungen. „Studien von ERNST & YOUNG, FUNK RMCE, RÖDL & PARTNER UND WEISS-MANN & CIE. belegen, dass die Notwendigkeit des Risikomanagement in der Praxis immer mehr Beachtung findet. Jedoch mangelt es an der Umsetzung und Etablierung in den Unternehmensstrukturen.“[1] In dieser Arbeit soll einerseits untersucht werden, wie deutsche Banken in Immobilien investieren und wie sie mit dem einhergehenden Risiko umgehen, andererseits soll untersucht werden, welche Rolle deutsche Banken im Rahmen der US-Subprime-Krise gespielt haben. Diese Arbeit geht der Forschungsfrage nach, inwieweit sich das Immobilien-Risikomanagement deutscher Banken seit der verheerenden Immobilienkrise vor ein paar Jahren verändert hat. Ein weiterer Fokus soll auf die momentanen Entwicklungen in China gelegt werden, da dort ein Pendant zur US-Subprime-Krise heranwächst. „Moody's warnte laut einem Bericht der Financial Times davor, dass der Zusammenbruch der chinesischen Immobilienbranche die Weltwirtschaft beeinträchtigen würde.“[2] An dieser Stelle kann schon vorweg genommen werden, dass sich in Hinsicht auf das Risiko im Bereich der Immobilienfinanzierung nur erschreckend verändert hat und dies soll im Zuge dieser Arbeit am Beispiel des chinesischen Immobilienmarktes aufgezeigt werden.
1.2 Vorgehensweise
Anschließend an das Unterkapitel 1.2 wird die moderne Geldtheorie (1.3) skizziert, deren Behandlung mit Sicherheit vorteilhaft für den weiteren Verlauf der Arbeit sein wird. Da in den folgenden Kapiteln komplexe Finanzinstrumente der Immobilienfinanzierung erwähnt werden, soll diese kurze Einführung in die moderne Geldtheorie das Verständnis erleichtern. Um das Thema „Risikomanagement deutscher Kreditinstitute im Bereich der Immobilienfinanzierung unter Berücksichtigung der US-Subprime-Krise“ adäquat behandeln zu können werden in erster Linie, sprich im zweiten Kapitel, die Aktivitäten deutscher Kreditinstitute in der Immobilienfinanzierung besprochen. Zunächst wird der grundlegende Unterschied zwischen den zwei Tätigkeitsfeldern (2.1) der privaten und gewerblichen Immobilienfinanzierung erläutert, da sich alle Banken nach dieser Unterteilung orientieren. Das Finanzinstrument des spekulativen Einkaufs von Wertpapieren über Zweckgesellschaften, dasjenige Finanzinstrument, welches zum Platzen der Immobilienblase auf dem US-amerikanischen Subprime-Markt geführt hat, soll erst im dritten Kapitel (Die US-Subprime-Krise) ausführlich behandelt werden. Im zweiten Kapitel sollen, in Hinblick auf die Thematisierung des momentan in China stark überhitzten Immobilienmarktes, die verschiedenen Formen des dort in erster Linie verwendeten Instruments der Direktinvestition behandelt werden. Im Unterkapitel 2.2 werden die zwei Begriffe Rendite und Risiko näher erläutert, sowie die Definitionen ihrer Zielgrößen im Bereich der Immobilienfinanzierung erarbeitet, bevor im Unterkapitel 2.3 die Besonderheiten der Immobilienfinanzierung erwähnt werden.
Das dritte Kapitel widmet sich der US-Subprime-Krise. Zunächst werden die Ursachen (3.1) für das Platzen der Immobilienblase auf dem US-Subprime-Markt erwähnt. Hier wird ein Fokus auf die Zweckgesellschaften als Beginn der Krise gelegt. Folglich wird der Verlauf (3.2) der Krise in Kürze skizziert und im Unterkapitel 3.3 die Rolle deutscher Banken in der Finanzkrise herausgearbeitet. Um die Folgen ganzheitlich zu erfassen wird der Autor dieser Arbeit im Unterkapitel 3.4 versuchen nicht nur auf die offenkundigen Auswirkungen der Immobilienkrise in den USA einzugehen, sondern speziell auch auf die Auswirkungen der Krise in Deutschland hinzuweisen. Als ein konkretes Beispiel soll die Stadt Pforzheim angeführt werden, die durch undurchsichtige Wertpapiere, welche der Stadt von der Deutschen Bank verkauft worden sind, riesige Verluste erlitten hat. Diese sind bis heute deutlich spürbar.
Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit dem Risiko- und Chancenmanagement in der Immobilienfinanzierung. Um ein grundlegendes Verständnis dieses Management-Bereiches zu erhalten, wird das Risiko- und Chancenmanagement (4.1) im Allgemeinen behandelt. In dieser Arbeit soll vordergründig das Chancenmanagement thematisiert werden, da im Bereich der Immobilienfinanzierung bei Banken meistens eher die Chancen, als die Risiken wahrgenommen werden. Dies war zur Zeit vor der US-Subprime-Krise genauso wie heute, obwohl die nächste Immobilienblase zu platzen droht. Im zweiten Teil des vierten Kapitels (4.2) werden die Eigenheiten des Risiko- und Chancenmanagements im Bereich der Immobilienfinanzierung erwähnt.
Das fünfte Kapitel widmet sich den Möglichkeiten zur Steuerung des Risikos im Bereich der Immobilienfinanzierung. Zunächst werden die unterschiedlichen Arten der Ansätze (5.1) angeführt, bevor im Unterkapitel 5.2 die Tendenzen des Risikomanagements in der Immobilienfinanzierung angeführt werden. Das sechste Kapitel versucht Lehren aus der US-Subprime-Krise zu entdecken und sie in Form von Reformansätzen (6.1) aufzulisten. Der Titel dieses Kapitels kann etwas in die Irre führen, denn im Zuge der Recherchen für diese Arbeit ist eher das Gefühl entstanden, dass sich nur wenig in der Gangart der Banken hinsichtlich der risikoreichen Immobilienfinanzierung verändert hat. So wie die Banken am US-amerikanischen Immobilienmarkt mit undurchsichtigen Wertpapieren spekuliert haben, so haben sie es kurz später auch mit Währungen und Staatsanleihen europäischer Staaten gemacht und so machen sie es bis heute am chinesischen Immobilienmarkt, was zu neuen Gefahren in Form von Finanzkrisen und Wirtschaftskrisen führen kann (6.2). Im siebten Kapitel wird ein Fazit aufgestellt.
1.3 Moderne Geldtheorie
Die moderne Geldtheorie beschreibt die Zusammenhänge „zwischen den geldwirtschaftlichen Größen untereinander und jene zwischen Geld- und Güterwirtschaft unter Berücksichtigung internationaler Verflechtungen: Sie erklärt, welche Rolle die einzelnen Größen, wie z.B. Geld, Kredit und Zins, im Wirtschaftsablauf spielen.“[3] Geld kann nach Mankiw in zwei Formen auftreten, nämlich als Warengeld und als Nominalgeld. Als Warengeld werden Waren mit einem inneren Wert bezeichnet, zum Beispiel, Gold oder Silber. Als Nominalgeld wird Geld verstanden, welches keinen inneren Wert besitzt, sondern nur einen aufgedruckten.[4] Samuelson und Nordhaus teilen das Geld in drei Bereiche ein, wobei sie das Nominalgeld in zwei Teilbereiche aufteilen. Sie bestimmen einerseits das Warengeld, welches als Tauschmittel in Form von Waren auftritt, das Papiergeld, welches seinen Wert aus der geringen Stückzahl und der allgemeinen Akzeptanz bezieht, und das Buchgeld, welches als Einlagen bei der Bank definiert wird.[5]
Neben der Definition der unterschiedlichen Formen von Geld, thematisiert die moderne Geldtheorie auch die Funktionen von Geld. Es können drei Funktionen festgestellt werden, welche notwendig sind um ein Zahlungsmittel als Geld bezeichnen zu können, nämlich die Wertaufbewahrungsfunktion, die Recheneinheitsfunktion und die Tauschmittelfunktion. Die Wertaufbewahrungsfunktion gewährleistet die Möglichkeit, Geld aufzubewahren und somit Kaufkraft von der Gegenwart in die Zukunft zu verlegen. Dies ist nur möglich, wenn ein Zahlungsmittel stabil ist und der Wert des Geldes über eine lange Zeit nahezu konstant bleibt. Die Recheneinheitsfunktion ist basal für eine Währung, da Tauschrelationen (Preise) realwirtschaftliche Mengenverhältnisse sind, in welchen Waren getauscht werden können. Das Geld muss als Recheneinheit fungieren, damit Preise erstellt werden können. Die Tauschmittelfunktion ist gewährleistet, wenn das Geld bequemer zu handhaben ist als Naturalien.[6]
Die moderne Geldtheorie beschäftigt sich des Weiteren mit den Motiven der Geldhaltung. Es werden drei unterschiedliche Motive angeführt, nämlich das Transaktionsmotiv, das Vorsichtsmotiv und das Spekulationsmotiv. Das Transaktionsmotiv besagt, dass ein Wirtschaftssubjekt einen Teil seines Vermögens in Form von Geld aufbewahren möchte, um mit diesem Zahlungen abwickeln zu können. „Da die Ein- und Auszahlungen meist zu verschiedenen Zeitpunkten anfallen, verfügt jedes Wirtschaftssubjekt über einen bestimmten Kassenbestand, dessen durchschnittliche Höhe von der Zahlungshäufigkeit und vom Transaktionsvolumen abhängt.“[7] Das Vorsichtsmotiv beschreibt das Bedürfnis eines Wirtschaftssubjekts, einen Teil seines Gesamtvermögens zur Sicherheit für zukünftige Notsituationen aufzubewahren. „Das Vorsichtsmotiv erklärt die Geldnachfrage mit der Unsicherheit der Wirtschaftssubjekte über Zeitpunkte und Höhe künftiger Zahlungen.“[8] Das Spekulationsmotiv beschreibt das Verlangen eines Wirtschaftssubjekts, aufgrund der Kenntnis von zukünftigen Veränderungen des Geldmarktes, Gewinn aus diesen Veränderungen zu erzielen. Die unterschiedlichen Motive sind in der Praxis nicht voneinander zu trennen und dienen vordergründig um die Geldnachfrage theoretisch zu untersuchen.





























