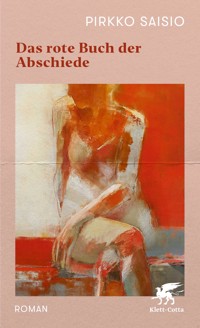
19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Saisio hat die kulturelle Atmosphäre, in der wir leben, für immer verändert.« Aleksis Kivi Prize jury Pirkko Saisios preisgekrönter Roman erzählt von einer sexuellen und künstlerischen Befreiung. Ihre Protagonistin sucht in Helsinki nach der Liebe und kämpft um Selbstbestimmung - zu einer Zeit, in der Kunst und Kommunismus eine unheilvolle Allianz bilden und queere Liebe nur im Untergrund stattfindet. Die Entdeckung des Werks von Pirkko Saisio ist eine literarische Sensation. Die Mutter will sie zum Arzt schicken, in der Öffentlichkeit gilt ihr Verhalten als strafbar. Und dennoch: Als eine Kommilitonin zu ihr sagt »Es gibt auch Frauen, die Frauen lieben« ist das ein Befreiungsschlag. Noch fühlt sich die junge Frau aus der Arbeiterklasse fremd in den Untergrundbars Helsinkis, in denen queere Liebe und intellektuelle Gespräche Hand in Hand gehen. Erst mit der Aufnahme in das Studententheater streift sie ihre Unsicherheit ab. Doch die Eintrittskarte in die Kunst kostet sie viel. Nicht zuletzt, weil das Theater mit dem Räderwerk der kommunistischen Revolution aufs Engste verzahnt ist. In einer Reihe von Abschieden – vom Elternhaus, vom Idealismus der Jugend und von den Frauen, die sie liebt, erzählt diese unglaubliche Neuentdeckung aus Finnland von der Liebe, von Kunst und von Selbstbestimmung. »Eine wunderschöne Hymne an das Überleben. Pirkko Saisio seziert die verborgenen Codes von Beziehungen. Wie keine andere findet sie Worte für das Gefühl, wenn man an der Bar auf jemanden wartet, der nie auftaucht.« Svenska Dagbladet »Pirkko Saisio ist vermutlich die beste lebende Autorin Finnlands. Sie ist weise, tiefgründig, komisch, gebildet, und natürlich eine göttliche Erzählerin.« Aamulehti (Finland) »Das rote Buch der Abschiede erzählt von der Entdeckung künstlerischer Ambition und den Quellen der Inspiration und - ohne Zweifel - von der Liebe. Die rote Färbung in diesem Buch steht natürlich für die Liebe, aber auch für die Politik. Saisio's Stil und ihre Selbstironie sind unfehlbar und lassen mich immer wieder zu ihrem Buch zurückkehren.« Kirjavinkit (Finland) »Pirkko Saisio war schon immer ein Genre ganz für sich, eine Autorin mit hohem Wiedererkennungswert, aber in ihren letzten Werken hat sie Grenzen überschritten und mutig aus den unterschiedlichsten Genres geschöpft.« Helsingin Sanomat
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Pirkko Saisio
Das rote Buch der Abschiede
Roman
Aus dem Finnischen von Elina Kritzokat
Klett-Cotta
Impressum
Die Übersetzung und Veröffentlichung dieses Buches wurden gefördert vom Deutschen Übersetzerfonds und FILI, Finnish Literature Exchange.
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Punainen erokirja«
im Verlag WSOY, Helsinki
©1998 by Pirkko Saisio
Published by agreement with Helsinki Literary Agency
Für die deutsche Ausgabe
© 2023 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH,
gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Anzinger und Rasp Kommunikation GmbH, München
unter Verwendung einer Abbildung von © Melinda Cootsona
Stadtplan Helsinki: VH-7 Medienküche GmbH, Stuttgart
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-98725-6
E-Book ISBN 978-3-608-12187-2
Du musst Türen aufmachen und wieder zumachen.
Du darfst nicht vergessen, hinter dir liegende Türen zuzumachen. Du darfst nicht vergessen zu atmen.
So sollst du dein Zuhause verlassen:
Du schließt das Küchenfenster.
Du kontrollierst, ob die Herdplatten aus sind.
Du atmest.
Du hebst die Busfahrkarte auf, die dir im Wohnzimmer runtergefallen ist.
Du gehst ins Schlafzimmer, aus dem das überflüssige Doppelbett weggetragen wurde, es steht im Umzugswagen.
Du siehst das Blut der Katze, dort, wo das Bett war.
Du darfst nicht vergessen zu atmen.
Du musst das Licht ausmachen. Du musst die Tür zumachen.
eins
7.8.2002
Die Sonne glüht auf der Haut und auf den Kanten des Aluminiumboots, die Luft wabert wie Wasser.
Aber das Wasser hier ist klar, fast durchsichtiger als die Luft, leicht grünlich.
Tief unten schaukelt Blasentang. Ein kleiner Barsch erschrickt vor meinem Schatten und gleitet in sein Steinversteck.
Honksu springt barfuß auf den heißen Felsen.
»Denk an die Schlangen!«, rufe ich ihr zu.
Besucht man eine Insel weit draußen im Meer, darf diese Ermahnung nicht fehlen.
Denk an die Schlangen.
Achte auf die Schlangen.
Vergiss die Schlangen nicht.
Dabei kann man die Schlangen auf den Außeninseln eigentlich nicht vergessen. Wenn es doch mal passiert, und sei es nur für einen Moment, taucht sofort eine auf.
Sie lauert reglos im ausgetrockneten Felsspalt, auf dem Spülsaum aus Schilf vom Vorjahr. Ihre schwarze, schuppige Haut schimmert, die Augen glänzen wie Firnis.
Von ihrem Felsspalt aus bedroht sie die Insel, denn sie ist nicht allein.
Unter den Steinen und knorrigen Baumwurzeln, im trocken knisternden Schilfrohr, um die modrigen und blubbernden Sumpflöcher gibt es Hunderte.
Du siehst sie nicht, aber sie sind da.
Gleich unter deinen Füßen, dort.
Die Inselgruppe heißt Pentinletot, Penttis Niedermoor.
Hier haben wir noch nie angelegt, gegenüber auf Sampo schon, aber nicht hier. Hier nicht.
Und ich habe auch noch nie gehört, dass jemand anders von der Lyökki-Insel hier angelegt hätte.
Bestimmt hat es mal jemand gemacht, aber gehört habe ich davon nicht.
»Etwas schwierig, diese Insel.«
»Ich finde sie schön.«
»Trotzdem schwierig. Felsig und unwegsam, angeblich.«
Wir tauchen die Hände ins kalte Wasser, um den Aluminiumrand ohne Verbrennungen anfassen und das Boot hochziehen zu können.
Auch die glatten Felsen sind heiß. Wir finden keinen Schattenplatz für die Styroporbox, und weit tragen geht nicht, dafür ist zu viel drin.
Glasflaschen mit Wasser.
Eine für jede.
Volle Wasserflaschen sind viel, wenn man bei gnadenloser Hitze auf einer Insel herumläuft.
Das Meer liegt ruhig da. Auch die Luft bewegt sich nicht mehr.
Aber die Sonne, sie muss sich bewegen, weil die Zeit vergeht. Und die Zeit muss vergehen, denn so ist es vereinbart.
Doch auch die Sonne steht still.
Aus einem flächigen Himmel richtet sie ihren starren, sengenden Hass auf die Insel, die, soweit man weiß, noch niemand angesteuert hat.
Die Sonne erlaubt keinen Blick in ihre gleißende Helligkeit, die Hochmütigen blendet sie. Genau wie Gott.
Aber auf dieser stillstehenden, abweisenden Insel gibt es Geräusche.
Ruhig ist es hier wahrscheinlich nur im Winter, unter Eis und Schnee.
Doch es könnte auch sein, dass das Eis unaufhörlich knackt.
Und in der offenen Fahrrinne ein Schiff tutet. Oder auch nicht, warum sollte es tuten? Nur die Motoren brummen gleichmäßig.
Vielleicht hoppelt ein Hase über die Insel, und seine Krallen schaben leise auf dem Schnee. Oder es ist ein Fuchs oder ein Luchs.
Möglicherweise fährt jemand auf Skiern vorbei und pfeift mit einem Schulterblick nach seinem Hund, als Antwort ertönt vielleicht ein Bellen.
Dann ist die Sonne gedimmt, verborgen hinter einem Vorhang aus Dunst, gleichgültig.
Aber jetzt nicht. Nicht jetzt.
Raubseeschwalben, Küstenseeschwalben und Silbermöwen kreischen im ausgeblichenen Blau. Das Wetter soll andauern, sie fliegen weit oben und sind kaum zu sehen. Neben ihnen gleitet ein Flugzeug, nicht größer als die Vögel.
Es gibt massenhaft gierige, hartnäckig summende Mücken. Sie umgeben mich wie ein luftiger Schleier, bilden mein gereiztes Wedeln unablässig nach.
Das Wasser steht niedrig. Selbst die tieferen Felslöcher riechen nach trocknendem Schlamm und Sumpf, obenauf schmatzt eine nervös wackelnde, grünschwarze Schicht. Millionen von Lebewesen kämpfen um ihren Raum, nicht eins kann ich benennen, doch das schert die Tierchen nicht. Und Schlangen gibt es hier. Viele, irgendwo. Geräusche machen sie keine.
Wer in der Ödnis stirbt,
stirbt ohne Gnade.
Die Sonne wird zu seinem Grab,
die Elemente sind die Bahre.
»Bleib weg!«
Honksu übergibt sich ins Meer. Das verschwitzte Hemd klebt ihr am Rücken, die Hand, mit der sie sich an einer Felskante abstützt, ist sonnenverbrannt.
Ich gehe zu ihr.
Zwischen zwei großen Steinen liegt eine Robbe.
Ihr Bauch zeigt nach oben, der Schwanz ragt ins Wasser.
Ich kenne Robben aus dem Fernsehen, aus Aquarien und aus dem offenen Meer.
Sie sind rund und feucht. Auch ihre Augen sind rund und feucht, und ihre Barthaare gesund und kräftig.
Ohren haben sie keine, jedenfalls keine Muscheln. Ihre Ohren bestehen aus kleinen Öffnungen, die sie auf- und zumachen können, genau wie ihre Nüstern.
Robben haben Münder, aber womöglich keine Zähne, meist haben sie den Mund zu und lächeln breit. Einmal habe ich eine husten gehört, draußen auf dem Meer.
Aber diese Robbe liegt zwischen zwei Steinen auf dem Rücken, und in ihrem Bauch klafft eine Wunde.
Ihre Schnauze steht offen, als würde sie etwas rufen.
Ihre Zähne sind lang und gelb wie bei einem Wolf.
Auf ihrem gefleckten Bauch sitzt eine Krähe. An ihrem Schnabel klebt Blut.
Es riecht nach Tod. Nicht nach Freesien, Calla und Flieder, nicht nach Orgelmetall, Gesangbuchseiten und dem Parfüm von Trauergästen.
Es riecht nach Tod wie in Bangladesch oder Indonesien. Nach fauligem Kompost und Hackfleisch für die Katze, das auf dem Küchentisch vergammelt.
Wer in der Ödnis stirbt,
stirbt ohne Gnade.
Die Sonne wird zu seinem Grab,
die Elemente sind die Bahre.
Doch bis es so weit ist, vergeht Zeit.
Zeit, bis die Sonne die Robbe auf ihre weißen, brüchigen Grundstrukturen runtergebrannt hat, die der Wind über die gesamte Insel verteilt. Vielleicht findet ein Ausflügler einen von der Witterung abgenagten Halswirbel und nimmt ihn mit nach Hause in die Stadt.
Bei mir liegt so ein Halswirbel unter der Glasplatte meines Tisches. Erst dachte ich, er gehöre zu einem menschlichen Skelett. Ich dachte, der Wirbel wäre von Muskeln und Sehnen ummantelt auf der Estonia gereist und nach ihrem Untergang zur Lyökki-Insel und weiter ans Ufer von Ärväskivi gespült worden, wo ich ihn schließlich fand, begraben von Sand.
Doch bei einer Untersuchung der Universität Turku wurde er einer Robbe zugeordnet, allerdings einer anderen als dieser hier mit den gelben Zähnen und dem Loch im Bauch.
Die Insel lässt sich nicht umrunden.
Zwar sind die Felsen im Nordosten, Norden und Nordwesten flach und glatt, und auch im Westen kann man noch einigermaßen am Ufer entlanggehen, aber das gesamte Südufer ist von zähem gelbem Schleim bedeckt. Und das Wasser steht niedrig, die Steine sind glitschig.
Im Osten ragen die Felsen steil auf, der schmale Uferstreifen ist dicht mit mannshohen Birken bestanden.
In der Mitte der Insel gibt es eine Heidefläche, überwuchert von struppigen Wacholderbüschen, die Pflanzen sind braun wie gebrannte Ziegel.
Und unter der Heide ruht vermutlich altes Geröll, und in diesem Geröll lauern Schlangen.
Wir stehen am Rand der Heide und der Schweiß brennt uns in den Augen, als das Telefon klingelt.
Es ist Touko Siltala, mein Lektor.
Ich kann den Straßenlärm vom Bulevardi hören, Autos und noch mehr Autos, das Quietschen der Straßenbahn und Stimmengewirr. Toukos Bürofenster muss offen stehen, Helsinkis Innenstadt heiß sein.
»Diese Nachricht, die du mir hinterlassen hast …«
»Hier liegt eine tote Robbe«, sage ich.
Darauf Touko (versucht irritiert, sich auf mich einzustellen):
»Aha. Oh je.«
Und ich:
»Die hat jemand erschossen. Hat ein Loch im Bauch.«
Und Touko (will zur Sache kommen):
»Ach. Elend. Also die Nachricht …«
Und ich (eigentlich müssten wir über das Manuskript sprechen, das weiß ich, aber ich kann gerade nicht anders):
»Eine merkwürdige Insel, wirklich. Wir sind zum ersten Mal hier.«
»Ah so.«
»Ja.«
Und Touko (nach einem Räuspern):
»Dein Text ist also weg, richtig?«
Ich:
»Jetzt darüber zu sprechen ist absurd. Diese Insel sieht aus, als würde die Welt noch mal neu geboren werden.«
Und Touko wieder:
»Aha.«
Ich habe ein Buch verloren, Das rote Buch der Abschiede. Das Buch mit diesem Namen ist unauffindbar.
Ich hatte es fertig geschrieben, und dann habe ich (um fünf Uhr morgens, als die Sonne sich gerade erst mattrot ankündigte) die Hände auf die Tastatur gelegt und aus Versehen zwei Tasten gedrückt: Ctrl und A. Der Text wurde schwarz und unleserlich. Ich wollte das Schwarze wegkriegen, und das ist mir auch gelungen. Indem ich die Taste Del drückte.
Vormittags, ehe wir zur Insel aufgebrochen sind, der einzigen, die man an einem solchen Tag ansteuern kann, haben sich mehrere Leute meinem Computer gewidmet.
»Es ist weg.«
»Tja.«
»Wie viele Seiten hast du gelöscht?«
»Alle.«
»Das ganze Buch?«
Das ganze Buch.
Nach dem Telefonat wirkt die Insel auf einmal ganz gewöhnlich.
Ich schaue auf die Uhr, zum ersten Mal an diesem Tag. Es ist zwanzig nach drei.
Das Licht ist anders, die Sonne hat sich weiterbewegt und steht nun leicht schräg.
»Fahren wir wieder zurück?«
»Ja, wird wohl Zeit.«
Die Möwen und der in der stehenden Luft wabernde Insektenschleier gehen mich nichts mehr an. Und auch ich bin ihnen egal.
Sie bleiben zurück, und im nächsten Sommer wabern hier andere Insekten.
Auch ich werde eine andere sein, unweigerlich, und Das rote Buch der Abschiede, das ich noch einmal schreibe, ist ein anderes als Das rote Buch der Abschiede, das am siebten August um fünf Uhr morgens verschwand.
Auf diese Insel fahre ich nie wieder. Das ist wirklich unwahrscheinlich.
Havva kommt erst fünfzehn Minuten vor Ende der Besuchszeit.
Bis dahin habe ich in meinem gelben, margeritenübersäten Krankenhauskittel auf dem Hof vor dem Gebäude gestanden und auf sie gewartet.
Es ist heiß, unerträglich heiß in diesem Juli im Jahr neunzehnhunderteinundachtzig.
Als der Bus hält und Havva aussteigt, hängen die Lindenblätter willenlos und unnütz herab. Und obwohl mir der Schweiß in die Augen rinnt und er Havva in einen trüben Schleier taucht, geschieht, was immer geschieht, wenn ich sie sehe: Mein Hals schwillt zu, meine Nasenlöcher werden feucht.
Ich wünschte, ich könnte Havva vor der Welt beschützen. Ich wünschte, ich könnte mich zwischen sie und die Welt stellen.
Havva geht mit schnellen Schritten in meine Richtung, hält den Kopf leicht gesenkt.
Trotz meines nach Aufmerksamkeit schreienden Kittels bemerkt sie mich nicht, die Schwüle tilgt mich aus ihrem Sichtfeld.
Havvas Schritte sind die kürzesten und schnellsten, die ich kenne.
Sie sticht ihren staksigen Gang in die Erdoberfläche wie eine präzise Singer-Nähmaschine.
Aber seit wann senkt sie beim Gehen den Kopf?
»Ich dachte, wir könnten eine Runde spielen. Das magst du doch.«
Sie hat das Schachspiel aus Moskau unterm Arm.
»Das schaffen wir nicht mehr, du bist spät dran.«
»Dauernd machst du mir Vorwürfe.«
Havvas T-Shirt ist mit einer smaragdgrünen Schlange bestickt.
Im Krankenhauscafé sperrt die Jalousie die Hitze aus.
Die Luft ist schwer von Zimt, Blutplasma und Östrogen. Die vaginal entbundenen Frauen tragen kleine, von zu Hause mitgebrachte Kissen mit sich herum.
Mein Springer schlägt Havvas Turm.
Zerstreut zieht sie ihren Läufer vor meine Dame.
»Du bist nicht bei der Sache«, sage ich.
»Huch, kann ich das rückgängig machen?«, fragt sie.
Ihre smaragdgrüne Schlange funkelt boshaft.
Ich habe Angst vor Havva. Seit einiger Zeit habe ich Angst vor ihr.
»Du hast gewonnen«, sagt sie leichthin.
Die Frau am Tresen will das Café schließen, ich werde panisch.
»Die machen zu«, stellt Havva fest, ihre Erleichterung ist nicht zu überhören. »Ich schätze, ich muss los.«
»Bleib doch noch«, sage ich und merke, es war ein falscher Zug: Meine Bitte enthält einen stummen Vorwurf.
Meine Unterwürfigkeit ärgert Havva, seit einiger Zeit ist das so.
Aber
dann stehen wir gemeinsam in der Hitze vor dem Krankenhaus. Es ist in Ordnung für Havva, noch einen Moment so zu stehen.
In meinem Bauch strampelt es. Da ist jemand spürbar auf meiner Seite.
Ich lege Havvas Hand auf meinen Bauch.
»Fühl mal. Ein bisschen fester.«
Sie lässt die Hand liegen, und der oder die Unbekannte tritt kräftig zu. Havvas Gesichtsausdruck kann ich nicht deuten.
»Morgen wissen wir, wer es ist«, sage ich.
»Morgen?«
Wäre ich mutig genug, könnte ich erkennen, wie erschrocken sie ist.
Es war November, als ich sie in Pori anrief.
Sie hatte dort einen Jahresvertrag, seit September konnte ich endlich ohne ihre Hilfe die Waschmaschine und den Staubsauger bedienen.
Obwohl mein Mund trocken war, versuchte ich, mit fester Stimme zu sprechen. Sie klang trotzdem brüchig.
»Jetzt ist es tatsächlich passiert.«
»Was?«
»Wir kriegen ein Kind. Im Juli ist es so weit.«
In der Leitung wurde es unangenehm still.
Ich hätte mich im Zaum halten müssen, aber es gelang mir nicht:
»Bist du noch da?«
»Hm?«
»Ob du noch da bist.«
»Ja. Natürlich.«
Und wieder fielen Angst und Zeit eng zusammen.
Im Hörer rauschte es, die Sekunden des Wartens wurden lang und klebrig.
»Ist es nicht toll, dass es geklappt hat?«
»Doch, klar.«
Daran konnte ich mich klammern. Ich schwankte wie ein Korken im Hafenbecken.
»Und?«
»Was, und?«
»Freust du dich?«
»Ich muss drüber nachdenken.«
»Morgen leiten sie die Geburt ein«, sage ich. »Es ist schon neun Tage über der Zeit.«
Die Smaragdschlange funkelt im Sonnenlicht. Genau wie Havvas Haare und Havvas Augen. Augen, die weder mich ansehen noch die Margeriten auf dem Kittel noch die Wölbung, die uns um wenige Zentimeter von dem Wesen trennt, das bald hier sein und alles zurechtrücken wird.
Ein dunkelblauer Krokusstrauß, der erste des Frühlings
Und das ist sie im Jahr neunzehnhundertsiebzig:
Sie ist zu ihrer vollen Länge ausgewachsen und eins achtundsechzig.
Sie wiegt etwa siebzig Kilo und würde das niemals verraten.
Sie ist stämmig, breitschultrig und markant.
Sie bemalt ihre (nicht vorhandenen) Augenbrauen mit einem dunklen Schminkstift.
Wenn sie allein ist, singt sie viel. Und sie schreibt auf ihrer Remington Kurzgeschichtenanfänge. Auf diese zarten Geschichtenkeimlinge malt sie Gesichter, Männergesichter und ihr eigenes, nie andere. Sie liest Romane, schreibt dazu Uniklausuren, gähnt und wartet.
Es ist die Zeit vor Havva.
Es ist auch die Zeit vor dem Mädchen mit den Clownaugen, vor dem grünen Zimmer in der Straße Maneesikatu, vor dem Studententheater.
Es ist die Zeit vor den Bloody Marys (die sie in Clownauges Gesellschaft zu trinken lernt und von ihrem letzten Geld bezahlt), vor den Tatar-Hacksteaks. (Im Restaurant Kosmos als Löwentatzen bekannt: Kapern, Fischrogen und ein Eigelb auf saftigem Fleisch. Bei diesen Zeilen laufen mir Ströme im Mund zusammen.)
Es ist die Zeit vor den Mahjong-Partien, dem Spieltisch mit Teakfurnier, der Cembalospielerin mit den weißen Haaren und langen Zähnen, die Zeit vor dem Geldmangel, der Freiheit, dem Licht der Liebe und dem Kellerraum in der Kalevankatu, die Zeit vor den Jungs mit Ohrringen und den Mädchen mit Krawatten.
Es ist die Zeit vor dem dunkelblauen Krokusstrauß.
Bevor der Krokusstrauß kommt, passiert Folgendes (nicht besonders viel):
Die Sowjetunion besetzt die Tschechoslowakei.
Eine Woche vorher flattert noch eine Rose vom Balkon der Hämeentie achtundsiebzig, an der ein Zettel mit der Parole Viva Dubček hängt. In der Wohnung, die Eltern sind gerade zum neuen Sommerhaus nach Inkoo aufgebrochen, grölen die Abiturienten vom Vorjahr linke Lieder aus der Lapua-Oper von Kaj Chydenius, die an Bertolt Brecht erinnern. Momente inniger Freundschaft leuchten auf, soziales Erwachen liegt in der Luft, es wird gekotzt, ein weiterer Moment der Freundschaft illuminiert, dann ist der Schnaps alle.
Sie (das bin ich) bekommt einen Studienplatz an der Universität Helsinki, finnische Literatur, Soziologie, Kommunikation, Philosophie und so weiter.
Sie verbringt viel Zeit im Unicafé, an wechselnden Tischen und in wechselnder Gesellschaft, mit Gesprächen über finnische Literatur, das Leben, die Sowjetunion, Philosophie und so weiter.
Sie ist allmählich gelangweilt von der Sowjetunion, Kommunikation, dem Leben, Philosophie, finnischer Literatur und so weiter.
Sie (das bin ich) richtet ihre sonst so schweifende Aufmerksamkeit auf ein Mädchen mit weichem, weißem Fleisch, das im schwarzen Samtcape durch die Säulengänge der Uni streift.
Und dann das: ein Krokusstrauß, dunkelblau, im April!
Das Mädchen mit dem weißen Fleisch und den kajalumrandeten Clownaugen schlägt unerwartet zu, in einem nicht vorhersehbaren Moment am Waschbecken der Damentoilette:
»Hast du vielleicht deinen Bibliotheksausweis dabei? Ich habe meinen verloren.«
Natürlich hat sie ihn dabei, sie hat alles dabei: den Bibliotheksausweis, Liebeshunger, Unklarheit über ihre sexuelle Identität und ihr Lebensziel, Geld (von ihrem Vater), die Scham, noch bei den Eltern zu wohnen, und den Wunsch, mehr über die Autorin Helvi Juvonen zu erfahren, das Thema von Clownauges Abschlussarbeit.
Und geradewegs ins Ziel:
Der Krokusstrauß erscheint im Flur des fünften Stocks der Hämeentie achtundsiebzig, unten ist das Etola-Haushaltswarengeschäft. Sie ist stark erkältet und kann nicht ins Kino gehen, dabei hatte Clownauge das umstandslos vorgeschlagen. (Vom Bibliotheksausweis keine Rede mehr, Clownauge geht entschlossen und ungeniert vor!)
Auch Mutter steht im Flur:
»Krokusse, die sind aber schön. Und das so früh im Jahr.«
(»Waren bestimmt teuer«, verkneift Mutter sich.)
Dafür schickt Mutter diesen Satz hinaus:
»Ich hole eine Vase. Schön, dass du zu Besuch kommst … ich bin Pirkkos Mutter, ich kann sicher du sagen, das passt doch, oder?«
Natürlich passt das. Alles passt.
Sogar der Tee, der statt Kaffee angeboten wird.
Es ist Beuteltee, ziemlich peinlich, aber Clownauge passt auch das.
Der Beuteltee passt zum dämmrigen Abend, die Lapua-Oper zum Plattenspieler, die Krokusse zur Silberhochzeitsvase der Eltern und die Vase zum schwarz gestrichenen Fensterbrett.
Und Clownauges Blick (seltsam flackernd) passt zum April, dem launischsten der Monate.
Aber ihr (mir!) passt all das nicht, weil sie nichts von dem versteht, was Philosophie und Literatur das Leben nennen.
Bis dieser Satz fällt:
»Es gibt auch Frauen, die Frauen lieben.«
In diesem Augenblick liegen ihre Eltern schon in den Betten, die sie jeden Abend im Wohnzimmer herrichten müssen, und wundern sich, warum der Besuch auch nach dem sechsten Lipton-Tee noch nicht gegangen ist.
Selbst die Stille nebenan im Wohnzimmer klingt ungeduldig.
Schweigen.
Pause.
Schweigen.
Sie ist dran.
»So eine … würde ich vielleicht … gern mal kennenlernen.«
Die kajalumrandeten Clownaugen lachen und werden wieder ernst:
»So eine kennst du schon.«
»Wen denn?« (Das kommt schnell.)
»Mich.«
Mich.
Die Krokuskelche verschließen sich in dunkelblauem Gleichmut, der Wind hört auf, die Vorhänge zu bauschen, der Mond hat sich in seine Staubhülle zurückgezogen und ihre Eltern ins undurchdringliche Dickicht der Träume.
Sie ist allein, mit der Hand auf der Türklinke, ohne Kraft.
»Kapierst du es wirklich nicht?«
Der Fahrstuhl hält in ihrem Stockwerk.
Ihr Nachbar kommt nach Hause und hilft ihr nicht, seine Tür fällt ins Schloss.
Vergebt den Ameisen, singt Kaisa Korhonen auf der Schallplatte und hilft ihr nicht.
Auch der Strom fällt nicht aus.
Der Gasometer an der Uferstraße Sörnäisten rantatie will nicht explodieren.
Auf der Richterskala tut sich nichts.
Der Himmel sendet weder Hagelkörner noch Heuschrecken noch Blitze noch Rinderseuchen.
Und die Wellen rollen in ruhigem Rhythmus an die Uferfelsen und haben nicht vor, das Land zu überfluten.
Am nächsten Morgen hat sie über vierzig Grad Fieber.
Auf dem Tisch findet sie die Tageszeitung, eine Thermoskanne und einen Teebeutel. Hinter der Thermoskanne steht der Krokusstrauß, aus den Kelchen strecken sich ihr lüsterne gelbe Zungen entgegen.
Während sie im schimmelgrünen Niemandsland zwischen Fieberwahn und Wirklichkeit schwitzt, ruft Clownauge kein einziges Mal an.
Am dritten Tag, spät am Nachmittag, schafft sie die Auferstehung.
Das Fieber ist gesunken.
Nein, ist es nicht, es hat sich nur nach innen gewendet und meldet sich als wiederkehrendes Brennen irgendwo zwischen Herz und Bauch.
Sie zieht sich schnell an, drückt auf den Fahrstuhlknopf, kann nicht warten und rennt die Treppe runter, nach draußen und bis zur Straßenbahnhaltestelle, wo sie wieder nicht warten kann und hechelnd die Hämeentie zum Markt Hakaniementori läuft, quer über den Platz zur Brücke Pitkäsilta, durch die Unioninkatu an der Heiligen Dreifaltigkeitskirche und der Domkirche vorbei bis zur Uni.
Mit zitternden Knien und außer Atem reißt sie die Tür auf und hetzt durch den Säulengang zum Café.
Clownauge ist nicht da. Nicht an ihrem Stammtisch, nicht in der gekachelten Stille der Damentoilette, nicht an der schummrigen Garderobe, nicht im Gewimmel draußen auf der Straße. Clownauge ist nirgends.
Sie lehnt sich an den Cafétresen, bestellt ein Bier, versucht ruhiger zu atmen und wischt sich den klebrigen Schweiß von der Stirn. Sie hat Angst, sich geirrt zu haben.
Clownauge macht sich über sie lustig.
Nein.
Das ist nicht wahr und nicht einmal wahrscheinlich.
Sie hat etwas anderes gemeint, andere Personen, sie hat von Literatur gesprochen.
Von Thérèse und Isabelle.
Ja.
Clownauge hat sogar den Namen der Autorin erwähnt, Violette Leduc. Thérèse und Isabelle, zwei Schulmädchen, die sich ineinander verlieben, Clownauge hat das literarisch gestaltete, leidenschaftliche Liebesverhältnis analysiert. Und dabei am Lipton-Tee genippt.
Ja.
Oder doch nicht.
Immerhin gibt es den Krokusstrauß.
Zu Hause auf ihrem Fensterbrett stehen die dunkelblauen Blüten und werden mit jedem Tag etwas blasser.
Clownauge hat eine andere gefunden.
Ja.
Clownauge hat eine gefunden, die nicht so schüchtern, unsicher und langsam ist wie sie.
Ja.
Clownauge hat im Unicafé auf keine bestimmte Frau gewartet, sondern nur auf irgendeine. Eine, die mutig genug ist für ungehemmte erotische Experimente wie die von Thérèse und Isabelle, Leducs kühnen, rebellischen Schulmädchen, die sich nach außen unschuldig geben.
Ja.
Ja.
Ja, ja, ja.
Sie hatte den Schlüssel schon in der Hand, und er hätte perfekt ins Schloss gepasst, aber in ihrer Dummheit hat sie ihn weggeworfen.
Ihre Hand lag schon auf der Türklinke, aber in ihrer Feigheit hat sie sie nicht runterzudrücken gewagt.
Sie stand schon auf der Schwelle und spähte in die Dämmerung, in den verlockend duftenden Raum, aber in ihrer Langsamkeit hat sie es nicht über die Schwelle geschafft, ehe die Tür zuknallte.
An das Folgende erinnere ich mich, ich erinnere mich ganz genau:
Ich gehe den gesamten Weg wieder zurück. An der Domkirche vorbei, wo die Apostel auf dem Dach mich an verblühte Tulpen erinnern.
An der Dreifaltigkeitskirche vorbei, hinter deren Türen die Mittwochsvigil erklingt.
Die Unioninkatu entlang zur Brücke Pitkäsilta, die massiv ist und trotzdem Einschusslöcher hat.
Über den Hakaniementori zur Hämeentie, wo die Möwen Essensreste aus den Mülleimern der Markthalle picken und Reklameschilder für Ladas und Wolgas ausgeblichen in die Röte des Aprilabends ragen.
Und dann biege ich in die Hämeentie ein, diese nicht enden wollende, farblose Asphaltwüste, eine bestürzende Metapher für weggeworfene Liebe.
Erinnerungen heften sich nicht an Wörter. Sondern an Bilder, an Kristalle aus Farben, Gerüchen und Bewegungen, die sich gegenseitig anstoßen.
Wann habe ich Clownauge, das Mädchen mit dem weißen Fleisch und meine erste Liebe, wiedergesehen?
Ich weiß es nicht.
Wo und weshalb bin ich ihr wiederbegegnet?
Ich kann mich wirklich nicht erinnern.
Der April ist wie ausgelöscht, ich weiß rein gar nichts mehr vom unruhigen Übergang in den langen, warmen Sommer.
Aber der Sommer trägt seine hellen Bilder so ruhig wie ein Kamel seine Last.
In der Nervanderinkatu.
Ein Mahjong-Abend. Der Spieltisch mit dem Teakfurnier, vor den Fenstern Marimekko-Vorhänge aus Kunstsamt.
Sie wurde eingeladen und in einem Sessel am Spieltisch platziert, müsste sich präsentieren, sitzt aber steif und plump da.
Eine dünne Staubschicht liegt auf den Möbeln, und aus ihrem Mund dringen unablässig holpernde, unvollständige Anekdoten.
Ketti (die mir später eine komplizierte, aber geliebte und langjährige Freundin werden soll) und Koo (die ich in völliger Unkenntnis meines drallen Selbst im kommenden Winter verführen werde) berühren sich den ganzen Abend kein einziges Mal.
Das ist nett von ihnen, wie sie bereits da erkennt, denn schon ein flüchtiges Streicheln würde sie vollends aus dem Konzept bringen.
Doch selbst in dieser warmherzigen, betont entspannten Atmosphäre fühlt sie sich unter Beobachtung.
Und als Beobachtete hat sie nur das zu bieten, was die Menschen am ehesten von ihr wegtreibt: übers Ziel hinausschießende Witze, zittrige Hände, auf dem Spieltisch verschütteten Tee, fragwürdiges Dauerlächeln und zusammenhangslose, sinnfreie Laute, die an Hundegebell erinnern.
Auf dem Plattenteller drehen sich die Beatles, Abbey Road: Because the sky is high, it makes me cry. Ging der Text wirklich so?
Immer wieder neu.
Because the sky is high, it makes me cry. Nein, er ging anders, oder?
Die Spielsteine sind aus Knochen und Bambus und klackern gnadenlos auf den Tisch, viel zu schnell für sie, aber immerhin tragen sie schillernde Namen: roter Drache, weißer Drache, Ostwind, Nordwind, grüner Drache.
Der Pfau ist die Eins, ein Randstein.
Man kann versuchen, Drachen oder Winde zu sammeln oder auch einfach nur Randsteine. Oder dreizehn Waisenkinder.
Letzteres hört sich poetisch an, also versucht sie den ganzen Abend, dreizehn Waisenkinder zu sammeln. Sie verliert jede Runde.
Ihr Vorhaben ist aussichtslos, genau wie der ganze Abend.
Ein Anruf aus Italien versetzt ihr den letzten Schlag. Koo wird in Mailand ein Cembalokonzert spielen, der Gastgeber erkundigt sich nach ihren Übernachtungswünschen.
Koo spricht in lässigem Wechsel Italienisch und Englisch und hebt demonstrativ die Augenbrauen Richtung Spieltisch, um ihnen zu signalisieren, dass der Italiener ein Vollidiot ist.
Sie kann kein Italienisch, auch Englisch nur schlecht. Fieberhaft versucht sie sich zu erinnern, wo Mailand liegt.
Ein Cembalo hat sie noch nie gesehen (in ihrer Abiturzeit gab es lediglich den albern verklausulierten Feierspruch »Und jetzt ab ans Cembalo!«), und die Abbildung aus dem Musikbuch der Mittelstufe will sich auf ihrer inneren Netzhaut nicht einstellen. (Das Einzige, was ich noch vor mir sehe, sind die unscharfen Bilder von langweiligen Perückenmännern, die ich, am hintersten Pult sitzend, mit Schnurrbärten und Brillen verziert habe.)
Sie gehört hier nicht her, in diese Welt aus Teak, grünem Tee und locker eingestreuten kulturellen Anspielungen.
Ihr Lächeln ist zu eifrig, ihre Hände sind zu groß, ihre Gedanken zu verklumpt.
Und trotzdem möchte sie dazugehören, Teil dieses Reichs der Frauen sein, in dem die Worte geschliffen scharf sind und die Blicke sanft.
Beim Abschied gehen Dankesbekundungen und liebe Wünsche hin und her, auch der nach einem baldigen Wiedersehen, mit dem sie ihr blutendes Selbstwertgefühl verarzten und sich aufrichten kann.
Der Abend im Schwedischen Theater, Aulikki Oksanen singt im schwarzen Studio, das aus irgendeinem Grund KOM-Theater genannt wird.
Dort trinkt sie mit Clownauge zum ersten Mal Campari.
Es werden etliche Gläser, und zum ersten Mal reicht ihr Geld nicht aus (das ihr Vater ihr gibt).
Clownauge hat schon seit dem Frühjahr keins mehr und drängt sie, ihren Vater um mehr zu bitten.
Für einen Augenblick tut sich eine Kluft zwischen ihnen auf. Clownauge versteht nicht, worum es geht: Ihr Vater gibt ihr ohne nachzufragen immer exakt so viel, wie sie haben möchte, und zwar, weil sie nie mehr erbittet, als sie braucht. Das Geld, das sie im Sommer bei ihrem Ferienjob verdient, überlässt sie ohne zu zählen ihrer Mutter, die es ihr ohne zu zählen im Verlauf des Winterhalbjahrs zurückgibt.





























