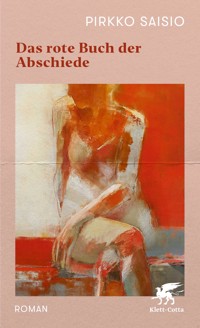19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Pirkko Saisio ist vermutlich die beste lebende Autorin Finnlands.« Aamulehti Eine Abiturientin verlässt ihre Geburtsstadt Helsinki, um in der fernen Schweiz die Liebe und Anerkennung zu finden, die ihr in ihrem sozialistischen Elternhaus versagt geblieben ist. Doch in der Fremde erkennt sie, dass ihre Sehnsucht nach Zugehörigkeit sie immer enger in ihrem Korsett verschnürt, statt sie daraus zu befreien. In leuchtender Prosa erzählt Pirkko Saisio davon, wie viel es als Frau aufzugeben gilt, um wahrhaft unabhängig zu sein. Es ist das Jahr 1968, als die Protagonistin mit neunzehn Jahren die Schule abschließt. Mit dem Vorsatz, die Enge ihres Elternhauses und ihrer Schulzeit in Helsinki hinter sich zu lassen, reist sie in die Schweiz – voller hochfliegender Träume und hungrig nach Liebe. Doch das kleine Land im Herzen Europas entpuppt sich nicht als das ersehnte Paradies, und das Waisenhaus, in dem sie arbeiten will, wirft sie zurück auf ihre Jugend in Finnland. Plötzlich ist sie wieder das sprachlose Kind aus dem Arbeitermilieu, das um jeden Preis von seinem Umfeld angenommen werden will, und doch nicht dazugehören kann. »Gegenlicht« ist ein brillantes Buch über das Erwachsenwerden. Die vielfach ausgezeichnete finnische Autorin Pirkko Saisio findet eine einzigartige Sprache für die Kraft und den Mut, den es braucht, um die Gesetze der Kindheit zu durchbrechen und die eigene Bestimmung zu finden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Pirkko Saisio
Gegenlicht
Roman
Aus dem Finnischen von Elina Kritzokat
Klett-Cotta
Impressum
Die Übersetzung und Veröffentlichung dieses Buches wurde gefördert vom Deutschen Übersetzerfonds, FILI – Finnish Literature Exchange, der Kunststiftung NRW und dem Europäischen Übersetzerkollegium EÜK.
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Vastavalo«
im Verlag WSOY, Helsinki
© 2000 by Pirkko Saisio
Published by agreement with Helsinki Literary Agency
Für die deutsche Ausgabe
© 2024 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH,
gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Anzinger und Rasp Kommunikation GmbH, München
unter Verwendung einer Abbildung von © Melinda Cootsona
Stadtplan Helsinki: VH-7 Medienküche GmbH, Stuttgart
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-98724-9
E-Book ISBN 978-3-608-12298-5
Es ist fünf Uhr morgens und die Welt in Gold gegossen.
Um die dicht stehenden Weiden, die erst Jahre später aus der Erde gebaggert werden, hängt schimmernder Dunst. Die saftigen, frisch aufgeschossenen Gräser tropfen sorglos vor sich hin.
Ich sehe sie im Gegenlicht.
Über die Wiese kommt sie auf mich zu.
In ein paar Jahren wird hier der City-Market stehen und die Wiese in Asphalt gegossen sein, auf dem Kleinfamilien beim Samstagseinkauf ihre Toyotas, Datsuns und Labradore zurücklassen.
Doch bis dahin ist noch Zeit, ein wenig.
Es ist ein verrücktes Jahr in Europa, der verrückte Sommer beginnt gerade. Das Alte Studentenhaus im Zentrum Helsinkis wird erst im Herbst erobert, aber in Paris gehen sie längst auf die Barrikaden. Moskau stellt Panzer bereit, und in Prag gibt es ohnehin schon etliche Gräber ehemaliger Herrscher. Die Moldau schürft sich durchs Flussbett, nagt gierig am Ufer.
Drei Kugeln schlafen im Magazin der Pistole, Rudi Dutschke schläft in seinem Bett, und auf der Wiese, über die sie mir entgegenkommt, schläft eine Kuh.
Es ist der erste Juni und fünf Uhr morgens, die Welt in Gold gegossen.
Auch sie trägt Gold, einen unwirklichen Umhang feinster Tautropfen, nicht einmal ihr Gesicht sehe ich.
Aber ich erkenne sie an ihrem vorsichtigen Gang.
Sie hat die Sandalen abgestreift, und ich kann mich gut an den eisigen Morgentau erinnern und dass die neuen Schuhe die ganze Nacht gescheuert haben.
Jetzt bleibt sie stehen.
Sie bleibt stehen, um der ersten Weidenammer zu lauschen.
An ihrer konzentrierten Körperhaltung und den neugierig verengten Augen erkenne ich, dass sie um diesen Moment und ihr eigenes Lauschen weiß.
Jetzt legt sie die Hand auf ihre Brust.
Am Zeigefinger baumelt die rechte Sandale, weiße Plastikriemen, hoher Absatz, eben erst gekauft.
Sie lässt die Hand schnell wieder sinken, offenbar weiß die Hand nicht, was sie als Nächstes tun soll, daher verschwindet sie leicht gekränkt in den Falten des cremefarbenen Kleides, das eben erst genäht wurde.
Sie beobachtet sich viel zu viel und leidet darunter.
Sie bettelt fortwährend um die eigene Anerkennung und wird stets hungrig bleiben.
Doch jetzt pflückt sie ein Nickendes Perlgras und verwandelt den zarten Halm in einen Satz: Das Perlgras schläft kurz, aber tief. Sie ist angetan und singt mit ungenierter Stimme los, ein lautes Lied für das Perlgras, die Weidenammer und den knallgelben Morgenhimmel.
Wag es bloß niemals, nie! Denke immer dran: Trampel nicht die Wiesen platt, fütter nicht die Affen matt!
Sie imitiert Kristiina Hautalas Stimme und vergisst für einen kurzen, verhängnisvollen Moment die Dimensionen ihres tollpatschigen Körpers.
Sie lässt ihre vorsichtigen Füße ein paar stolze Tanzschritte machen und ist sofort deprimiert.
Dann steht sie vor mir.
Sie schaut an mir vorbei, denn sie kann mich nicht sehen.
Ich weiche zur Seite, ihrem gnadenlosen Blick möchte ich mich nicht aussetzen.
Sie schaut in die Ferne.
Zum Horizont, natürlich. Der liegt ungefähr dort, wo die Fußgängerbrücke das nun verblassende Gelb des Sommermorgens von der Straße mit dem frisch markierten Zebrastreifen trennt.
Doch das nimmt sie nicht wahr. Ihre innere Bilderwelt ist zu dieser Zeit von Lucy M. Montgomery besetzt, von schattigen Tälern, in denen Apfelbäume knospen und die Nachtigall bis zum Tagesanbruch durchträllert.
Nun gleitet die Sonne in ihre Form.
Das dunstige Gold zieht sich zusammen, wird fahl und alltäglich.
Es schlingt sich wie die neue Bismarckkette um ihr Handgelenk, setzt ihr den modischen, blassblauen Aquamarinstein auf den Mittelfinger und prägt die gewichtige Lyra durch die schwarze Samtblende der Studentenmütze auf ihre helle Stirn. Die Requisiten der Abiturientin, nur in ihrem Blick erlischt das Gold.
Sie springt über den Graben zurück auf die Straße.
Ein einsames Taxi bremst neben ihr ab und beschleunigt wieder.
Ein betrunkenes Pärchen wankt an ihr vorbei, auch sie mit Studentenmützen, das Mädchen hat sich den Schlips des Jungen um den Arm gewickelt. »Viel Spaß noch«, ruft es ihr zu.
Sie antwortet mit einem Lächeln, kann es aber nicht zum Leuchten bringen, schlagartig fühlt sie sich müde und bleischwer.
Sie quetscht ihre schmerzenden Füße wieder in die engen Sandalen.
Sie setzt die weiße Mütze mit der schwarzen Blende ab.
In ihren sprayfixierten Haaren bleibt eine ovale Kerbe zurück. Die verschmierte Wimperntusche hängt ihr wie ein Schleier über die Wangenknochen.
Sie ist fast zu Hause, da will sie die Mütze nicht aufhaben, denn
als ich am Abend weggegangen bin, saß Vater mit einer Plastiktüte auf dem Kopf vor dem Fernseher.
Und in der Tüte lag meine Studentenmütze, die mir herzlich egal ist, denn Vater hat nie eine besessen. Dabei hätte gerade er es verdient.
Der Morgen im Tempel
Die aus Osten sind immer zu spät. Weil niemand von denen, die in Helsinki das Sagen haben, an eine vernünftige Straße gedacht hat.
Als Erstes haben sie die Brücke zur Insel Kulosaari abgerissen, eine neue gebaut und östlich der Holzvillen von Kulosaari auf der anderen Seite des Sunds den Stadtteil Herttoniemi errichtet. Dann, als die kleinen Bäume in den neu angelegten Gärten Wurzeln schlugen, Blätter trieben und den ersten Mehltau bekamen, zogen die Bagger und Kräne weiter, in neues Terrain südlich der alten Straße Porvoontie.
Sie fällten den Wald und rissen die Obstbäume mitten in der besten Bestäubungszeit aus der Erde. Den roten, gelben und blauen Holzhäuschen versetzte die große Radladerschaufel den tödlichen Stoß.
Der Stadtteil Roihuvuori mit den mehrstöckigen Wohnhäusern im Schuhkartonstil entstand. Die alte Porvoontie schlängelte sich nun durch Herttoniemi, Roihuvuori und an Fabrikhallen, Transformatoren, Feldern und Schrebergärten vorbei bis Puotila, wo ebenfalls bald strenge, legoblockartige weiße Mehrfamilienhäuser aufragten.
Der Bauboom der Sechzigerjahre zog immer mehr arbeitswillige Menschen aus östlichen Richtungen ins Helsinkier Umland, wo in Kontula und Myllypuro die riesigen Betonbunker im Warschauer Stil hochwuchsen. Ganze Scharen von Neuankömmlingen wurden von ihnen geschluckt, und die wenigen stehen gebliebenen Waldflecken wirkten aus den oberen Stockwerken wie verkümmerte Moospolster.
Schnell schossen auch die Vororte Puotinharju, Mellunmäki, Itäkeskus, Vuosaari und Rastila empor, und die alte Straße Porvoontie, deren begrenzte Kapazität niemand bedacht hatte, erstickte vor Abgasen, tristen Hupkonzerten und Gummireifengestank. Die Morris’ und Minis, die sowjetischen Moskwitschs und DDR-Wartburgs reihten sich morgens wie abends zu einem endlosen Band, das im gescheckten Licht der kränklichgelben Straßenbeleuchtung nervös voranzuckte.
Die Eingangstür ihrer neuen Schule hat einen reich verzierten Messinggriff.
Unter dem Griff befindet sich ein Schloss, das um exakt zehn nach acht zugeschnappt ist, wie jeden Morgen.
Der Hausmeister, der die Tür verriegelt, trägt dunkelblaue Dienstkleidung und angelaufene Metallabzeichen am Kragen …
Nein, ich erinnere mich falsch.
Der Hausmeister mit der Dienstkleidung kommt erst in der Universität dran, acht Jahre später.
Der Hausmeister meiner neuen Schule, Kallios Gymnasium und Oberstufe, trägt eine dunkelblaue Strickjacke mit sorgsam aufgenähten Ellenbogenflicken – und den traurigen, zuverlässigen Gesichtsausdruck eines Totengräbers.
Er erfüllt seine Aufgaben gewissenhaft und ist immun gegen das scheue Klopfen, die leisen Flüche und die trotzigen Tritte auf unserer Türseite.
Ich schließe mich der mittlerweile verstummten, nassen Schar der Verspäteten an.
Der Regen fällt in dicken, salzlosen Tränen.
Er saugt sich in die violetten, dunkelbraunen und schwarzen Mäntel, rinnt in die Taschen mit Schottenkaromuster, die dunkelblauen Seesäcke und die beiden altmodischen Flößer-Rucksäcke (der armen vom Land zugezogenen Brüder).
Rucksäcke hat sonst niemand mehr und Pausenbrote mit Kasseler erst recht nicht – nur diese zwei Unglücksraben, die jeden Morgen den Ässänrinne-Hang hochhetzen, je nach Jahreszeit in Stiefeln mit Gummikappe oder Skischuhen, aber immer mit Baskenmütze auf dem Kopf. Sie sprechen einen unverständlichen Dialekt, riechen nach Schuhfett und nasser Wolle und haben keine Ahnung, ob sie Zwillingsbrüder sind oder nicht.
Ich bin um halb sieben aufgestanden und habe mein Aufwachfrösteln und die mütterlichen Fragen nach Kaffee oder Tee und doch bitte wenigstens einer Scheibe Brot schweigend hinter mich gebracht.
Habe mir die Plastiklockenwickler vom Kopf gezerrt und die Haare toupiert.
Habe auf Mutters Anordnung die blickdichte Nylonstrumpfhose für die Herbstmonate liegen gelassen und eine andere angezogen, die keine Laufmaschen kriegt.
Habe fünfundsiebzig Minuten auf der Rückbank unseres Moskwitschs gesessen, den wir Mosse nennen, eingezwängt in die pfützenspritzende Autoschlange, und schon weit vor der Kulosaari-Brücke gewusst, dass ich wieder einmal zu spät sein werde.
Vergeblich habe ich meine Eltern darum gebeten, erst zur zweiten Stunde in die Schule gehen und noch ein bisschen auf den Bananenkisten im Kühlkeller der Markthalle schlafen zu dürfen.
Doch Vater hat erraten, dass ich in der ersten Stunde Arithmetik habe, und als ich ihm mit einem giftigen Grinsen klargemacht habe, Arithmetik sei nichts weiter als simples Rechnen, hat er mir einen langatmigen Vortrag gehalten über die enorme Bedeutung des Rechnens für all diejenigen, die beruflich mit Geld zu tun bekommen, und das beträfe sehr viele, sobald sie erst einmal erwachsen wären, ob sie nun wollten oder nicht.
Ich habe mir möglichst unauffällig die Ohren zugehalten und mich in meiner Fantasie im schummrigen Keller ausgestreckt, in dem es immer nach überreifem Obst und frisch geröstetem Kaffee riecht.
Neben dem Messinggriff befinden sich kleine Türfenster aus geschliffenem Glas.
Dahinter führt eine steile Treppe aus dem düsteren Eingangsbereich ins Helle.
Oben befindet sich eine weitere Tür, durch deren Fenster ich die endlose Prozession meiner Schulkameraden sehe, ein langsamer Strom von links nach rechts, immer neue schmuddelige Lederstiefel, knielange Kunststoffröcke aus Terylen, dunkelgraue Hosen mit strenger Bügelfalte und Aufschlag, Gesangbücher, hochtoupierte Haare, schwere Lider und aufmüpfig lackierte Fingernägel.
Ich kehre der Tür den Rücken und halte mich abseits.
Ich will mit niemandem reden.
Aus den vollgesogenen Wollhandschuhen rinnt ein eisiger Tropfen auf mein Handgelenk.
Durch die geschlossenen Fenster des Festsaals dringt ein schleppend gesungenes Gesangbuchlied, es kommt als diffuser Brei bei mir an. Nur die schrille, führende Stimme einer Lehrerin hebt sich ab.
Doch
dann wird ein Fenster aufgerissen.
Ich erkenne die dickliche Hand. Eine Viertelstunde später wird sie nach der Kreide greifen und verschnörkelte Zahlen, Plus-, Minus- und Ist-gleich-Zeichen an die Tafel schreiben.
Die Zahlen und Zeichen werden nach einer Antwort verlangen, die ich nicht geben kann.
In die stumme, nasse Schar kommt Leben, die Schnellsten drängen sich schon um die Glasscheiben. In wenigen Sekunden wird ein Mädchen ohnmächtig im schummrigen Flurlicht liegen.
Meine Scheibe beschlägt.
Ich wische sie mit dem Ärmel blank und blinzele.
Erst sehe ich den Pullover – die hübsche cremefarbene Angorawolle –, dann den Schottenrock, aus dem zwei dünne Beine ragen, willenlos.
Mein Atem stockt.
Das Opfer der gleichgültigen Morgenzeremonie ist meine beste und bis dahin einzige Freundin, regungslos liegt sie auf dem kalten Boden.
Ich rüttele am Messinggriff.
Ich weiß, die Tür wird nicht aufgehen.
Ich spüre die Blicke der anderen, genieße sie aber, auch wenn wir uns gegenseitig meiden.
Ich locke ein Wimmern in meinen Kehlkopf und, vom Regen unterstützt, eine Träne auf meine Wange.
Wische sie demonstrativ mit dem Handrücken weg.
Und
dann stehen zwei schwarzlederne Absatzschuhe neben dem Angorapulli, aus denen sich zwei Nylonsäulen erheben, und von irgendwo oben ragen blutrot lackierte Fingernägel ins Bild und streichen der Ohnmächtigen zart, allzu zart die blonden Locken aus der Stirn.
Warum
kann nicht ich das benommene Opfer auf dem Steinfußboden sein, das von meiner rotlackierten Angebeteten so schrecklich liebevoll umsorgt wird?
Ich jedenfalls würde nicht den Fehler begehen, die Augen schon jetzt aufzumachen und mir sofort den Rock über die Knie zu zupfen.
Die eben noch Ohnmächtige aber steht bereits wieder, auch das ein Fehler, und die Rotlackierte legt als letzte schützende Geste ihre Hand auf die schmale Angoraschulter.
Warum bin ich nicht anämisch, blass und zierlich?
Warum gelingt es mir nicht, in Ohnmacht zu fallen?
Worte gehen hin und her, die ich nicht höre, und ein mehrmaliges Lächeln, das mich ausschließt.
Die Angebetete verhält sich heute ohnehin erstaunlich: Sie bückt sich, um das in die Ecke geflogene Gesangbuch aufzuheben, und reicht es der Wiedererwachten mit einer Innigkeit, als wären sie engste Freundinnen.
Die Brüder mit den Baskenmützen stehen hinter mir und kichern.
Gedemütigt verlasse ich meinen Platz an der Tür.
Die diesige Luftschicht reißt auf, und es wird Alltag.
Der ernste Zeremonienmeister mit der flickenbesetzten Stickjacke öffnet die Tür zum Tempel.
Die verspätete, nach feuchtem Schuhleder und nassem Hund riechende Schar schiebt sich verdrossen ins Dunkel, die Letzte bin ich.
Mit dem Wörterbuch Finnisch-Deutsch-Finnisch auf dem Schoß sitzt sie im Zug.
Ihr Marimekko-Kleid hat Knöpfe aus Zinn, das warme Orange eines Sonnenuntergangs im Frühling und viele kleine Taschen.
Die Taschen sind leer.
Draußen flimmern die herrlichen Wälder der Schweiz vorbei, Bäume so prächtig wie in Parkanlagen.
Leider kann sie nicht richtig hinschauen, ihre Augen fühlen sich an wie zugemauert.
Auch ihre Beine sind zur Unkenntlichkeit gedunsen, denn sie hat zwei Tage lang in ihrem nagelneuen Abiturkostüm an Deck einer Autofähre gelegen.
Ihre Haut ist verbrannt und schmerzt.
Und sie kämpft mit der Angst, ist sich dessen aber nicht bewusst. Deshalb hat sie zu allem, was ihr begegnet, eine Meinung, auch zur Schweiz, obwohl der Zug aus Hamburg das Land nach zwölfstündiger Fahrt eben erst erreicht hat.
Die Schweiz ist eine alte Jungfer und sitzt auf ihrem breiten Hintern mitten in Europa, lautete der Kommentar ihres Patenonkels, als er von ihren Plänen hörte, den Sommer über dort zu arbeiten.
Sie will das nicht so sehen. Deshalb legt sie sich schon jetzt eine Antwort auf die Frage zurecht, die sie bald häufig hören wird: Oh ja, die Schweiz ist ein sehr schönes Land, aber Finnlands Natur ist sanfter.
Sanft? Sie befragt ihr Wörterbuch, das »weich« vorschlägt, die Natur im Norden ist also weicher.
Sie hat in den Fünfzigerjahren die Volksschule und in den Sechzigerjahren das Gymnasium und die Oberstufe besucht, bis noch vor Kurzem.
Sie hat gelernt, dass Finnland das schönste Land der Welt ist, weshalb sie sich mit dem Wörterbuch gegen die übermächtige Pracht der Schweizer Natur verteidigt.
In Finnland sind die Bäume filigraner, laut Wörterbuch »kleiner«, dafür gibt es Zehntausende Seen.
Das Licht dort ist anders, nicht wie hier gelb und hart; in Finnland ist es weicher.
Zum x-ten Mal kramt sie die Wimperntusche heraus und kontrolliert in dem winzigen Deckelspiegel unauffällig ihr Gesicht.
Ihre Hautfarbe ist unverändert.
Sie ist dunkellila.
Unter dem rechten Auge, an der schmerzhaftesten Stelle, klafft eine Wunde, aus der klare Flüssigkeit tropft.
Sie blättert im Wörterbuch.
Sie sucht nach einer deutschsprachigen Form für einen gewagten Satz: Aus meinem Gesicht tropft Wundwasser wie aus Jesu Rippen am Kreuz.
Ihre Situation ist diese:
Sie ist neunzehn, hat gerade Abitur gemacht und beschlossen, möglichst bald Leiterin eines Schweizer Waisenhauses zu werden.
Sie hat sich gründlich mit Pestalozzis Theorien zu Waisenhäusern befasst, genauer gesagt im Reader’s Digest eine etwas kitschige Geschichte über Schweizer Pestalozzi-Dörfer gelesen, und stellt sich das Leben der Waisenkinder wie das von Kindern mit Eltern vor, nur abwechslungsreicher und interessanter.
Außerdem hat sie achtmal den oscarprämierten amerikanischen Kinofilm Meine Lieder – meine Träume gesehen und identifiziert sich mit der heiteren, blonden Julie Andrews, die nie gebären musste und trotzdem zu sechs süßen Kindern kam und sogar von ihnen angebetet wurde.
Sie will auch angebetet werden.
Ohne es sich einzugestehen, aber durchaus berechtigt geht sie davon aus, bei schutzbedürftigen Waisenkindern auf besonders selige Anbetung zu stoßen.
Die Landschaft ist ihr aus dem Film schon ein wenig vertraut, sie kennt das weite Grün aus der Vogelperspektive, aus der ebenfalls zu sehen war, wie Julie Andrews sich auf einer Blumenwiese ausstreckt und sich dem überraschenden Lauf des Lebens mit Leib und Seele hingibt.
Selbst den Eigengeruch der Schweiz hat sie bereits erschnuppert: Das Land riecht dezent nach Bibliotheksstaub, deutlicher nach Rhododendren und Ziegenmilch, und Heidi hat sie natürlich Dutzende Male gelesen.
Die untergehende Sonne taucht die Parkanlagen in glühendes Purpurrot. Sie ist in Basel umgestiegen und erreicht nun Bern.
Ihr kunstlederner Koffer ist schwer.
Eigentlich gehört er Vater, das sowjetische Mosfilm-Logo musste sie mühsam mit der Wurzelbürste abscheuern. Trotzdem kann man das athletische Pärchen, das dem kapitalistischen Wind die Fäuste entgegenreckt, noch schwach erkennen.
Mit dem Koffer zu ihren Füßen steht sie am Bahnsteig und versucht, keine Angst zu haben.
Immer neue Züge fahren in die Bahnhofshalle ein.
Das schrille Ächzen der Waggons, die scharfen Pfiffe der Schaffner und die Gesprächsfetzen der Reisenden wölben sich zu einer Kuppel, in deren Lärm sie fast versinkt.
Drei Tage war sie unterwegs, schweigend und sonnenverbrannt, und nun wartet sie auf einen Menschen, der sie abholt und zu dem sie sagen kann: Oh ja, die Schweiz ist ein sehr schönes Land, aber Finnlands Natur ist milder.
Doch da ist niemand.
Niemand kommt in freudiger Erwartung auf sie zu.
Mit dem Koffer zu ihren Füßen steht sie am Bahnsteig, und ihr entgleitet die Zeit.
Sie möchte in einer schalltoten Ellipse versinken und weit fort sein, fort von diesem Moment, dessen Wucht sie zu vernichten droht.
Mit dem Koffer zu ihren Füßen steht sie am Bahnsteig und lässt sich vom Lärm entführen, fort aus Zeit und Raum, weit fort.
Sie träumt sich aufs Fensterbrett in ihrem ersten Zuhause.
Noch passt sie mühelos dorthin und liegt mit geschlossenen Augen selig in der Sonne, von Mutter mit einem Geschirrtuch zugedeckt, das nach Suno-Waschmittel riecht, liegt da wie die ebenso zugedeckten Hefeteilchen auf dem Backblech.
Hinter ihren Lidern wartet eine weitere Glückseligkeit: das gedämpfte Knallen frisch gemangelter Bettwäsche, die ihre Eltern über ihr zusammenlegen, während sie mit geschlossenen Augen unter dem weißflatternden Stoffhimmel liegt.
Und noch eine Glückseligkeit: Im sanften Abendwind lässt sie das Köpfchen sinken und steht am Tor zum Schlaf. Es riecht nach den filterlosen Työmies-Zigaretten, frisch gestärktem Hemdkragen und Schweißbrenner.
Und wenn sie die Augen aufmacht, sieht sie über Großvaters Schulter das schwarze Himmelsgewölbe und tausend helle Sterne, die sich auf Großmutters Sonntagskleid fortsetzen. Und hinter Großmutters Ohr lugt die Mondsichel hervor.
Sie macht die Augen wieder zu und findet eine letzte Glückseligkeit: eine heiße arabische Nacht, wilde Pferde, Männer mit Turbanen und ermattete Frauen. Der Raub der Sabinerinnen. Eigentlich weiß sie nicht, was Sabinerinnen sind, doch eins ist klar, sie werden geraubt.
Der Lärm in der Bahnhofshalle ist verebbt.
Der Stationsvorsteher trägt eine fremdartig aussehende Mütze und einen Schnurrbart – in ihrer Heimat sind Stationsvorsteher in diesem verrückten Jahr in Europa garantiert noch ordentlich rasiert. Er zupft sich einen Fussel von der Hose und geht gleichgültig an ihr vorbei.
Der Koffer steht neben ihr wie ein alter treuer Hund.
Sie gähnt ausgiebig und verbietet sich, an ihrer Lage zu verzweifeln, denn
auch wenn ihr romantischer Plan kindisch erscheinen mag und man sie mit gutem Grund für realitätsfremd halten kann, wie ihr Vater es nennen würde, oder sogar für eine dusselige Traumtänzerin, wie ihr Großvater sagen würde, so hat sie doch Zielstrebigkeit und praktischen Verstand bewiesen und ausführlich mit verschiedenen Schweizer Ansprechpartnern korrespondiert, sogar auf Deutsch, und sich selbst auf diesen verlassenen Bahnhof verfrachtet.
Also
nimmt sie entschlossen ihren Koffer, und
eine halbe Stunde später steht sie im Gang eines vollen Regionalzugs von Bern nach Münsingen.
Die Sonne hat sich inzwischen für Zinnoberrot entschieden, die Sonne liebt Zinnoberrot.
Ihre Gesichtshaut schmerzt, verstohlen tupft sie sich mit einem Taschentuch die Wundflüssigkeit ab.
Die Häuser entlang der Bahnstrecke sehen aus wie überdimensionierte Kuckucksuhren, doch aus selbstauferlegtem Zwang muss sie diese Architektur mögen.
Auf der Bahnhofsbrücke erwartet sie ein rundliches Mädchen in ihrem Alter.
Das Mädchen streckt ihr die Hand hin und sagt Guten Tag, deutlich schweizerisch. Prompt muss sie an einen Abend im letzten Winter denken:
Eine Party bei irgendwem zu Hause, alle sitzen auf dem Boden; auf dem Boden zu sitzen ist wichtig, Sessel und Sofa haben sie extra auf den Balkon geschoben.
Sie sind beschwipst, mehr vom Leben als von der halben Flasche Bordeaux Blanc, den sie Bulebule nennen und der ihnen ungekühlt wohl doch ein wenig zu Kopf steigt und tiefe Freundschaftsgefühle für alle anwesenden Bodensitzer sowie plötzliche politische Erweckungsmomente entfacht.
Sie schwören bei Marx, Engels, Lenin und etlichen anderen, dass sie nie zu den Erwachsenen zählen werden, die sich beim Wiedersehen die Hände schütteln.
Die zweite Erinnerung, die direkt auf diese erste folgt, gehört ihr noch nicht, denn sie ist meine: Ein Vierteljahrhundert später sehen wir uns bei einer kleinen Weihnachtsfeier in Timos Anwaltskanzlei wieder und schütteln uns vor Schreck über die gnadenlosen Spuren der Zeit geradezu übereifrig die Hände. Wir erkennen einander kaum wieder.
Das Mädchen geht vor ihr her und lässt den Koffer, den es ihr abgenommen hat, auf dem Boden schleifen.
Das Mädchen heißt Renate. Die frisch gemähten Wiesen riechen betörend.
In Gedanken schreibt sie folgenden Satz: Der Abend kühlte ab, der Wind brachte den Duft von blühendem Wermut.
Sie weiß nicht, wie Wermut riecht, nicht einmal, wie er aussieht, aber in guten literarischen Werken taucht er immer mal wieder als abendliche Geruchsnote auf.
Renate stapft wie ein Muli den Hang hoch, ausdauernd und beharrlich, ihre gelockten Nackenhaare sind feucht vor Schweiß. Zwischen den dunklen Strähnen sind auch ein paar weiße zu erkennen, dabei ist Renate bestimmt nicht älter als siebzehn.
Auch im kleinen Münsingen erinnern die Häuser an Kuckucksuhren.
Schmutz oder Abfall gibt es hier nicht.
Dahlien, Tigerlilien und Löwenmäulchen stehen wie Soldaten in den Gärten, aus den frisch gestutzten Weißdornhecken ragt nicht ein verirrter Zweig.
An einer rotgeziegelten Mühle gibt es immerhin einen Teich mit trübem Wasser und schmutzigen Enten.
Sofort fühlt sie sich ein wenig zu Hause und wendet sogleich ihren ersten deutschen Satz an: Die Schweiz ist ein sehr schönes Land, aber die finnische Natur ist milder.
Viel milder.
Renate dreht sich zu ihr um, ihr Haaransatz ist schweißnass.
»Rauchst du?«
Die Intonation der rauen Stimme sagt ihr, dass sie es mit einer Frage zu tun hat.
In Gedanken durchforstet sie ihr Wörterbuch. Braucht sie etwas? Nein, da war kein B, das klang anders. Rauchen … Was meint Renate?
Vorsichtshalber schüttelt sie erst den Kopf, nickt dann aber schnell.
Renate lacht.
Renate hat auseinanderstehende Zähne und einen leichten Bartschatten über der Oberlippe.
Renate macht eine Bewegung mit Zeige- und Mittelfinger.
Da fällt es ihr wieder ein, to smoke, to rauch, Quatsch, der deutsche Infinitiv ist natürlich rauchen.
Als sie eine Packung Colt-Zigaretten aus ihrer Handtasche fischt, dem einzigen Gepäckstück, das sie selbst trägt, schüttelt Renate entsetzt den Kopf: nicht hier. Renate stellt den Koffer ab und zieht sie hinter eine dicke Eiche.
Der Baum ist warm und staubig wie sie selbst, und im Schatten seiner Krone zündet sie mit einem Sampo-Streichholz zwei Zigaretten an, die, so vermutet sie, ihr Geheimnis bleiben müssen.
Die Enten schnattern mit dreckigen Stimmen.
Vom trüben Teich steigt das erste Insektengeschwader des Abends auf. Irgendwo öffnet sich quietschend eine Tür, und in einer Sprache, die sie nicht als Deutsch erkennt, wird wohl zum Essen gerufen.
Der Kapitän wässert den Rasen mit einem grünen Plastikschlauch.
Neben dem Rasen befindet sich ein Schwimmbecken mit hässlichem Betonrand, und auch hier haben die Gebäude nichts von den Schweizer Pestalozzi-Satteldachhäusern aus dem Reader’s Digest.
Schon eher erinnern sie an den Helsinkier Vorort Puotila oder an die Baracken in den Broschüren der Zeugen Jehovas.
Es sind schlichte zweistöckige Reihenhäuser mit Flachdächern, und von dankbaren Waisenkindern ist keine Spur.
Immerhin trägt der Kapitän eine kurze Hose und zeigt seine männlich behaarten Beine. Er dreht den Wasserhahn fest zu, wischt sich die Hände an einem blau-weiß-karierten Stofftaschentuch trocken, legt es exakt an den Bügelfalten zusammen, schiebt es in die Hosentasche und streckt seine Hand aus:
»Wir dachten schon, Sie würden sich nicht hertrauen.«
Es folgen laute Schweizer Lachsalven und Erklärungen:
Der Kapitän hat sehr wohl mit seinem Auto in Bern auf sie gewartet und sogar den Heilsarmee-Anzug getragen, aber keine der jungen Damen anzusprechen gewagt, weil keine fragend, geschweige denn verloren dreingeblickt hätte.
Als die Erklärungen und das Gelächter verklungen sind, führt er sie hinein und stellt ihr seine Frau vor, die energisch dauergewellte Haare hat und sie noch energischer anlächelt, und
daher hört sie nicht auf das warnende Flüstern ihrer inneren Stimme, dabei
mussten sie ihre Colt-Zigaretten einzig und allein wegen der Kapitänsfrau hinter einer hundertjährigen Eiche rauchen und danach Renates Pastillen mit Schweizer Kräutergeschmack lutschen.
Nachdem sie in ihr Zimmer geführt wurde, das an ein winziges Wohnheimkabuff erinnert,
nachdem sie die Dusche im Waschraum lange genug hat laufen lassen, schließlich will sie die teure Wimperntusche nicht unnötig vergeuden, und sie ihre zerknitterte Kleidung aus dem Koffer geholt und in den Schrank mit dem abgeplatzten Mahagonifurnier gehängt hat, ist es so weit, und
sie darf endlich die Waisenkinder sehen.
Heute ist Kirschentag.
Die ersten Kirschen des Sommers sind reif und baumeln den Kindern, die vorhin zum Abendessen reingerufen wurden, um die Ohren. Schweizer Waisenkinder scheinen dickes Haar zu haben, manche feuerrotes wie Anne auf Green Gables – sie liebt dieses Buch –, und kräftige Augenbrauen haben sie auch.
Sie dagegen muss sich ihre Augenbrauen jeden Morgen mit Wimperntusche hinpinseln.
Außer ein paar verstreuten kleinen Borsten kann sie nichts vorweisen.
Mutter hat das Nichtvorhandensein meiner Augenbrauen immer beklagt, und Tante Ulla meine flachen, breiten Fingernägel, die leicht einreißen.
Als ich neun wurde, kaufte Mutter in der Apotheke am Bärenpark eine Flasche Rizinusöl und strich mir jeden Abend mit dem Korken über die Augen, dort, wo sie die Brauen hinhaben wollte. Drei Jahre lang gab sie die Hoffnung nicht auf.
Tante Ulla verabreichte mir sporadisch Calciumtabletten und schob nach der Sauna mit ihren rotlackierten Fingern meine Nagelhaut zurück.
Aber
die Waisenkinder haben gesunde Fingernägel, dazu ausgeprägte Nasen, schwungvolle Lippen und rote Ohrgehänge aus Kirschen, und
im direkten Vergleich fühlt sie sich plump, plattnasig und farblos.
Vor ihr stehen Schüsseln mit Schweinerippchen und gedünstetem Spinat, und die Waisenkinder essen ihre Teller so zufrieden leer,
dass sie den Anblick blasser, straßenköterblonder finnischer Kinder vermisst, die mit scheu gesenktem Blick Soße auf dem Tellerrand verteilen.
Schweizer Kinder sind schön, sehr schön, aber finnische Kinder sind irgendwie weicher, viel weicher, wie die finnische Natur, die sich um diese Uhrzeit bestimmt schon in Dämmerung hüllt.
Sie steht am Fenster.
Hinter den Pappeln und Buchen kullert der Mond hervor, aus einem Graben dringt leises Quaken.
Die von den Zeugen Jehovas so geschätzten geometrischen Reihenhäuser versinken in gnädigem Dunkel.
Die Lichter gehen aus, nur in der Etage des Kapitäns leuchtet noch das unruhige Blau des Fernsehers.
Der Wermut duftet, und falls es kein Wermut ist, dann die süßliche Waldhyazinthe oder der hochschießende Weizen.
Das Wasser im Schwimmbecken liegt spiegelglatt im Mondschein und glänzt, und