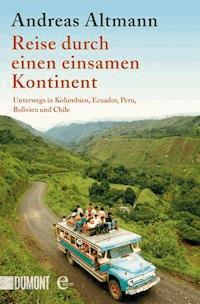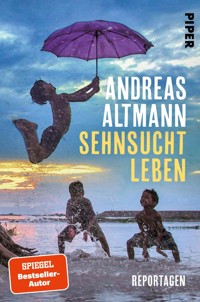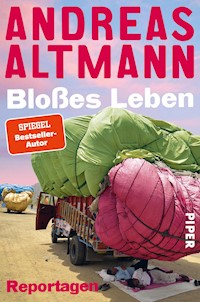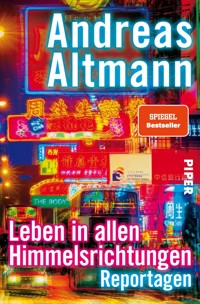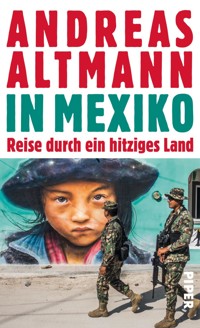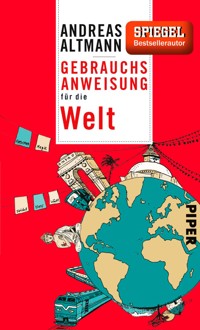Das Scheißleben meines Vaters, das Scheißleben meiner Mutter und meine eigene Scheißjugend E-Book
Andreas Altmann
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Eine Kindheit der Nachkriegszeit im idyllischen Wallfahrtsort Altötting. Doch die Geschichte, die Andreas Altmann erzählt, handelt weder von Gnade noch von Wundern, sondern von brutaler Gewalt und Schrecken ohne Ende. Schonungslos blickt Altmann zurück: auf einen Vater, der als psychisches Wrack aus dem Krieg kommt und den Sohn bis zur Bewusstlosigkeit prügelt, auf eine Mutter, die zu schwach ist, um den Sohn zu schützen, und auf ein Kind, das um sein Überleben kämpft. Erst als Jugendlichem gelingt Altmann die Flucht. Die schreckliche Erfahrung aber kann ihn nicht brechen. Sie wird vielmehr der Schlüssel für ein Leben jenseits des Opferstatus. Ein Leben, indem er seine Bestimmung als Reporter findet: »Hätte ich eine liebliche Kindheit verbracht, ich hätte nie zu schreiben begonnen, nie die Welt umrundet …«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für meinen Bruder, den einen, den Tapferen.
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2011
ISBN 978-3-492-95378-8
© Piper Verlag GmbH, München 2011 Umschlaggestaltung: Jorge-Schmidt Umschlagabbildung: Ullstein Bild
Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Es ist mein Herz, das zerstörteste Land.GIUSEPPE UNGARETTI
DER KRIEG / Teil eins
1
Als ich zum ersten Mal in Paris lebte, hatte ich meine Wohnung in Deutschland vermietet. Ich war mir nicht sicher, ob mein Umzug nach Frankreich endgültig sein würde. Eines Morgens bestieg ich panikartig den Zug zurück nach M. Meine Untermieterin, so hatte ich nachts per Albtraum erfahren, war dabei, mein Hab und Gut zu ruinieren.
Bis auf wenige Details war alles wahr. Ich klingelte und da stand die junge Frau. Wie immer schön und, wohl zufällig, nackt. Ich sah die Nackte und die Verwüstung. Die verschmierten Wände, das Geschirr im schwarzen Badewannenwasser, die Brandlöcher im Teppichboden, die Fliegen auf der verranzten Herdplatte, die angeschimmelten Lebensmittel, das unbetretbare Klo, die faulen Kartoffeln im Waschbecken, die Weinflecken auf dem Leintuch, ein Berg verstunkener Wäsche, unübersehbar, die fünfzig Quadratmeter waren zum Basislager der Heroinsüchtigen verkommen.
Ich blieb erstaunlich ruhig, forderte Linda auf, sich anzuziehen, kündigte der 23-Jährigen fristlos und trug ihre Sachen hinunter auf die Straße. Zwei Stunden später war ich wieder Alleinmieter. Ich begann aufzuräumen, zuletzt waren es zwei Plastiksäcke voller Müll. Dann checkte ich die Bücherwand. Die einzig verdächtige Lücke fiel mir sogleich auf. »Mein Kampf« von Adolf Hitler fehlte. Aus dem Jahr 1939, mit der Unterschrift des Autors. Natürlich war Linda kein Naziliebchen. Aber wie alle Junkies brauchte sie Geld und mit der Souveränität eines jeden, der ununterbrochen nach Verwertbarem Ausschau hielt, fand sie das einzige Buch, für das es auf dem Flohmarkt mehr als fünfzig Pfennig gab. Etwa viertausend Mark war der damalige Schwarzmarktpreis. Das reichte für mindestens vierzig Spritzen.
Seltsamerweise war mir sofort klar, dass dieses Buch die letzte (physische) Erinnerung an meine Eltern war. Sie hatten es, wie jedes andere Paar in jenen Zeiten, zu ihrer Hochzeit bekommen. Der Verlust stimmte mich froh. Nun war ich alles los, was mich an die beiden erinnerte. Nur um das Geld tat es mir leid, nicht um die Schwarte. Jeder Blick darauf hatte nur Hass ausgelöst. Nicht auf den massenmordenden Verfasser, sondern auf die zwei, die ich damals für das Unglück meines Lebens verantwortlich machte. Dafür gab es Gründe.
2
Ich kam mit einem Verzweiflungsschrei zur Welt. Er stammte von meiner Mutter. Sie sah mein Geschlecht und stieß diesen hysterischen Schluchzer aus. Als Zeichen grausamer Enttäuschung. Für sie war alles Männliche – und was wäre männlicher als ein Schwanz – Symbol von Niedertracht und Unterdrückung, ja, lebenslänglicher Ernüchterung. Nie war Sex imstande gewesen, sie zu begeistern, sie wegzutragen in einen Zustand seliger Benommenheit. Auch nicht neun Monate zuvor, als ihren Ehemann, meinen Vater, wieder einmal ein Bedürfnis überkam. Und er zufällig seine Frau neben sich fand. Sie ließ es zu, in der wilden Hoffnung, eine Tochter zu gebären: endlich nach drei Söhnen ein Wesen (der Erstgeborene starb kurz nach der Geburt), das keine Insignien der Gewalt mit sich herumtrug. Jetzt kam ich, der insgesamt fünfte Schwanz in der Familie, jetzt war das Maß voll. Jetzt – und ich sollte erst viel später davon erfahren – verlor sie die Nerven. Kaum war sie allein mit mir im Wochenbett, drückte sie das Kopfkissen auf mich. Lieber töten, als noch einen auszuhalten, der zum Unglück der Welt beitrug. Gerettet hat mich die Hebamme, die rechtzeitig wieder das Krankenzimmer betrat. So kam ich davon. Wenn auch mit der Ahnung im blauen Kopf, nicht willkommen zu sein.
3
Die nächsten vier Jahre sind schnell berichtet. Ich habe nicht die geringste Erinnerung daran. Nur, dass ich »Puppa« genannt wurde, wie Püppchen, wie Puppe. Denn so zeigen es die Fotos und so hat es Mutter später erzählt: Sie steckte mich in Mädchenkleider, um nicht daran erinnert zu werden, dass ich ein Mann werden würde, ein Schwein. Puppa klang mädchenhaft, ich sah aus wie ein Mädchen, meine goldenen Locken passten vollkommen. Absurderweise nannte sie mich jetzt ihren »Lieblingssohn«. Sie war katholisch und das Wissen, dass sie ihr eigenes Kind zu töten versucht hatte, machte ihr zu schaffen. So überschüttete sie mich mit Liebe. Als eine Art Wiedergutmachung, um der Hölle zu entgehen. So dachte sie, so würde sie es eines Tages erzählen.
4
Dann kam das Unglück zu mir zurück. Meine Schwester wurde geboren. Und damit der Posten des Lieblingsmenschen neu besetzt. Die Freude meiner Mutter muss ungeheuer gewesen sein. Ein schwanzloses Wesen kam zu ihr, wie ein Schutzengel wurde sie empfangen, ohne Würgegriffe diesmal, dafür mit Tränen der Fassungslosigkeit. Und auf die drei heiligen Namen »Maria Perdita Désirée« getauft, die Geliebte, die Verlorengeglaubte, die Ersehnte.
Jetzt begannen meine ersten Erinnerungen. Der Fotograf wurde einbestellt und wir vier Kinder fotografiert. Mit der immer selben Aufstellung: die Tochter in der Wiege und wir drei Brüder mit Blick auf sie. Als Bewunderer, als Frohlocker. Aber immer ohne Ehemann, ohne den Vater. Sicher hat Mutter diese Fotos absichtlich so arrangiert. Damit dieser Mensch, der Erwachsene mit dem erwachsenen Schwanz, nicht den Zauber der Situation zerstörte.
5
Es dauerte eine Weile, bis mir klar wurde, dass die Vorzugsposition, die ich vier Jahre lang bei Mutter eingenommen hatte, vorbei war. Bisher wurde ich umarmt, umschlungen, umgarnt, geküsst, herumgereicht, hergezeigt, ausgestellt und lauthals gelobt. Ich war der Liebling, der Lieblingssohn, das Lieblingskind. Meine Brüder, beide älter, verschwanden neben mir. So sehr, dass ich sie kein einziges Mal wahrnahm. Es gab nur mich. Auch Vater blieb verschwunden. Ich und Mama, sonst kein Mensch. Symbiotisch, neurotisch, mit Bravour einem Desaster entgegen. Denn alles war falsch an mir: Ich war der falsche Liebling, der falsche Lieblingssohn, das falsche Lieblingskind. Mutter und ich taten nur so, als ob. Denn nicht Liebe hatte ihren Überschwang genährt, sondern ein penetrant schlechtes Gewissen. Als die tatsächlich Geliebte erschien, war mein Sonderauftritt vorbei. Ich war wieder Schwanzträger, wieder Andreas (griechisch, der Tapfere! Der Mann!), wieder lästiger Nachwuchs, den ihr ein besoffener Mann zugeschanzt hatte.
6
Um mich an mein neues Dasein zu gewöhnen, landete ich in einem Heim. Wochenweise, monatsweise, immer dann, wenn Mutter mit den »Nerven runter war«. Sie war oft runter. Später erfuhr ich, dass man sie hinter vorgehaltener Hand eine »Kuckucks-Mutter« nannte, eine Mutterschlampe, die ihre Kinder in fremde Nester legte, um sie loszuwerden. Aber sie war keine Schlampe, keine richtige, sie wollte nur jene Exemplare loswerden, die sie nervlich überforderten. Das war zuallererst ich, der Ex-Günstling. Mutter gehörte zu jener Menschenrasse, die tatsächlich nur den Kopf in den Sand stecken musste, um zu vergessen. Sie war eine Verdrängungsweltmeisterin. Nicht immer, aber oft. Sie deponierte mich an der Pforte und verschwand. Um irgendwann wieder aufzutauchen und mich abzuholen. Ich weiß bis heute nicht, welche Rolle mein Vater in diesem Kinderversteck-Spiel innehatte. Noch immer war er nicht vorhanden, noch immer taucht er in meinen Erinnerungen aus dieser Zeit nicht auf.
7
Von den Hunderten von Heimtagen habe ich ein paar Bilder abgespeichert. Eines davon, stets das gleiche: Ich kroch in dem dämmrig beleuchteten Massenschlafsaal aus dem Bett und schlich vor zur Tür, öffnete sie und lugte in den Gang hinaus. Endlos lang, eisiger Steinboden, eisige Luft, dunkel, verlassen, grauenhaft still. (Meist musste ich im Winter hierher, da war Mutters Leben noch depressionsgeladener.) Und ich sah mich, den Tapferen, wie ich mit mir haderte und den Hader verlor. Weil ich den Weg zum Klo nicht schaffte, weil mich die Angst vor der Dunkelheit bezwang, weil ich ins Bett zurückkehrte und wieder das wurde, für das ich inzwischen bekannt war: ein Bettnässer.
Unvergesslich: diese Mischung aus Erleichterung, diesem Strahl warmen – Wärme! – Wassers und dieser elenden Scham, deren Beweis noch Stunden später für jeden sichtbar war. Zweimal Scham: die eine des Feiglings, die andere des uralten Säuglings, der noch immer nicht stubenrein war. Der Konflikt schien unlösbar, die Furcht vor jeder Finsternis ging tiefer als die Furcht vor der täglichen Bloßstellung.
Und doch, irgendwann gab es eine Lösung. Mein älterer Bruder Manfred wurde nun ebenfalls hier abgeladen (Stefan, der älteste, war inzwischen Internatsschüler, nur Perdita blieb bei Mutter). Und Manfred wurde der große Bruder, der Beschützer, der Unersetzliche. Er tapste mit mir durch den schaurigen Korridor zur Toilette. Und stand Wache. Nie ließ er mich spüren, dass er tapfer war und ich nicht.
8
Ich kam in die Schule. Ich war wieder zu Hause (nur die Ferien über musste ich zurück in den Massenschlafsaal). Fräulein Rambold, ganz grau, ganz altes Mädchen, kümmerte sich um uns. (Auch in der zweiten Klasse.) Sie trug keine Kleider, sie trug Stoffballen um ihre einsamen Hüften und in ihren Augen stand die Gewissheit, dass ihr Leben anders verlief, als sie es sich irgendwann vorgestellt hatte. Früh hatte ich einen Blick für traurige Frauengesichter entwickelt.
Ich wurde ein passabler Schüler, fast nur Zweier, ein Einserturner. Noch heute blicke ich mit Bewunderung auf Lehrerinnen. Auf geheimnisvolle Weise sind sie mitverantwortlich, ob einer mit Neugier auf die Welt zugeht oder nicht. Und die Rambold war kein böses Weib, die andere ihr glanzloses Leben spüren ließ. Auch nicht uns Kinder. Sie gab, was sie hatte. Mir schrieb sie drei Bemerkungen ins Zeugnis, eher kritisch: »intelligent, doch sehr phlegmatisch« und »Mut hat Andreas noch wenig. Er ist ein Angsthase.« Ein Pluspunkt und zweimal minus. Mein Name war ganz offensichtlich kein Omen.
9
Mutter war auch nicht »böse«, aber ihr Unglück konnte sie nicht verheimlichen. Ihre Nähe tat mir nicht gut. Jetzt fühlte ich am lebendigen Leib, dass ich sie nicht interessierte. Ich war ihr Pflichtprogramm, die Kür – die Liebe – bekam die Schwester. Die unten ohne.
Mein Körper nahm das nicht hin. Es fing arglos an: Nägelbeißen. War ein Drittel weg, biss ich links und rechts vom Nagel ins Fleisch. War auch hier nichts mehr zu holen, zog ich die Schuhe aus und bearbeitete die Zehennägel. Mit den bereits blutenden Fingern. Und aß alles auf. Aß mich. Ich wurde ermahnt, beschimpft, auf das hässliche Ergebnis verwiesen. Welch wunderlicher Versuch, mich zur Besinnung zu bringen. Immerhin holte Mutter die Rolle Leukoplast hervor und klebte je ein Fünf-Zentimeter-Stück auf meine Wundstellen. An manchen Tagen trat ich mit einem Dutzend Pflaster vor sie hin, barfuß, die Hände nach oben streckend: »Schau, wie ich blute«, und es klang wie: »Schau, ich will deine Liebe.«
Sie kam nicht. Ich begann, meine Nase zu traktieren. Aus der kindlichen Vermutung heraus, dass das Leiden ihres Sohnes Mutter zur Umkehr bewegen könnte. Zu mir zurück.
Rein in die Nase. Nicht leicht mit einem stumpfen Zeigefinger, zwei stumpfen Zeigefingern, deren Spitzen bei jeder Berührung schmerzten. Doch irgendwann floss das Blut aus meinem Gesicht und vermischte sich mit dem meiner Hand. Ich schleckte alles ab, auch die Nasenpopel. Jetzt legte ich mich auf den Boden, mit den kaputten Fingern, den kaputten Zehen, den rot verschmierten Nasenlöchern. Jetzt blutete ich von Kopf bis Fuß, blutete links und rechts. Die lächerliche, dramatische Geste verpuffte. Jedes Mal war Mutter unfähig, sie zu dechiffrieren. Sie sah mich, erschrak – und verabreichte Erste Hilfe. Ein Taschentuch, ein Wattebausch, ein paar abwesend gemurmelte Floskeln. Eher nervös als fürsorglich.
10
Ich hielt ihre Ferne nicht aus. Ich entdeckte meine Haare und riss sie aus, stellte mich vor den Spiegel und zerrte am Schopf. Aus brutaler Wut darüber, dass es mich gab. Ich hatte kein Recht zu existieren. Sodass ich den Körper in Stücke zerlegte, damit er aufhörte zu sein. Möglich auch, dass es genau umgekehrt war: dass ich das alles unternahm, um ihn zu fühlen. Dass es ihn gab. Obwohl die eine, die alles bedeutete, nie wollte, dass er, der Körper, lebte. Jedenfalls blutete irgendwann der Schädel. Ich hatte ein Büschel erwischt, weniger resistent, das sich nun wie ein Skalp mit blutigen Hautfetzen in meiner rechten Hand befand. Bei allem Schmerz befriedigte es mich. Zudem war die Reaktion von Mutter plötzlich energisch. Mit hysterischer Stimme lief sie zum Telefon und rief nach dem Hausarzt. Eine Stunde lang war ich der Mittelpunkt. Die Wunde musste genäht werden, wie eine Trophäe trug ich den Verband. Für Tage hörte ich auf, mich zu zerstückeln. Die Illusion einer Rettung überkam mich. Eine Woche lang glaubte ich, dass Liebe käuflich sei. Und wäre es mit Blut. Wie kann einer nicht geliebt werden, der sich mit Haut und Haar auslieferte?
11
Mutter war nicht umzustimmen. Auch nicht mit blutgetränkten Bandagen. Kaum verkrustete die Schädeldecke, wendete sie sich wieder ihrem Lieblingsobjekt zu. Ich war erneut auf der Reservebank. Wie ein Spieler, den der Trainer nicht mehr aufstellen will, aber aus irgendwelchen Gründen nicht entlassen durfte. Mutter konnte mich nicht feuern, das nicht, aber sie konnte mich auf Sparflamme setzen. Bekam ein abgeschobener Fußballer ein Mindestgehalt, bekam ich nun die Mindestration an Wärme, die man von einem zivilisierten Menschen erwarten konnte.
Mein Körper holte noch einmal aus. Mit seiner letzten Trumpfkarte. Ein eher gefährliches Unternehmen, das in seiner Radikalität nur bewies, wie mich nach ihr und ihrer Liebe hungerte: Ich verweigerte den Stuhlgang. Spürte ich den Druck, hielt ich inne und presste die Pobacken zusammen. Bis zur nächsten Druckwelle. Die heftiger kam und heftigeren Gegendruck forderte. Selbst mitten im Unterricht, mitten beim Sport. »Andreas muss Scheiße verdrucken« war die bald gefundene Wendung meiner Klassenkameraden, wenn sie mich – mittendrin zur Salzsäule erstarrt – dastehen sahen.
Das kümmerte mich nicht. Was zählte, war die Anteilnahme meiner Mutter. Sie sollte mich erstarren und leiden sehen. Und sie sah mich, ganz unvermeidlich. Aber erst, als ich im Bett lag und mich nicht mehr rühren konnte. Jetzt hatte ich sie da, wo ich sie haben wollte. Nah, mit warmer Stimme, mit Fragen, die nur mich betrafen. Ich erzählte ihr, dass ich seit sieben Tagen nicht mehr auf dem Klo war. Und diese abwesende Frau kam plötzlich wieder in mein Leben, legte ihre Frauenhände auf meinen steinharten Bauch und bekam Angst, tatsächlich Angst. Und suchte nach einem Nachttopf, zündete den Gasboiler an, holte mich aus dem Bett und setzte mich in den jetzt mit heißem Wasser gefüllten Pott. Die Wärme sollte meinen Unterleib aufweichen, ihn zur Herausgabe überreden.
Mutter blieb an meiner Seite. Stunden, vermute ich. Sie saß neben mir und wartete. Und irgendwann – ich presste und wimmerte – kam die Belohnung. Als ich erschöpft zur Seite kippte, sah ich den Topf ebenfalls kippen und sah die Wurst, stahlhart und von feinen Blutrinnsalen überzogen, auf den Teppich des Badezimmers schwemmen. Und Mutter hielt zu mir, wiegte mich, ließ die Blutwurst liegen, bis ich ausgeheult hatte.
12
Ich kam nie wieder so nah an sie heran. Obwohl ich mich weiter verstümmelte, weiter an mir fieselte, weiter den Magen schindete, ja, irgendwann mit einer Darmvergiftung ins Krankenhaus kam. Sobald ich wieder vom Abgrund wich, wich sie auch. Ich hatte nur in Gefahr, nein, in höchster Gefahr, ein Recht auf sie.
13
Jetzt trat mein Vater auf. Ich kann bis heute nicht sagen, warum ich ihn bis zu meinem neunten Lebensjahr nicht zur Kenntnis genommen habe. Wahrscheinlich war ich zu sehr damit beschäftigt, meiner Mutter hinterherzulaufen. Vielleicht, weil jetzt beide Brüder nicht mehr da waren. Wobei nur Manfred fehlte. Der Bruder, der zählte, der Hüter. (Er kam wegen schulischer Schwierigkeiten in ein Internat.) Beim Abschied weinte ich um ihn. Ich Trottel, ich hätte ihm zu seinem Glück – weg sein zu dürfen – gratulieren sollen.
14
Jetzt verschoben sich die Fronten. Jetzt wurde aus dem bislang unsichtbaren Vater ein Kriegsherr, ein Wüterich, ein Choleriker mit psychopathischen Tendenzen. Sicher war er das schon vorher, versteckt, unterdrückt, aber erst jetzt nahm ich ihn als solchen wahr. Manche Frauen erzählten mir später, dass ihre Männer bis zum Hochzeitstag als Gentlemen auftraten und nach der Hochzeitsnacht als Bestien aufwachten. Der Unterschied zu Franz Xaver Altmann war, dass er nach der Trauung den Tornister packen und in den Krieg ziehen musste, den Weltkrieg.
15
Ich bin bereit, alles Schlechte über meinen Vater zu bezeugen. Ich werde auf den nächsten hundert Seiten, sollte das reichen, seine Schandtaten ausbreiten und vor keiner Missetat haltmachen. Dabei nicht den Satz von Georges Simenon vergessen: »Ich bin als Schriftsteller nicht hier, um zu urteilen, sondern zu verstehen.« Das ist ein leidlich intelligenter Spruch. Schon wahr: Hinter den Schandtaten liegen die Gründe der Schande. The story behind the story. Ich gehe davon aus, dass ich – wie alle Schreiber vor mir – nicht ausreichend erklären kann, warum ein anderer, hier Franz Xaver Altmann, so oder so geworden ist. Ein Teil Rätsel und Unbegreiflichkeit bleibt immer. Man kann nur Wahrscheinlichkeiten anbieten, Grundzüge, die entscheidende Richtung. Klar, urteilen werde ich auch, selbstverständlich. Ich wurde immerhin Vaters bevorzugtester Prügelknabe, ich habe ein Recht auf meinen Hass.
16
Während des Vietnamkriegs wurde der Ausdruck »posttraumatic stress disorder« bekannt. Man bezeichnete damit eine seelische Krankheit, an der Veteranen litten, die traumatische Erlebnisse hinter sich hatten. Vorkommnisse, die das eigene psychische »defence system« überforderten. Frechheiten, ja Beleidigungen, kann man hinnehmen, ohne die innere Balance zu riskieren. Aber jeden Tag töten und jeden Tag getötet werden können, macht krank. So kamen die Männer nach Hause und hatten den Verstand verloren. Oder ihre Stimme. Oder jede Freude. Delirierten wach in ihren Betten, sahen sich kämpfen und Angst schwitzen, sahen ihre Freunde verrecken und ihr eigenes (unverdientes) Überleben, lagen leblos und impotent neben ihren Frauen, wurden kriminell oder lebensmüde oder verlauste Obdachlose. 700000 von insgesamt drei Millionen GIs begaben sich damals in Behandlung, Diagnose: PTSD.
17
Als mein Vater heil aus dem Krieg zurückkam, war er bereits verwüstet. Seelisch. Hätte er von seiner »posttraumatischen Belastungsstörung« gesprochen, man hätte ihn ausgelacht. Damals gab es keine Schachtel Aspirin umsonst. Was Vater in Polen und Russland – und es gab ein Foto von ihm in SS-Uniform, das später verschwand – gesehen hat, als Soldat, als Täter, als Barbar (die Barbarisierung schien unvermeidlich), hat keiner von uns erfahren. Von einigen folkloristischen Episoden abgesehen, die er Manfred erzählte und die ohne einen Funken Grauen auskamen, hielt er den Mund. Es hatte ihm wohl die Sprache verschlagen. Was man als Zeichen von Anstand deuten könnte, von Gewissen. Vielleicht war er nur vorsichtig. Um nicht überführt zu werden. Immerhin protzte er nicht mit seinen Freveln – die er anstiftete oder bei denen er danebenstand.
Wir beide haben nie darüber geredet. Als ich in das Alter kam, in dem Vergangenheit mich zu interessieren begann, verhandelten wir schon nicht mehr miteinander. Was – das Nicht-darüber-Reden – ich heute aufs Tiefste bereue. Ich hätte ihn zur Aussage zwingen sollen. Er tauchte als Vierzigjähriger, genau in der Mitte seines Lebens, als Zombie aus dem Krieg wieder auf und führte genau die nächste Hälfte seines Lebens wieder Krieg. Aber diesmal diente nicht der ferne Ural als Kampfzone, sondern die eigene Familie.
18
Unbegreiflich, wenn man bedenkt, was für Aussichten er gehabt hatte. Immer wenn ich Fotos aus seinem jungen Erwachsenenleben betrachtete, wünschte ich, so daherzukommen wie er, so lässig den eigenen Körper bewegen zu können. Dazu ein Filmschauspieler-Gesicht, die Haare nach hinten gewellt, so ein nachlässiges Lächeln. Ein Beau, ein Mann, ein notorischer Gutausseher.
Das waren die einen Göttergaben. Die anderen betrafen sein Leben. Die Familie hatte Geld und der 30-Jährige besaß ein Pferd, ein Haus, ein Motorrad, ein Segelflugzeug und – heute nicht mehr denkbar – einen Sportwagen nach eigenen Entwürfen. Einen Prototypen, ein Einzelstück für ihn allein. Ich vermute, er gefiel den Frauen, ich vermute, er dachte, sie und die Welt gehörten ihm. Der Nazi Hitler störte nicht. Man war ja patriotisch, durchaus deutsch-national. Und zuletzt: Vater war intelligent, hatte in seiner Jugend Zeugnisse hingelegt, die für eine fulminante Akademiker-Karriere gereicht hätten.
Nun, der Konjunktiv verweist auf den Haken. Sie hätten gereicht: wenn. Wenn er einen anderen Vater gehabt, einen, der ihn nicht zu seinem Unglück gezwungen hätte. Oder wenn er die Kraft gehabt hätte, sich diesem Vater und dem von ihm verabreichten Unglück zu entziehen. Aber er hatte sie nicht. Vielleicht war er korrupt. Korrumpiert vom guten Leben. Vielleicht ein Schwächling, für den Geldausgeben (für sich) aufregender war, als sich hinzustellen und »Nein« zu sagen. Nein zu einem Beruf, der ihn für den Rest seiner Zeit, nur unterbrochen von den sechs Jahren Soldatenleben, kränkte. (Und jeden kränkte, der damit in Berührung kam.) Eine Tätigkeit, die alles Erfreuliche an ihm verwittern ließ: seinen Charme, sein Hirn, seine musische Begabung. Er war der erste Mensch, bei dem ich verstand, dass Attraktiv- und Klugsein nicht reichen, um nicht abzustürzen in ein gnadenlos banales Schicksal. Irgendeine Kraft muss dazukommen, so etwas rücksichtslos Stolzes, was keine Kompromisse duldet und sich mit einer kühlen Handbewegung über die Träume der Väter hinwegsetzt.
Nicht Franz Xaver, er ließ sich nach ein paar Jahren Gymnasium, mit Einsernoten, von der Schule kommandieren. Nicht, um durch Europa zu reisen. Oder in Cambridge ans College zu gehen und hinterher englische Literatur zu studieren. Oder den Amazonas hinunterzurudern und das Lied von der Schönheit der Erde zu singen. Nein, er kuschte, setzte sich ins Nest und wurde das Kläglichste, was einer mit seinen Gaben werden konnte, er wurde, wie sein Vater, wie sein Großvater, er wurde – ROSENKRANZHÄNDLER. Und um die Schmerzgrenze der Erbärmlichkeit noch einmal anzuziehen, verbrachte er seine knapp achtzig Jahre in einem Kaff, das man als Geburtsort nicht öffentlich aussprechen, nur als Geburtsfehler verheimlichen will: ALTÖTTING.
Hätte sich sein Leben in Buenos Aires oder San Francisco oder an den Ufern des Lago Maggiore abgespielt, es wäre erträglicher gewesen. Die Schönheit dieser Orte hätte die Zumutungen entschärft. Auch entschärft die nicht auslotbare Gemeinheit, sein Dasein als Devotionalien-Trödler verbringen zu müssen. Aber »AÖ«, dieses Provinzloch mitten in Bayern, seit Jahrhunderten eisern in römisch-katholischer Hand, das tat weh. Diese Brutstätte hechelnder Bigotterie (ich liefere noch die Fakten), dieses weltberühmte Wallfahrtsziel, an dem sie seit Urzeiten den pilgernden Schafsherden Wunderlügen, Weihwasser, die »Allerheiligste Madonna im Schneegestöber« und als uneinholbaren Verkaufsschlager den »Gekreuzigten« – ein Gefolterter als Markenzeichen passt unschlagbar zur allein seligmachenden Kirche – verscherbeln, das war ein Schicksal, sein Schicksal. Und in dieser Stadt voller Pfaffen und von Pfaffen geducktem Volk zum »Rosenkranz-König« aufzusteigen, sprich, jeden Tag die Schafshirten und ihre Schafe mit dem Gebetsmühlen-Schrott zu versorgen, der keinem anderen Zweck diente, als dass die Schafe auf immer Schafe blieben: Das war kein Schicksal, auch kein bedauerliches, das war eine in den Himmel schreiende Jämmerlichkeit, das war mein Vater. Der besoffen seine Frau schwängerte. Der Ex-Playboy. Der Kinderschläger. Der SA-Mann. Der Ehebrecher. Der SS-Uniformträger* Der Kirchenchor-Tenor. Der Playboy-und-Praline-Onanist. Der getreue Katholik. Der Kinderarbeit-Arbeitgeber. Der tadellose Kirchensteuer-Zahler. Der Russland-Frevler. Der Polen-Frevler. Der Bruder-Hasser. Der Jeden-Bruder-Hasser. Der Nachbar-Hasser. Der CSU-Wähler. Der Frauen-Hasser. Der Männer-Hasser. Der Alle-Hasser. Der Kinder-Erniedriger. Der respektable Bürger. Der Ohne-Liebe. Der Ohne-Freunde. Der Ohne-Freude. Der Prozesshansel. Der Vertreiber. Der Speisekammer-Verschließer. Der Tischgebet-Aufsager. Der Lebensmittel-Entzieher. Der Klingelbeutel-Spender. Der Niederbrüller, morgens. Der Niederbrüller, mittags. Der Niederbrüller, abends. Der Blumenliebhaber. Der viehische Liebhaber. Der zuverlässige Begräbnisbesucher aller Gehassten. Der Minus-Mann. Der ordentliche Steuerzahler. Der Entwerter. Der Mensch, die Krone der Schöpfung, das Schwein. Mein Vater.
19
Mein Leben veränderte sich. Plötzlich vernahm ich seine Stimme. Ganz unvermeidlich, denn sie war schneidend und kalt. Wenn sie nicht schrie. Vielleicht hatte er auf diese Weise, so lange konnte es nicht her sein, einer Horde Polacken Befehle erteilt. Aber im »Altmann-Haus«, dem stattlichen Haus, dem von seinem Vater geerbten Teil, gab es keine Polacken. Gott behüte. Es gab nur uns, nur die fünfjährige Schwester und mich, den bald Neunjährigen. Und es gab meine Mutter. Sie war der Polack, der Jude, der ewige Sündenbock für das nun an allen Ecken und Enden misslingende Leben meines Vaters.
Alles war längst weg, der Flitzer, das Flugzeug, die BMW, der Hengst, die Freiheit, das smarte Leben, Großdeutschland. Geblieben war ihm Altötting, das von ’33 bis Ende April ’45 brav mitlief und keinen Muckser gegen die NS-Kreisleitung verlauten ließ. Bürgermeister Karl Lex war Parteimitglied. Erst in den letzten Tagen – die Amerikaner standen schon an der Donau – taten sich ein Dutzend Männer zusammen, um die lokalen Nazibonzen zu verhaften. Sechs der Beherzten haben diese Mutprobe mit ihrem Leben bezahlt. Unter den Aufständischen befand sich kein Vertreter der Kirche. Dass man sich in Altötting im Laufe der folgenden Jahrzehnte die Legende vom entschlossenen Anti-Nationalsozialismus zimmerte, sollte nicht überraschen. Überall im Nachkriegsdeutschland wurde daran gebastelt. Und dass die meisten AÖ-Obernazis, auch wie überall, ungeschoren zurück ins brav verlogene Bürgerleben fanden, ist ein alter Hut. Man kann ja nicht von jedem Mitläufer verlangen, dass er sich – wie der Altöttinger Bürgermeister – per Kopfschuss von seiner Mitschuld verabschiedete. Unter den Aufrechten, und er entzog sich durch Flucht der standrechtlichen Hinrichtung, war jedoch der Onkel meiner Mutter, Gabriel Mayer, der Bruder ihres Vaters Hans (der sich zu dieser Zeit nicht in Altötting aufhielt). Sie standen gemeinsam auf der »Todesliste« der Nazis. Schade, dass ich die beiden nicht kennen gelernt habe. Und schade, dass Mutter nichts von deren Tapferkeit geerbt hat. Die hätte sie brauchen können, jetzt, während der letzten zwei Jahre, in denen sie von ihrem Ehegatten geschunden wurde. Bis er sie nicht mehr aushielt und hinauswarf. Und sie, leidensbegabt wie ein Haustier, tatsächlich nicht mehr leiden konnte und davonlief.
20
Natürlich ging die Schinderei schon vorher los. Nur war sie mir verborgen geblieben, gefangen in der eigenen Welt, den eigenen Verlusten. Aber jetzt kam Mutter zu mir zurück, ich war ja der einzige, der sie »beschützen« konnte. Ich durfte sogar zu ihr ins Bett, am frühen Morgen, wenn Vater noch schlief. Sie brauchte meine unschuldige Nähe. Von meinem Kinderbett ins eheliche Doppelbett. Mutter war immer dick vermummt, zwei Nachthemden plus eine Strickjacke, plus eine kurze und zwei lange Unterhosen. Eine Art Rüstung, um allen etwaigen »ehelichen Pflichten« vorzubeugen (damals gab es dieses Gesetz noch). Ich kam immer auf die Ritze. So lag vor mir der warme Körper meiner Mutter und hinter mir, jenseits der Ritze, mein Vater. Schnarchend, nein, durch die Nase pfeifend, noch im Schlaf aggressiv atmend. Wäre ich älter gewesen, ich hätte die Ironie der Situation verstanden: der tumbe Gatte und der heimliche Liebhaber.
Zu dieser Zeit hatten die zwei es schon überstanden: alles Sexuelle, denn das von Mutter unterzeichnete Statement – von dem ich erst in ein paar Jahren erfahren sollte – lag bereits im Safe. Per Unterschrift bestätigte sie darin, »alle weiteren sexuellen Handlungen zu verweigern«. Ihre Winterkleidung im Bett, auch im Hochsommer, war folglich nur noch Reflex. Für den Fall, dass Vater den »Vertrag« brechen sollte.
Unter all dem Panzer, unter dem Mutter ihren Körper verschanzt hatte, fühlte ich zum ersten Mal bewusst die Haut einer Frau. Am Nacken, der frei lag. Sog den Duft ein, hörte ihr Herz, das leise Pochen, drängte mich an sie wie ein Liebender, der noch nicht reif war, um das Spiel zwischen Mann und Frau zu kennen, die unfassbaren Dinge.
Mutter genoss es, sicher. So linkisch und unwissend meine Kinderhände sich auch benahmen, linkischer als die meines Vaters konnten sie nicht sein. Nicht, dass Mutter auf mein Streicheln reagiert hätte. Aber ich bildete mir ein, dass für eine kurze Weile die Angst aus ihr wich und sie eine Ahnung davon bekam, wie anders ihr Leben hätte verlaufen können. Wenn ihr Mann kein Seelenkrüppel gewesen wäre, sondern ein Liebender.
So hatten wir täglich eine halbe Stunde für uns. Dann verduftete ich und ging wie mit einer Heimlichkeit, noch bevor Vater aufwachte, zurück in mein Zimmer. Um das Geheimnis zu retten. Um den Augenblick zu vermeiden, in dem er verrotzt aus dem Bett stieg und die Badezimmertür hinter sich verriegelte.
21
Mutters Jugend, sie war fünfzehn Jahre jünger als Vater, verlief erfreulich. Hübsches Mädchen neben drei Schwestern und einem Bruder. Hotelierstochter, vom »ersten Haus am Platz«, dem Hotel Post(offiziell: Hotel zur Post). Nur zweihundert Meter vom Haus des »königlichen Kommerzienrats, des Ehrenbürgers Altöttings« entfernt, dem Vater ihres zukünftigen Mannes. Zwei »beste Familien«, könnte man sagen.
Brave Kindheit, von Gouvernanten und Wohlstand behütet, von wohlwollender Nachlässigkeit der Eltern begleitet, die gern »repräsentierten«. Elisabeth ging in die »Höhere Töchterschule« der Englischen Fräuleins. Nach Abschluss musste sie für ein Jahr zum »Reichsarbeitsdienst« nach Remagen und durfte dann als 18-Jährige nach Hamburg, an ein Spracheninstitut. Für eine solche Entscheidung in damaligen Vorkriegszeiten, eine solche auch geistige Großzügigkeit, müsste man ihren Eltern noch nachträglich einen Lorbeerkranz flechten. Hatte der zweite Rosenkranz-König seinen Sohn Franz Xaver, meinen Vater, zum Rosenkranz-König Nummer drei dressiert, so durfte Elisabeth das Kaff verlassen und in eine Weltstadt ziehen.
22
Man sagt, dass jeder Mensch (ok, fast jeder) im Laufe seines Lebens Chancen bekommt. Mindestens einmal steht das Glück zur Verfügung. Aber er muss es sehen, muss, noch wichtiger, den Mut haben, sich ihm in den Weg zu stellen, es couragiert herauszufordern. Aber Mutter war blindwütig entschlossen, kein Unglück auszulassen. Statt sich am Hamburger Hafen festketten zu lassen, folgte sie einem Mann, den sie an einem »geselligen Abend« getroffen hatte. Sie hatte sich für den Ungeselligsten entschieden, der sich für sie, die Höhere Tochter, die Bildhübsche, die Fremdsprachen-Studentin, begeisterte.
Das Glück war da gewesen. In Gestalt eines spendablen Vaters, einer Großstadt, eines Studiums, das ihr die Möglichkeit geboten hatte, eines der aufregendsten Dinge zu lernen: Sprachen. Was für ein Zaubermittel, um die Welt zu erobern, die Weltbewohner auszufragen, seine Erkenntnislust zu stillen. Aber Mutter war wohl zu brav, zu verwöhnt von der Widerstandslosigkeit ihrer Jugend, zu voll von den Bildern eines bürgerlichen Frauenglücks, um zu realisieren, dass sie – verliebt und ohne Hunger nach Wissen und Erfahrung – die Koffer für den Weg ins Fegefeuer packte. Gewiss wollte sie wirtschaften im großen Haus, wollte schön sein und stolz sein auf den schönen Mann, wollte die schönsten Töchter. Es kam anders, es kam so: vom »Tor zur Welt« zurück zur Dösigkeit von Hinterbayern. Vom Trubel eines Studentenlebens umweglos aufs Laken eines unglücksschwangeren Ehebetts. Von Friedenszeiten in einen monströsen Krieg. Die Hochzeitsgeschenke waren noch nicht ausgepackt, da schäumte Hitler schon durch den Volksempfänger: »Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen!«
Etwas Absurdes passierte. Sie bekam noch einen Aufschub. »Die himmlischste Zeit«, Originalton Mutter, »meines Lebens begann.« Der Mann zog in den Osten, sie in den Westen. Nach München, wo sie immer wieder ein paar Wochen verbrachte. Freundinnen besuchte, ein Theater-Abonnement für die Kammerspiele kaufte und noch Jahre danach »von Hans Albers in der Loge gegenüber« schwärmen sollte. Die »Hauptstadt der Bewegung« strahlte, das blaue Wetter, die Biergärten, die roten Hakenkreuzfahnen, Deutschland im Siegerrausch. »Elly« war ein junges dummes Ding, politisch vollkommen unbeteiligt, zu verzogen, um auch nur ansatzweise das Verderben zu ahnen, das auf Deutschland zurollte. Und auf sie. Aber jetzt war jetzt, sie atmete, sie lachte, eine nie gekannte Lebensfreude kam über sie.
Noch eine bizarre Begegnung. Im Frühjahr ’42 waren die Ausflüge ins High Life vorbei, sie blieb in Altötting. Irgendwann, es ging schon dem Ende des Tausendjährigen Reichs zu, kam ein Russe bei ihr vorbei, ein Zwangsarbeiter. Soweit sie verstand, war er auf der Flucht. Vielleicht verstand sie in ihrem Schrecken auch alles falsch und verwechselte einen verdreckten Landstreicher mit einem Vertreter eines Volks, dessen Männer grundsätzlich – so die Propaganda – deutsche Frauen vergewaltigten. Auf jeden Fall hielt sie ganz still und gab keinen Ton von sich. Er war kein um sich schlagender Unhold und war bald fertig, flüsterte eher beruhigend auf die Starre ein. Und verschwand mit einem Laib Brot und kam nie wieder.
23
Als mir Mutter, wieder viel später, die Geschichte erzählte, war ich wieder einmal fasziniert von dem, was Gewalt konnte. Sich eine Frau und etwas zum Essen verschaffen. Einfach so. Ohne jede Vorbereitung, ohne Kenntnisse, mittellos, mit nichts. Sie war das erste Gewaltopfer, das ich kennen lernte. Ich meine nicht nur den nächtlichen Überfall, sondern – vor allem – ihre Zeit im Altmann-Haus. Was man einem Menschen alles zumuten konnte. Weil einer Macht hatte und der andere nicht. Weil einer (Vater) handelte und der andere (Mutter) behandelt wurde.
Seltsamerweise berichtete sie gefasst über die dramatische Begebenheit. Als hätte sie Mitleid mit dem Wildfremden gehabt, zumindest Verständnis. Mutter war keine Analytikerin, sie hatte keine Erklärung für ihre Nachsicht. Auf meinen Vorschlag, dass sie milde gestimmt gewesen sei, weil er keine Gewalt anwendete, eher drängte und bettelte, nickte sie mit dem Kopf und meinte: »Schon möglich.« Was sie an Vater so hasste, der nie von der Begegnung mit dem Fremden erfuhr, war die Brutalität, dieser Mangel an Zärtlichkeit, seine blöde Talentlosigkeit im Umgang mit ihrem Körper und dessen Sehnsüchten. Ihr Mann schien nichts anderes als den Eingang bei ihr zu suchen, den Zutritt für seine Geilheit. Den Rest, ihre zwei Quadratmeter Haut, ließ er unberührt liegen. Haltloses Schmusen brach nie aus. Wie Hengst und Stute gingen sie miteinander um. Bekam er eine Erektion, fuhr er in sie hinein. Und sie wartete, bis sich sein Aufbäumen beruhigt hatte.
24
Ich kam in die dritte Klasse. Die traulichen Zeiten mit Fräulein Rambold waren vorbei, jetzt übernahm Oberlehrer Johann (Hans) Korbinian Spahn das Kommando. Er erinnerte mich sofort an meinen Vater. So ein latenter Zorn in seinem Gesicht, so eine Generalwut auf die Welt. Einer, der niemanden anlächeln konnte. Nur anstarren. Kriegsteilnehmer, noch ein Kriegskrüppel. Ich wundere mich noch immer, über wie viel Stauraum für Tobsucht und Jähzorn diese Männer verfügten. Heute sind ihre Taten gesetzlich verboten, aber damals war nicht denkbar, dass man sich über einen im Klassenzimmer randalierenden Lehrer beschwerte. Dort war sein Jagdgebiet, sein Freiraum, seine Stätte, um zu züchtigen. Auf dem Grab des Lehrers müsste per Gerichtsbeschluss »Nebenberuf: Kinderschänder« stehen. Dabei scheint belanglos, ob er sexuell (auf Umwegen) oder körperlich (gewiss) und seelisch (aber sicher) geschändet hat.
Spahn tourte auf leisen Sohlen durch die Bankreihen. Und wenn ein Neunjähriger ihm nicht passte, dann griff er zu. Der Schüler konnte »schlecht« dasitzen, die Hände »verkehrt« halten, die Hausaufgabe nicht gemacht haben, verträumt zum Fenster hinausblicken, seine Murmeln zählen, keine Antwort wissen: Spahn sprang auf ihn los, japste triumphierend »Ich packe dich am Suppenschlauch!«, umklammerte mit der linken Hand den Kinderhals, riss Hals und Kind hoch, zerrte den Gebückten nach vorne und warf sein Opfer – ein Ritual – auf die inzwischen in Blitzgeschwindigkeit von zwei Mitschülern geräumte vorderste Bank. Hier konnte er breitbeiniger dastehen und geräumiger ausholen. Und mit dem »spanischen Rohr« auf den inzwischen nackten Hintern dreschen. Ob manche von uns die Hose herunterlassen mussten, um noch schmerzverzerrter die vorgeschriebene Ablassformel – »Ich bitte um Barmherzigkeit!« – zu brüllen oder um noch schneller dem Erziehungsberechtigen, dessen Hände zu scheinbar allem berechtigt waren, zu seinen kranken Phantasien zu verhelfen, konnte ich damals nicht entscheiden. Ich könnte aber mit Bestimmtheit sagen, dass Spahn an manchen Tagen der Schweiß ausbrach, so rückhaltlos bemühte er sich um uns. War er fertig, flüsterte er: »Weitermachen!« Dann durfte der vor aller Augen an Leib und Seele Entblößte sich wieder bedecken, an seinen Platz zurückgehen und sich vorsichtig an den Stuhlrand setzen. Und weitermachen, soll sagen, am Unterricht teilnehmen, als wäre nichts geschehen. Spahn konnte nur heiser krächzen. Die restlichen Töne, so das Gerücht, hatte ihm ein anderer Krieger, im Krieg, weggeschossen.
Seine beiden Arme funktionierten tadellos. Leider. Hätte er sie auf dem Schlachtfeld der Ehre gelassen, sie hätten weniger Unheil angerichtet. Denn nicht immer hatte die Zeremonie der Abrechnung mit den blutstriemigen Arschbacken ein Ende. Überkam den Unkündbaren das Gefühl, dass »der Gerechtigkeit noch nicht Genüge getan sei« (Spahn war praktizierender Anhänger einer mühelos abrufbaren Selbstgerechtigkeit), dann fuhr er mit dem Tafellappen über den noch heißen Rattanstab und bemerkte trocken: »Tatzen!« Das Wort hatte zwei Bedeutungen: »Hände« oder die nun folgende Bestrafung für sie: »Jetzt gibt es Tatzen!« Kinderarme nach vorne strecken, Hände ebenfalls, Außenseite nach oben.
Und nun wartete der 58-Jährige, bis das Angstzittern der Kinderhände aufhörte (was es nicht tat), verlor aber bald die Geduld und bestrafte das Zittern gleich mit. Und vollzog. Von rechts oben mit Schwung nach unten auf die Fingerknöchel. Dann das flehentliche »Ich bitte um Barmherzigkeit!« genießen. Dann wieder ausholen. Und wieder. Wehe dem Kind, das mit seinen Händen aus der Schusslinie zuckte. Dann kam die Innenseite dran, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Mal. Nach zwanzig Tatzen konnte man stundenlang nicht mehr schreiben. Die Hände jaulten, wie glühende Brennstäbe hingen sie hinterher an den Unterarmen. Mitten im »Gnadenort« Altötting.
Ich erinnere mich noch daran, dass ich die Herabwürdigung der anderen so tief empfunden habe, als wäre ich selbst gerade die Beute von Spahn gewesen. Wieder der Anblick von nackter Gewalt, von hundsgemeiner Verletzung der kindlichen Innenwelt. Und wieder an Gegnern, die keine sein konnten, da haushoch unterlegen. Ich hatte in dieser Zeit einen Maciste-Film gesehen, in dem ein Schweinehund ausgepeitscht wurde. Es ist die einzige Episode, die ich bis heute nicht vergessen habe. Auch nicht den Wunsch, dass ich gern Maciste gewesen wäre, um ein paar Erwachsenen in meinem Kinderleben den Rücken blutig zu schlagen.
25
Jahre später lernte ich den Begriff Spanking kennen, den die deutsche Sprache übernommen hat. Sogleich musste ich an Spahn denken. Die Ähnlichkeit zwischen den beiden Namen ist nicht zu übersehen und – noch absurder – der englische Ausdruck bedeutet nichts anderes als: verprügeln. Nicht genug. Heute wird der Begriff nur noch in einem »erotischen« Zusammenhang verwendet. Für Leute, die sich gegenseitig das Hinterteil versohlen, um die Erregungskurve nach oben zu treiben. Sobald ich das wusste, erschien mir Spahns geradezu manische Sucht, uns arschnackt über einer Bank liegen zu sehen und draufzudreschen, im eindeutigen Licht eines sexuell verdrehten Sadisten. Ach ja, der Mann war regelmäßiger Kirchgänger. Fest im Glauben. Einmal habe ich sein Pult durchsucht. Alles säuberlich aufgereiht. Kreide, Papier, Schulhefte, die Bibel.
Nachforschungen – beim Schreiben dieses Buches – haben ergeben: Johann Korbinian Spahn (7.6.1900–29.4.1979) war nicht nur reputabler Katholik, sondern Parteimitglied der NSDAP, zudem beim NSLB eingetragen, dem Nationalsozialistischen Lehrerbund, dessen Aufgabe primär darin bestand, »die nationalsozialistische Weltanschauung zur Grundlage des Erziehungs-, vor allem des Schulwesens« zu machen. Unter seinem Namen existiert sogar eine Akte »Parteikorrespondenz«.
26
Zweimal die Woche kam der Religionslehrer, Josef Asenkerschbaumer. Nach Tagen verpasste ihm die Klasse das stimmige Pseudonym »Roter Teufel«. Denn ein helles Fleischrot gleißte über sein Gesicht, wenn er ausholte und der »Watschenbaum« fiel. Der Rohling trat als Zorn Gottes auf. Gleich zu Beginn (dienstags), wenn er fragte, ob jeder die Sonntagsmesse besucht hätte. Und mindestens einer dumm genug war, ein »Nein« zu beichten. Immerhin musste sich keiner vor der Züchtigung ausziehen. Die Watschen zischten auch (und an schlechten Tagen schlug er mit Fäusten und Tritten nach uns), wenn sich die Hand eines Drittklässlers (!) zu nahe am Hosenschlitz befand. Das war, so erfuhren wir fassungslos, »eine schwere Sünde«. Der Kaplan hatte wohl laut katholischem Lehrplan die Aufgabe, uns den Abscheu vor dem eigenen Körper einzubläuen. Allem voran den Ekel vor den Geschlechtsteilen. Von der »Unkeuschheit« schien er besessen. Unserer, wenn ich richtig verstanden habe. Das klang in meinen Kinderohren umso abstruser, als ich ein Spätentwickler war, ja, das Wort Unkeuschheit nicht verstehen konnte, da ich dazu – zum Unkeuschsein – physisch nicht in der Lage war. Mein Penis schien zum Pipimachen da. Noch nie war ich lüstern gewesen, noch nie hatte ich mit Begehrlichkeit auf eine Frau geblickt. Zudem war über das Thema zu Hause nie gesprochen worden. Weder Vater noch Mutter hatten mich aufgeklärt. Der »Gottesmann« klärte uns vorbeugend auf. Nicht über die Wunder des Eros, sondern über die Abgründe, in die »unkeusche Lust« die Menschen zu stürzen vermag.
Unauslöschlich bleibt mir der Mann im Gedächtnis, weil er eines Tages etwas tat, was am radikalsten meine Angst vor Frauen und meinen Schrecken vor ihrem Geschlecht genährt hat. Ich behaupte, dass ich den Katholizismus von der Pike auf gelernt habe. Und mich instinktiv vor vielem schützte. Nur da nicht, denn auf verheerend erfolgreiche Weise ging die religiöse Saat der Leibfeindlichkeit, nein, des Leibhasses, des Lusthasses, in mir auf. Wie flüssiges Gift breitete sich die Tat des Asthmatikers in meinem Kopf aus. Und blieb dort, wie Ameisensäure. So lang, so endlos lang unaufhebbar.
Was war geschehen? Das Thema war Eva, die Paradies-Eva, die ja als schönes, hinterhältiges Weib den schuldlosen Adam verführt hatte. Und die beiden deshalb nach dem »Sündenfall« von »Gottvater« in die kalte Welt vertrieben wurden. Das Weib somit für das Elend auf Erden (das Jammertal!) verantwortlich war.
So predigte der Asthmatiker und so kam es bei uns an. Bei mir zumindest. Die Frau als das Böse, das Gefährliche, das furchtbare Übel. Um nun die These von der Unheilsbringerin zu illustrieren, verteilte der Priester eines Morgens an jeden in der Klasse ein handgroßes Bild, auf dem vorne ein gemaltes weibliches Wesen zu erkennen war, »anständig« gekleidet, mit einem durchaus hübschen Gesicht. Nun der Clou: Die Rückseite war wie ein Adventskalender. Zwei Karton-Türchen bildeten den Rücken. Und jetzt forderte uns der Religionslehrer auf, die beiden Flügel zu öffnen. Da passierte es: Im Rücken der Frau wimmelte es von Würmern, Schlangen und Spinnen. Der ganze Leib war randvoll mit Tieren, die nichts als Grauen auslösten. Und damit wir auch alle die Botschaft verstanden und keiner auf die Idee kam, es handele sich um einen Scherz, sprach der Erziehungsberechtigte zu uns Neunjährigen: »Seht nur, Kinder, was dahinter steckt!« Hinter der Fassade der Frau, hinter dem Lächeln: das Tückische, das Versaute, das Unglück des Mannes.
Ende der Leseprobe