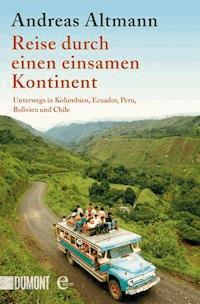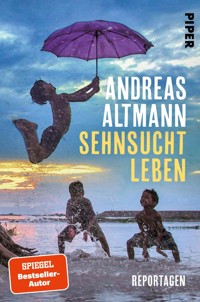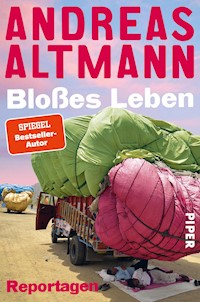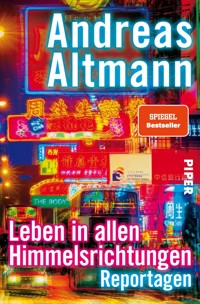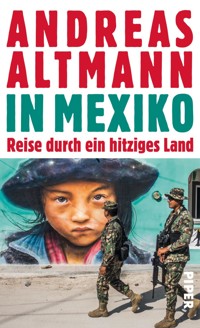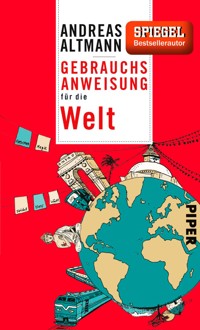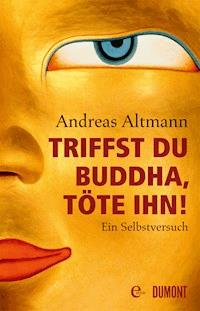8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Wenn es einen deutschen Reiseschriftsteller vom Kaliber eines Bruce Chatwin gibt, dann ist dies Andreas Altmann." DIE WELT Andreas Altmann startet in Sydney und kommt nach drei Monaten dort wieder an. Mit 25 000 Kilometern in den Beinen und einem Ranzen voller Storys von Männern und Frauen, die er unterwegs getroffen hat. Er hört Geschichten, die erstaunlich viel über das Leben auf dem fünften Kontinent verraten. Er begegnet Erin, der 18-jährigen Amazone, die mit elf per Motorrad von Zuhause abhaute. Er findet Jeffrey, den Aborigine, der fünf Milliarden Dollar erben könnte, aber nicht will. Und er zieht mit Fred Brophy und seinen kriminellen Preisboxern durch das Outback. Drei von dreihundert Begegnungen. Einmal mehr erweist sich Andreas Altmann als begnadeter Augenöffner, der nicht aus sicherer Distanz agiert, sondern sich aussetzt: mal intensiv und hitzig, dann wieder ehrfürchtig und einfühlsam. Wer dieses Buch liest, kehrt klüger, glücklicher und leicht benommen nach Europa zurück, das Herz und den Kopf voller Bilder und Unglaublichkeiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Andreas Altmann
IM LAND DER
REGENBOGENSCHLANGE
Unterwegs in Australien
Für Domi, die Blume
Für Günther, von deinem Schuldner und Freund
eBook 2010
© 2008 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Zero, München
Satz: Fagott, Ffm
ISBN eBook: 978-3-8321-8507-7
ISBN App: 978-3-8321-8526-8
www.dumont-buchverlag.de
Was bleibt mir an Wünschen?
Die Ferne.
Die Nähe.
Ko Un
Ein Buch ist verfehlt,
welches den Leser unversehrt lässt.
André Gide
VORWORT
Dieses Buch ist wie jedes meiner Bücher ein Minority Report, ein Bericht für die Minderheit. Es soll jenen gehören, die Reisen (und Leben) als einen Zustand begreifen, der einmalig ist. Der ihnen Gefühle zumutet, die anstrengen und – wenn gemeistert – reich machen. Reicher allemal, im Kopf, im Herz, tief im Bauch. Die 319 Seiten sind, auch das ist geblieben, ein vehementes Ja-Wort an die Welt, diesmal an die australische Welt. An ihre Wunder, an ihre wunderlichen Schrecken, ihre Schönheit, ja an all die Möglichkeiten, die sie vor uns ausbreitet. Damit wir etwas über den Kontinent und seine Bewohner erfahren, ihre Geschichten. Und über uns. So wie wir sind. Reisen als Offenbarungseid. Auch das.
Nicht geschrieben wurde das Buch für die Tranigen, die Luxusgeschöpfe, die Glotzer, die Virtuellen, die Langschläfer und alle anderen, die sich vorgenommen haben, der Welt und der Wirklichkeit aus dem Weg zu gehen. Sie werden sich hüten, es aufzuschlagen. Jeder Absatz würde sie daran erinnern, wie sterbensfad sie sich inzwischen in ihrem Alltag, ihrer Allnacht eingerichtet haben. Dösend. Nie plagt sie erhöhte Temperatur. Die Lauwarmen sind immer lau.
Was das Buch nicht ist, nimmer: Ein Reiseführer, mit keiner Zeile werde ich jemanden »führen«. Es ist ein Tagebuch, ein Fahrtenschreiber, ein Notizheft, in dem jeden Tag Australien und die Australier auftauchen. Und dazwischen melden sich eigene Gedanken zu Wort, Nebengedanken, Seitenhiebe, Widersprüche, Einsichten, Zweifel, Bewunderung, Wutsplitter, Einsamkeit, Lachanfälle, wieder Bewunderung, wieder Zweifel, wieder Lachen.
Natürlich taugt Im Land der Regenbogenschlange auch als Kriegserklärung an die Grauen Herren, jene umtriebigen Hanswurste, die sich vorgenommen haben, die Welt, die Weltbewohner, ihre Träume und ihr Verlangen nach Freiheit und Sinn zu demontieren. Jene Global Criminals, die uns in verschiedenen Kostümierungen begegnen. Mal als kriegslüsterne Politiker, die im Namen des Friedens morden, morden lassen. Mal als geifernde Hochwürden und Muftis, die uns mit ihren gräulichen Göttern in Atem halten. Mal als Natur abfackelnde Businessmen, die uns ihre höllischen Reden vom Wachstum um die Ohren hauen. Auch ihnen begegnet man in Australien. Wie den weißen Hassern, die sich noch immer der Herrenrasse zugehörig fühlen und bis heute nicht willens sind, den Aborigines – immerhin die ersten Australier – ohne Anmaßung zu begegnen.
Die Reise über diesen riesigen Erdteil ist kein Ausflug für Zartlinge. Selbst als Leser wird man sich Schrammen und Flecken holen. Doch das wäre durchaus im Sinne des Verfassers. Hat er doch sein »Herz ausgeschüttet«, sein Australien. Und dessen Glanzpunkte und Geheimnisse, dessen Gemeinheiten, Wunden und Niederlagen. Und je inniger die Sprache den anderen berührt, desto inniger die Freude. Bei beiden. Dem Leser einen dicken Brief schreiben, ein Buch eben, das scheint bis zum heutigen Tag das probateste Mittel, um uns von der Welt und dem Staunen über sie zu erzählen.
Wer von Europa nach Australien fliegt, verliert einen Tag seines Lebens. 10 000 Meter über Asien verschwindet er, der Tag. Die Zeitverschiebung hat Schuld. Ein Zwilling, der in Sydney ankommt, ist älter als sein in Paris gebliebener Bruder. Absurd, aber wahr. Es gibt aber noch andere Gründe, um unnötig schnell auf dem Weg dorthin zu altern. Ich blättere im Heft, in dem das Unterhaltungsprogramm für den Flug steht. Grell wird der neue Film von Bruce Willis vorgestellt, Die hard 0.4 – A new breed of violence. Die Welt darf sich freuen. Hat sie doch die Schnauze voll von alter, althergebrachter Gewalt. Mister Willis und seine Mittäter haben sich für uns was Neues ausgedacht: brandneue Gewalttätigkeiten, um mit ihr (und uns) fertig zu werden. Der letzte Satz in der Ankündigung, der letzte von Bruce: »I kill you all«.
Neben dem Flachkopf steht ein Bericht über Elle Macpherson. Das Ex-Modell ist tatsächlich bemerkenswert attraktiv. Auf das »Geheimnis ihrer Schönheit und Harmonie« angesprochen, meint die heute 44-Jährige, die einst als The Body berühmt wurde: »Viel Wasser trinken und viel schlafen.« Das muss ein wildes Leben sein, nach dem vielen Schlafen kommt das viele Wassertrinken. Und doch, irgendwie beneidet man die Australierin. Wie man immer Zeitgenossen beneidet, die mit ein paar wenigen Gedanken über die Runden kommen. Was hat die Menschheit nicht alles unternommen, um Schönheit, innen und außen, zu finden. Dabei wäre alles so einfach, ein Bett und ein Wasserhahn genügten.
Dennoch, das wird ein angenehmer Flug. Herr Abed sitzt neben mir. Ein Arzt aus Malaysia, der sich in Frankreich verliebt hat, dort ein Sommerhäuschen besitzt und eines Tages, mitten in einem Wutanfall, innehielt und sich fragte: »Was tue ich gerade?« Seitdem erregt er sich nur noch »innerlich«, sagt sich gefasst: »I walk away«. Er geht weg, entfernt sich vom Ärger, lässt ihn stehen. »Wie einen keifenden Patienten.« Zwölf Stunden lang schiele ich immer wieder auf einen Mann, der sich vorgenommen hat, anders mit seinem und anderer Leute Leben umzugehen. Er zieht keine Pumpgun, keinen Dolch, er zieht Leine, will immer elegant bleiben. Die Wut soll verpuffen, nicht explodieren.
Zwischenstopp am Flughafen von Kuala Lumpur. Suche nach einem Ort, wo man (noch) rauchen darf. Den es tatsächlich gibt, die Smoking Lounge. Tische, Stühle, zwei Getränkeautomaten, sogar eine Entlüftung funktioniert. Hier wirtschaftet kein sadistischer Flughafenchef, der einen Raum zur Verfügung stellt, den man mit ein paar Handgriffen zur Gaskammer hochrüsten könnte. Die Bude ist voll, alle scheinen gut gelaunt, eine Insel der Seligen, auf der munter kommuniziert wird. Kein Kommunikationsmittel verdammt uns zum Schweigen. Man denkt sogleich an die Go-West-Werbung. Die muskulöse Tattoo-Frau spricht mit der malayischen Stewardess in ihrem hübschen Kebaya. Chinesen, Inder, Bangladeshi, Gutbetuchte, 18-Jährige mit Rucksäcken, Klomänner, Klofrauen, Saudis, Schwarze, kleine Leute, große Leute, schöne Paare, ex-schöne Paare, Rolexträger und Sandalen-Jünger, Piloten in schicken Uniformen und Handelsvertreter mit schweren Aktenkoffern, sie reden, sie hören zu. Eine betagte Muslimin mit Kopftuch zieht lässig eine Marlboro-Schachtel aus ihrem Umhang, inhaliert, diskutiert, vergisst bisweilen die Zigarette im rechten Mundwinkel. Alles an ihr wirkt mondän, unkriegerisch, religionsfern, ganz offensichtlich predigt sie keinen heiligen Krieg, sondern bekennt sich öffentlich zur Sünde.
Wir kommen gut miteinander aus, das Gefühl der Zusammengehörigkeit verbindet, wie Aufsässige und Dissidenten dürfen wir uns fühlen. Ist uns doch allen bewusst, dass wir seit einiger Zeit die einzige Rasse sind, die täglich und weltweit verfolgt wird. Immerhin haben wir für Momente einen Ort gefunden, wo wir von den schrillen Aufrufen der Fitness-Ayatollahs verschont bleiben. Rauchen ist ungesund, aber ja doch – und entspannt, verführt zu einem Lächeln. Umso mehr, wenn der Blick durch die Glasscheibe fällt, vor der die kugelrunden Nichtraucher vorbeischnaufen, gewiss heimlich von einer radikalen Entschlackung träumend.
Mir fällt das Wort »Fickbomber« ein, das ich von einem Lufthansa-Kapitän gelernt habe. Jene Flugzeuge, in denen überwiegend Männer sitzen, die auf der Suche nach Sex nach Mombasa oder Phuket oder Manila jetten. Bald haben wir die »Smokebomber«. Damit dürfen wir Raucher auf eine Insel fliegen, wo sich ein rebellischer Häuptling entschlossen hat, uns für die Dauer von ein paar Schachteln Nikotin Asyl zu gewähren.
Nochmals sieben Stunden Flug, diesmal neben einem leutseligen Australier, der als Ingenieur in Malaysia arbeitet und beiläufig erzählt – der Essensservice wird gerade wegen starker Turbulenzen abgebrochen –, wie er kürzlich die Leiche seines Freundes identifizieren musste, der bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam. Eine Leiche, der zwei Beine fehlten.
Das wird sich noch oft bestätigen. Aussis haben eine Begabung zu schwarzem Humor, kaltblütig reden sie von der Wirklichkeit. Jack ist der erste Australier, den ich auf dieser Reise treffe. Und er ist freundlich und hilfsbereit (nach dem Schauermärchen lädt er mich zu einem Martini ein). Schöne Vorurteile, denen selten einer widerspricht. Denn ein Fremder braucht den Beistand des Ansässigen. Wie ein Spurenelement führt er ihn durch die Fremde.
Spätabends Ankunft in Sydney, »Welcome« steht in dem Zug, der in die Stadt fährt. Der Wind faucht, hier haben sie Winter, es regnet, die letzten Meter auf der George Street führen an Kneipen und Shops mit Adult books vorbei. Ich werfe mein Gepäck im Hotel ab und finde ein Café mit überdachter Terrasse. The Australian liegt herum, die größte Zeitung des Kontinents.
Auf der ersten Seite das Foto eines indischen Arztes, eines Moslems, der in Brisbane arbeitete, und verdächtigt wird, an den (gescheiterten) Attentaten in Großbritannien beteiligt gewesen zu sein. Und ein (größeres) Foto vom berühmtesten Bimbo-Paar, das sich die westliche Welt zurzeit leistet, David Beckham mit Frau, Ex-Spicegirl Victoria B. Ausführlich werden wir auf Seite eins darüber informiert, wie viel Geld die beiden an wie vielen Orten scheffeln. Er ist bereits zu Los Angeles Galaxy gewechselt, sie droht der Menschheit mit einer eigenen TV-Show. Der Artikel endet mit der nervenzerreißenden Frage an das australische Volk, ob die beiden zu einem Abstecher hierherkommen oder nicht.
Die Franzosen nennen dieses rasant boomende Phänomen »peopolisation«: Nicht unser Planet und seine Bewohner sollen uns interessieren, sondern »people«, jene magersüchtigen Idiotinnen und gelverklebten Hohlköpfe, die uns mit ihren Sottisen in Atem halten.
Das ist eine lehrreiche Zeitungslektüre, todernst gemeint. Sie lehrt uns etwas über Globalisierung, übers Reisen. Wo immer man ankommt, zwei Sorten von Erdenbürgern sind schon da: die Bombenleger und die »simple minds«, kein Winkel entgeht ihnen. Wer wüsste noch ein Versteck, um ihnen zu entkommen. Meist die gleichen Visagen und gleichen Sprüche. Die einen versprechen uns den Tod, die anderen den Hirntod.
Der Beginn dieser Reise erinnert mich an eine Szene aus der Kindheit, als ich neben einem zockelnden Güterzug herlief und aufzuspringen versuchte. Es dauerte, bis ich den Tritt fand, den Mut, den rechten Augenblick. Australien kenne ich nur flüchtig, ich habe noch keine Ahnung, wie mit ihm umgehen. Aber ich spüre, dass ich hier – wie seltsam, gleicht es doch in vielem Europa – länger brauchen werde als auf unvertrauteren Erdteilen.
Nächster Morgen. Frühstück direkt neben dem Hotel, ein Türke ist der Boss des Fast-Food-Ladens. Ich stelle mich vor Mister Cenel auf und deklamiere ein Gedicht von Nazim Hikmet, dem Gott, dem Liebling, dem Nationaldichter aller Türken. Der Alte traut seinen Ohren nicht, 15 000 Kilometer von Anatolien entfernt hört er eine Strophe aus seiner Heimat (sie ist kurz und die einzige, die ich auswendig weiß):
Leben
einzeln und frei
wie ein Baum
und brüderlich
wie ein Wald
ist unsere Sehnsucht
Hinterher habe ich einen Kumpel in Sydney, ab sofort kommt der Kaffee umsonst zu den Spiegeleiern. Ich genieße die kleinen Siege der Poesie. Nie wird sie Berge versetzen, aber mit nichts als ein paar Worten Nähe und Wärme zwischen zwei Wildfremden zaubern. Das schon.
Jeder Reisende kennt das Gefühl. Man betritt eine Stadt und mag sie. Oder nicht. Ich bin das dritte Mal hier und bin noch immer nicht begeistert. Zu brav, zu schön, zu geschleckt. Es ist, als ginge man mit einer verdammt gut aussehenden Frau aus, die immer nur verdammt gut aussieht. Und irgendwann, ziemlich bald, kann man den Wunsch nicht mehr unterdrücken, sich nach einer anderen Frau zu sehnen. Bei der sich nicht jeder umdreht. Aber die mit jedem Satz, den sie ausspricht, verlockender wird. Weil Tiefe und Weltwissen begehrenswerter machen als eine Oberfläche, die kein Geheimnis birgt.
Die Presse heizt gerade die Stimmung für das hiesige Opernhaus an, es soll, nein, es muss auf die Liste der »sieben neuen Weltwunder«. Ach, ich weiß nicht, ich würde Cate Blanchett vorschlagen, sie ist eine australische Sensation an Schönheit und Talent und, das auch noch, klugen Gedanken.
Das Problem mit der größten Stadt Australiens und ihren über vier Millionen Einwohnern ist die Abwesenheit von Aufregung. Nirgends ein Spinner. Ein Großteil der Sydneysider eilt morgens mit einem Pappbecher Starbucks-Kaffee Richtung Subway und abends nach Hause, diesmal mit Shoppingtüten beladen. In einem im Flugzeug gelesenen Reisebericht über die laut Bürgermeister »schönste Stadt der Welt« klapperte der Autor die typischen Klischees ab, die Harbour Bridge, den Blick auf den Hafen, die Skyline, das Lichtermeer. Bis er, wohl unbewusst, ahnte, dass wir Leser bereits den Zustand gereizter Dösigkeit erreicht haben und er, der Schreiber, ganz plötzlich von zwei Hunden gejagt wurde. Welch Glück, denn die Jagd und die Flucht weckten wieder auf, endlich erfuhr man etwas, worauf man nicht gefasst war. Ich finde, Leser und Reisende haben ein Recht auf Überraschungen.
Außer zwei talentlosen Bettlern und einem begabten Stepper, vor dem keiner zum Bewundern stehen bleibt, habe ich kein streetlife entdeckt. Kein Marabu wandert die Bürgersteige entlang und verspricht, die Zukunft zu kennen, keiner verteilt die Visitenkarte eines SM-Clubs, kein Wunderheiler, der das Wunder Glück in Aussicht stellt, kein Scharlatan, der behauptet, mit bloßen Fingern zu operieren, kein Feuerschlucker, kein Clown, nur blasse, wohl vom Hungerlohn ausgemergelte Männchen, die Waschzettel verteilen, auf denen gewaltige Steaks abgebildet sind, die man ein Eck weiter aufessen kann. »Eat as much as you can.« Nun, man wird bald gewahr, dass die australischen Männer, Frauen und Kinder sich mehr Steaks einverleiben, als ihren Körpern guttut. Ganz dem Vorbild Amerika verpflichtet, wird XXX-Superlarge zur Norm. »Fat is beautiful«, steht auf einer Abortwand. Der Satz ist gewöhnungsbedürftig.
Am dritten Abend läuft mir in der Pitt Street ein Straßenprediger über den Weg. Immerhin. Auf seiner Brust hängt ein Schild, das uns allen heimleuchten soll: »You are a sinner and you have god's word on it.« Auch das ein alter Hut. Der liebe Gott ist der liebe Gott und wir sind die Sünder. Nachrichten, die offensichtlich niemand mehr redigiert. Bis zum Jüngsten Tag nicht.
Ich wandere zum Kings Cross, jenem Viertel, das während des Vietnamkriegs (an dem australische Soldaten teilnahmen) zum vice center, zum Sündenpfuhl des Landes avancierte. An den Häuserwänden lungern noch immer die zum Frevel bereiten Damen. Noch betagter als bei meinem letzten Besuch, noch verbogener die Beine vom vielen Stehen am selben Ort. Und noch immer kein barmherziges Stadtoberhaupt in Sicht, das die Dienstältesten diskret ins Seniorenheim abschiebt.
Ich bin gekommen, weil heute ein Artikel über einen injecting room in der Zeitung stand, ein witziger Artikel. Denn in diesen Räumen dürfen sich Junkies offiziell Heroin spritzen, dürfen sich die (saubere) Nadel überall reindrücken, nur nicht in den Nacken. Und jetzt der kleine Wahn, so steht er auf einem Schild: »Rauchen strikt verboten«, noch lustiger, »aus gesundheitlichen Gründen«. Ich trete ein, will zuschauen. Ja, das geht, aber erst morgen Abend. Ich melde mich an.
Sydney holt auf, die Sonne scheint und ich setze mich direkt vor sie. Und der Kaffee kommt. Und jetzt in den Himmel blinzeln, einen Zigarillo anzünden, lesen und mich mittendrin an den Satz aus dem Film Bonnie & Clyde erinnern, in dem Faye, die Gangsterbraut, zu Warren, dem Gangster, sagt: »Ain't life great?« Aber ja doch.
Selbst dann noch, als ich Babs kennenlerne, nicht näher, aber nah genug, um zu wünschen, ihr nie begegnet zu sein. Denn die Bedienung straft jeden Kunden, der zahlt, mit dem Satz: »It's a fabulous day, isn't it?«, nicht genug, sie schleudert dem Armen noch ein »have a gorgeous afternoon« hinterher. Dass sie die beiden Sätze vor jedem wiederholt, ist nicht die Strafe, natürlich nicht. Was alle Anwesenden zusammenzucken lässt, ist die quietschende Tonlage, mit der die Wörter durch den Raum fahren. Wie Reifen bei einer Vollbremsung, wie Hamster unter Folter. Die Amerikaner sollten die Unerbittliche für Guantánamo rekrutieren. Nach einer halben Stunde mit Babs im selben Zimmer ist man zu jedem Geständnis bereit.
Ich bin inzwischen ein gewiefter Reisender geworden. Aus Europa habe ich spezielle Lärmschützer mitgebracht. Kein popeliges Ohropax, sondern Silikon, das vom Optiker in die Ohrmuschel gespritzt wird, um eine Art Verschluss herzustellen, der sich genau der individuellen Form anpasst. Die zwei federleichten Plastikteile sitzen wie Korken. Der Preis: neunzig Euro, der Wert: pyramidal. Tonnen von Blabla kommen nicht mehr an, selbst Babs' Peitschenhiebe schrumpfen zu einem fernen Rauschen.
Die Freude nimmt noch zu, als ich im Sydney Morning Herald lese, dass vorletzte Nacht Feuer in einem hiesigen Bordell ausbrach und über 100 (hundert!) Kunden von der Feuerwehr evakuiert werden mussten. Eine solche Meldung ehrt die Stadt. Viel mehr als, sagen wir, die Nachricht von hundert Shoppern, die mitten beim Einpacken von Ralph-Lauren-Handtüchern von Rauchwolken überrascht wurden und sich über den Notausgang ins Freie retten konnten.
Neben dem Hyde Park liegen die Hyde Park Barracks, mitten in der Stadt. Wer etwas lernen will über die Geschichte Australiens, der muss hierher, in dieses Museum. Eine wilde, drastische Geschichte, denn das Land begann – für die Weißen – als Zuchthaus. 1788 trafen auf der Terra australis die ersten 750 Kriminellen ein. Per Schiff aus London. Weil Englands Zuchthäuser platzten, vor Enge, vor Bitternis. Seuchen und Aufstände wüteten. Im Themse-Delta vegetierten Heerscharen Zwielichtiger in abgewrackten Schiffen, notdürftig umfunktioniert zu schwimmenden Kerkern. Die Hauptstadt galt als »Hauptstadt der Galgen«, zeitweise trugen Henker, Schnellrichter und Gesellen einen tragbaren Balken mit Strick durch die Straßen. Um Frischertappten standrechtlich das Genick zu brechen. So blieb nur Australien, um mit der Raumnot fertig zu werden. Andere Optionen waren inzwischen ausgefallen. Die amerikanische Kolonie hatte sich für unabhängig erklärt und ein Gefangenentransport nach Afrika war gescheitert.
Die Aussichten schienen deprimierend. Es liegen Berichte von Männern und Frauen vor, die sich lieber aufhängen ließen, als in eine Gegend verschleppt zu werden, die so unvorstellbar weit entfernt lag. Acht Monate Überfahrt, Meutereien, Epidemien, die verlauste Enge, plus sieben Jahre Verbannung für das heimliche Mitnehmen von zwei Laib Brot. Einmal Australien und nie mehr zurück für den Diebstahl von mehr als »five shilling«. Es gab Erfreulicheres, als Ende des 18. Jahrhunderts ein (armer) Untertan von George III. zu sein.
Knapp zwanzig Jahre zuvor hatte James Cook das »südliche Land« betreten und für die englische Krone requiriert. Unter dem Vorwand, dass es sich um jene ominöse Terra nullius handelte, um ein Gebiet, das keinem gehört. Diese (bewusst) falsche Behauptung sollte für unglaubliches Leid sorgen. Denn die 7 700 000 Quadratkilometer wurden längst von den Aborigines bewohnt, jenen eben, die »ab origine« (lateinisch: seit Ursprung) hier leben. Zumindest seit etwa 50 000 Jahren.
Cook ist ihnen begegnet, er wusste von ihrer Anwesenheit. Die folgende Anekdote erzählt von einer der ersten Begegnungen zwischen den Fremden und »the natives«: Mittels eindeutiger Handbewegungen fragten die Schwarzen nach dem Geschlecht der Engländer, die bartlos waren und folglich nur weiblich sein konnten. Als einer der Engländer die Hose herunterließ, provozierte er ein erstauntes Raunen. Rasiert und doch Mann, welch Überraschung. So wandten die »primitives« den Kopf zur Seite und deuteten auf ihre Frauen, die ebenfalls splitternackt in der Nähe standen. Deuteten, als wollten sie sagen: »Help yourself!«
Was für ein Akt von Großmut. (Auch nicht die feinste Art, aber die Angebotenen schienen ganz einverstanden.) Männer mit Frauen teilen mit Männern ohne Frauen. Aber der weiße Mann kann nicht teilen. So wird er die Frauen vergewaltigen, die Männer töten, das Land rauben. Seit 220 Jahren wollen die einen herrschen und die anderen nicht beherrscht werden. Die monatelange Reise wird zeigen, dass diese Ursünde noch immer wie eine Wunde das Land überzieht.
Natürlich fragt sich ein Außenstehender, ob er je die Zusammenhänge des Dramas begreifen wird. So widersprüchlich, verwirrend scheinen sie. Was er sofort begreift, ist die ironische Interpretation des Zeichens BC, das die angelsächsische Welt mit Before Christ übersetzt, die Aborigines aber mit Before Cook, sprich, bevor das Unglück seinen Lauf nahm.
Anfang des 19. Jahrhunderts wurden die Hyde Park Barracks errichtet. Um die convicts nachts unterzubringen, bis zu 1400 Männer. Später wurde es zu einem Asyl umgebaut, um alleinstehende »Frauenzimmer« zu schützen. Dann als Krankenhaus verwendet, als Irrenhaus, als Bürohaus, zuletzt in ein Museum verwandelt. Das fein restaurierte Gebäude ist Zeuge intensiven Lebens.
Mit der ersten Ladung kamen auch 300 Soldaten. Meist Landsknechte und rohes Gesindel, die Grenzen waren fließend, die Wächter nicht menschlicher als die 750 Bewachten, auf die sie routinemäßig einprügelten. Laut Schiffspapieren befanden sich auch »ideots and lunaticks« (sic!) unter den Passagieren, Idioten und Irre, plus Syphilitiker. Die Expedition war eine passende Gelegenheit, um unliebsame Subjekte auf lebenslänglich zu expedieren.
Das unergründliche Menschenherz. Als die Australier, die weißen Australier, 1988 die zweihundert Jahre ihrer Ankunft feierten, war ich zum ersten Mal in Sydney. Für eine Reportage über den fantasievoll inszenierten Rausch. Während der wochenlangen Geburtstagsparty lief ich dem 80-jährigen Len über den Weg. Er erzählte, dass seine Landsleute immer beleidigt waren, wenn ihnen andere ihre »mörderische Vergangenheit« vorwarfen. Bis sie erkannten, dass das brave Leben ungenießbarer war als das unanständige. Und anfingen, mit Emsigkeit nach einem Bösen im Stammbaum zu suchen, einem Verwegenen. Deshalb gehörte Len zu den vielen Verzweifelten, die seit Monaten Bibliotheken und Geburtsregister der Pfarreien durchstöberten, mit Vergrößerungsgläsern vor Mikrofilmen saßen, lange Briefe an die British Library in London schrieben, ja, einen professionellen Genealogen anheuerten, um endlich – very funny – erleichtert auszurufen: »I've got at least one convict in my family«, immerhin ein Sträfling in der Familie.
Ein solches Geständnis brachte Ansehen. Somit war der Nachweis angetreten, dass man zu den Allerersten gehörte und die Wurzeln bis nach Great (groß!) Britain zurückreichten. Und wäre der Urvater ein Lustmörder, Sodomit oder Taschendieb gewesen. Sie alle, Len und die anderen Hunderttausend, müssen wohl irgendwann den Satz von Billy Wilder gehört haben: »Tugend ist nicht fotogen, das ist eine Grundregel. Bösewichte interessieren jeden, Volksschullehrer-Fräuleins niemanden.« Deshalb auch die herbe Enttäuschung, wenn kein Halunke zum Vorschein kam, nur sechs, sieben Generationen Biedermänner und Biederfrauen.
Ein Gang durch die Barracks kann nur eine Ahnung vermitteln von dem, was die 1050 Männer und (wenigen) Frauen erwartete: Ein unbrauchbares Land, der steinharte Boden, die gigantischen (unfällbaren) Eukalyptusbäume, die gemeine Sommerglut, die Bisse fetter Ameisen, der Mangel an Nahrung, der Mangel an Sex, die trostlose Zukunft. Und von der Stunde Null an der Kampf mit den »Eingeborenen«, die nicht europäisch, nicht englisch zivilisiert werden wollten. Zwei Welten gerieten aneinander. Jene, die Natur erobert und plündert, und jene, die immer nur zeitweiser Gast sein will, die nehmen kann, ohne zu ruinieren. Eine Welt, in deren Sprachen kein Wort für Besitz existierte.
Faszinierender Geschichtsunterricht findet auf den drei Stockwerken statt. Nachrichten aus der Schreckenskammer Australien. Über einen gewissen Thomas Haynes kann man nachlesen, dass er sich weigerte, das verabreichte Gefängnisbrot zu essen. Er ruft zum Brotstreik auf, der Direktor lässt es prüfen, es wird als »good and wholesome«, als gut und gesund, befunden, ergo: fünfzig Peitschenhiebe für den Aufrührer. Die Herren Dignum und Hughes kauften ihren Kollegen die Gefängniskleidung ab. Um sie auf dem Schwarzmarkt zu verschleudern. Das machte acht Tage Einzelhaft, 15 Shilling Bußgeld und 15 Tage Tretmühle. Jene Vorrichtung, die gerade in England erfunden worden war: Mit vier Eisen an Armen und Beinen behängt auf Sprossen steigen und lostreten. Vollkommen nutzlos, vollkommen sinnlos. Wäre nicht der Sinn, dem Mann (oder der Frau) den Stumpfsinn des Daseins einzubläuen. Und am Ende mit gerissenen Achillesfersen und blutigen Händen vom Marterpfahl steigen.
Ein Inhaftierter beschreibt die Szene seiner Auspeitschung. Es gab einen Weg, um die hundert Hiebe abzumildern. Der Peitscher fragt sein Opfer diskret:
– Is there any hangings to it? (Irgendwas für mich drin?)
– Yes.
– All right.
Und dann – nun versichert, dass er später dafür belohnt wird – holt der Hiwi aus. Nur barbarisch, nicht extrem barbarisch.
Wie zu allen Zeiten führte die physische Nähe von Männern (und die Ferne der wenigen Frauen) zu homosexuellen Vermengungen. Damals ein Verbrechen von »abscheulicher Natur«. Am 8. Februar 1812 erwischt es Thomas B. und William B., sie werden zu körperlicher Züchtigung und zu drei Jahren Lager in weit entlegene, noch unwirtlichere Landstriche verurteilt, mit noch mehr Arbeit, noch weniger Frauen. Und zu einer Stunde am Pranger stehen, wobei »die Entrüstung der Bevölkerung derart groß war, dass die Polizei einschreiten musste, um das Werfen von Steinen und anderen harten Gegenständen an die Köpfe der Kriminellen zu unterbinden.« Irgendein Besucher vor mir muss den Zettel hinterlassen haben, der jetzt neben der Vitrine liegt. Ein Akademiker, denn auf lateinisch steht da: »Vox populi, vox bovis«, Volkes Stimme, Rindviehs Stimme. Man verbietet sich sogleich, den Satz klug zu finden. Es gelingt nicht.
Die Strafaktionen gegen Frauen waren eine Spur weniger brachial. Die Autoritäten fanden bald heraus, dass das Abschneiden der Haare, sprich, der Verlust von Schönheit, zu den härtesten Erniedrigungen zählte. Schlimmer als Tabakentzug, Essensentzug, Einzelzelle oder »Steine brechen«.
Erstaunlicherweise wurde die Strafkolonie im Mutterland bald verklärt, zum »land of milk and honey«. Eingedenk dessen, dass England Mitte des 19. Jahrhunderts ein Alptraum gewesen sein muss, klingt die Sehnsucht verständlich. Da das Zahlenverhältnis Mann/Frau in Australien noch immer 6 zu 1 betrug, waren fernwehlustige Damen hochwillkommen. Es gab jedoch Bedingungen: zwischen 18 und 35 Jahre, ein Gesundheitsattest und die Beglaubigung eines »moral character«.
Achtzig Jahre lang, bis 1868, wurden etwa 150 000 Schwerverbrecher und glücklose Pechvögel verschifft. Unter ihnen auch der (einzig nachweisbare) Deutsche, ein gewisser Gustavus Hallenburg, den es in frühester Jugend nach London verschlagen hatte und der als Halbwüchsiger beim Klauen einer Uhr gefasst worden war. O.k., sieben Jahre Deportation. In seinen Unterlagen steht »readis« (sic!), er kann lesen. Er wird wegen einer ganz undeutschen Eigenschaft – »idleness«, Trägheit – am 4. November 1846 ausgepeitscht, 24 Streiche mit dem Lederriemen. Einmal bekommt er zehn Tage lang »bread and water«. Und nach genau sieben Jahren sein »Certificate of Freedom«, die Nummer 44/216 weist ihn als freien Mann aus. Er kehrt zurück nach England, wo sich seine Spur verliert.
Zwei Minuten, nachdem ich das Museum verlassen habe, sehe ich wieder einen Bürger dieser Stadt, wie er mit moderner Gerätschaft das Trottoir fegt. Auf dass keine Baumnadel und kein Grashalm den nackten Asphalt entstelle. Sofort will man ein convict gewesen sein. Um nie so zu enden: Mit dem Staubsauger in der Hand auf der Jagd nach Grünzeug. Der Blick auf den vielleicht 30-Jährigen lehrt, dass selbst ein Galgenvogel im Stammbaum kein überschwängliches Leben garantiert.
Beim Abendessen in Chinatown sitzt mir Greg gegenüber, ein Obdachloser. Ich will ihn ködern, er soll eine Geschichte erzählen. Aber er beißt nicht an. Immerhin kommt ein kurzer Satz, als ich meinen Besuch in den Barracks erwähne und ihn frage, wie er als Weißer zu den Aborigines steht. Meist reden Penner wie Populisten, scharf rechts, immer nach Sündenböcken für die eigene Misere Ausschau haltend. Nicht Greg, trocken meint er: »We are staying on their fucking land.«
Heitere Abendlektüre, in der Zeitung zwei erstaunliche Meldungen. Der Bürgermeister von Paris ließ Merkblätter verteilen, um die Einwohner zu mehr Freundlichkeit den Besuchern der Stadt gegenüber zu bewegen. Inzwischen sei nämlich das Japan-Syndrom ausgebrochen. Jene Nervenkrise, an der Japaner und Japanerinnen erkranken, die so erschüttert über das flegelhafte Benehmen der Pariser sind, dass sie sich in ärztliche Behandlung begeben, in Härtefällen den Rückflug antreten. In Sydney würde ihnen das nicht passieren. Sogar Greg, der Abgerissene, fragt, als ich auf den Stadtplan blicke: »You need help?«
Die zweite Notiz betrifft eine TV-Journalistin, die sich weigerte, eine Nachricht über Paris Hilton vorzulesen. Sicher Miss Hiltons Nachdenklichkeiten über gelb getupfte Büstenhalter, die sie gestern bei Bloomingdale's gesichtet hat. Es sollte die erste Meldung der Evening News sein. »Das war keiner Nachricht wert«, wird die Reporterin hinterher erklären. Die Mutige soll hochleben. Eine, die noch spürt, eine, die noch unterscheiden kann zwischen dringlich und Schwachsinn.
Ich weiß nicht, ob die Erinnerung an P. Hilton mich dazu bewegt hat, noch bei Dymocks vorbeizuschauen, einem der großen Buchläden im Land. Groucho Marx bemerkte einmal: »Ich finde Fernsehen sehr erzieherisch. Wo immer es läuft, gehe ich ins Zimmer nebenan und lese ein Buch.« Könnte es sein, dass die kalifornische Tussi ähnlich pädagogisch wirkt? Durchaus. Wie Hunger zum Essen treibt, so treibt (geistige) Dürre an einen Ort, an dem man Frauen und Männer trifft, die einen mit allem beschenken. Mit allen Gedanken, mit aller Welt, mit allem, was je auf ihr stattfand. Ich sitze am Boden zwischen zwei Bücherregalen und finde einen Absatz von Thomas Nash, einem aufmüpfigen Dichter, immer pleite, immer auf der Flucht vor denen, gegen die er rebellierte. Vor über 400 Jahren schrieb der Engländer ein paar Zeilen übers Unterwegssein, die damals nicht mehr stimmten als heute: »Wenn einer reisen will, so muss er den Buckel eines Esels haben, um alles zu ertragen. Den Schwanz eines Hundes, um jeden damit zu trösten. Die Schnauze eines Schweins, um alles Angebotene zu schlucken. Das Ohr eines Händlers, um allen widerspruchslos zuzuhören.«
Am nächsten Morgen zum Bondi Beach, vielleicht der dritt- oder viertberühmteste Strand im Universum. Auf dem langen Weg komme ich an einem Laden vorbei, über dem steht: »Jews for Jesus.« Ich gehe hinein und frage nach dem Sinn des Satzes. Ich höre, dass hierher Juden kommen, die Jesus Christus als Gottessohn anerkennen. Ich bin jetzt ganz Händler und kommentiere mit keinem Wort. Ein paar hundert Meter weiter kann man seinen vierbeinigen Liebling bei Cat & Dog Grooming abgeben. Um ihn hinterher frisch geföhnt und pedikürt wieder spazieren zu führen. An der nächsten Ecke leuchtet auf einer großen, elektronisch beschrifteten Tafel, von überall sichtbar: Big screen/Big games – Australia versus Onan (sic!). Wieder einer dieser geheimnisumwobenen Sätze, die so beschwingt zum Nachdenken animieren. Erdkunde-Mangel? Tippfehler, der Onan mit Oman verwechselt? Provokation? Eine Meldung aus dem heftig Verdrängten? Ich liebe diese harmlosen Wahnsinnigkeiten, sie werden mir noch oft in Australien begegnen.
Cooles Viertel, viele Cafés, sogar ein Café mit Wänden voller Bücher lädt ein, die Sonne leuchtet, das Meer, die Gischt, die biegsamen Australierinnen. Seevögel kreischen. Am Strand entlanggehen, alle schwer relaxed, jeder sagt zu jedem: »No worries.« Ob man jemanden versehentlich anrempelt oder vom berühmten Beach-boy-Hautkrebs redet, hier rufen sie tapfer: Kein Problem!
Ein Schild erklärt die Gegend zur Alcohol-Free-Zone, bis zum 22.1.2009. Man darf vermuten, dass es sich die Stadtväter dann wieder anders überlegen. (Viele Wochen später werde ich gelernt haben, dass die Bier-Lobby in diesem Land über kurz oder lang jeden kauft.) Ein blau markierter Ausschnitt auf einer Karte zeigt die Straßen, die betroffen sind. Alle hiesigen Zecher sollten den Plan genau studieren, denn der Hastings Boulevard zum Beispiel ist nur die ersten hundert Meter alkoholfrei, einen Schritt weiter darf man wieder zur Flasche greifen.
Vieles ist gesetzlos. Selbstverständlich rauchen (im Freien, im windigen Freien!), zudem Frisbee, Fußball, Weingläser, etc. Ich überfliege die Piktogramme, die ein Dutzend Tätigkeiten untersagen. Ich suche einen offenen Mund mit einem roten Querbalken. Gibt's nicht, wir Glücklichen, atmen ist noch erlaubt. Ich postiere mich vor der kleinen Säule, auf der eingraviert steht, dass von hier aus Königin Elisabeth II. am 6. Februar 1954 aufs Meer blickte. Ich blicke auch hinaus. Allerdings leicht deprimiert, da mir schmerzhaft bewusst ist, dass kein Denkmal die Nachwelt über diesen historischen Augenblick informieren wird.
Ein paar Meter weiter befindet sich der Aussichtsturm des Surf Life Saving Club, angeblich der erste Verein dieser Art, weltweit. Andere widersprechen, sie wollen auch die ersten gewesen sein. Wie auch immer, hier wirtschaften Heldinnen und Helden, keiner weiß, wie viele Nichtschwimmer, Herzkranke, Haifischverfolgte und Volltrunkene die Retter – kostenlos – aus den Wellen gezogen haben. Lebendig, rechtzeitig. Seit 1907.
Eine revolutionäre Einrichtung. Denn vor diesem Datum musste niemand gerettet werden, da Schwimmen am helllichten Tag verboten war. Nur frühestmorgens oder spät nach Sonnenuntergang, nur im Dunkeln durften die Australier ins Wasser. Nach Geschlecht getrennt. Und immer – jetzt stimmt das Wort plötzlich – im knielangen Bade-Anzug. Bis ein Sieger auftrat, ein gewisser William Henry Gocher, Brillenträger und Pfeifenraucher, er ging eiskalt zur Mittagszeit baden, wurde glatt verhaftet – und wieder frei gelassen. Ein Damm war gebrochen, ab jetzt durfte jeder zu jeder Tageszeit »swim in the surf« (surf ist in diesem Land nur ein anderes Wort für Meerwasser).
Das nächste Wunder geschah am 23. Dezember 1915, ein gewisser Duke Paoa Kahinu Mokoe Hulikohola Kahanamoku, genannt Duke Kahanamoku, amerikanischer Kraul-Weltmeister und dreifacher Olympiasieger aus Hawaii, segelte auf einem vor Ort gezimmerten Holzbrett über australische Wogen. Und der eleganteste Sport aller Zeiten, das Gleiten, das Surfen entlang schäumender Wellen war geboren. Die Zuschauer fingen Feuer, ein Lauffeuer brach entlang der 36 000 Kilometer langen Küste Australiens aus.
Hundert Jahre nach Gründung der Lebensretter-Vereine gab es ungute Schlagzeilen. Vor einigen Monaten wurden zwei Lifesaver von einer Gruppe libanesischer Einwanderer attackiert. Daraufhin demonstrierten Tausende »weiße« Australier im Stadtviertel der Libanesen. Einige randalierten. Die Polizei schritt ein, es gab Verhaftungen, eine Untersuchung kam zu dem Schluss, dass eine Mischung aus Rassismus und krimineller Energie zur Explosion geführt habe. Surf Life Saving Australia hat daraufhin eine Initiative gestartet, um auch nicht-weiße Mitglieder zu gewinnen, sprich Moslems. Integration als Friedensinitiative.
Klingt verständlich, klingt machbar. Bis sich Mecca Laalaa, eine 20-jährige Studentin mit libanesischen Eltern, zum Kurs anmeldete. Das Problem: Vor langer, langer Zeit haben Allah und sein Prophet Mohammed beschlossen, dass das Herzeigen weiblicher Haut ruchlos ist. Wie also ins Wasser hechten und Ohnmächtige an Land ziehen, ohne gegen ewige Wahrheiten zu verstoßen? Kein Problem, nein, ein Riesenproblem. No worries? Von wegen.
Eine clevere Frau tritt auf, Aheda Zanetti, Stylistin, ebenfalls aus Libanon, ebenfalls in Sydney wohnhaft. Sie hat Erbarmen mit jenen »scarecrows« (Vogelscheuchen, so heißen sie im Volksmund), die in voller Montur bei 36 Grad im schattenlosen Sand sitzen und mit voller Montur ins Wasser waten. Sie erfindet – jeder muss grinsen, sobald er das Wort liest – den Burkini, eine Mischung aus Burka und Bikini, ein Kleidungsstück, das »allah-gefällig« alles bis auf Gesicht, Hände und Füße versteckt, zugleich aber eng genug anliegt, um sich damit (relativ) frei bewegen zu können. Auch im Pazifik. Scheich Taj Aldin al-Hilali, Australiens oberster Mufti, hat seinen Segen gegeben.
Andere wollen davon nichts wissen, sie nennen den Auftritt »shameful« und drohen ab und zu der Erfinderin und der Trägerin mit dem Tod. Die Jugend sieht es locker, die hübsche Mecca wurde inzwischen zum »Burkini babe« ausgerufen. Mir fällt auf, dass DHL die Brust von Miss Mecca Laalaa – wie alle Lebensretter-Brüste – beschlagnahmt hat. Als Werbefläche. Das Transportunternehmen als Sponsor. Man kann nur hoffen, dass die Gesponserten schneller reagieren als ihre berüchtigt unzuverlässigen Geldgeber. Sonst ist die halbe Bevölkerung bis Ende des Jahres ertrunken.
Die Burkini-Story ist eine gute Story. Sie erzählt uns wieder vom kleinen Wahn, bisweilen nicht ganz so harmlos, mit dem wir unser bisschen Zeit auf Erden verpesten. Man will schmunzeln, und dann will man schreien. Über die Dummheit, die umgeht in diesen hochmodernen Zeiten.
Im nahen Speedo's Café – eine Endlosschleife übers Surfen läuft im Fernseher – bin ich mit einer Journalistin verabredet. Ich habe ihr flottes Buch über Australien gelesen, zuletzt war man froh, als sie von einem (weißen) Eingeborenen erzählte, mit dem sie sich anmutig und lange unterhalten konnte. Nicht über Kricketstars, nicht über Footy, auch nicht umzingelt von fünf Kasten Bier und fünf ausdauernd gröhlenden Buddies. 188 Seiten lang hat man die Mühe der Autorin gespürt, sich den Frust nicht anmerken zu lassen. Zuletzt kam er zum Vorschein: als Lobrede auf einen, der mit seinem Kopf Gedanken produzierte und ihr Freund werden sollte.
Julica Jungehülsing ist sympathisch, eine Spur scheu. Vor sechs Jahren zog sie von Hamburg nach Bondi. Sie wollte in ein Land mit mehr Wärme und mehr Wellen. Sie surft und rettet, hat den mühseligen Menschenretter-Kurs hinter sich, auch das Krafttraining, die entscheidenden Handgriffe, das Üben der Mund-zu-Mund-Beatmung an der gliederlosen Plastikpuppe Miss Annie. Sie hält sich über Wasser, indem sie für deutschsprachige Magazine schreibt. Geschichten voll blauem Himmel und superviel Spaß. Anders, sagt sie, will man Australien in Europa nicht wahrnehmen. Sie hat eine Reihe von Reportagen in petto, die von einem weniger spaßigen Kontinent berichten. Die wird sie nicht los. Geistige Schonkost ist kein australisches Phänomen, sie wird weltweit verabreicht.
Zurück in die Stadt, heute findet die Tour durch den injecting room statt. Finanziert wird das Unternehmen von der Stadt. Raucher und Trunkenbolde müssen draußen bleiben, Junkies jedoch sind willkommen. Wir werden von Colette, einer Mitarbeiterin, herumgeführt, eine kleine Gruppe, darunter ein paar Medizinstudenten aus den USA. Das Zentrum ist während des Rundgangs (einmal pro Monat) leer, ohne Patienten. Aus verständlichen Gründen. Wer will sich schon bei seiner Sucht zuschauen lassen. Etwa 230 Süchtige kommen pro Tag.
Acht Kabinen für je zwei Leute gibt es. Das Personal verteilt Spritzen, einen Löffel, eine Salzwasserlösung, die Abschnürbinde. Das Heroin muss jeder selbst mitbringen. Und es selbst injizieren, dabei darf niemand helfen. Aber beim Suchen der passenden Vene, da darf Hilfe gewährt werden. Der eher trostlose Ort soll lediglich garantieren, dass sich keiner mit einer dreckigen Nadel infiziert. Und für Erste Hilfe sorgen, wenn etwas schief läuft. Im After-Care-Raum kann der Gedopte auschillen und/oder sich in ein Entziehungsprogramm überweisen lassen. Was wenige in Anspruch nehmen. Kaum ein Prozent der Abhängigen will geheilt werden. Und nicht einmal zehn Prozent aller Injecting-Episodes finden hier statt. Noch etwas Seltsames: Hier passieren mehr Fälle von gewollter oder ungewollter Überdosierung als »draußen«. Eine mögliche Erklärung ist, dass die Fixer darauf vertrauen, im Notfall gerettet zu werden. Noch ist hier keiner zugrunde gegangen. Sicher, das Problem der Beschaffungskriminalität bleibt, nicht ein Gramm Rauschgift bekommen sie von offzieller Stelle zugesteckt. Nur Selbstversorger dürfen rein.
Eine Stunde später wieder auf der Darlinghurst Road. Nach ein paar Metern werde ich von einem Zittrigen angesprochen, der sich den schmucken Namen »Daddy Longleg« zugelegt hat. Stimmig, denn der Kaputte ist lang und dünn. Wie alle Abhängigen sichtet er fehlerlos die Unabhängigen. Ja, sagt Daddy, er kenne den injecting room, bisweilen drücke er dort auch. Im Augenblick, meint er (man darf vermuten, dass er schon viele solche Augenblicke hinter sich hat), sei er pleite. Um Eindruck zu schinden, zeigt er mir eine (leere) Dose mit der Aufschrift Xanax-Tablets. Ich kenne das Mittel, ein schnell wirkendes Medikament, um Panikanfälle in den Griff zu bekommen. Damit nicht genug, aus der anderen Jackentasche zieht der Magere ein neutrales Schächtelchen mit (noch) drei Pillen, die aussehen wie Aspirin-Tabletten, sagt beiläufig, als stünde ihm ein Apotheker gegenüber: »Oxycodone.« Soweit ich Daddy Longleg, den ziemlich Zahnlosen, verstehe, handelt es sich um ein Opium-Derivat, auch das hilfreich, um angstfreier und heiterer in die Welt zu blicken. (Später werde ich wissen, dass es 1916 zum ersten Mal von Bayer hergestellt wurde. Als Ersatzdroge für Heroinopfer.)
Ich hole einen Schein heraus. Obwohl ich weiß, dass der 31-Jährige damit nicht, wie ich ihn auffordere, australische Kuhmilch kaufen wird. Wir beide wissen es. Aber ich habe über die Jahre ein immer innigeres Verhältnis zu jenen entwickelt, die sich von den Zuständen der Welt überwältigen lassen. Die sich mittels Nervenzusammenbrüchen oder anderen Fluchtversuchen – Rausch, Rauschgift, Verweigerung – aus dem Staub machen. Hätte ich nicht das Schreiben, das Aufschreiben, um die Irrungen und Niederlagen auszuhalten, ich würde jetzt wie der ehemalige Zoowärter mitten im Großstadverkehr mein Unglück herauslallen und mit dreckig-schorfigen Händen nach den Dollars eines Fremden greifen. Genau so oder so ähnlich. Auf jeden Fall lallen.
Nicht weit von meinem Hotel gibt es den Spanish Club. Hier hat die Musik noch eine Lautstärke, die man bei robuster Konstitution ohne gesundheitliche Beschädigungen übersteht. Ich gehe ins Hinterzimmer, den Raum voller Pokies, den Spielmaschinen. Hier ist es am ruhigsten, ich will lesen. Wunderbar absurdes Bild: Ein Leser umgeben von sieben Männern, die links das Bier halten und rechts die Knöpfe am Automaten drücken. Fast still ist es jetzt, nur Geld sprudelt ab und zu. Was uns verbindet, ist unser Alleinsein. Sacht gehen wir damit um, nicken uns stumm zu, keiner will es dem andern nehmen. In den Zeitungen stand heute ein Bericht über einen Mann, der mit einem Panzerwagen der Armee durch einen Stadtteil Sydneys brauste und dabei »verzweifelt« sieben Telefonmasten umriss. Wie verschieden wir doch mit Einsamkeit umgehen.
Am nächsten Morgen Richtung Süden. Habe gestern erfahren, dass der englische Romancier und »Skandalautor« D. H. Lawrence kurze Zeit in Thirroul gelebt hat, einer Kleinstadt, eine gute Stunde von Sydney entfernt. Ich merke wieder, dass ich einem begegnen muss, der mich impft. Gegen das brave Leben, die Einluller, merke, dass ich mit zunehmendem Alter wieder Kind werde, das nach Bildern, nach Vorbildern sucht, die es anspornen. Als der Bus kilometerlang durch die gesichtslosen Vorstädte rollt, verstärkt sich dieses Gefühl. Herr im Himmel, wer will hierher ziehen, aus freien Stücken? In diese Öde, in diese Häuser, in denen man nur als Selbstmörder oder Selbstmordattentäter hausen kann. So habe ich mir immer Orte vorgestellt, über die in der Presse irgendwann steht, dass ein gewisser Mister Sullivan seine Familie mit dem Küchenmesser zerstückelt hat und die Nachbarn anschließend bestürzt ausriefen: »Mister Sullivan konnte keiner Fliege etwas zuleide tun. Ich kann es gar nicht glauben, nie hätte ich ihm das zugetraut.«
Ich glaube es immer, traue jeder dieser Geschichten. In Lichtgeschwindigkeit kann ich mich in einen Totschläger hineinversetzen, kann im Zeitraffer Mister Sullivan nachempfinden. Wie er die Jahre, die Jahrzehnte über alles einsteckte, jeden Tag zuschauen musste, wie seine Träume nicht abhoben und Wirklichkeit wurden. Und wie er sich eines Tages nicht mehr zu helfen wusste und zu zerstückeln anfing. Armer Sullivan, hätte er ein Buch von Lawrence gelesen, es hätte ihn vielleicht dazu verführt, anderen Sehnsüchten hinterherzurennen. Weniger viereckigen, weniger grauen, weniger grau machenden.
Ein Gespräch lenkt ab. Über mein Weltempfänger-Radio höre ich auf ABC (Australian Broadcasting Corporation) ein Interview mit einem Schriftsteller, mit Jacob G. Rosenberg. Der 85-Jährige stellt sein neues Buch vor, Sunrise West. Die Geschichte (seine Geschichte) eines Polen, der im Getto von Lodz aufwuchs, nach Auschwitz kam und schon am ersten Tag seine Familie verlor. Von der Rampe weg vergast.
Der Alte gefällt mir. Lässig erzählt er, mit Ironie, mit Weisheit. Einer, der alles gesehen hat und alles überlebt. Und er erwähnt seine Dankbarkeit Australien gegenüber, wohin er 1948 emigrierte (kein Land hat mehr Holocaust-Flüchtlinge aufgenommen). Ich beneide ihn. Das klingt absurder, als es ist. Neid, weil er ein Schicksal hatte. Und ihm standhielt. (Ich werde das Buch in den nächsten Tagen lesen und einen brillanten Stilisten entdecken, der ohne Greinen festhält, ohne Rachegelüste, nur fassungslos, das schon.) Man erfährt in dem Interview noch, dass er in Melbourne wohnt. Wenn ich dort ankomme, will ich ihn treffen, ihn aushorchen. Ich renne jedem hinterher, der von inneren Landschaften weiß, an die ich selbst nie rankomme.
Mitten in einer von Mister Sullivans »suburbs« (wörtlich: Unterstädte) fährt der Bus an einer Plakatwand vorbei. Man sieht darauf eine riesige Küchenschabe, neben ihr eine Spraydose, das tödliche Mittel, um mit der Plage aufzuräumen, Text: »Endangered species«, vom Aussterben bedrohte Art. Ich habe gerade das Gespräch mit Rosenberg gehört, da wirkt die Werbung seltsam befremdlich.
Kurz vor Mittag in Thirroul, nicht weit vom Bahnhof liegt die Craig Street. Ich frage nach dem Weg und jeder weiß Bescheid. Irgendwie scheinen sie stolz auf den berühmtesten Mann, der es je hierher geschafft hat. Dennoch, man versteht nicht recht, warum der ewig Getriebene sich dieses Nest als (zeitweiliges) Refugium ausgesucht hat. Erst als ich an Wyewurk vorbei (so nannte er den Bungalow) bis vor zum Wasser gehe, kommt die Antwort. Dramatisch schlägt das Meer an die Steilküste, von links die finster dräuenden Wolken, von rechts ein Regenbogen, von allen Seiten her brausender Wind, der den Regen an Land peitscht. Und genau hier, mittendrin, muss man sich D. H. Lawrence vorstellen. Wie er am äußersten Rand des Gartens steht, den Blick zum stürmischen Himmel und stürmischen Ozean gerichtet, dabei immer von dem triumphierenden Gefühl begleitet, einen Ort gefunden zu haben, der es mit seiner aufgewühlten, rebellischen Seele aufnimmt. Um schließlich – einmal mehr gestählt vom heldischen Gefühl, noch immer dem Toben und Schreien der Welt trotzen zu können – zurück an den Schreibtisch zu kehren.
Natürlich war lange Zeit auch in Australien (wie in Europa und in den USA) eine Reihe seiner Bücher verboten, »too pornographic«, »too dirty«, so die offizielle Begründung. Darunter Söhne und Liebhaber, Liebende Frauen, Lady Chatterleys Liebhaber. Dazu kamen sein »skandalöses« Leben, seine homosexuellen Affären, seine Liaison mit einer sechs Jahre älteren, verheirateten Frau und Mutter von drei Kindern, Frida Weekley, geborene von Richthofen, Deutsche, Schriftstellerin, Übersetzerin und nicht weniger untauglich für die bürgerliche Existenz als der Mann, den sie bis ans Ende seines kurzen Lebens – er starb mit 45 – begleiten sollte.
Ich klingle am Gartentor. Von einer Nachbarin habe ich gehört, dass die jetzigen Besitzer das Haus aufstocken lassen wollten. Für den zu erwartenden Kinderreichtum. Aber der town council von Thirroul hat den Familienwerten, nach hartem Kampf, nicht stattgegeben. Es siegte ein anderer Wert: dass es für die Welt wichtiger ist zu wissen, wie einer der bedeutendsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts gelebt hat. Das ist eine bravouröse, ganz und gar dem Zeitgeist widersprechende Überlegung. Doch die abwesenden Eigentümer – ich läute lang und rufe laut – gehen entspannt mit dem Platz um. Kein mit der Nagelfeile manikürter Rasen, keine Geranien neben der Treppe, die zum Eingang führt, kein Fremde hassender Köter, der an der Kette reißt, keine gehäkelten Vorhänge, nein, eher elegant verwildert, fettes, wucherndes Gras, schiefe Kaktusstengel vor den Fenstern, überall liegt Spielzeug herum, unaufgeräumt, einladend. Die Nachlässigkeit erinnert an die Besitzer, an David Herbert und Frida Lawrence, die hier den Winter 1922 verbrachten.
Strömender Regen, ich harre aus, ein Tagtraum lässt mich minutenlang den durchnässten Rucksack vergessen. Ich träume, dass die beiden Bürgerschrecke die Tür aufmachen und heiter rufen: »Come on in, Andrew, tea's ready.« Bis ich aufwache, weil jetzt doch ein Hundsvieh zwei Häuser weiter bellt und mir wieder einfällt, dass ich 85 Jahre zu spät bin. Ich würde für alles bezahlen, für den Tee, das Flegeln auf der Couch, für jedes Wort, das sie aussprechen.
Aber niemand spricht zu mir. Durch den jetzt taifunartigen Regen mit wild ächzenden Bäumen zurück zum Bahnhof. Irgendwann überquere ich die Street of the year, das ist die Harbord Street, die 1996 zur Straße des Jahres in Thirroul gewählt wurde. Hier haben sie die Grashalme mit dem Mikrometer aufeinander abgestimmt. Vieles glaubt man erst, wenn man davor steht. Ich stehe davor, nass von oben bis unten, grinsend.
Kurze Fahrt nach Wollongong, knapp 250 000 Einwohner, drittgrößte Stadt von New South Wales. Ich checke im Dicey Riley's ein, in Australien fungieren Pubs oft auch als Hotel. Ich bekomme die Nummer 19. Alles normal, nur befindet sich der Fernseher eigenartigerweise oben auf dem Schrank, das Kabel eindeutig zu kurz, um die Steckdose zu erreichen. Und der Apparat eindeutig zu schwer, um ihn von seinem Hochstand zu balancieren. Fungiert hier ein Hotelmanager als Pädagoge? Auch sonst ein strenges Haus, am Eingang steht: »Muss geschlossen werden«, andernfalls droht »instant eviction«, sofortige Ausweisung. An der Küchentür der klare Hinweis: »Kein Service, da Lebensmittel gestohlen wurden.«
Wollongong und ich haben Pech, noch immer pfeift der Regen. Die Crown Street, die Hauptstraße, die Straße der Krone, wurde so angelegt, dass man sich am Ende von ihr an nichts mehr erinnert. Sie sieht aus wie tausend andere Hauptstraßen. Immerhin komme ich an KMA vorbei, einer Kampfsport-Schule. Hier kann man – so jedenfalls steht es auf dem Schild – ganz altmodische Werte trainieren: Courage & Ehre, Respekt für sich und Respekt für andere.
In der »lebenswertesten Provinzstadt des Staates« (so trompetet der Bürgermeister in Anzeigen) fliehe ich in ein Café. Das ist leicht gesagt in Australien. Denn hier haben sie die unmenschliche Angewohnheit, diese Orte der Eintracht und Hingabe ab 15 Uhr zu schließen. (Das würde in Österreich, Arabien und Frankreich einen Bürgerkrieg auslösen.) Zuletzt finde ich in der Mall, dem Shopping Center, einen revolutionären Kaffeehausbesitzer, der eine Stunde später schließt. Allerdings benutzt er diese sechzig Minuten, um zwischen den Beinen der Gäste die Kuchenkrümel wegzusaugen. Lärmig, ungeniert.
Direkt neben dem Kaffeehaus steht eine Box aus niedrigen Pappwänden, hinter denen ein (seriöser) Massage-Salon seine Dienste anbietet. Jeder, der vorbeigeht, kann hinschauen und Halbnackten bei der Behandlung zusehen. Ich warte darauf, dass wir per Gesetz aufgefordert werden, unsere Toilettentüren herauszureißen. Damit nichts mehr in unserem Leben unbeobachtet bleibt. Denn die Öffentlichkeit, so die Marktschreier des unbremsbaren Exhibitionismus, hat ein Recht auf Information.
Wie ein Heimatvertriebener irre ich durch einen Ort, den man in Stunden zum Friedhof umgraben könnte. Irgendwann sehe ich – es ist längst dunkel – einen grellroten Frauenmund blinken, bei jedem Aufleuchten blinkt das Wort »Open«. Für Augenblicke halluziniere ich, denke, dass eine Schöne mir einen Kussmund zuwirft. Bis ich wieder aufwache und kapiere, dass hier ein letztes Restaurant noch offen hat. So werden die hier Gestrandeten darüber informiert, dass sie dort drüben noch leben, noch immer nicht gestorben sind.
Am vitalsten klingt das Schnarren der Ampeln, wenn das Fußgänger-Grün erscheint. Das Geräusch soll die Blinden einladen, jetzt den Zebrastreifen zu überqueren. Aber auch Blinde sind hier um diese Zeit nicht zu finden. Fast poetisch klingt das, mitten in der Nacht um sieben Uhr abends, mitten in einer leeren Stadt, unter einem leeren Himmel.
Ich finde zwei Armenier, zwei Kebab-Männer. Ich esse ein Sandwich unterm kalten Licht ihres Ladens. Hinterher die Neon-Bude verlassen, zum Rauchen. Wie ein Obdachloser suche ich einen Hauseingang, um eine Zeitung unter den Hintern zu legen, einen Zigarillo anzuzünden und das Radio einzuschalten. Ein Autor wird zu seinem neuen Buch befragt, er schreibt über die 50er Jahre in Australien. Damals wurden die (seltenen) Touristen bei Ankunft über die Beweggründe ihrer Reise interviewt. Nicht wie heute aus Sicherheitsgründen, nein, die Australier waren damals so scheu und bescheiden, dass sie nicht glauben konnten, jemand würde freiwillig, aus Neugier eine so lange Reise antreten. So mussten sie jeden fragen, um ganz sicher zu sein.
Ich bin nicht lange allein. Die anderen Herumtreiber haben mich geortet. Sicher riechen sie meine Kebabfinger, sie sind auch hungrig. Aber ihre Litaneien sind fad, einer erfindet ein Asthma, der andere jammert von seiner davongelaufenen Frau. Ich spende grundsätzlich nur, wenn mir der Schnorrer ein fantasievoll erstunkenes Gräuelmärchen erzählt. Als Gegenleistung für meine Dollar. Aber heute bin ich schwach, prinzipienmüde. Als ein Dritter vorbeikommt, erkläre ich, dass seine beiden Vorgänger mich gerade gerupft haben. Darauf die souveräne Antwort: »O.k., no problem.«
Ich gehe zurück ins Hotel. Habe ich einen Schutzengel, dann jetzt, denn er schützt mich vor Wollongong und führt mich direkt auf ein Sofa, direkt neben eine blonde Frau. Weil ich mich ins (warme) Fernsehzimmer verirre. Elton John beantwortet gerade Fragen auf MTV. Ich verehre den Künstler, aber vergesse ihn augenblicklich, als die Blonde und ich zu reden beginnen. Sagen wir, ich erkundige mich und sitze anschließend mit offenem Mund da. Erin sieht aus wie eine Amazone, über 1,80 Meter stattlich, lange glatte Haare, ein rundes Sommersprossen-Gesicht, mit blauen, mutigen Augen, die vor nichts ausweichen. Sie ist wie ein (offener) Tresor, ich brauche nur die Hand auszustrecken und die Schätze einzusacken.
Und die Wilde packt aus. Als Erin zehn ist, stirbt ihre geliebte Mutter bei einem Verkehrsunfall. Auf der Beerdigung erfährt das Kind von der Großmutter, dass weder Mutter noch Großmutter ihre leiblichen Verwandten sind. Genauso wenig wie der (gehasste) Vater. Der »was just an asshole«, kein Schläger, aber ein fieser Rechthaber, oft abwesend, oft beim Saufen. Die heute 18-Jährige wurde als Baby adoptiert, sie hat keine Ahnung (und kein Interesse daran, es zu erfahren), wer ihre tatsächlichen Eltern sind. Die Freigabe zur Adoption empfand sie als Verrat, und mit Verrätern, erklärt sie, will sie nichts zu tun haben.
Vier Monate nach dem Begräbnis (sie selbst hat den Unfall schwerverletzt überstanden) haut sie ab, zwei Tage nach ihrem elften Geburtstag. Fünf Jahre Grundschule liegen hinter ihr, sie kann lesen und schreiben. Und Motorrad fahren. Mit einer alten Norton braust sie an einem frühen Sonntagmorgen von der Farm, ohne einen letzten Blick zurückzuwerfen. Sehr früh, meint sie, habe sie gelernt, von Zuständen zu lassen, die sie »fesseln«. Mit den dreihundert von der Mutter geerbten Dollar beginnt sie ein anderes Leben.
Sie weiß instinktiv, wie mit den neuen Verhältnissen umzugehen. Sie fährt in die nächste Stadt und kauft die Zeitung, überfliegt die Kleinanzeigen, bekommt Stunden später ihren ersten Job: dogwalker, führt die Hunde der Reichen aus. Bei einem der Spaziergänge kommt sie an einem car yard