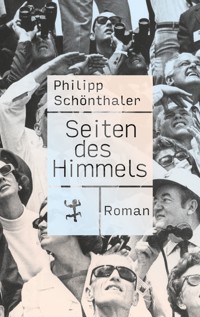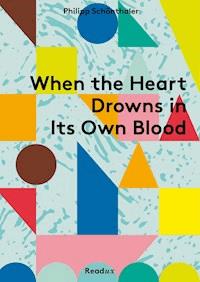Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Protagonisten des Debutromans von Philipp Schönthaler stellen sich den Herausforderungen, den Ansprüchen und Zumutungen unserer alltäglichen Arbeits- und Lebenswelten. Jeder Tag ist ein Kampf um optimiertes Aussehen, optimierte Arbeitsziele, optimierte Arbeitsplätze, optimierte Berufseinstellungen. Soll man nun daran scheitern oder darüber lachen? Schönthaler entscheidet sich in diesem außergewöhnlichen Roman für den feinen, leise ironischen Blick, den sanften und liebevollen Spott, geleitet von Neugier und Faszination, von Zuneigung und Verständnis. Offen bleibt nach der Lektüre, ob wir auf die Menschen in den Verhältnissen um uns oder ob wir bloß in einen Spiegel geschaut haben. "Antiromantisches Erzählen auf der Höhe der Zeit." - aus der Begründung für den Clemens-Brentano-Preis 2013
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
IN SACHEN KOMMUNIKATION: kann man das auch immer ganz anders angehen. Grundsätzlich ist eine kräftige, sonore Stimme jedoch von Vorteil, eine gepflegte Sprache, gepflegter Ausdruck, Äußeres. Erik blickt in den Spiegel, grimassiert, lässt die Wirbel im Nacken knacken, knetet die Fäuste. Im Kopf beherrscht er die Situation, er ist gut. Er ist wirklich gut, er weiß, dass er gut ist – bei dem Gedanken steigert sich seine Stimmung zusätzlich, er ist jetzt noch besser, nahezu euphorisch streicht er mit der linken Hand seine Krawatte glatt, reißt mit der rechten die Tür auf,
Rike glühen die roten Flecken auf der Brust, grell im Kontrast zur weißen Bluse, sie wachsen sich aus, greifen über auf den Hals, die Wangen. Rike spürt ihre erhitzte Stirn, sie arbeitet jetzt gegen sich selbst, sie hat etwas gutzumachen, bevor sie überhaupt begonnen hat, verspielt den Zauber des ersten Eindrucks immer wieder aufs Neue, ein Kapital, das jedem gegeben ist, es lastet als Schuldenberg auf ihr, wächst im Sekundentakt, ohne dass sie den Vorschuss der Empathie der anderen je für sich hätte verbuchen können – Rike japst, sie weiß, dies ist keine Hinrichtung, nur ein Vorstellungsgespräch
Der Mensch ist ein sprachbegabtes Tier und sprachbegabte Tiere müssen sprechen:
Erik macht gern den Anfang, am liebsten hört er sich selbst reden, er räuspert sich, wirft den Kopf in den Nacken, strafft seinen Rücken. Natürlich weiß er, in dieser Situation muss er erst mal einen Gang runterschalten, sein Adrenalin zügeln, den anderen den Vortritt geben, wenn er das Gespräch gleich zu Beginn an sich reißt, ist das ein glattes Knock-out-Kriterium – wer fragt, der führt, also langsam, erst mal die anderen kommen lassen, er ist hier nicht auf dem Rasen, beim Fußball, da könnte man die Dinge auch mal anders angehen, sportlicher. Unter dem Anzug, Hemd, spürt er seine modellierte Brust, die Arme, spannt die Muskeln an, lässt die Spannung weichen, spannt die Muskeln an, lässt die Spannung weichen – pectoralis major, biceps brachii, teres major, teres minor, er ist jetzt ganz bei sich, viel zu gut für diese Veranstaltung: Er kennt seinen Text,
don’t argue, convince your partner:
Natürlich ist es kaum möglich, mit Worten auszubügeln, was der erste Auftritt vermasselt, erklärt Hödebeck-Höfig, Personalleiterin einer großen Investmentbank, sie sitzt in der klimatisierten Empfangslounge eines schlanken Frankfurter Büroturms, 21. Etage, die Beine übereinandergeschlagen, der Blick aus dem Panoramafenster streift über die Stadt: Das sind alles Erfahrungswerte, im Jahr führt sie gut 100 Jobinterviews, was man am Anfang versäumt, ist auch später verloren, das bestätigen neueste Harvard-Studien, 30 Sekunden reichen im Regelfall für einen guten Personaler aus, um das Leistungsniveau des Gegenübers intuitiv zu erfassen, was danach kommt, bestätigt nur die Regel:
Rike hebt jetzt ihre Hände, lässt sie wieder fallen, rudert mit den Armen, sie steht im Besprechungszimmer, das Geräusch der ins Schloss schnappenden Tür zwei Schritte entfernt in ihrem Rücken, für einen Moment schwingt es hörbar in der Luft, ihr gegenüber ein drahtiger Mann, eine schlanke Frau im asphaltgrauen Hosenanzug, sie kommt mit schwungvollen Schritten auf sie zu, ihre geföhnten Haare wippen im Takt ihrer Schritte, ihr Kinn erhoben, freundlicher Gesichtsausdruck, gern würde sich Rike ein letztes Mal mit ihrem Stofftaschentuch über die funkelnde Stirn, ihre rechte Hand tastet über das linke Handgelenk, ihr Taschentuch klemmt unter dem linken Blusenbund, beult das Handgelenk auf der Unterseite des Bunds über der Pulsader aus – Rike drückt den Arm rasch gegen die Hüfte, lächelt, es schmerzt, es darf jetzt bloß nicht noch feuchter um die Augenpartie werden, sonst verschwimmt die Tusche vollends, in ihrer Vorstellung sieht sie ein Gespenst mit schwarzzerfaserten Augenringen auftauchen, schlagartig fühlt sie sich trotz Wohlfühlkleidern unwohl, transpirationsfeucht, die Bluse hat sie tags zuvor gekauft, 95 Euro, so teure Kleider tragen sonst nur die anderen, rasch stemmt sie beide Beine hüftbreit auseinander, bohrt die Fersen in die hellgraue Schlingenware, das gibt Halt hat sie gelernt:
Leitlinien zur Steigerung der Glaubwürdigkeit
Positionieren Sie sich in Frontalstellung vor ihrem Gegenüber, das signalisiert Selbstbewusstsein. Treten Sie abhängig von der Nationalität Ihres Gesprächpartners einen halben Schritt nach vorne oder nach hinten. Zeigen Sie ihre geöffneten Handflächen, signalisieren Sie Offenheit, dass Sie nichts zu verbergen haben. Nehmen Sie Ihr Gegenüber entschlossen in den Blick, sprechen Sie laut und deutlich. Kommen Sie auf den Punkt. Stottern und Stammeln schmälern das Vertrauen: die Seriosität. Spiegeln Sie im Verlauf des Gesprächs die Gestik ihres Gegenübers, mit einem Kopfnicken vermitteln Sie den Eindruck des Wohlwollens, der Sympathie, dass Sie tatsächlich zuhören, wissen, worum es geht –
»Ja, ja«, nickt Erik zustimmend, der Mund zu einem lautlosen Lachen in die Breite gezogen, seine Augen strahlen, ruhen fest in den Augen seines Gegenübers, bevor er der Aufforderung des Personalers folgt, mit gut bemessenen Schritten zur Sitzgruppe an der Stirnseite des Raums geht, Platz nimmt. Zunächst gilt es die Verbindlichkeiten zu steigern: Die Kommunikation scheitert nicht an der Substanz, sondern an der Akzeptanz, weiß Erik: »Schön hier!«, kommentiert er entschieden, sein Blick auf den Räumlichkeiten. Fehlt die Akzeptanz, hilft auch keine Substanz, ist hingegen die Akzeptanz gegeben, kann man beginnen, über die Substanz zu reden,
als Leitfaden dient die 55-38-7 Regel, erklärt Zander, Inhaberin und Trainerin der Lizenz A für berufsbezogene Eignungsbeurteilung nach DIN 33430 sowie Sprecherin der Fachgruppe Differentielle Psychologie und Persönlichkeitspsychologie in der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGP): Also die Frage, wie kommuniziere ich, wer ich bin. Zunächst ist da das gesprochene Wort, das heißt der Inhalt. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass der Inhalt weitgehend zu vernachlässigen ist: Das sind fünf, allenfalls zehn Prozent. Halten wir uns also weniger bei dem auf, was Sie sagen: Entscheidend sind vielmehr die paraverbalen Faktoren, das Wie, die Expertin zählt die Faktoren auf: erstens Stimme, zweitens Tonfall, drittens Klangmelodie – diese Parameter fallen mit 30 bis 35 Prozent ins Gewicht, erklärt sie, verharrt einen Moment, bevor sie schließt: Entscheidend für einen wirklich guten Auftritt – wir sprechen von 50 bis 60 Prozent – ist jedoch die Körpersprache, das bedeutet: Körperhaltung, Gestik, Blickkontakt, das muss absolut sitzen:
Rike rutscht auf dem Stuhl nach vorne, kaum ist sie an der ledernen Sitzkante des Designerstuhls angekommen, sackt diese unter ihrem Gewicht weg, sie schiebt ihr Gesäß, die Absätze in den Teppich gestemmt, wieder behutsam zurück in die Stuhlmitte, sie weiß, wenn sich der Schweiß über ihrer Oberlippe sammelt, bildet er kleine Tröpfchen, sonst könnte man die glasigen Oberlippenhärchen, die sie jetzt deutlich zu spüren meint, nicht sehen, das zweimalige Zucken einer Muskelfaser zwischen linkem Nasenflügel und Oberlippe, sie nimmt die Augen des Krawattenmanns wahr, den bebrillten Blick der Frau, die Körper durch das weiße Tischoval getrennt – sie sollte jetzt etwas antworten, von ihren bisherigen Erfahrungen berichten, Erwartungen äußern, oder einfach irgendetwas sagen – im Zweifelsfall sprechen, reden ist besser als schweigen, mit spitzen Fingern streicht die Frau einen Fussel von ihrem Ärmel, mustert das Fädchen, lässt es fallen, im Raum ist nur das Surren der Lüftung zu hören, das Fenster an der Front öffnet sich auf weitere Bürofenster nur durch einen Lichthof getrennt, überall Glas, verspielte Durchsichten und komplexe Spiegelungen, nicht wirklich beruhigend, das Pochen des Pulsschlags in ihren Schläfen, etwas legt sich mit feuchten Fingern gegen die Innenseite ihrer Stirn, ihr Gaumen ist spröde: Rike muss jetzt den Augenschlitzen der beiden standhalten, häufiger Lidschlag bedeutet Unsicherheit, möglicherweise eine nervöse Störung, Tics, der seitwärts gerichtete Blick könnte ihr als geheime Fluchtabsicht ausgelegt werden, der Mann räuspert sich, Rike ringt nach Luft, als sie plötzlich von einem rektalen Flattern ergriffen wird, die Angst beißt sich in ihre Gedärme, ihre Handteller sind merkwürdig taub, das akute Gefühl, sich auf der Stelle zu entleeren, der Magen im freien Fall, das hat sie so erst zwei Mal zuvor erlebt: Rikes Herz rast, ihr Blickfeld verschwimmt, ihr Rumpf verkrampft sich, mit schreckgeweiteten Augen stiert Rike auf ihre beiden Gesprächspartner, erstarrt
Philipp Schönthaler
Das Schiff das singend zieht auf seiner Bahn
Philipp Schönthaler
DAS SCHIFF DAS SINGEND ZIEHT AUF SEINER BAHN
Roman
Die Arbeit am Roman wurde durch ein Stipendium des Berliner Senats mit einem Aufenthalt im Literarischen Colloquium Berlin sowie durch ein Stipendium der Kunststiftung Baden-Württemberg gefördert.
Für Gespräche und Einwände danke ich Benjamin Herbst, Michael Lenkeit, Matthias Meyer, Florian Zimmer-Amrhein und ganz besonders Morten Paul und Kathrin Schönegg. Zudem gilt mein großer Dank Matthes & Seitz Berlin.
Wer kann da heute noch sagen, dass sein Zorn wirklich sein Zorn ist, wo ihm so viele Leute dreinreden und es besser verstehen als er?!
Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Impressum
Weitere E-Books
1
DR. BEATE POSNER wirbelt um 180 Grad im Bürostuhl herum, dunkle Strähnen wehen ihr ins Gesicht, sie trägt ihre Haare offen, das Haargummi spannt um ihr Handgelenk, im Verlauf des Vormittags wird Posner es mehrmals um ihre Haare schlingen und wieder lösen. Posner streift die Strähnen aus ihrer Stirn, nimmt die Fernbedienung vom Tisch, richtet sie – einen Arm gestreckt, das gegenüberliegende Auge geschlossen – auf den Beamer unter der Decke, pausiert das Video. Anschließend schaltet sie das Licht an, blinzelt erwartungsvoll in die Runde, während sie mit einer Hand ihren sandfarbenen Blazer zurechtrückt, ihre bestiefelten Beine unter dem Tisch ausstreckt: »Na?«, erkundigt sie sich: »Irgendwelche Fragen soweit, Kommentare? Machen wir eine kleine Naschpause – es raucht doch keiner … oder soll es gleich weiter gehen?«
Posner (37) sitzt im neuen Seminarraum des akademischen Career Centers, gemeinsam mit fünf Doktorandinnen, acht Postdocs, querbeet durch die Geschlechter, den Wildwuchs der Disziplinen, sie leitet einen dreitägigen Workshop, Titel: Der Sprung auf den freien Markt. Posner, promovierte Philosophin, mit »Posner Consulting – Training – Coaching« freischaffender Coach, ist auf die Karriereförderung von Akademikern und Nachwuchswissenschaftlern spezialisiert, inzwischen bietet sie ihre Kurse bundesweit an, projektbasiert ist sie mitunter an universitären Gutachten beteiligt. Mittlerweile ist es später Vormittag, auf dem Baugerüst vor dem Fenster turnen die letzten Handwerker, Maler in versauten Latzhosen, der Rauputz des neuen Gebäudes schimmert in einem hoffnungsvollen Grün, im Raum herrscht eine allgemeine Trägheit. »Und was ist das nochmal, was du genau machst?«, flüstert ein frisch promovierter Sportwissenschaftler, den Oberkörper großzügig aus dem Lot gekippt, seine Lippen gefährlich nah am Übergang von Haaransatz und Ohr seiner attraktiven Sitznachbarin, die ihren Kopf taubenhaft schräg stellt, ihre Erwiderung mehr haucht als flüstert: »Typologie und Sprachvariationen aus historisch-soziolinguistischer Perspektive am Beispiel der Integration fremder Verben ins Koptische nach der islamischen Expansion im siebten und achten Jahrhundert nach Christus« – »Jesus!«, seufzt der Sportsfreund, dessen Kopf mit einem resignierten oder abfälligen Abwinken der Hand bereits in die entgegengesetzte Richtung schwingt: »Und was ist das nochmal, was du genau machst?«, fragt er seine Sitznachbarin rechter Hand – als Posner in die Hände klatscht: »Aufmerksamkeit bitte!«, mahnt sie, ihr Blick geht in die hinterste Sitzreihe: Um den gesamten Raum zu kontrollieren, muss man die Teilnehmer der letzten Reihe binden – »fahren wir fort«:
Modul 4: So steigern Sie Ihre Performance
»Ziel ist es, im Gedächtnis des Gegenübers einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, den anderen zu gewinnen«, erklärt Posner, »gezielt Sympathien aufbauen: Die Weichenstellung erfolgt – wie in Modul 2 besprochen – mit dem KLP-Prinzip.« Sie hat sich erhoben, steht am Flipchart, malt die drei Buchstaben handtellergroß ans Board, sagt: »Wiederholen wir gemeinsam im Chor« – ihr Zeigefinger markiert Einsatz und Takt:
K für Kompetenz
L für Leistungsorientierung
P für Persönlichkeit
»Zu bedenken ist jedoch: Ohne Persönlichkeit keine Kompetenz, stimmt hingegen die Chemie«, Posners Edding zirkelt quietschend vom P hinauf zum K, »fasst man auch Vertrauen in Ihre Kompetenz.« – Posner lässt ihre Worte wirken.
ERIK JUNGHOLZ SCHLIESST SEINE AUGEN, konzentriert sich. Den Brustkorb weitend nimmt er Sauerstoff auf, zählt lautlos bis sieben, lässt die Spannung anschließend aus dem trainierten Oberkörper weichen, kehrt mit elastischen Knien in den Stabilen Reitersitz zurück, das Gewicht gleichmäßig auf beiden Füßen verteilt.
Es ist früher Morgen, Jungholz steht vor der Glasfront seines Wohnzimmerfensters, ein Flügel geöffnet, ein kühler Windzug weht von draußen herein. Die offenstehende Schlafzimmertür gibt den Blick auf das nachtwarme Doppelbett frei, in dem seine Lebensgefährtin noch immer schläft, zumindest döst, nur ein Wust heller Haare sprudelt zwischen den Laken hervor, ihr bezaubernder Hüftknochen, über dem sich die dünne Mikrofaserdecke anzüglich wölbt.
Jungholz atmet aus, wechselt flüssig zur nächsten Übung: Dem Gegner auf die Ohren hauen. Die wohlige Jane-Fonda-Stimme aus den Ohrstöpseln souffliert den Bewegungsablauf: Schulterbreiter Stand, die Hände locker zu Fäusten geballt, Jungholz rollt die Finger einzeln ein: Ausgehend vom kleinen Finger über Ringfinger, Mittelfinger, Zeigefinger, abschließend der Daumen, erklärt Fonda: Jungholz legt die Faust mit abwärts gerichtetem Handrücken seitlich an die Hüftknochen, schwingt sein Dantian nach rechts, das Gewicht ruht auf einem federnden Bein, säuselt Fonda, bevor die Arme spiralartig gedreht nach vorne schwingen, die einwärts geklappten Fäuste in Kopfhöhe, schlägt Jungholz seinem Gegenüber beidseitig auf die Ohrmuscheln, verlagert das Dantian mit dem Einatmen wieder zurück auf das rechte Bein, die Fäuste öffnen sich mit dem Ausatmen, schließen sich: Und nun die Übung allein, ermutigt die Sprecherin, aus den Ohrstöpseln dringt nur noch die Melodie von Erik Saties Gymnopédie no. 3 arrangiert von John Williams für Gitarre (mit kl. Orch.), Jungholz rollt die Finger einzeln ein: Ausgehend vom kleinen Finger über Ringfinger, Mittelfinger und Zeigefinger, abschließend der Daumen, er legt die Faust mit abwärts gerichtetem Handrücken seitlich an die Hüftknochen, schwingt sein Dantian nach rechts und … er beendet die Übung als die Fonda-Stimme sich aus dem verebbenden Klang der Nylonsaiten zurückmeldet, lobt: »Gut gemacht! Das kontinuierliche Schreiten und Gewichtsverlagern fördert die Atemtätigkeit; das kämpferische Zusammenspiel von Bewegung, Vorstellung und Atmung stärkt die innere Kraft für die täglichen Konflikte; mit Qi Gong können Sie Ihren regenerativen Energien gezielt nachspüren«, erklärt Fonda
– aber Jungholz hat die Stöpsel bereits aus den Ohren gerissen, sein Gesicht in ein Handtuch vergraben. Als er aus dem Dunkel des Frotteestoffs auftaucht, fällt sein Blick auf die Uhr – er erschrickt: Die monatliche Strategiesitzung ist heute eine halbe Stunde früher angesetzt, er ist spät dran, zumal er vor versammelter Mannschaft präsentieren muss. Das Handtuch segelt in die Zimmerecke, Jungholz greift zum Telefon, lässt ausrichten, dass er fünf Minuten später eintreffen wird: »Meine Unterlagen direkt in den Konferenzraum!«, befiehlt er. Die plötzliche Hektik elektrisiert ihn auf natürliche Art und Weise, Jungholz fühlt sich zurück in seinen Körper, durchwandert die einzelnen Gliedmaßen – er fühlt sich gut, atmet stoßweise aus, im nächsten Augenblick prasselt das kalte Duschwasser auf ihn nieder.
Keine drei Minuten später fädelt Jungholz den letzten Knopf ins Hemdloch, schiebt seinen Kopf ins Schlafzimmer, nuschelt unverständliche Zärtlichkeiten. Kurz darauf zirkelt er aus der Einfahrt, die Haare feucht aus der Stirn gekämmt. Jungholz schlingt, ohne einen Blick in den Rückspiegel zu werfen, seine Krawatte um den Hals, während er die Birkenwaldstraße runterbraust, am Fuß der Straße fährt er stadteinwärts; er schiebt eine CD in den Spieler, aus den Lautsprechern ertönt das Voodoo Orchestra & The Bad Haircuts:
Restmusik
Ich trink gern kleine Biere
Ins Bett geh ich um elf
Und wenn der Wecker klingelt
Dreh ich mich einmal um mich selbst
Nur manchmal bin ich unzufrieden
Träum von einem Großstadtleben
Zwischen Paris und Budapest
Vor meinem Fenster ranken Weinreben
Jungholz unterquert den Schlossplatz, pausiert die Musik, schaltet das Audiosystem auf Raumsprechanlage. Als die Sekretärin sich meldet, wünscht er zum zweiten Mal einen guten Morgen, lässt sich seine Termine für den Tag bestätigen. »Sehr gut«, quittiert Jungholz die Auskunft, wählt dann umgehend die Nummer von De Voeck (Professional Products), um Rücksprache über die bevorstehende Präsentation in der Strategiesitzung zu halten. Er hat fünf Minuten, um die Resultate der letzten drei Monate, den gegenwärtigen Stand der Dinge sowie die weiteren Maßnahmen vorzustellen. Jungholz hat inzwischen die Innenstadt durchquert, schraubt sich aus dem Stadtkessel hoch in Richtung Fildern, die langgezogenen Kurven der Neue Weinsteige/B 27 nimmt er mit Schwung. Seit über einem halben Jahr ist Jungholz Managing Director von Harry & Herbert Beauté Eau pour Homme, die Produktlinie gehört zur Marke Harry & Herbert Beauté (HH Beauté), die Marke wiederum zu Pfeiffer Beauty Kosmetik (PB). Seit drei Jahren in Folge macht Harry & Herbert Beauté pour Homme Verluste, schwarze Zahlen schreibt allein HH Beauté Accessoires mit dem Verkauf von Sonnenbrillen und Lifestyle-Artikeln. Jungholz, zuvor bei dem zu Procter & Gamble gehörigen Zahnpastahersteller Blendax in Mainz tätig, hat den Job trotz allem ohne Zögern angetreten – auch oder vielmehr wegen der Fallhöhe, die der neue Posten bot.
Noch innerhalb der Stadtgrenze Stuttgart-Degerlochs, in Höhe Albstraße, beschleunigt Jungholz den Wagen auf 110, 120, auf der Gegenspur schieben sich die Pendler stadteinwärts Schnauze an Arsch voran. Auf der Schnellstraße zeigt der Tacho 170, es lohnt kaum, das SI-Centrum kommt schon in Sicht, zwei Kilometer weiter sticht Jungholz in einem Zug von links außen auf die Abbiegerspur, Ausfahrt Stuttgart-Plieningen/-Hohenheim/-Möhringen, der Halbkreisel der Abfahrt lässt die Autoreifen in einem hellen Oberton singen, die rote Ampel unmittelbar nach der Ausfahrt zwingt ihn zu einem scharfen Stopp. Jungholz flucht, drückt auf play, aus den Boxen schallt erneut das Voodoo Orchestra:
Chorus:
Man muss das Leben an sich reißen
Im Recorder spielen die Voodoos
Ich vertrau guter Reklame
Lass die Restmusik laufen
Ich kenne viele Menschen
Die man nicht kennen muss
Sie sind mir viel zu ähnlich
Ich werd dann schnell konfus
Irgendwie krieg ich die Hummeln
Sehn mich nach einer Metropole
Ich sitz im Express nach Bratislava
Das ist keine Nostalgie
Jungholz biegt auf die Auffahrt zum Campus Filder, auch auf den letzten Metern beschleunigt er gewohnheitsgemäß, saust direkt auf die Pfeiffer Beauty-Zentrale zu. Der Anblick des PB-Hauses beeindruckt selbst nach einem Dreivierteljahr noch jedes Mal aufs Neue, denkt Jungholz: stark – ein Gefühl der Genugtuung breitet sich in ihm aus, stimmt ihn aktivistisch. Architektonisch ist der Rundbau jenem zeitlosen Rouge-Tiegel nachempfunden, den das Ehepaar Pfeiffer – er von Haus aus Chemiker, sie entwickelte sich in kurzer Zeit zu einer mondänen Geschäfts- und Lebefrau – erstmals 1911 für ihr Rouge, kurz darauf für die ersten Hautcremes verwendete und der noch heute von den Luxusprodukten der Marke Peiffer Beauty (PB) zitiert wird, aber ebenso von einigen Produktlinien der Apothekenkosmetik (Charlette Roche, PeauPeau!) und Naturkosmetik (Cosmeceutikal, Ecodermis).
Jungholz umfährt die Firmenzentrale, an der Front öffnet sich der Haupteingang mit dem hohen, geschwungenen Portal auf einen großzügigen Vorplatz. Unmittelbar an den Vorplatz schließen Grünflächen an, dort gibt es nirgends Parkmöglichkeiten. Anstatt auf den fünf Gehminuten entfernten Mitarbeiterparkplatz zu fahren, stellt Jungholz sich auf einen der Vorzugsparkplätze direkt hinter dem Gebäude, zwei Lücken weiter steht der bananengelbe Panamera von Gröber, der Vorsitzende und CEO hat seinen eigenen Parkplatz direkt am Eingang, das brauche ich auch, denkt Jungholz, steigt aus. Zumal Gröber mit 46 noch erstaunlich jung ist, gerade zehnJahre älter als er. Mit großen, keinesfalls hektischen Schritten eilt Jungholz durch den Nordeingang, unter Kollegen nennt man das PB-Haus mittlerweile liebevoll oder auch scherzhaft Puderdose. Jungholz passiert die Eingangsschleuse, steht dann allein im Aufzug, obwohl im weitläufigen Foyer mit Restaurant, Bistro, zwei Cafés, Firmenshops sowie Besprechungszimmern und Empfangsräumen, dazu die Sitzgelegenheiten im begrünten Innenhof, selbst zu dieser Tageszeit schon reger Verkehr herrscht. Zwei große Bildschirme an der Stirnseite der Eingangshalle sorgen zusätzlich für Leben. Jungholz steht dicht am Rundglas der vollverglasten Aufzugkabine, seine Finger trommeln auf das Geländer, erst blickt er auf das Treiben im Foyer, dann hinauf in die fluoreszierende Leere des 33 Meter hohen Lichthofs, nur von schmalen Verbindungsstegen durchzogen, sternförmig ausstrahlende, asymmetrisch angeordnete Übergänge, Flure, kleine Oasen, die zwischen den Abteilungen und Teams eine vitalisierende Kommunikationsatmosphäre schaffen. In den meisten Abteilungen herrscht eine open door policy, viele Innenräume sind selbst von hier einsehbar, die Durchsichten spenden in sämtlichen Büros beste Lichtqualitäten, lassen die work spaces großzügig atmen.
Jungholz holt Luft, steigt im siebten Stock aus dem Aufzug und eilt den Flur hinunter, die Tür zum großen Konferenzraum ist bereits geschlossen. Er ist tatsächlich zu spät dran – macht nichts: Jungholz fühlt seinen Puls, grimassiert, lässt die Wirbel im Nacken knacken, knetet die Fäuste. Im Kopf beherrscht er die Situation, er ist gut. Er ist wirklich gut, er weiß, dass er gut ist – bei dem Gedanken steigert sich seine Stimmung zusätzlich, er ist jetzt noch besser, nahezu euphorisch streicht er mit der linken Hand seine Krawatte glatt, reißt mit der rechten die Tür auf.
RAUM K 2.1.2.3: Im zweitem Stock des Akademischen Universitäts-Lehrkrankenhauses, Klinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie, Ärztlicher Direktor Prof. Dr. Dr. H. Steinhart, greift Dr. K. Riemenschneider, leitender Arzt der Abteilung für Phoniatrie und Pädaudiologie (Kommunikationsstörungen), mit einem kunstfertigen Griff die weiß belegte Zunge, zieht den zuckenden Muskellappen M. genioglossus – das mit den Retraktoren M. palatoglossus und M. styloglossus weitaus wendigste Muskelsystem des menschlichen Körpers – im Schraubstock von Daumen und schräg gelegtem Zeigefinger zwischen zwei kariösen Zahnreihen, einem belegten Zahndamm, aus der widerwillig geöffneten Cavum oris mit einem beherzten Ruck hervor.
Es ist seine dritte Behandlung am Morgen, Riemenschneider ist nach einer erholsamen Nacht im Vollbesitz seiner Kräfte, Konzentration, selbst Motivation, sein rechtes Auge blinzelt einzeln und groß im kleinen Metallguckloch, umkränzt von einem silbernen Rundspiegel, der an einem verchromten Drahtgestell bierdeckelgroß vor seinem Gesicht schwebt, das Drahtgestell ist in einem handgefertigten Kalbslederkopfband eingelassen. Riemenschneider treibt einen Einweg-Holzspatel mit raschen, seitwärts gewendeten Kippelbewegungen stückweise in die schmale Ritze zwischen fixierendem Finger und stumpfen Schneidezähnen, seinen Kopf, die Nase nah des feucht bebenden Musculus genioglossus, über sein olfaktorisches und nasal-trigeminales Nasenschleimhautsystem nimmt er jetzt deutlich den Effekt phlegmonöser Prozesse in Gaumen und Rachen wahr, denogene Zysten: »Foetor«, stöhnt Riemenschneider, ohne seinen Kopf abzuwenden, er ist zu routiniert, als dass er zurückschrecken oder sich etwas anmerken ließe. Furchtlos bringt er den Kopf (und unweigerlich die Nase) näher an den oral-dentalen Infektionsherd, »ausgeprägter Überbiss«, murmelt er, mehr zu sich selbst als zu seinem Assistenten, der mit dem Klemmbrett unter dem Arm pflichtbewusst einen Schritt heranrückt, den Oberkörper vorgebeugt, die Hände beidseitig auf seine Kniekapseln aufgestützt, seine Nase neugierig witternd in Richtung der Patientin erhoben (darauf erpicht, in einem eventuellen Nachgespräch unter vier Augen dem Geruchsurteil des Chefs empirisch fundiert beipflichten zu können), während Riemenschneider neben dem Holzspatel in aller Ruhe einen Mundspiegel in den geöffneten Rachen einführt, in jovialem Ton sagt: »Jetzt wollen wir doch mal sehen!«
»Das menschliche Ansatzrohr reicht von den Stimmbändern bis zu den Mundlippen und der Nasenöffnung, einschließlich Hypopharynx, Mesopharynx, Hyperpharynx, Mundhöhle und den durch das Septum längsförmig zweigeteilten Nasenraum Cavum nasale. Für die Lautbildung sind die aktiven Partien zuständig, wir sprechen konkret von Unterkiefer, Zunge, Lippen, Gaumensegel, Zungenbein und Kehldeckel. Zähne, Zahndämme sowie harter Gaumen verhalten sich lediglich passiv«, erklärt Riemenschneider, noch immer die Patientenzunge wie ein feuchtes Stück Kernseife zwischen Daumen und Zeigefinger geklemmt. In Anwesenheit des noch recht jungen, aber bestrebten Assistenten nimmt er sich hin und wieder die Freiheit, galant pädagogische Lektionen in die Behandlung einfließen zu lassen, auch seine Patienten können davon letztlich nur profitieren:
»Die Sprachlaute werden auf zweierlei Weise geformt«, fährt Riemenschneider fort, versucht während seiner Ausführungen einen laryngoskopischen Blick auf die Stimmlippen seiner Patientin zu erhaschen, sein Redefluss gerät nur zwischenzeitlich ins Stocken: »Indem sich der Hohlraum des Ansatzrohrs vergrößert oder verkleinert, werden verschiedene Resonatoren ausgebildet, die den durch die Schwingung der Stimmlippen erzeugten Stimmklang formen, sprich: Vokale bilden. Konsonanten entstehen hingegen, indem sich einzelne Partien des Ansatzrohrs dem Luftstrom in den Weg stellen. Das Wesen der Vokale, und in gewissem Sinn auch das der Konsonanten, beruht nun akustisch auf der Realisierung bestimmter Formanten, also von Partialtönen, die in Hinsicht auf die Sprachlautbildung von den Grundtönen nahezu unabhängig sind.«
»Ein A«, erklärt Riemenschneider, wobei er seine Patientin ermutigt – Finger und Spatel noch immer im fremden Mund-Rachen-Raum –, doch bitte laut und deutlich diesen ersten, elementarsten aller Vokale zu artikulieren …
– »Nun ja«, urteilt Riemenschneider, nickt wohlwollend: »Gewöhnlich weist ein A immer einen Formantbereich von 1000 Hertz auf. Bereits 1926 konnte Brünings – nicht zu verwechseln mit dem glücklosen Weimarer Reichskanzler Brüning – auf dem wegweisenden Kongress Deutscher HNO-Ärzte in Hamburg dem gefesselten Fachpublikum von einer Versuchsanordnung bestehend aus Kondensatoren und Spulen, den sogenannten Siebketten, berichten und darlegen, dass die Formantbereiche eine unerlässliche Voraussetzung der akustischen Perzeption bilden, will sagen, für die Wiedererkennung der einzelnen menschlichen Sprachlaute.«
»Was das bedeutet?«, fragt Riemenschneider in bescheidener Selbstgefälligkeit, den Blick noch immer konzentriert in den Rachen der Patientin gerichtet: »Sprechen – und wir bewegen uns hier in einem vorsyntaktischen, rein physikalisch-anatomisch-lautlichen Bereich – erfordert eine räumlich und zeitlich hoch präzise Koordination aller beteiligten Muskelgruppen, die auf vielfältige Weise gründlich misslingen kann.«
Mit diesen Worten lässt Riemenschneider das fremde Zungenfleisch los, richtet sich auf, mit Daumen und Zeigefinger zupft er am Gummi seiner Einweghandschuhe, als verlangten die Fingerspitzen nach Atemluft. »Mundraum unauffällig«, gibt er zu Protokoll, der Kugelschreiber des Assistenten setzt sich in Aktion, »leicht gerötete Stimmlippen«, mit einer Hand klappt er den Rundspiegel über seinem Auge zurück, er prangt jetzt wie ein Heiligenschein über seiner Stirn. Riemenschneider seufzt: »Im phoniatischen Gutachten wollen wir zunächst organisch bedingte Sprachstörungen ausschließen, die in diesem Fall als Ursache der Redeflussstörung gelten könnten«, erklärt er.
– Seine junge Patientin, Rike G. Njlhouz, lagert nach wie vor in der unentschiedenen 50-Grad-Schräge des Behandlungsstuhls, weder sitzend noch liegend, die Augen geschlossen; nur ein gelegentliches Zucken des Mundwinkels oder einer Augenbraue verrät eine innere Anspannung. »Dazu werden wir abschließend pernasal flexibel endoskopieren«, fährt Riemenschneider fort, prüft – »Ich darf doch mal?!« – mit zwei latexbehandschuhten Fingern, ob die rhinogene Schwellung der Oberflächenanästhesie bereits hinreichend abgeklungen ist und stößt – »Vorsicht!« – mit der Rechten, während sich die Linke behutsam um den Hinterkopf der Patientin schließt, das großzügig gegelte Plastikkabel mit gut dosiertem Schwung in die rechte Nasenpassage, kurz öffnen sich die Augen der Patientin mit schreckgeweiteten Pupillen – »und?!« – Riemenschneiders Blick ruht auf dem Monitor, der im Rücken der Patientin oberhalb ihres Kopfes plötzlich in rascher Abfolge abenteuerlichalptraumhafte Bilder von lymphoid-zytologischen Kanälen, Durchgängen und Tunneln produziert, schimmernde, zyklamisch-zuckende Zäpfchen, blasenförmige Häute, Wölbungen und Ausstülpungen, die an amateurhafte, einer gymnasial-pubertären Phantasie entsprungene Horrorfilmchen erinnern: »Gleich haben wir’s!«, ruft Riemenschneider ermunternd, schiebt das stroboskopisch Bilder schießende Kameraauge mit beiden Händen tastend durch die engen Nasenabschnitte in Richtung Kehlkopf zu den Stimmlippen und -bändern, sagt, keinesfalls unzufrieden: »Na bitte, da sind wir doch schon!«
IM ERDGESCHOSS der Puderdose betritt Dr. Frederick Quass (44) das firmeninterne Ausbildungs- und Traineezentrum, bellt seinen Gruß: »Hundert Jahre Erfahrung in der Kosmetikbranche!« – Quass tritt direkt ans Rednerpult, sämtliche Augen schwenken auf den Assistant Director of Human Resources, das Geflüster verstummt, Quass fährt nahtlos fort: »6,2 Milliarden Euro konsolidierter Umsatz im letzten Jahr! Sieben internationale Marken! Davon fünf Marken mit Sitz in diesem Haus! Vertreten in 110 Ländern! 31.000 Mitarbeiter weltweit! 40 Patentanmeldungen allein in den letzten sieben Monaten!«
»Meine Damen und Herren!«, Quass tritt neben das Rednerpult, stützt einen Ellenbogen darauf, seine freie Hand schiebt er in die Hosentasche, lässt dort Münzen in der hohlen Faust klimpern, während er eine theatralische Pause einlegt. Seine Mundwinkel zieht der Assistant HR-Director in die Breite, seine Augen ruhen auf der Naht zwischen rückwärtiger Wand und Deckenabschluss – bevor er die 25 in vier Stuhlreihen platzierten Bewerbungskandidatinnen und -kandidaten mit einem überschwänglichen »Willkommen« begrüßt: »Allein das neue PB-Haus«, nimmt er seine Ansprache auf, sein erhobener Zeigefinger beschreibt einen Zirkel in der Luft, »mit dem wir im hohen zweistelligen Millionenbereich in diesen Standort investiert haben, gibt Zeugnis, dass sich Pfeiffer Beauty Kosmetik nachhaltig zum Standort Deutschland bekennt – Süddeutschland, wenn sie mir die Verwendung des Präfixes erlauben.«
Erneuter Applaus, Lachen, aus den hinteren Reihen ein Pfiff, Quass blickt zufrieden auf sein Publikum: Die Bewerberinnen und Bewerber haben sich allesamt mächtig ins Zeug gelegt, diffizil bis zu den Ohransätzen homogen UVA- und UVB-ausgebräunte Gesichtshäute, komplex gefönte Haarauf-, -seiten- und -abschwünge, sorgfältig selektierte Strähnen, die in chromatischen Farbverläufen abrupt enden, schmachtende, stirnwärts strebende Wimpernaufschläge, mit kühl-geometrischer Präzision gezogene Lippenbögen, die den mondsüchtigen Kurvenverlauf handverlesener Augenbrauen exakt spiegeln, leuchtende, wahlweise an Pantone- oder RAL-Farbmuster angepasste Augensterne, die in der fremden Umgebung nervös in alle Richtungen springen, linksseitig monoton mahlende Kaugummibacken, orthopädisch fachmännisch kalibrierte Unterkiefer, umweht von eiskristall- oder jasminhaltigem Atem, großzügig angereichert aus einer saisonal sortierten, bei Müller Deutschland: Drogerie, Parfümerie, Schreibwaren und vieles mehr, sich über gut fünf Regalmeter erstreckende Palette an offensiv konkurrierenden Duftstoffen, die vor wenigen Stunden nur und nach wie vor intensiv an der Entfaltung ihrer individuellen Note laborierend mit angehaltenem Atem und gewölbt-abgewandter Stirn verschwenderisch unter kahlrasierten Achselhöhlen appliziert wurden, auf seidigen Halspartien und selbst mit einem raschen Tusch des Flakons auf dem straffen Leib enthaarter Hodensäcke.
Quass hat seine Berufung zum Assistant Director of Human Resources sofort genutzt, um Umstrukturierungen vorzunehmen: das Online-Recruitment ist neu, sodann hat er den Bereich Ausbildung & Trainees entschlackt und neu aufgestellt – seitdem werden sämtliche Rekrutierungs- und Assessmentverfahren kostensparend von externen Kräften durchgeführt, zumindest schwerpunktmäßig. In der Anfangsphase der Umstrukturierung wirft Quass deshalb noch selbst einen Blick auf die Abläufe, bis die Sache auf einen guten Weg gebracht ist. Auch jetzt hat er es sich deshalb nicht nehmen lassen, die neuen Ausbildungskandidaten zu begrüßen, um das Auswahlverfahren selbst zu eröffnen, auch wenn er die endlos wiedergekäute Firmengeschichte des jungen Ehepaars Pfeiffer inzwischen allzu oft vorgetragen hat.
– Die Pfeiffers gehörten jener bemerkenswerten Generation an, die die Kosmetikbranche zu Beginn des 20. Jahrhunderts in kürzester Zeit in ein big business verwandelte. Die legendäre Helena Rubinstein, die 1896 aus armen Verhältnissen in Polen nach Australien emigrierte, eröffnete 1903 mit den in Eigenarbeit angerührten Valaze by Dr. Lykuski Cremes den ersten Beauty Salon. Wenig mehr als eine Dekade, und sie war millionenschwer, mit Salons im Zentrum von London und Paris, ab 1914 zudem auf der Fifth Avenue Ecke 57. Straße in New York. 1907 hatte der Chemiker Eugène Schueller in seiner Pariser Junggesellenbude nach jahrelanger Arbeit die ersten, wissenschaftlich geprüften Haarfärbemittel entwickelt, die 1909 den Grundstein für das prosperierende Unternehmen L’Oréal legen sollten. Märchenhafte Erfolgsgeschichten, die oftmals das tradierte Rollenverhältnis auf den Kopf stellten und Frauen wie Helena Rubinstein, Elizabeth Arden, Estée Lauder oder Mary Kay zu Führungsfiguren an die Spitze von Millionen- und Milliardenunternehmen katapultierten. Bei allen Anstrengungen, Umstrukturierungen, Tief- und Wendepunkten der einzelnen Konzerne, kannte die Kosmetikbranche keine Krisen – weder in der Depression 1929, noch in den beiden Weltkriegen. 1915 entwickelte sich das Lippenwachs – nicht mehr im Tiegel, sondern von Patronenhülsen inspiriert fortan in Metallröhren vertrieben – zu einem erschwinglichen Massenprodukt. Im Zweiten Weltkrieg gehörte der Lippenstift zu den alliierten Mädchen wie das Blut in ihren Adern, zitiert Quass eine unauffindbare Quelle. Selbst in Deutschland hütete sich das Reichspropagandaministerium trotz naturmystizistischer Anwandlungen ein Verbot gegen Schönheitssalons und Lippenstift zu verhängen; zu groß war die Furcht, das Volk gegen sich aufzubringen. Die amerikanischen GIs konnten sich hingegen selbst in der Wüste Nordafrikas kleiner Kosmetikboxen mit Sonnencreme, Camouflage Make-up plus Entferner erfreuen, einschließlich einer Anleitung zum Gebrauch der Helena Rubinstein Inc. Produkte. Die Grande Dame verwöhnte die tapferen Kämpfer umsichtig mit Hautcremes, Talkpuder und Kölnisch Wasser.
Quass umreißt dieses Kultur- und Wirtschaftsmärchen nur in groben Zügen: Den Aufstieg von PB mit seinen Erfolgen, Affären und Skandalen mit oftmals langwierigen juristischen Auseinandersetzungen zu beschreiben, wäre ein bestenfalls buchhalterisches oder gar romanartiges Unterfangen, das ihn wirklich nicht inspiriert:
»Sie wissen«, erklärt Quass, »wir blicken inzwischen auf eine langjährige Firmen- und Familientradition zurück. Madame Christiane C. Marianne Pfeiffer-Besson, die sich derzeit unter dem Verdacht geistiger Unzurechnungsfähigkeit vor Gericht verantworten muss, ist Hauptanteilseignerin, Familienspross in der zweiten Generation – und die dritte Generation, als Anklage führende Partei an jenem erwähnten Prozess beteiligt, steht mit ungezügeltem Elan in den Startlöchern.«
»Meine Damen und Herren!« Quass ist jetzt in voller Fahrt, er referiert ohne Skript, bewegt sich spielerisch in der Materie, mittlerweile schreitet er vor seinem Publikum energisch auf und ab: »Sie alle kennen die entbehrungsreiche aber glückliche, ja triumphale Geschichte, eine Familien- und Gesellschaftssaga, ich sage nicht zu viel, wenn ich von historischen Dimensionen spreche, ich muss mich nicht wiederholen.« Quass legt eine Kunstpause ein:
»Erlauben Sie mir deshalb, an eine andere Geschichte zu erinnern, die nahezu dieselbe historische Zeitspanne umfasst und der wir es verdanken, dass wir heute unter diesen erfreulichen Bedingungen zusammenfinden. Sie wissen natürlich, wovon ich spreche« – natürlich weiß niemand, worauf der Personaler hinauswill. Quass genießt diesen Moment, der zwar kein sophistisches Talent offenbart, aber wirksam genug ist, um elliptisch kreisenden Unterkiefern auf dem Scheitelpunkt ihrer Umdrehung Einhalt zu gebieten, langgliedrige Finger, die verspielt den verschlungenen Bahnen klug präparierter Locken folgen, kurzzeitig verharren zu lassen.
»Verehrtes Publikum!« Quass fährt mit gekonnt modulierter Stimme fort: »Ihnen ist klar, dass Sie sich in den nächsten zwei Tagen einem harten Auswahlprozess stellen. Das Unternehmen kann sich nichts anderes leisten, als die Besten unter Ihnen auszubilden. Aber auch Sie streben nichts anderes an, mit Ihrem einzigartigen Potenzial, von dem wir überzeugt sind – deshalb sitzen Sie hier! Gemeinsam brennen wir, im Dienst der Schönheit die größtmögliche Leistung zu erbringen.
Der nachhaltige Erfolg dieses Verfahrens basiert auf Entwicklungen, die sich ebenfalls zu Beginn des 20. Jahrhunderts vollziehen: 1910 präsentiert der Hamburger William Stern das Konzept des Intelligenzquotienten, kurz IQ, auf dem 5. Kongress für experimentelle Psychologie in Berlin. Fortan soll die Psychologie im Dienst der Allgemeinheit stehen.« – Quass ist mittlerweile bei seinem Lieblingsthema angelangt, er wurde über eine Arbeit zu Stern promoviert, unwillkürlich wird seine Gestik mit jedem Satz gravitätischer:
»Die Leistung, nicht die Herkunft soll als egalitäres Selektionskriterium dienen«, referiert Quass: »Wir dürfen von bahnbrechenden Umwälzungen sprechen, der Geburtsstunde der angewandten Psychologie. Das Assessment-Center wie wir es heute kennen und für Sie veranstalten, verdankt sich schließlich psychologischen Testverfahren, die Dr. Johann Baptist Rieffert erstmals in den 1920er Jahren zur neutralen Auswahl von Offiziersanwärtern in der Weimarer Republik entwickelte. Die Royal Air Force adaptierte Riefferts Verfahren, aber auch in den USA machte es in den 1940er Jahren zur Rekrutierung von Geheimagenten Schule. Im Rahmen einer Langzeitstudie bei AT&T, der legendären American Telephone and Telegraph Company, hält das AC 1956 schließlich in der Wirtschaft Einzug.«
»Meine Lieben!«, Quass hebt nochmals an, aber nur um das Ende seiner Rede einzuleiten: »Ich will Sie nicht länger strapazieren, Sie haben noch Großes vor sich. Aber lassen Sie mich zum Schluss betonen, dass wir inzwischen auf eine lange Tradition und wertvolle Erfahrungen zurückblicken dürfen, wenn wir Sie heute in diesem Rahmen begrüßen.« Mit diesen Worten wendet sich Quass abrupt ab, winkt seine Referentin für Employer Branding & Talent Management nach vorne. Im Hinausgehen schüttelt er den externen Prüfern die Hand, heißt diese abschließend mit einem raumfüllenden Flüstern persönlich willkommen. – Und dann ist er auch schon aus der Tür, Kaffee, überlegt Quass, während er den Flur des Ausbildungs- und Traineezentrums hinuntereilt, ein guter Cappuccino. Der Assistant HR-Director steuert geradewegs auf das hauseigene Café Pfeiffer im Foyer zu, hier gibt es noch immer die besten Warmgetränke im gesamten Haus.
LIST STÜTZT EINEN ARM auf den Cocktailtisch, nippt an einem haselnussbraunen Filterkaffee, den er aus einem dünnwandigen Plastikbecher trinkt, auf dem Tisch seine Fotokamera, darüber das aufgeblätterte Amtsblatt, Rubrik: »Vermischtes«. Ihm gegenüber sein Sohn, ohne dass die Aluplatte des Stelzentischs, die ihm nahezu bis ans wuchtige Kinn reicht, die Nervosität des übergewichtigen Jungen verbergen könnte. Vater und Sohn befinden sich in Stuttgart-Cannstatt vor einem zweifelhaften Kiosk und Spirituosenladen. Es ist schulfrei, schon in diesen Morgenstunden liegt die von Hundekot imprägnierte Luft feucht und schwer in den Straßen. List seufzt. Von Zeit zu Zeit führt er seine rauchfreie E-Zigarette an die schmalen Lippen, unter dem Zug leuchtet ein winziges Gestirn glutroter Dioden an der Spitze der Power-Slim auf. List trägt ein graubraunes Strellson-Jackett und Khakihosen, auf den Oberschenkeln sind großflächige Taschen aufgenäht, auf dem Kopf sitzt eine graumelierte Stetson-Schirmmütze. Seine Füße stecken in Allzweckboots aus rehbraunem Wildleder, die Gummisohlen der Schuhe sind geriffelt, mit dem rutschfesten Schuhwerk kann er notfalls einen passablen Spurt hinlegen.