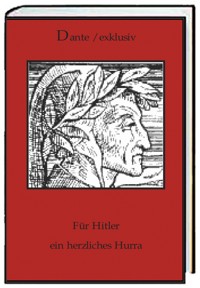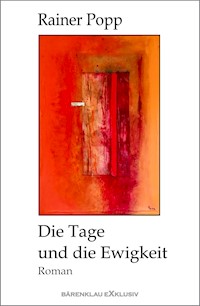3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Reise in den Sudan, nach einer Botschaft des Schreckens zufällig durch den Flug eines Reiskorns auf einer Weltkarte bestimmt, soll einem Frankfurter Aktienhändler die Erlösung bringen. Doch die Ereignisse, die ihm das Schicksal bescheren, entwickeln sich anders als geplant. Eigentlich ist ihm sein Sterben mehrfach vorausbestimmt; die Begegnung mit einer einheimischen jungen Frau führt ihn aber wieder zurück ins Leben.
Ob er Deutschland jemals wiedersieht, darüber wird der Tod entscheiden. Und wem sich das Leid in den Weg stellt, darüber gibt das Schweigen der Schatten Auskunft, die eines Tages plötzlich und unerwartet heraufziehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Rainer Popp
Das Schweigen
der Schatten
Roman
Impressum
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Covergestaltung: © by Lothar Joerger, Gemälde: Rainer Popp, 2023
Lektorat/Korrektorat: Bärenklau Exklusiv
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Die Handlungen dieser Geschichte ist frei erfunden sowie die Namen der Protagonisten und Firmen. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig und nicht gewollt.
Alle Rechte vorbehalten
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Das Schweigen der Schatten
ERSTER TEIL:
Die Reise
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
ZWEITER TEIL:
Der Weg zurück
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
Epilog
Der Autor Rainer Popp
Weitere Werke des Autors sind erhältlich oder befinden sich in Vorbereitung
Das Buch
Eine Reise in den Sudan, nach einer Botschaft des Schreckens zufällig durch den Flug eines Reiskorns auf einer Weltkarte bestimmt, soll einem Frankfurter Aktienhändler die Erlösung bringen. Doch die Ereignisse, die ihm das Schicksal bescheren, entwickeln sich anders als geplant. Eigentlich ist ihm sein Sterben mehrfach vorausbestimmt; die Begegnung mit einer einheimischen jungen Frau führt ihn aber wieder zurück ins Leben.
Ob er Deutschland jemals wiedersieht, darüber wird der Tod entscheiden. Und wem sich das Leid in den Weg stellt, darüber gibt das Schweigen der Schatten Auskunft, die eines Tages plötzlich und unerwartet heraufziehen.
***
Das Schweigen der Schatten
Roman von
Rainer Popp
Gewidmet
in Solidarität
allen Fremden,
allen Vertriebenen,
allen Verfolgten,
allen Asylsuchenden
allen Flüchtlingen
und allen Angereisten,
die in Deutschland
und in Europa
oder an anderen Orten der Welt
eine Zuflucht,
eine Bleibe,
oder eine neue Heimat
gefunden haben.
ERSTER TEIL:
Die Reise
1. Kapitel
Die Geschosse, die in sein Gehirn eindrangen, die waren nicht aus Blei gegossen. Es sind Wörter gewesen und nur sehr wenige davon, die das Bewusstsein von ihm zerstörten, als wäre seine gesamte Existenz im ersten Feuerstoß eines Kugelhagels niedergestreckt worden. Und deshalb, und nur aus diesem einzigen Grund beruhte sein Entschluss, den zukünftigen Verlauf seines Daseins unwiderruflich zu ändern und seine bisherige Biografie aus der gewohnten, aus der berechenbaren und beneidenswerten Lebensführung herauszunehmen, nicht auf einer eigenmächtig getroffen und nicht auf einer aus freien Stücken herbeigeführten Abmachung mit sich selbst.
Das Los, für das er sich entschieden, und das Vorhaben, das er daraufhin geplant hatte, das war notgedrungen gewesen, und es bedeutete für ihn die unabänderliche, die unvermeidbare Konsequenz einer vorausgegangenen Nachricht, deren Inhalte ihn aus der Bahn geworfen und deren Folgen ihn gezwungen hatten, unter dem Druck einer Todesdrohung zu handeln. Er kam sich vor, als wäre er unter einem wolkenlosen Himmel im heißen Schein der Sonne geschächtet worden mit einem einzigen Messerschnitt quer durch seine fettarme Bauchdecke.
Er, dieser begüterte, dieser gut situierte, dieser gehätschelte Günstling, dieses von Geburt an geliebte Geschenk Gottes, als das seine Eltern ihn stets betrachteten, dieser geschliffene Geschäftemacher, der stets geglaubt hatte, gesegnet zu sein von den Geheiligten, gekrönt von ihnen im Geschrei des Gefolges ihres himmlischen Geblüts und ausgewählt von ihnen unter Hunderttausenden von Gesalbten, dieser begabte, gescheite, vom Erfolg verwöhnte Glücksritter, der aus der Sicht der allermeisten Frauen herausragend attraktiv war und gebildet, der sich großzügig gab, der sich gebührlich benahm, der stets gut gelaunt und galant auftrat, der geistreich erschien und der sich gelegentlich genusssüchtig zeigte, dieser gepflegte, dieser gefällige, gestriegelte Typ eines Gewinners, dieser selbsternannte Guru des Geldes, dieser des Lebens gierige Gaukler, dieser Gardist der Gefälligkeit, der stets sein eigener gutherziger Gönner gewesen war, dieser von seinen Gespielinnen gepriesene Galan, dieser Geschmacksverstärker sexueller Gepflogenheiten, die zur rechten Zeit gemächlich waren und an der richtigen Stelle gefügig, dieses Genie der Kapitalvermehrung hatten die Geleitzüge seiner Gene aus den Geleisen gehoben und zum Einsturz gebracht.
Die Zeit vor der Wucht des emotionalen Niederschlags, der ihn traf, und die Sekunden danach, in denen er kollabierte – die erforderten gerade mal so wenig Atemverbrauch, wie es normalerweise dauert, einen einzigen, grammatikalisch vollständigen Satz auszusprechen. Ihn aber prügelten die Laute der Vokale und der Konsonanten wie ein Rohrstock.
Er, dieser verflixte Verführer von verlorenen, verzweifelten Frauen, dieser Verächter von Furcht und Feigheit, dem niemand etwas anhaben konnte, dem sich niemand in den Weg stellte, dieser Bevorzugte der Vorsehung, wie er sich selbst sah, dieser Vorzügliche unter den Vornehmen, der niemals eine Straßenbahn benutzt, niemals in einem Bus gesessen hatte, der niemals in einem Billigladen gewesen, der niemals als Pauschaltourist gereist, der niemals mit einem Ausflugsdampfer gefahren war, dieser herbe Schönling, der einer Schicht angehörte, die nicht auf Ratenzahlung kaufte, nicht in Imbissbuden aß, nicht in der zweiter Klasse mit der Eisenbahn fuhr, die zum Neukauf einer Wohnungseinrichtung keinen Kredit aufnehmen musste, die keine Preise verglich, die kein öffentliches Schwimmbad aufsuchte, die nicht an Theaterkassen anstand, die ihre Autos nicht selbst betankte, sondern gegen ein Trinkgeld von Lehrjungen mit Benzin auffüllen ließ, dieser Hochwohlgeborene, wie er sich stets in eigener Selbstherrlichkeit definiert hatte, krachte an jenem zurückliegenden Zeitpunkt auf einen Streich in sich zusammen, als fiele er, einem Schuppen gleich, den Erschütterungen eines Erdbebens zum Opfer. Seine Wandlung, die vollzog sich so abrupt, wie ein Würgeanfall dauert, den ein angefaulter Fisch ausgelöst hat.
Das, was er sich vorgenommen hatte, stand an diesem Tag im Oktober erst am Anfang, und es war das Resultat des Striches, den ihm sein Schicksal durch seine bis dahin vortrefflich gestaltete Biografie gekritzelt hatte. Und das, was ihn erwartete, war das genaue Gegenteil seiner Hoffnungen und seiner Wünsche, war unkalkulierbar, war viel gefährlicher und viel tragischer, als er vermutet hatte; und es war den Weiten seiner Vorstellungskraft vollkommen entzogen.
Was er tatsächlich im Schilde führte, verborgen hinter Schwindeleien und Ausflüchten, das wusste niemand. Den wenigen Menschen, denen er Adieu sagte, erzählte er sein Märchen von einer Weltreise, die er, angelangt am Scheideweg seiner Karriere, übersättigt von den Annehmlichkeiten seiner Lebensführung und heillos versunken in einer Sinnkrise, für viele Jahre unternehmen wollte.
„Wenn ich es nicht jetzt tue, dann werde ich nie mehr die Gelegenheit dazu haben“, hatte er seine Absicht begründet und damit nicht die Wahrheit ausgesprochen.
„Und wann … wann kommen Sie zurück?“, war die Frage gewesen, die am allermeisten von seinen Untergebenen gestellt wurde.
Und seine Antwort hatte, verziert in den Mundwinkeln mit einem linkischen Grienen, immer wieder nur so gelautet: „Irgendwann … vielleicht … falls ich nicht mein Leben verliere. Denken Sie doch nur an die wilden Tiere, die mich fressen … an die Krokodile und an die Schlagen, die mich beißen könnten … oder an die Kannibalen, die mich in ihren Kochtopf stecken und mich verzehren, wenn ich gar bin und für ihre Zungen zart zu kauen und schmackhaft scharf gewürzt.“
Er hatte sein holzvertäfeltes, mit Marmor gefliestes Luxus-Penthouse verkauft und alles, was sich an Gebrauchs-Mobiliar, an Antiquitäten, an Gemälden, Skulpturen, an Büchern, Geschirr und Gläsern, an Tafeltüchern und Küchengeräten, an Vasen und Aschenbechern in den sechs Zimmern befand. Er hatte alles ausräumen lassen und die Reste seines Hausstandes, für die er keine Verwendung mehr fand, in einem Container verstaut.
Er hatte seine Arbeitsstelle mit Panorama-Blick auf die Alte Oper fristlos gekündigt, sich mit einem Umtrunk von seinen männlichen und seinen weiblichen Mitarbeitern verabschiedet, seine beiden Autos dem Bruder und der Schwester geschenkt, seine Bankverbindungen, seine Lebensversicherungen, den Telefonanschluss, die Verträge für seine vier Mobiltelefone und den Internet-Zugang gekündigt, seinen Wohnsitz abgemeldet, hatte seinem Weinhändler Bescheid gesagt, dass er keine Lieferungen mehr zu bekommen wünsche, die Zeitungsabonnements storniert, das Sortiment seiner Kreditkarten zurückgeschickt, seinen Steuerberater und seine Zugehfrau informiert, sein Testament beim Notar hinterlegt; und er hatte am Morgen seines neununddreißigsten Geburtstages die Summe seines gesamten Guthabens von mehreren hunderttausend US-Dollar in Reiseschecks umgewechselt.
Sein Barvermögen, das er zu einem Packen von neun Scheinen gefaltet in die linke Tasche seiner Hose gestopft hatte, betrug siebentausendvierhundertachtundsiebzig Euro. In einem mit zwei vergoldeten Klammern verschließbaren, aus braunem Leder gefertigten Beutel-Portemonnaie, das in dieser verschnörkelten Machart alte Damen zu benutzen pflegen, bewahrte er elf Ein-Euro-Münzen und zweiundsiebzig Cents auf.
Er hatte seine zwei Dutzend maßgeschneiderten Anzüge, seine fünf Merino-Wolljacken und seine sechs Leder-Blousons, seine an die Hundert zählenden seidenen Krawatten, seine mit Monogramm bestickten vierundsechzig Hemden, seine drei Kaschmir-Mäntel und seine mehrere Dutzend Paar handgenähter Schuhe bei einem Kleider-Trödler als Schenkung hinterlegt; dazu zwei Smokings, einen Stresemann und einen Cut. Die Hälfte des Erlöses sollte der Abmachung nach, die er mit dem aus Armenien stammenden Geschäftsinhaber getroffen hatte, auf das Konto der gemeinnützigen Stiftung für den Erhalt von Kulturdenkmälern in Sankt Petersburg überwiesen werden. Für die Zigeuner-Hilfe Ungarn hatte er ebenfalls einen ziemlich hohen Geldbetrag hinterlegt.
Er hatte ein Visum beantragt, sich einen Rucksack besorgt und darin die Dinge verstaut, die er seiner Ansicht nach benötigte: seinen Pass, die Blöcke der Reiseschecks, ein Kulturbeutel mit Wasch- und Rasierzeug, Zahnpasta, Hautlotion, ein Paar Socken, ein Ersatzhemd und eine sechste Garnitur Unterwäsche.
Er hatte seinem Internisten einen Brief geschrieben, hatte telefonisch zwei Freunden Adieu gesagt, ein exquisites Abendessen und ein paar Abschiedsküsse mit einer seiner Wochenend-Geliebten hinter sich gebracht, der Friedhofsgärtnerei die Verlängerung der Zehn-Jahres-Gebühr für die Pflege des Grabes seiner Eltern entrichtet und er hatte die Nacht zuvor nur wenige Stunden schlaflos im Doppelbett eines Hotels gelegen.
Von dort hatte er sich kurz vor acht Uhr bei strömendem Regen in seine Wohnung fahren lassen und überprüft, ob das Inventar ausgeräumt und sein Putzauftrag erledigt worden war. Ein hastiger Rundgang durch die Räume, und er quittierte den Glanz des Parketts und das blank gewischte Bad mit einem anerkennenden Lächeln, das seine vollen, seine blutleeren, seine weißen Lippen für die Dauer einer halben Sekunde umspielte.
Bevor er die Tür hinter sich zuschlug und den Schlüssel in den Briefkasten warf, verriss er verstört seinen Blick ein letztes Mal in einem schmalen Winkel und führte die Sehkraft seiner Pupillen, die tusche-grauen, aufgehellten Augen zu schmalen Schlitzen zusammengezogen, mit der Schnelligkeit eines Blitzes die kahlen Wände und den Boden des Flures entlang, der am anderen Ende, mehr als fünfzehn Meter entfernt, an einem tropfnassen Fenster endete, das die Sicht über den Main eingeschränkt freigab auf die in der Morgendämmerung verschwommen Umrisse der wuchtigen Hochhausfassaden des Bankenzentrums in der Frankfurt Innenstadt. Die Spitzen der Türme, die sich in der Senkrechten aufrichteten, als nähmen sie nirgendwo ein Ende, waren mit der Farbe von Asche der tief hängenden Himmelswolken übermalt; dazwischen glomm ein Streifen indigoblau in einem Luftsee aus lackiertem Wasser. Zu seinen Füßen, etliche Meter unter ihm, zerflossen die Zweige der Eschen zu einem Farbanstrich aus Lachsrot und dem Glühen der Bremslichter der stadteinwärts steuernden Fahrzeugkolonnen.
Das war’s also, dachte er. Das ist es gewesen, was mich ausgemacht hat in meinem Leben bisher und das, wofür ich es gehalten habe, sagte er sich und schlurfte in den Fahrstuhl, der ihn, begleitet vom zirpenden Surren der Zahnräder, sieben Stockwerke tiefer ins Parterre brachte. Er fröstelte und schüttelte sich. Mehrere kurze Zuckungen, die von seinem Rücken ausgingen und bis in den Bauch wanderten, ließen ihn aufstöhnen. Vor Schmerzen krampfte er die Finger beider Hände zusammen.
Sein Gesicht, das er in der verspiegelten Kabinenverkleidung vor sich sah und das er mit unbeteiligter Miene musterte, als gehörte es zu einem Fremden, das kam ihm dennoch bekannt vor; aber der sich in diesem Moment ergebende Ausdruck der eingefallenen Konturen zwischen der Stirn und dem Kinn, den er in der Abwesenheit jedes Gefühls von sich zur Kenntnis nahm, hatte nichts mehr zu tun mit dem Manne, der er noch vor einem halben Jahr gewesen war: ein in seinem Fach sehr gewissenhaft arbeitender, ein karrierestürmender, ein in der Kredit-Branche angesehener, ein mit einem Spitzengehalt von fünfundsechzigtausend Euro netto pro Monat entlohnter und ein mit regelmäßigen Extra-Sonderzahlungen überhäufter, hochgelobter, nahezu angebeteter charismatischer Investment-Banker, der die Europa-Abteilung der Niederlassung eines in Philadelphia ansässigen Kreditinstituts leitete.
Er war der Star aller Stars. Er war der Meister seines Gewerbes. Er war die unstrittige Richtschnur, die zielgerichtete Orientierung verhieß und die schwindelerregende Umsätze garantierte. Er war der Heiland der großen Kapitalgeschäfte, der keinen Gott neben sich duldete.
Seine untergebenen Kolleginnen, die ihn als Chef und als Mann anhimmelten, trauten ihm sogar einen Vorstandsposten in der Zentrale zu. Jede von ihnen wäre ihm unter Einsatz ihres Lebens zu Diensten gewesen und jede hätte alles getan für ihn und sich geopfert für jeden Zweck, der für ihn nützlich und für ihn von Vorteil gewesen wäre.
In diesem Augenblick der Betrachtung seines Antlitzes, der ihm die ganze Wahrheit über sich offenbarte, war die Geschichte seines bisherigen Lebens auf einmal mit den Atemzügen entwichen, die er von sich gab. Er wusste, dass er dorthin nicht mehr zurückkehren konnte. Aber er wusste nichts von der Dauer und von den Verläufen seiner zur Neige gehenden Zukunft. Ihm stand, so war er sich ganz sicher, nichts mehr bevor außer seinem Tod.
Als er ins Freie trat und auf seinen gelben Schnürschuhen mit langsamen, schleppenden Schritten auf das an der gegenüberliegenden Straßenseite mit laufendem Motor parkende Taxi zuging, schlugen ihm die von stürmischen, zackigen Windböen aufgepeitschten Regenwände entgegen und klatschten gegen seinen olivgrünen Parka an, den er offen trug. Seine langen, dichten, seine schwarzen Haare, die bis tief in den Nacken wuchsen, wirbelten ihm wie eine in Fetzen gerissene Fahne um den Kopf. Er hatte eine Jeans an und ein weißes Hemd, das am Kragen zugeknöpft war.
So wie er aussah in seiner Kleidung – die Körperlänge auf einen Meter und siebenundachtzig hochgeschossen, von schlanker, fast dürrer Gestalt – in dieser Erscheinung hätten ihn Passanten bei flüchtiger Ansicht für einen Wildhüter in einem Safaripark gehalten. Er wäre auch als britischer Söldner durchgegangen, als Reisebüro-Manager in Freizeitkluft oder als steinreicher Großstadt-Zahnarzt auf einer Trekking-Tour.
Diese Überlegung stellte auch der Taxifahrer an, der sich allerdings über den schleppenden, betagt-gemächlichen, beinahe greisenhaften Gang des Mannes wunderte. Wieso rennt der nicht los bei diesem Hundewetter?, fragte er sich. Der weicht doch durch bis auf die Knochen … bei diesem Schneckentempo, das der vorlegt.
„Wohin?“, fragte er, als sein Fahrgast, dessen Gesicht vor Nässe glänzte, eingestiegen war und auf der Rückbank Platz genommen hatte.
„Zum Flughafen … bitte.“ Seine Stimme klang fest, und sie hatte den Tonfall von Bestimmtheit und die Zugabe eines energischen Timbres, das ganz im Gegensatz zu seiner offensichtlich angegriffenen körperlichen Verfassung stand.
„Zu welchem Terminal soll ich Sie denn bringen, fragte der Fahrer.
„Zu demjenigen, von dem im allgemeinen die Flüge ins Ausland starten.
„Und … und mit welcher Linie fliegen Sie?“
„Air France“, antwortete er.
Der Fahrer nickte und schaltete den Dieselmotor vom Leerlauf in den ersten Gang. Unter den Rädern des Autos spritzen schwere Wasserfontänen von der Fahrbahn hoch und röhrten in die Radmulden des Wagens.
„Mistregen … Mistverkehr … Mistarbeit“, schnauzte der vor sich hin. „Und dann noch diese … diese ängstlichen Arschgeigen, die vor jeder Pfütze anhalten, einen Diener machen und dann reingucken, wie tief es wohl in dem tosenden Meer ist.“
Nach einer Pause fragte er: „Wo soll’s denn hingehen … bei Ihnen? Zum Ausspannen irgendwo in den sonnigen Süden, wie?“
Als er keine Antwort erhielt, blickte er mit einem schnellen Aufschlag seiner Lider in den Rückspiegel und sah, dass sein Fahrgast, steil aufgerichtet und weit nach hinten in den Sitz gelehnt, die Augen geschlossen und die Lippen verkrampft hielt, als hätte er, irgendwo versteckt in seinem Bauch, furchtbare Schmerzen, oder als wäre ihm plötzlich übel geworden. Der da, der gehört auf die Intensivstation eines Krankenhauses, aber bestimmt nicht in ein Flugzeug, dachte er.
Julius York, der mit seinen Gedanken nirgendwo war und den nicht der kleinste Zipfel irgendeines Fantasiegebildes in Anspruch nahm, spürte kein Brennen im Magen und keine Magensäure aufsteigen. Ihm tat nichts weh. Ihm waren die Gedärme nicht in Brand gesetzt. Er brauchte sich auch nicht zu übergeben. Da er nicht gefrühstückt und deshalb weder feste noch flüssige Nahrung zu sich genommen hatte, war ohnehin nichts vorhanden, das er hätte erbrechen können.
Ihn quälte nur ein einziges Gefühl, und das setzte sich aus der Empfindung zusammen, als würden anstatt seines Blutes Eiswürfel durch seine Adern gepresst. Er fing auf einmal zu zittern an, und seine Zähne schlugen im stotternden Rhythmus aufeinander.
„Soll ich die Heizung aufdrehen?“, fragte der Fahrer, dessen Schädel so glatt rasiert war und der so glänzte wie ein geschältes weiches Ei …
„Das nützt nichts … Dadurch wird mir auch nicht wärmer … aber danke sehr für Ihr …. Ihr Angebot und für Ihre Aufmerksamkeit“, erwiderte Julius York, und er holte mühsam tief Luft, um den angestauten, den schmerzhaften Druck in seiner Brust zu mindern.
Dann wandte er sich ab und schaute aus dem Seitenfenster auf die zwischen den bleifarbenen Schleiern des Regendunstes verborgenen Häuserfassaden. Der Regen der war unterdessen in einen Wolkenbruch übergegangen. Am tiefen Horizont, der in einer Baulücke sichtbar wurde, schimmerte ein rotes Glühen.
Eine knappe halbe Stunde später erreichte das Taxi das Gebäude des Abfertigungsschalters. Julius York zahlte, stieg sichtlich angestrengt aus und schlurfte, einen Fuß vor den anderen, auf den Eingang zu, als der Fahrer ihm durch das heruntergedrehte Seitenfenster nachrief: „Hallo, Sie da …! Ihr Gepäck … Sie haben’s vergessen.“
Er zeigte mit einer Armbewegung auf den hinteren Teil seines Autos und klopfte, anstatt auszusteigen und seinem Fahrgast behilflich zu sein, mit der Handfläche mehrmals gegen das Blech der Karosserie.
„Da … da … Es liegt da noch drin!“, brüllte er in voller Lautstärke in den Lärmpegel des Regengusses.
Julius York, der sich langsam umgedreht hatte, ging die paar Meter zurück, öffnete den Kofferraum und nahm seinen braunen Lederrucksack heraus, der nicht größer war als das Format, das Frauen bevorzugen, wenn sie Kosmetikeinkäufe erledigen wollen. Er schlug den Deckel zurück, nickte dem Fahrer zu und zeigte ihm als Zeichen seiner Dankbarkeit für die erwiesene Aufmerksamkeit ein verdrehtes Lächeln.
Das hätte gerade noch gefehlt, dachte er erleichtert, während seine rechte Hand die beiden Schulterriemen des Rucksacks umschlossen hielt. Der wäre losgefahren, und ich hätte die ganze Stadt nach ihm absuchen müssen. Ohne den Pass wäre ich gar nicht erst in mein Flugzeug gekommen und ohne die Reiseschecks hätte ich sowieso gleich hierbleiben und in gar keinem Falle dieses Land verlassen können, überlegte Julius York. Und ohne das Visum wäre mir die Einreise unmöglich gewesen.
Niemand wusste, wohin er fliegen würde. Niemand ahnte, was mit ihm geschehen war. Niemand konnte sich sein Verhalten erklären, warum er alles aufgegeben und alle Brücken hinter sich abgebrochen hatte. Für die Zurückgebliebenen war er von diesem Tage an, dem 9. Oktober, spurlos verschwunden. Und es schien so, als wäre er für immer und ewig vom Erdboden verschluckt worden.
Das Ziel jedoch, das er in weniger als neun Stunden erreichen sollte, war nicht von ihm ausgewählt und nicht von ihm als Ergebnis seines Willens gewünscht worden. Der Sekunden-Flug eines Reiskorns, von seiner Fingerspitze gestartet und im Abstand von zweieinhalb Metern in eine Höhe von weniger als dreißig Zentimeter über Grund in die Luft geworfen, der hatte, als es niederging auf der von Ozeanen und einer Meerenge umgrenzten Silhouette eines Kontinents, das Land seiner Bestimmung und den Ort des Endes seines Schicksals ausgewählt.
Die Menschen, die dort lebten und die ihm dort begegnen sollten, die ahnten noch nichts vom Dasein dieses Fremden. Sie kannten sein Wesen nicht. Sie kannten den Klang seiner Stimme nicht. Sie kannten die verschiedenen Spielarten seines Lächelns nicht und nicht die Farbe seiner Augen. Sie hatten keine Kenntnisse, wie er ihre Lebensführung bestimmen und sie verändern würde. Und sie konnten sich nicht vorstellen, wie er aussah in seinem Gesicht, wie groß er war, wie dick oder dünn und welche Farbe und welche Länge seine Haare hatten.
Und sie wussten erst recht nichts von seinen Leiden, die ihm widerfahren waren und die noch auf ihn zukommen würden. Sie gingen, wie jeden Tag, ihrer Wege – in einer anderen Welt, in einem anderen Land, in dem Bürgerkrieg herrschte und in dem Millionen Menschen vor Hunger und Tod auf der Flucht waren; Tausende von Meilen entfernt von dem Abfertigungsschalter der Air France, an dem Julius York, der sich bemühte, das Zittern seiner Hände zu unterdrücken, seinen Flugschein vorlegte.
2. Kapitel
Der heftige, harte Hieb, der den Rumpf der Maschine erfasste und bis in die Spitzen der Tragflächen erschütterte, war das Zeichen, dass der Schub der Motoren auf volle Kraft geschaltet war. Die Turbinen heulten auf, und sie bündelten im Heck die Kraft von tausenden von Pferdestärken. Nur noch wenige Sekunden, und das Leitwerk, das auf seine Höchstgeschwindigkeit zurollte, würde sich von der Betonpiste lösen.
In Erwartung des einsetzenden Tempos, mit dem das Flugzeug so schnell wie ein Rennwagen über die Startbahn raste, machte Julius York, der seinen Oberkörper nach vorne beugte, gleichzeitig seine Augen zu, die er so lange geschlossen hielt, bis die Boing 727 nach dem Abheben von der Startbahn und ihrem Steilanstieg in eine Höhe von viertausend Metern allmählich eine fast waagerechte Flugbahn eingenommen hatte und sich von dort in einer für die Passagiere kaum noch bemerkbaren Schräglage immer höher und tiefer Richtung Norden in den wolkenverhangenen, von Schauerschwaden verwirbelten Himmel schob.
Erst als er das sichere Gefühl in sich spürte, da nun ein jäher Absturz nach menschlichem Ermessen so gut wie auszuschließen sei, setzte sich Julius York beruhigt wieder auf und legte den Rucksack, den er zu Beginn der Startphase vor seine Brust genommen und ihn an dieser Stelle umklammert gehalten hatte, neben sich auf den freien Sitzplatz. Obwohl er bereits mehrere hundert Mal geflogen war, übermannte ihn stets aufs Neue eine in seinem Unterbewusstsein ausgelöste Beklemmung, die er nicht abschütteln konnte, so sehr er sich auch immer wieder klar zu machen versuchte, dass Flugangst nicht mehr als ein kleiner psychologischer Defekt ist und keine auf nachweisbaren Erfahrungen beruhende Erkenntnis über eine zwangsläufig erhöhte Unfallgefahr im Luftraum.
Aus der Tasse mit heißem Kaffee, den ihm die Flugbegleiterin servierte, nahm er vorsichtig, um sich die Lippen nicht zu verbrennen, mehrere kleine Schlucke zu sich. Aber die Kälte, die in seinen Knochen saß, wich nicht heraus aus ihm. Er löste den Sicherheitsgurt, zog sich den Reißverschluss seiner Jacke zu und klappte den Kragen hoch.
Nur wenige Passagiere waren an Bord. Er dachte: Wenn es reicht, dann sind es insgesamt nicht einmal drei Dutzend, die hier mitfliegen. Ein paar weiße Geschäftsleute, eine vierköpfige Touristengruppe, eine einheimische Familie mit zwei Kindern, drei Offiziere in Uniform und sechs dunkelhäutige Ordensschwestern – das waren die Personen, die vor ihm und die, durch den Gang getrennt, neben ihm saßen und die er bereits während des Einsteigens beobachtet hatte.
Ich bin sehr gespannt auf die Stadt und darauf, was mich dort bei den Vorbereitungen erwartet, bevor ich ins Landesinnere aufbreche, überlegte er. Welche Temperaturen werden dort wohl herrschen? Es wird sicher so heiß sein wie in einem Backofen. Und wie komme ich an meine Ausrüstung und wie an einen Jeep heran? Ich werde den Taxifahrer fragen, der mich in meine Unterkunft fährt. Vielleicht kann der mir gegen gute Bezahlung helfen, all die Gegenstände und all die Waren, die ich für meine Reise benötige, zu organisieren.
Julius York, der mit einer Flugdauer von mehr als sechs Stunden rechnete, stellte sich in Gedanken versunken noch eine Vielzahl von Fragen, deren Antworten zu diesem Zeitpunkt weder durchdacht, noch formuliert und schon gar nicht ausgesprochen waren. Nur die Ungewissheit war gewiss und die Abfolge seines Schicksals, das ihn bereits zwischen die Zähne genommen hatte wie ein Kater die Maus und das damit beschäftigt war, ihn genau an die Schnittstelle von Längen- und Breitengrad zu schleifen, auf der das Reiskorn liegen geblieben war.
Sein Seelenzustand, der sich eigentlich in tiefer Depression und in Attacken von Panik befinden müsste, war angesichts des Unheils, mit dem er zu rechnen hatte, erstaunlicherweise stabil und in der geringen Nähe einer Empfindung von Entspannung und Heiterkeit angelangt; erzeugt in ihm durch seinen ungebrochenen Willen, die Vollstreckung seines Todesurteils ohne Furcht davor selbst in die Hand zu nehmen und sich im eigenen Ermessen zu erledigen – durch gezielte Unterlassung und an einem von ihm selbst durch das Zufallsprinzip bestimmten Ort.
Wann das sein würde, das stand noch nicht fest. Sicher war jedoch, dass es nicht mehr lange dauern würde. Ein paar Tage vielleicht, einige Wochen oder wenige Monate; mehr Zeit, die blieb ihm nicht.
Ich will und ich werde es sein … mein eigener Tod. Diesen furchtbaren Satz hatte er, mehrmals geschrien und mehrmals geflüstert, vor sich hingesagt, damals am Ende der Nacht im April, nachdem er, die Schreckensnachricht wie ein Kugelblitz eingesperrt in seinen Kopf, zunächst stundenlang wie von Sinnen durch die Straßen von Frankfurt geirrt und schließlich mit dem Verlust eines Teils seiner Vernunft und der Erschütterung seines stets auf Hochtouren laufenden Verstandes von Tränen nass und im kalten Schweiß gebadet in seine Wohnung zurückgekommen war.
Er war nicht eingeschlafen und hatte wach gelegen bis zum Morgengrauen. Er hatte Wein getrunken, sich besoffen gemacht, hatte sich zusammengekauert unter den heißen Strahlen der Dusche. Er hatte sich unter der Bettdecke verkrochen und später versucht, sich mit lauter Musik abzulenken. Aber was er auch tat, nichts konnte ihn zerstreuen, nichts konnte ihn besänftigen, nichts ihm den furchtbaren Schrecken nehmen, nichts ihm die Angst vor dem Sterben austreiben.
Nur das eine Wort, das war es gewesen, das ihn umgehauen hatte, als wäre er von einem Boxhandschuh aus Eisen getroffen worden. Nur die drei Silben, die waren es gewesen, die ihn dazu gebracht hatten, dass ihm der Boden unter den Füßen weggezogen wurde und er, nachdem er noch eine Frage gestellt hatte, in sich zusammensackte auf seinem Stuhl, auf den er sich gesetzt hatte; zwei Meter entfernt von dem weiß lackierten Schreibtisch, hinter dem der Internist saß und nervös mit seinen Fingern spielte.
„Wie geht es Ihnen … heute?“, hatte er gefragt, dieser grauhaarige, mittelgroße, dieser schlanke, blauäugige Dr. med. Rolf-Rüdiger Bronner.
„Ich fühle mich noch immer sehr müde und ich fühle mich noch immer sehr schlaff“, hatte Julius York seinen Gesundheitszustand beschrieben. „Und mir ist ständig kalt … und mir wird schwindelig … ganz plötzlich … wie ein Blitzschlag aus heiterem Himmel. Und dann habe ich das Gefühl, dass ich gleich zu Boden stürze.“
Der Arzt, der hatte aufgeschaut zu ihm und dann mit leiser, hüstelnder Stimme gesagt: „Der Befund … also das Untersuchungsergebnis, das liegt nun vor.“
„Und? Was besagt es?“, hatte Julius York mit einem verlegenen Lächeln im Mund gefragt.
„Ich habe keine gute Nachricht für Sie.“
„Sagen Sie mir ja nicht, ich müsste mich ins Bett legen und ein paar Tage meiner Arbeit fernbleiben.“
„Das müssen Sie nicht … nicht sofort, aber … aber … Sie sind ernsthaft krank. Sehr sogar … sehr, sehr.“
„Und? Was hab’ ich?“, hatte Julius York gefragt und dabei nicht mehr gelächelt. Er war auf nichts gefasst und er war auf nichts vorbereitet.
„Ihr Blut ist es. Ihr Blut, das ist nicht in Ordnung …“
„Was heißt das? Was genau?“, hatte er mit belegter Stimme nachgehakt. „Muss ich mir etwa Sorgen machen?“
„Ja …“
„Große oder kleine?“
„Ich befürchte große … sehr große.“
„Hat diese Krankheit, die ich habe, hat die auch einen Namen, den ich verstehe und mit dem ich etwas anfangen kann?“
„Natürlich, den hat sie“, sagte Dr. Bronner.
„Und welchen?“
„Leukämie … so ist ihr Name. Um genau zu sein: akute maligne myeloische Leukämie. Oder … mal laienhaft ausgedrückt … Sie … Sie leiden an einem heimtückischen, einem hinterhältigem … einem unberechenbaren … und deshalb an einem sehr gefährlichen Blutkrebs“, hatte er ohne Umschweife gesagt und seinen Patienten dabei nicht angesehen.