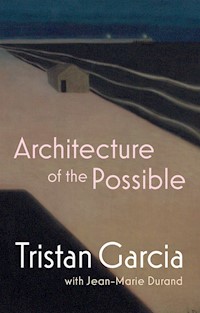Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Klaus Wagenbach
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es geschieht sieben Mal: Er stirbt und wird im selben Moment wieder geboren. Immer neu. Stets der Gleiche. Immer wieder kehrt der Ich-Erzähler nach dem Tod an den Anfangspunkt zurück, behält aber all seine früheren Leben in Erinnerung, alle Irrtümer und Erfolge. Jedes Mal muss er wieder neu laufen und sprechen lernen, warten bis das Blut kommt, um dann nach Paris gebracht zu werden. Dort trifft er Fran, der ein Mittel zur Blutstillung besitzt, ihn stets aufs Neue erwartet, erkennt und begleitet. Wie alles andere auch, ist diese Freundschaft sieben Mal gleich und doch grundverschieden. Sieben Mal liebt der Erzähler außerdem hingebungsvoll die gleiche, ja dieselbe Frau mit dem seltsamen Namen: Hardy. Wie wäre es, noch mal ganz von vorn anfangen zu können? Und ist dem, was Leben ausmacht eher wissenschaftlich oder politisch, religiös, sinnlich oder künstlerisch auf die Spur zu kommen? Dieser waghalsige Roman erzählt spielerisch und humorvoll von Zufall und Schicksal und befragt die Möglichkeit von (politischer) Veränderung überhaupt. Ein maßloses Buch, sinnlich und klug, das schwindlig macht und lange zu denken gibt …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die französische Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel La Septième im Band 7. Romans bei Gallimard in Paris.
Dieses Buch erscheint im Rahmen des Förderprogramms des französischen Außenministeriums, vertreten durch die Kulturabteilung der französischen Botschaft in Berlin.
© 2015 Editions Gallimard, Paris © 2019 für die deutsche Ausgabe: Verlag Klaus Wagenbach, Emser Straße 40/41, 10719 Berlin Covergestaltung: Julie August unter Verwendung einer Fotografie © John Smith. Datenkonvertierung bei Zeilenwert, Rudolstadt.
Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung und Verwertung der Texte, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für das Herstellen und Verbreiten von Kopien auf Papier, Datenträgern oder im Internet sowie Übersetzungen.
ISBN: 978380314262 7 Auch in gedruckter Form erhältlich: 978 3 8031 3315 1www.wagenbach.de
»Das letzte tötet«
Ich blute nicht aus der Nase.
Obwohl ich gerade sieben geworden bin. »Was soll der Scheiß, brumme ich, das ist nicht normal.« Auf dem Bett aus hellem Holz in meinem Kinderzimmer ausgestreckt, warte ich nun schon seit zwei Tagen auf das Ereignis, das sich nicht einstellen will. Immer mit der Ruhe, sage ich mir und stecke Daumen und Zeigefinger in ein Nasenloch, um mir ein paar Haare an der Wurzel auszureißen. In meinem Alter habe ich noch gar keine. Niesen muss ich trotzdem. Hoffnungsvoll begutachte ich den purpurroten Schimmer des Nasenschleims auf der Bettdecke und versuche, Blut darin zu finden; aber ich blute kaum, es hat schon aufgehört, und ich sitze auf dem Trockenen. Bald wird es Abend werden hinter dem runden Dachfenster, durch das die Landschaft, halb golden, halb leer, wie das Auge eines Uhus erscheint. In ein paar Minuten wird meine Mutter rufen, damit ich zum Abendessen runterkomme.
Verdrossen und genervt schnaubend mache ich mich daran, das Allernötigste in diesen blöden Lederschulranzen zu stopfen. Dann öffne ich die Dachluke, lausche dem Trällern der Amsel, das schon die Dämmerung über den Hecken und Wäldchen ankündet, klettere über die Einfassung, rutsche über die Ziegel des Giebeldachs und lande schließlich zu Füßen des knorrigen Baumes im Garten. Es ist Frühling, mild, und zum Abend hin leicht kühl. Der schwarze Hund, der immergleiche Mischling, kläfft mich an; einen Finger an den Lippen, streichle ich ihm mit der anderen Hand über die Schnauze und befehle ihm, still zu sein, um die Eltern nicht aufzuschrecken. Die verschwimmende blaue Linie am Horizont zeichnet die Bergkämme wie Zacken einer Säge nach. Mich überläuft ein Schauer.
Ich bin sieben Jahre alt, trotzdem muss ich einen Weg finden, um nach Paris zu gelangen.
Nach der Brücke schlage ich den Weg ein, der ins Dorf führt. Wenn ich schon ein Auto klauen muss, dann schnappe ich mir lieber gleich den Dodge des Doktors. Meine Reflexe aus langjähriger Fahrpraxis kommen zurück, ich setze mich ganz vorn auf den Sitz und binde mir zwei Schuhkartons unter die Sohlen, um die Pedale zu erreichen. Auf dem Beifahrersitz ein Päckchen amerikanische Zigaretten: Ich zünde mir eine Kippe an. Wie gut das tut, bei offenem Fenster, die Haare im Wind! Ich fahre schnell. Ich kann gerade so übers Lenkrad gucken, aber ich kenne die Strecke. Über Frankreichs Osten ist es Nacht geworden. Ich habe Durst, ich habe Hunger. In einer Lkw-Raststätte in Lothringen setze ich mein Unschuldslächeln auf und bestelle Pommes, Bier und Kaffee »für meinen Vater«.
»Kinder werden hier nicht bedient. Wir wollen keinen Ärger.
– Arschlöcher«, zische ich zwischen zusammengebissenen Zähnen.
Draußen spucke ich in den Rinnstein, immer noch kein Blut, und als ich aufblicke, spüre ich die Augen der Frauen auf mir, Kunstleder-Minirock mit Leopardenmuster und falscher Pelz, ich habe große Lust, nach dem Preis zu fragen, aber das wäre zu unvorsichtig. Im Vorbeigehen pfeife ich und zwinkere ihnen zu: In der Dunkelheit machen sie dem Zwerg Platz, der es auf seinen zu kurzen Hinkebeinen eilig hat. (Wenn die wüssten, grolle ich.)
»Wie alt bist du, Kleiner?«
Den Frauen ist mulmig zumute: Im Schein der Straßenlaternen leuchten meine blonden Haare auf, und mit meinem Kleine-Jungen-Engelsgesicht müsste ich längst im Bett sein. Ich fahre weiter. Gegen Morgen stehe ich mir in einem übergroßen Anorak vor dem rückenwirbelförmigen Gebäude des Val-de-Grâce-Krankenhauses fast eine Stunde lang die Beine in den Bauch und hoffe, nicht aufzufallen. Ich will nicht schon wieder für ein Entführungsopfer gehalten werden. Als die Gruppe der Assistenzärzte in weißen Kitteln sich während einer Pause in der Eingangshalle aufhält, finde ich ihn wieder, ganz der Alte: Etwas abseits und in Gedanken schaut der ewig hochgewachsene blasse Mann mit den feinen Haaren auf sein Mobiltelefon.
»Tag, alter Junge.
– Wie bitte?«
Er ist überrascht. Natürlich erkennt er mich nicht wieder: Er kennt mich ja nicht.
Ich versuche, überzeugend zu wirken: »Ich bin der, der blutet.
– Wo sind deine Eltern? (Er sieht sich um.)
– Du wartest seit Jahren auf mich. Hier bin ich.« Ich verrate ihm ein paar der üblichen Hinweise: die erste Frau, die er geliebt hat (diese ältere Dame aus bürgerlichen Verhältnissen mit dem überheblichen Tonfall), den Namen der Stelle unterhalb der Mundwinkel, an der Männer manchmal keinen Bartwuchs haben, die Inhaltsangabe des Buches, das Sie gerade anfangen zu lesen, und dann frage ich ihn, warum er mich getötet hat.
»Was?«
Und plötzlich merke ich, dass meine Geschichte absurd ist und er mir nie glauben wird. Mein Freund ist guten Willens. Seine Tätowierungen? Mir fällt auf, dass seine Gesichtshaut hellrot-rosa ist, die Haut an seinen Armen ebenfalls. Ich werde verrückt. Dieses Mal klingt alles falsch. Also umfasse ich meinen Kopf mit beiden Händen. »Bitte, ich muss dringend untersucht werden. Ich weiß nicht, warum ich kein Blut mehr verliere. Und du? Sieh dich an! Du bist nicht derselbe.«
Er zögert, aber ich flehe ihn an:
»Kumpel, du wirst mich doch nicht hängen lassen …
– Bin gleich wieder da«, antwortet er. (Er brauchte eine Spritze, eine Nadel, ein Röhrchen, Kompressen, einen Stauschlauch und Handschuhe, die sich im Obergeschoss befanden.) »Du rührst dich nicht vom Fleck, verstanden!
– Keine Gefahr. Bring mir Kippen und Kohle, ich bin total abgebrannt.«
Ich ließ mich auf einen der für die kleinen Patienten gedachten Sitze im Wartezimmer fallen und schloss die Augen. Ich weiß, was ich durch ihn geworden bin: eine Art gleichermaßen unreifes und abgelaufenes Monster, das keiner versteht. Als ich mich wieder aufrichtete, sah ich durch die Glastür seine langgestreckte Silhouette und die Schatten zweier Wachmänner. Dieser Idiot hatte die Security verständigt. Ich wollte weglaufen, aber zu spät: Ich war knapp 1,27 Meter groß, also hatten mich die Security-Typen eingeholt, noch bevor ich die Kreuzung des Boulevard de Port-Royal und der Rue Saint-Jacques erreichen konnte.
Ziemlich jämmerlich verbrachte ich den restlichen Tag im Kommissariat des V. Arrondissements und wartete, bis die Bullen mich wieder meinen Eltern übergaben. Maman hat geweint, meinem Vater war es peinlich. Nach unserer Rückkehr setzte sich unser Landarzt am Tag nach meinem Versuch, von zu Hause wegzulaufen, noch spät abends an mein Bett. »Was fehlt dir denn, mein Kleiner?
– Ich blute nicht, flüsterte ich.
– Was?
– Nichts. Sie können das nicht verstehen.«
Ich saß in der Falle. Ich bekam Hausarrest, man ließ mich nicht aus den Augen und brummte mir einen Schulpsychologen auf, der wollte, dass ich zeichne, dass ich rede, dass ich mich ausdrücke. Nach dem Essen wurden Tür und Fenster des Dachzimmers, wo ich schlief, sicherheitshalber abgeschlossen. Zu Füßen des knorrigen Baums gab es keine Spur eines verletzten Vogels mit silbrigem Gefieder. Die Hände im Nacken verschränkt, lag ich auf meinem Bett, sah in die schwarze Nacht, die über die eben noch farbigen Berge dieses verlassenen Nests kroch, und versuchte, mich zu beruhigen: vielleicht nur eine kleine Verzögerung … Aber vor allen Dingen dachte ich an sie: Wann und wie würde ich sie nun wiedersehen? Doch die Tage vergingen, Monate, schließlich Jahre. In der Schule war ich sehr schlecht. Ich wartete auf das Blut, aber das Blut kam nicht.
Im Alter von zehn Jahren habe ich begonnen, die hohe Wahrscheinlichkeit, sterblich geworden zu sein, ernsthaft in Betracht zu ziehen.
Das Erste
Über meine Geburt könnten eigentlich nur die vor mir Geborenen etwas erzählen. Während meiner ersten Kindheit erinnerte ich mich an nichts und musste alles erst lernen. Mein Vater, meine Mutter und ich wohnten am Rande verwilderter Wälder im Osten des Landes, nur ein paar Kilometer von der Grenze zum Orient entfernt. Wir hatten kalte Winter und warme Sommer. Ich war ein Blondschopf, lebhaft, unbekümmert und fröhlich, der die meiste Zeit im Freien verbrachte. Mir scheint, ich hatte kein Innenleben. Laut meiner Mutter, einer langsamen, schönen und gottesfürchtigen Frau, soll ich, kaum dass ich laufen gelernt hatte, von zu Hause ausgebüxt sein, um über die kurvenreichen Wege zu hüpfen, mit den Händen im Schlamm zu wühlen, den bitteren Humus zu probieren, faserige Ruten vom grünen Holz abzubrechen und gerillte Raupen zu piesacken, bis schließlich die Nachtfalter aktiv wurden. Abends soll ich dann vor lauter Erschöpfung wie ein Stein ins Bett gefallen und unter der Daunendecke sofort eingeschlafen sein.
Bei mir hatte ich immer einen schwarzen Mischlingshund, der in der Gegend umherstreunte. Sobald ich meine Hand herunterbaumeln ließ, reckte er den Hals, um gestreichelt zu werden. Ich fand ihn lustig.
Abgesehen von diesem Gefährten war ich allein. Mein Vater arbeitete als Zollbeamter an der Grenze, hinter der sich die Flüchtlingscamps befanden (er sprach nie darüber); kurz vor Feierabend wartete ich aufgekratzt hinter der Rauchglastür in der Küche auf ihn, während meine Mutter das Abendessen vorbereitete, und war jedes Mal erstaunt, ihn nicht zu überraschen: Ich hatte nicht begriffen, dass er durch das dicke trübe Glas hindurch meinen Schatten längst erspäht hatte. Er spielte mit.
Ich war naiv und unschuldig.
Sobald ich in die Schule kam, die auf der anderen Seite des Flusses hinter der römischen Brücke gebaut worden war, veränderte ich mich allmählich. Vielleicht fühlte ich es schon kommen. Zwar blieb ich ein kleiner blonder Junge, der viel lachte, einen gesunden Appetit besaß, in Begleitung des schwarzen Hundes auf steilen Pfaden herumkraxelte, im Frühling reißende Gebirgsbäche durch behelfsmäßige Dämme aufstaute, Steine in den See warf und aus voller Kehle gegen Felswände anschrie, um es mit dem Echo aufzunehmen. Aber im Umgang mit den anderen Kindern meines Alters wurde ich immer schüchterner. Wenn ich nachmittags aus der Schule kam, streckte ich mich auf meinem Bett aus und sah durch die Dachluke in die Äste des Baumes, die sich wie Finger himmelwärts reckten.
Ich erinnere mich daran, am Fuße dieses Baumes einen winzigen Vogel mit silbrigem Gefieder aufgelesen zu haben, der ein verletztes Bein hatte; ich pflegte ihn, fütterte ihn und richtete ihm in einer Streichholzschachtel ein kleines, mit Watte weich gepolstertes Nest her. Ich rettete ihn. Leider fand der schwarze Hund die Schachtel und tötete den Vogel. Darüber war ich sehr traurig, ich glaube sogar, dass ich Angst bekam.
Vielleicht lag es an diesem Aufruhr der Gefühle, dass wenige Stunden später das Nasenbluten einsetzte. Es war mein siebter Geburtstag.
Angeblich soll ich zu oft mit zwei Fingern in der Nase gebohrt haben. Mein Vater machte sich darüber lustig. »Junge, irgendwann wirst du noch im Gehirn rauskommen …«
An jenem Abend blutete ich also, und die Blutung hörte nicht auf. Ich rief: »Maman!« Meine Mutter, kreidebleich, musste mich stützen, während mein Vater auf dem Parkett kniend mein Blut aufwischte, den Lappen über einem schweren Tonkrug auswrang, der schon bald randvoll war, sodass er den Inhalt in eine große Zinkwanne leerte. (Selbstverständlich erinnere ich mich an jedes Detail.)
Sie riefen unseren Landarzt herbei, Doktor Origène, der mit meinem Vater befreundet war. Ich hatte schon beinahe zwei Liter verloren. Man hätte meinen können, ich verblute, und fürchtete nicht nur um mein Leben, sondern auch um die Gesetze der Natur: Maman war sehr gläubig, und in meiner Hämorrhagie lag etwas, das dem gesunden Menschenverstand widersprach. Doch bevor Doktor Origène mich auf den Rücksitz seines Sportwagens der Marke Dodge verfrachten konnte (er war ein Fan von Eddie Mitchell, Rock und Amerika), hatte sich der Blutfluss beruhigt. Trotzdem hatte ich ungefähr ein Sechstel meines Körpergewichts an Blut verloren (damals war ich schmal und leicht). Blutleer und mit baumelnden Füßen betrachtete ich von der Höhe eines Korbstuhls aus das Ergebnis meines Aderlasses in dem alten Wäschezuber; glücklich schlief ich ein.
Eine Woche später verlor ich erneut fast drei Liter Blut. Maman weinte. Am ersten Ferientag an Allerheiligen beschlossen Doktor Origène und mein Vater, mich in die Hauptstadt zu bringen und vom größten Pariser Hämatologie-Spezialisten untersuchen zu lassen. Ich fuhr zum ersten Mal Zug; die Banlieue-Hochhäuser hinter dem Abteilfenster, riesige Klötze aus Glas und Beton, die fächerartigen, von Graffiti bedeckten Schallschutzmauern, die auf den Balkonen hoch oben flatternde Wäsche, das bizarre Straßengewirr, dazu die Flugzeuge von Orly und Roissy am Himmel, das Grau und die Moderne beeindruckten mich schwer. Ich war ein Kind aus einfachen Verhältnissen, lebte auf dem Land, hatte keine Ahnung von der Großstadt.
Ein einflussreicher Freund meines Vaters hatte den Termin im Val-de-Grâce-Krankenhaus ermöglicht. Der Spezialist hielt meiner Mutter galant die Tür zur Praxis auf und ließ sie eintreten, während ich einem Assistenzarzt für die »Routine-Untersuchungen« überlassen wurde. Allein in einem weiß gekachelten Raum, in dem nur das Tropfen eines Wasserhahns zu hören war, zog ich mich aus, schlüpfte in den für mich bereitgelegten Kittel und wartete. Ich nahm jede noch so kleine Einzelheit wahr und kann mich noch heute daran erinnern.
Auf dem Krankenhausbett sitzend, betrachtete ich den auf metallenen Regalen aufgereihten Vorrat an Medikamenten neben dem Waschbecken, und die Tristesse der menschlichen Medizin sprang mir an die Gurgel wie ein Hund. Was für ein Aufwand, diesen von Anfang an verurteilten Körper instand zu halten und zu reparieren! Während dieser unendlichen Minuten bekam ich große Angst, ein krankes Kind zu werden; ich fürchtete, dass das von nun an mein Schicksal sein sollte. Ich würde zu jenem bedauernswerten Jungen werden, an den man gelegentlich ein paar Gedanken verschwendet. Ich stellte mir vor, mit kahl rasiertem Schädel mein ganzes Leben damit zu verbringen, vergebens zu kämpfen, zwischen Operationstisch und Intensivstation. Als ich dann seine Gestalt verschwommen und verzerrt durch das gläserne Rechteck der Feuerschutztür des Labors kommen sah, mochte ich ihn sofort. Er war nachlässig gekleidet, hochgewachsen, hatte feine blonde Haare, die zur Annahme verleiten konnten, er sei Skandinavier. Seine Haut war blass, aber er hatte ein offenes Lächeln, das mir den Eindruck vermittelte, dass er mich nicht für einen beklagenswerten Fall hielt. Ich fasste wieder Mut.
»Hallo, alter Junge«, sagte er und streckte mir die Hand hin. Er zitterte: Dieses sympathische Zittern hat er in entscheidenden Momenten immer gehabt. »Ich heiße François, aber alle nennen mich Fran.
– Guten Tag, Monsieur Fran.«
Fran zündete sich eine Zigarette an. »Das stört dich doch nicht, oder? Sonst musst du es mir sagen.
– Ist das nicht verboten?, murmelte ich.
– Hey, willst du mich verpfeifen?« Und er setzte sich auf einen Hocker mit Rollen, seine langen Spinnenbeine hämmerten in mitreißendem Takt auf dem Schachbrettmuster der schwarz-weißen Fliesen, als wäre er Schlagzeuger.
»Willst du mal probieren?
– Was? Rauchen?«
Beim ersten Zug habe ich mich verschluckt: Ich war sieben. Er hat mir auf den Rücken geklopft.
»Du bist der, der blutet?
– Ja.
– Schön, schön.« Fran kratzte sich am Kopf und fuhr sich mit der Hand durch die Haare, die seinen Fingern sofort wieder entglitten; er war blass, unruhig, aber forsch.
»Junge, dich suche ich schon seit Jahren.« Ich war verblüfft. Vielleicht hatte er ja regelmäßig solche Wahnanfälle; diese Frage stelle ich mir noch heute. »Weißt du, was wir beide jetzt machen? Ein paar kleine Untersuchungen ganz unter uns. Ich behalte die Ergebnisse deiner Blutabnahme für mich und gebe dem Chef irgendwelche Resultate. Er wird zufrieden sein, deine Eltern erleichtert. Was meinst du?
– Ich weiß nicht … Was habe ich denn? Ist es schlimm?
– Du musst mir vertrauen.«
Ich wollte ihm gerne glauben. Das Nasenbluten setzte ein.
»Nimm das.«
Fran gab mir eine winzige Phiole, von der das Etikett nicht vollständig abgelöst worden war, sodass die Fingerspitzen daran kleben blieben. Die klare, stinkende Flüssigkeit roch nach Ammoniak.
»Atme es tief ein.«
Durch die Droge schienen die geplatzten Äderchen auf der Stelle zu kauterisieren, was mir imponierte.
»Was ist mit meinem Blut?
– Wahrscheinlich eine genetische Anomalie …« Er suchte nach Worten. »Was weißt du vom Leben?
– Keine Ahnung.«
Der Mann holte sich eine der von den Assistenzärzten hinter dem Kühlschrank versteckten Bierdosen, um sich zu entspannen. Ich glaube, dass ich ihn beeindruckte.
»Vom Tod?
– Na ja … Alle Menschen sterben.
– Wie soll ich es dir erklären …« Er nahm einen großen Schluck. »Glaubst du an einen Gott? Oder etwas Derartiges?
– Ich weiß nicht. Kommt darauf an.« Noch nie war ich zu solchen Dingen nach meiner Meinung gefragt worden, und er sprach mit mir wie mit einem Erwachsenen.
Fran war sehr schön, sein Gesicht spiegelte Begeisterung, Zärtlichkeit und Hilfsbereitschaft. Er glich einer zum Gedenken an einen noch unbekannten Menschen im Voraus errichteten Statue; er besaß die Aura einer Persönlichkeit, die inmitten der anderen Wesen aus Fleisch und Blut vor Worten und Ideen strahlte. Aber sein Blick galt nicht mehr ihm selbst, er sah sich nicht einmal. Er war einzig mir zugewandt. Sofort fühlte ich mich wichtig, zum ersten Mal in meinem Leben.
»Warum erzählen Sie mir das alles?
– Du bist etwas Besonderes.« Er wartete ein paar Sekunden. »Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber siehst du …«
Er sprach nicht weiter und holte sich noch ein Bier.
»Du wirst nicht sterben.
– Sie meinen, dass ich nicht jetzt sterben werde?
– Nein, ich versuche, dir zu erklären, dass du nicht dieses Mal stirbst, genauso wenig wie das nächste Mal …
– Verstehe ich nicht.
– Du bist unsterblich.
– So was gibt’s doch gar nicht.
– Du bist anders. Die Blutung ist das Zeichen.
– Sie wollen mich wohl auf den Arm nehmen?«, murmelte ich, um ihn nicht zu verstimmen, denn unsere Unterhaltung wurde mir immer unheimlicher. »Sind Sie wirklich Arzt?« Ich sah mich um.
»Nach und nach wirst du begreifen, was ich sage.
– Wenn ich nicht sterbe, was wird dann aus mir?
– Christus ist auferstanden, aber mehr auch nicht: Er ist nur ein Mal ins Leben zurückgekehrt, danach ist er für immer in den Himmel entschwunden. Du jedoch wirst lange leben, ans Ende gelangen und wiederkommen, einmal, zweimal, dann noch einmal und immer wieder.
– Woher wollen Sie das wissen?
– Ich habe es in einem Buch gelesen, und ich weiß es. Überleg mal, ob du tief in dir drinnen etwas Besonderes spürst.«
Ich dachte nach.
»Ich weiß nicht.
– Es ist ganz einfach, Kumpel: Du musst daran glauben. Wenn du an dem, was ich sage, zweifelst, kann ich dir nichts garantieren. Sonst verspreche ich dir das ewige Leben. Deal?
– Ok.«
Ich war nur ein kleiner Junge, zuckte mit den Schultern und schlug ein, um ihm eine Freude zu machen. Er lachte erleichtert, nahm mich in den Arm wie ein alter Freund.
Ich wusste nicht so recht, was ich von dieser Unterhaltung denken sollte (vielleicht hatte der Mann zu viel getrunken), aber ich war geheilt. Natürlich habe ich meinen Eltern kein Sterbenswörtchen von dem erzählt, was sich im Krankenhaus wirklich abgespielt hatte. Wieder zu Hause, feierten Origène und meine Eltern die gute Nachricht. Zum Dank ließ man dem größten französischen Hämatologie-Spezialisten (der nichts getan hatte) die wertvollste Flasche Champagner eines seltenen Jahrgangs aus dem Keller meines Vaters schicken. Von Zeit zu Zeit sah Origène nach mir. »Wie geht’s, Sohnemann?« Ausgezeichnet, danke. Unter meinem Bett hatte ich die kleine Glasphiole, die Fran mir anvertraut hatte, in Watte gewickelt unter einer Latte des Parkettbodens verborgen. Sobald das Blut anfing zu fließen, holte ich die kostbare Mixtur aus ihrem Versteck und inhalierte die gleichermaßen berauschende und ekelhafte Flüssigkeit, die unter flüchtigen Ammoniakschwaden nach einem stinkenden Gemisch aus Terpentin und verblühten Veilchen roch; doch sie stillte die Blutung sofort. Es funktionierte wunderbar.
Außerdem hatte ich einen Freund gewonnen: drei- bis viermal pro Monat wartete Fran nach Schulschluss bei der römischen Brücke auf mich. Vermutlich erzählte er mir jedes Mal irgendeinen Unsinn, aber ich wollte alles gern glauben, und mit ihm war mir nie langweilig.
Seine Karre roch nach Hund und kaltem Tabak. Wie aus einem geöffneten Maul quollen Wanderkarten, Musikkassetten, vergilbte Bücher mit Eselsohren und beschädigtem Einband aus dem Handschuhfach. Wir fuhren bis zum Flussufer, wo wir uns niederließen, um über »das Leben, den Tod und das Ganze« zu quatschen. Er war ein seltsamer Mensch, offen, ehrlich, alert, ein Phantast, der ausschließlich für mich lebte. Er war einfach, aber nicht einfältig. Ich glaube, dass er neben die Spur geraten war und seitdem keine normalen Beziehungen mehr unterhalten konnte, außer mit einem Jungen meines Schlags.
Er hätte einen ausgezeichneten Arzt abgegeben, aber seine Kenntnisse in der Genomforschung waren nicht ausreichend, und trotz aller Blutabnahmen, in die ich über die Jahre eingewilligt hatte, ist es ihm nie gelungen, mir meine Unsterblichkeit schlüssig zu beweisen. »Es ist keine exakte Wissenschaft«, hielt er mir entgegen. »Meine Aufgabe ist es, dich dazu zu bringen, dass du daran glaubst und dir nicht den Kopf zerbrichst.«
Ehrlich gesagt brachte er mir in den zehn Jahren vor allem das Rauchen und Trinken bei. Außerdem gab er mir Selbstvertrauen. Ich zweifelte immer weniger an meiner Ewigkeit, zumal ich durch ihn eine Menge ganz unterschiedlicher Dinge lernte: wie man das Bein eines verletzt am Wegesrand gefundenen kleinen Tieres heilt; wer die Halunken, die Feinde und Freunde im Leben sind; warum man nicht lügen soll, aber wie man es dennoch tut; wie die Namen aller Knochen und Muskeln des menschlichen Körpers und die Teile des Organismus heißen, die in unserer Sprache keine offizielle Bezeichnung haben, zum Beispiel diese beiden kleinen Hautdreiecke unterhalb der Mundwinkel, wo Männer oft keinen Bartwuchs haben (lange Zeit wollte mir kein Bart wachsen, aber er beruhigte mich, das würde schon noch kommen). Im Autoradio hörte er experimentelle Musik, die sich für mich anfangs nur nach Krach anhörte, an die ich mich aber schließlich gewöhnte. In solchen Dingen wurde er mir zu einem fabelhaften älteren Bruder. Er hat mich initiiert. Er erzählte mir auch aus seinem Leben. Ständig wiederholte er, dass er lange auf mich gewartet habe, sehr lange, und dass alles nun einen Sinn ergäbe: Er habe nun verstanden, dass nicht er die Hauptperson in seinem Leben sei, sondern ich. Ich strengte mich gehörig an, das Vertrauen dieses erstaunlichen Mannes nicht zu enttäuschen. Er war häufig verliebt, und die Frauen zogen vorbei. Es hatte eine gegeben, eine Schriftstellerin, in die er sich als Jugendlicher verknallt hatte, von ihr sprach er häufig: Sie hatten sich getrennt, wiedergefunden, erneut getrennt … Was war aus ihr geworden? Das war nicht ganz klar. Jedenfalls wohnte sie nicht mehr mit ihm zusammen. Seitdem hatten mehrere junge Frauen diesen ruhigen und sanften Mann liebgewonnen, ihm dann jedoch vorgeworfen, treu, anständig und gut zu sein – aber Himmel noch mal, wie ein Hund! Komplett unerfahren auf dem Gebiet, erteilte ich ihm ernst gemeinte naive Ratschläge in der Liebe wie ein kleiner Bruder. Sobald er ein Glas zu viel getrunken hatte, sagte Fran, dass er schon immer davon geträumt habe, der Leutnant (der Hund) einer wichtigen Persönlichkeit der Weltgeschichte zu werden: »Du wirst es sein, mein Kleiner.« Und er wuschelte mir über den Kopf.
»Unsterblich, Kumpel, wenn du wüsstest … «, wiederholte er beschwipst, während er mich voller Bewunderung betrachtete. »Wenn du wüsstest.« Dann erzählte er mir von der Welt jenseits der Berge: »Hier lebst du in einem abgeschiedenen Winkel, aber bei Jesus und Buddha war es genauso, bevor sie das Leben entdeckt haben.«
Er erklärte mir, dass Europa ins Wanken geraten sei, die Globalisierung den ganzen Planeten in einem einzigen Strudel mitreiße und dass die auf der Erde zusammengepferchten hungernden Massen durch die Finanzströme einen immer geringeren Anteil an den Reichtümern hätten, die sich in Händen einer kleinen Minderheit befänden; dass Revolten, Bauernaufstände, Freiheitskämpfe und Kriege hier und da wie Luftblasen in kochendem Wasser aufstiegen. »Es sind unruhige Zeiten, Kumpel, du bist nicht umsonst aufgetaucht.« Ich solle mich auf die Errettung des gesamten Universums vorbereiten.
»Was wird geschehen, wenn ich sterbe?
– Unmöglich vorherzusagen vor dem ersten Mal.«
Also versuchte ich, mir vorzustellen, wie es weitergehen würde, wenn ich erst einmal auf meinem Sterbebett läge, meinen letzten Atemzug getan hätte, das Pochen meines Herzens wie der letzte Glockenschlag einer Turmuhr verhallt wäre, sobald die Durchblutung des Großhirns aufgehört hätte und die Nacht in den Schädel hereinbräche, daraufhin bei meiner Beerdigung das Hinabgelassen-Werden in die Gruft, und schließlich unter der Erde liegend, allein, weise, nicht vorhanden. Wenn ich daran dachte, wollte sich kein Bild einstellen: alles schwarz ohne Licht.
Im Sommer erzählte ich meinen Eltern, ich würde mit Freunden zelten gehen, aber in Wirklichkeit verbrachte ich meine ganze Zeit mit Fran; er fuhr mich mit dem Auto durch die krisengeschüttelte, verlassene Gegend, wir bauten unser Zelt auf und lebten von dem, was wir auf Feldern auflasen oder aus dem Fluss angelten. Als er sich das erste Mal fast nackt vor mir auszog, bemerkte ich schwarze Tinte an seinen Beinen, die von den Leisten bis zu den Knien verlief: Es waren Tätowierungen aus seiner Jugendzeit, die er nun lieber verbergen wollte, wie ein Gemälde, das ein Künstler nach einem Gesinnungswandel mit vollständig deckendem dunklem Lack übermalt hätte. Möglicherweise bildeten die Tätowierungen den Namen und das Porträt der Frau ab, die er so geliebt hatte. Fran schien viel gelebt, aber fast alles vergessen zu haben. Ich war sehr jung und vertraute ihm. Natürlich zog ich von Zeit zu Zeit die Möglichkeit in Betracht, dass ich eines Tages sterben würde und dass dieser Mann log oder alles nur erfand: Vorerst aber folgte ich ihm wie ein Kind, das an die Zahnfee glaubt, die den Milchzahn unter dem Kopfkissen über Nacht in eine Münze verwandelt, dann wie ein Schüler, der gewisse Naturgesetze anerkennt, zum Beispiel die Tatsache, dass sich die Erde um die Sonne dreht oder dass Atomkerne Elementarteilchen enthalten, auch wenn man es nicht selbst herleiten und beweisen kann. Man vertraut den Wissenden.
Sicher ist jedenfalls, dass er mir eine Hilfe war: Ich hatte sehr gute Noten in den Naturwissenschaften, und es wurde Zeit. Er wollte eine Bruchbude im Zentrum Frankreichs mieten und dort für mich ein richtiges »kleines Heer« von Anhängern aufbauen, in der konfusen Absicht, die Verhältnisse zu verändern. Er phantasierte.
Fran war sehr nett, aber bei seinem Vorhaben hatte ich Bedenken und wollte mich lieber um meine Zukunft kümmern. Ich bat ihn, noch ein wenig zu warten, bevor ich mich in den Messias (oder etwas Derartiges) verwandle. Seit ich in die Pubertät gekommen war, glaubte ich nicht mehr ganz so fest an alles, was er mir versprach: Ich hatte schon bemerkt, dass ihm Irrtümer unterliefen, dass er Gedächtnislücken hatte oder unbesonnen redete.
Mit siebzehn Jahren zog ich nach Paris. Plötzlich verhielt Fran sich zurückhaltender, und nichts von dem, was er mir vorgegaukelt hatte, bewahrheitete sich: Ein- oder zweimal pro Trimester zitierte er mich heimlich in eine heruntergekommene Brasserie am Pariser Stadtrand und sprach nur noch in Andeutungen; ich bekam das Heer der erwarteten Anhänger nicht zu sehen. Ich glaube, ich habe ihn enttäuscht, weil ich mich nicht mehr genug für unsere gemeinsame Idee einsetzte. Trotzdem blieb ich ein guter Schüler und bekam fürs letzte Schuljahr im Lycée einen Platz im renommierten Internat Louis-le-Grand und hoffte, anschließend zu den selektiven Vorbereitungsklassen zugelassen zu werden. Während meiner ganzen Jugend hatte ich neben diesem komischen Vogel keinen anderen Freund gehabt, was mir nicht gutgetan hatte. Rückblickend hielt ich mich selbst für merkwürdig und asozial. Ich kannte niemanden und teilte mir das Zimmer mit einem bornierten Mathefreak, der gern feiern ging. Unter seinen Freunden waren ein paar Schlägertypen, in deren Gesellschaft ich mich unwohl fühlte. Er lud mich mehrmals zu einer gemeinsamen Sauftour am Samstagabend ein. Erst als ich es im Frühling vor Einsamkeit und Langeweile nicht mehr aushielt, nahm ich an. Es war schon dunkel, und mein Zimmergenosse traf eine Gruppe von Studienanfängern, die auf den Grünflächen im Parc de la Villette am Ufer des Canal de l’Ourcq picknickten. Die kühle Luft war erfüllt von Flaschenklirren und Stimmengewirr, vom Geruch nach feuchtem Gras, vom Funkeln heller Augen, glitzernder Armreifen und metallischer Schnallen an den Schuhen der Jugendlichen, die auf ihre Ellenbogen gestützt auf dem Boden lagen und diskutierten; ich zündete mir eine Zigarette an.
Langsam sog ich den Rauch ein und genoss es, da zu sein.
Etwas abseits, nahe am Wasser, sang eine schlanke junge Frau mit langem blondem Haar und begleitete sich dazu auf der Gitarre. Sie setzte dreimal an, um ihr Stück zu spielen, brach lachend ab und entschuldigte sich; dann stimmte sie einen Hit aus den Achtzigern an, der noch immer im Radio lief und den ich gut kannte.
Sie hielt inne und sah mich an.
»Bist du durchsichtig oder was?
– Wie bitte?«
Sie hob die Schultern und wies hinter mich. »Weil du zufällig genau vor meinem Publikum sitzt.« Ich drehte mich um und entdeckte ungefähr dreißig Personen, die es sich in der Dunkelheit bequem gemacht hatten und sich über meine Überraschung und Verlegenheit lustig machten. Die Jugendlichen hatten auf dem Gras einen Halbkreis um die Sängerin gebildet; und ich hatte mich im Glauben, nicht aufzufallen, genau davor niedergelassen.
Ich entschuldigte mich und setzte mich zu ihnen. Sie stellte sich vor: Sie hieß Hardy. Seltsamer Vorname für ein Mädchen, aber er passte gut zu ihr.
Nach ihrem letzten Lied bot sie mir eine Zigarette an. »Aber ich warne dich, das ist die letzte, ich mache nie Jungs an.
– Ah.«
Ich war eher langsam und nicht schlagfertig: Während ich noch nach einer originellen Formulierung suchte, war ich schon von Pfeilen durchbohrt. Ich setzte den Bogen ab und lächelte sie einfach an, ohne die geringste Hoffnung, ihr zu gefallen. Seit ich allein war und Fran nicht mehr an meiner Seite hatte, um mir einzuflüstern, ich sei unsterblich und daher allem überlegen, war mein Selbstbild zu dem einer hoffnungslos gewöhnlichen Person geschrumpft.
Hardy, die in weiten bequemen Hosen im Schneidersitz neben mir saß, war eine begnadete Quasselstrippe: Sie berauschte sich an ihren eigenen Sätzen; kaum ausgesprochen, begannen sie von Neuem und entrollten sich kreiselnd wie endlose bunte Bänder voller Wörter und Ideen in einem durchsichtigen Brunnen. Sobald ich meinen Blick auf ihren Mund oder ihre Augen richtete, wurde mir beinahe schwindlig. Außerdem hatte sie getrunken. Sie ließ das Bier direkt aus der Flasche in ihren feinen rosa Mund rinnen. Die Zarte mit den feinen Zügen einer florentinischen Statue kam aus der Banlieue Nord, aus dem Milieu der kleinen weißen Leute, die ihr zufolge völlig uninteressant waren. Um Mitternacht wusste ich schon fast alles über Hardy und verkannte ebenso viel. Der Vater hatte die Familie verlassen, und sie war von ihrer Mutter und einer Tante, die sie nicht mochte, in einem Wohnblock in Aubervilliers aufgezogen worden. In der Schule hatte sie gute Noten geschrieben und gehofft, sich dadurch aus der Patsche ziehen zu können. Sie wusste nicht, wie die Bäume hießen, fürchtete sich vor Tieren, ekelte sich vor allem Glibberigen, auch vor Spinnen, das ganz nebenbei gesagt, denn ich kam ja vom Land (von wo noch mal?), zog sie mich auf. Sie wollte Ärztin oder Sängerin werden. Das war noch nicht entschieden. Ihr war klar, dass sie ziemlich hübsch aussah, aber Männer interessierten sie nicht: Die wussten, was sie wollten, sie auch, und es war nicht dasselbe. Sie redete sowieso zu viel. Dazu kam in ihren Augen etwas wirklich Indiskutables: Typen, die mit Fettflecken auf dem Hemd rumliefen, die sich vernachlässigten, im Ernst, wer wollte so einen zum Ehemann? Sie hatte nicht die Absicht, ihr Leben damit zu verbringen, Monsieur die Wäsche zu machen, zu bügeln und seine Erziehung zu vervollständigen, weil seine Mutter es versäumt hatte. Sie wollte zwei Kinder: Eines war nicht genug, drei schon wieder zu viel. Der Kinderwunsch wurde den Frauen aber immer noch eingebläut, und danach waren sie es, die sich um den Nachwuchs kümmerten, nein danke. Sie war sehr ungeschickt, zerbrach Geschirr und stieß sich an Tischecken. Ihre Lieblingsgruppe waren die Breeders. Ob ich die kenne? In der Dunkelheit warf ich einen verstohlenen Blick auf mein Hemd, um zu sehen, ob es Flecken und Falten hatte. Leider gab es welche. Meine Studentenbude war nicht mit Bügelbrett und Bügeleisen ausgestattet (und diese Woche hatte ich vergessen zu waschen).
Endlich machte sie eine Atempause, und ich konnte eine Frage anbringen.
»Warum heißt du Hardy?
– Na, weil ich mutig bin. Und du?
– Ich weiß nicht. Mein Name hat keine besondere Bedeutung.
– Du begleitest mich jetzt nach Hause, aber versuch nicht, mich zu küssen. Das hasse ich nämlich. Okay?«
Sie verabschiedete sich von allen ihren Freunden, es waren viele, und ich ging mit ihr zur nächsten Métro-Station. Wir lachten über einen Besoffenen, der versuchte, sie auf dem Bahnsteig mit einem »Sie sind reizend, Mademoiselle« zu ködern, sie wies ihn sehr humorvoll ab, dann drückte ich ihr verlegen die Hand zum Abschied, und sie bat mich, meinen Namen, Adresse und Telefonnummer auf eine Zigarettenschachtel zu schreiben. Zum ersten Mal seit meinem siebten Lebensjahr schlief ich nicht mit dem Gedanken an mich selbst ein. Ich hinterließ Fran eine Nachricht, um am nächsten Tag mit ihm etwas trinken zu gehen; und während seines üblichen Monologs über das unendliche Leben, das mich von allen anderen Menschen unterscheide, in der Bar neben dem Krankenhaus Val-de-Grâce, in Paris und anderswo, fielen mir geistreiche und originelle Kommentare zu Hardys Sätzen ein, die sich immer wieder in meinem Kopf drehten wie Holzpferdchen eines Karussells nach dem Ende der Kirmes.
In der darauffolgenden Woche rief Hardy mich an, wir verabredeten uns im Kino, und von da an pilgerten wir gewöhnlich jeden Sonntag ins Multiplex an der Place d’Italie.
»Was für ein Mist, seufzte sie eines Abends. Nach einem schlechten Film fühle ich mich dreckig. Es ist wirklich verplemperte Zeit. Manchmal – geht es dir nicht auch so? – habe ich den Eindruck, am Rand meines Blickfelds den Countdown der vergehenden Minuten, Stunden und Tage zu sehen, und sage mir: Dir bleibt exakt so viel Zeit vor deinem Tod, warum verschwendest du also eineinhalb Stunden deines Lebens für nichts und wieder nichts?
– Nein, gab ich zu, an so was denke ich nie.
– Da hast du aber Glück. Na gut, scherzte sie, jetzt kennen wir uns schon drei Monate, und du hast mich immer noch nicht geküsst, worauf wartest du eigentlich? Dass ich dir die Erlaubnis gebe? Darauf kannst du lange warten.«
Ich wusste nicht, was ich antworten sollte.
»Hast du keine Lust?«
Ich gab ihr zu verstehen, dass ich sehr große Lust hatte.
Ich habe nie begriffen, was sie an mir fand, aber sie hatte mich auserwählt; und Hardy änderte ihre Meinung nicht. Sie studierte sehr fleißig, geradezu aufopferungsvoll: Wenn ich in der Bibliothek hinter ihr saß, schweifte ich oft ab und konnte mich nicht mehr konzentrieren, während ich stundenlang ihren weißen Arm und die tausend kleinen Bewegungen und leichten Zuckungen ihrer Schulter und ihres Ellenbogens betrachtete, die wie Zeichen einer Geheimsprache oder eines hypnotischen Morsealphabets waren, das ich nicht zu entziffern vermochte. Sie las und lernte unaufhörlich, getrieben von einem großen Wissensdurst, den man daran erkennen konnte, wie sie ihre Bücher hielt, öffnete und wieder schloss. Ihre Hände begehrte ich am meisten, weil sie eine Art Eigenleben zu haben schienen, das sich aus ihrem Bauch, ihrem Brustkorb und ihren Brüsten speiste, während die Seele ihres Geschlechts, ihrer Schenkel und Waden eher bis in die Füße ausstrahlte, die unter dem Tisch einen ständigen Tanz vollführten. Und plötzlich stieg alles Energische und Junge an ihr in einer nervösen Gegenbewegung hoch, um erneut in den Fingerspitzen zu pulsieren, mit denen sie während der Vorbereitung der Prüfungsthemen ungeduldig ihren Haarknoten neu zurechtzurrte. Eine andere Geste, die sie oft wiederholte und die an eine Tänzerin beim Aufwärmen erinnerte, bestand darin, alle Fingerglieder einzeln zum Knacksen zu bringen und anschließend ihr Handgelenk wie einen Kreisel um die eigene Achse kreisen zu lassen. Sie trug keinen Armreif, aber die Bewegung legte es nahe. Sie zog sich nie so hübsch an, wie sie es hätte tun können, bemühte sich nicht, ihre Schönheit zur Geltung zu bringen, dabei wusste sie wohl, wie man Jungs verführte, aber wahrscheinlich fand sie das Ganze langweilig. Manchmal weinte sie plötzlich, es brach wie ein gewaltiger Strom aus ihr heraus, und sie presste die Vorderarme so fest vor die Augen, dass meine Kräfte nicht ausreichten, ihr Gesicht wieder zum Vorschein kommen zu lassen. Es war, als wolle sie sich vor den Felsbrocken eines einstürzenden Himmels schützen; dann verging es wieder, lachend zitierte sie: Life is unfair, kill yourself or get over it. Es stammte aus einem Song. Sie war von einem abgründigen Hass gegen Intriganten, Karrieristen, Erben und Profiteure getrieben, die nach Erfolg streben, weil sie die Mittel dazu haben, weil ihnen die Arbeit dafür vorgekaut wurde, weil es ihnen leicht gemacht wird – vom Hass derer, die wissen: Für uns wird es nicht so laufen. Wir haben keinen Stammbaum im Rücken. Manchmal sah ich sogar, wie sie gut situierte Männer anlockte, in der Hoffnung, ihnen schaden oder sie demütigen zu können. Aber das dauerte nie lange: Hardy wusste, dass Groll nichts als Zeitverschwendung und Verachtung nur Energieverlust ist.
Später lernte ich ihre Mutter kennen, eine sanfte Frau, die in allem gleich das Schlimmste sah, und ihre Tante, die sich nicht unnötig mit Fragen aufhielt, aber einen schlechten Charakter hatte. So aufzuwachsen war kein Spaß. Hardy hatte sich selbst geschaffen, ohne jegliche Hilfe von außen; deshalb waren Teile von ihr solide, stabil, fast zu sehr, und andere erwiesen sich bei der Berührung einer beliebigen Stelle ihres Körpers oder ihres Geistes als instabil und brüchig wie schlecht gebrannter Ton, der schon beim Anfassen in sich zusammenfällt: Ihre Seele glich einer sehr schönen Statue aus Sand und Marmor, deren extreme Härte und Zerbrechlichkeit sich behutsam tastenden Fingern nach und nach offenbarte. Manchmal rührte ich an einen Punkt, der mir unverfänglich schien, und alles stürzte ein, sie geriet in Panik; ein andermal kam sie mir ganz im Gegenteil unerschütterlich und geradezu auf einen Sockel der Vernunft geschraubt vor. Je besser ich sie kannte, desto mehr schämte ich mich dafür, mir dummes Zeug über Leben und Tod erzählt und zusammen mit Fran nutzlose Schimären erfunden zu haben.
Sie versuchte nur, sich würdevoll aus der Affäre zu ziehen; alles andere war purer Luxus.
Ich stellte Hardy meinen Eltern vor, die sie gleich mochten, aber Fran erzählte ich bis zum Winteraufstand nicht von ihr. Ich war so sehr mit meiner leidenschaftlichen, überwältigenden Liebe beschäftigt, dass ich fast nicht mehr an das Blut und die Versprechungen meines Freundes dachte; wenn es mir gelegentlich nach einem Abend mit Hardy beim Einschlafen einfiel, fühlte ich mich nicht wie jemand, der an Gott geglaubt hatte und davon abgekommen war, sondern eher wie einer, der vom Traum eines anderen hört und nicht versteht, wie der andere sich blindlings in einer kindlichen, geradezu beneidenswerten Vertrauensseligkeit derartigen Märchen hingeben kann. Im Moment waren meine Blutungen nichts anderes als eine schöne Fabel für die Zeit der Unschuld. Sobald ich versuchte, mich ernsthaft auf diese Idee zu konzentrieren, schweifte mein Geist immer mehr ab, die konkrete Zukunft kam mir in den Sinn, ich hatte vor, zu Semesterbeginn für Hardy und mich ein kleines Apartment in der Gegend von Le Plessis zu mieten. Doch es war nicht sicher, ob ich Wohngeld für Studenten bekommen würde, und ich überlegte, einen kleinen Job anzunehmen, vielleicht als Kellner in einem Bistro. Die reale Arbeitswelt war mir vollkommen fremd, deswegen entwickelte ich eine Art Minderwertigkeitskomplex gegenüber Hardy, die ihre Bücher fürs Studium und ihr Essen in der Kantine durch einen Wochenendjob als Empfangsdame finanzierte. Die Zustände empörten sie.
Hardy glaubte an die Veränderung, sie führte mich an soziale Fragen heran, und ich folgte ihr. Zu jener Zeit entstand als Folge der langen Wirtschaftskrise, die die Stimmung im Land erhitzt hatte, eine neue Bewegung. Wir waren halb Zuschauer, halb Akteure des Aufstands, weil wir keiner Organisation angehörten und die Politik mit dem gesunden Menschenverstand der Naiven reflektierten. Andere unter Hardys Freunden hatten sich seit Langem radikalisiert und prophezeiten einen Bürgerkrieg: Nichts hielt mehr zusammen. In Paris kam es bei den großen Winterstreiks zum Zusammenstoß mit den Ordnungskräften; wir demonstrierten gemeinsam mit unseren Kommilitonen im Schneetreiben. Wenige Meter vor unserer Riege gab es drei Tote: Ich bekam Angst und wollte Hardy in Sicherheit bringen.
Vielleicht lag es daran, dass ich sie zum ersten Mal in meine Arme genommen hatte, dass mein Blut anfing zu fließen.
»Was hast du?« Hardy dachte wahrscheinlich, ich sei getroffen worden.
Ich suchte in der Innentasche meiner Lederjacke nach Frans Droge, die ich immer noch bei mir trug. Hardy wollte mir helfen und riss mir fieberhaft und ungeschickt die Phiole aus der Hand: Sie fiel zu Boden und zerbrach auf dem vereisten Trottoir.
Im Hauseingang, in den wir uns vor der allgemeinen Aufregung geflüchtet hatten, überfiel mich eine zusätzliche Panik, deren Grund ich Hardy nicht nennen konnte. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Schon bald war ich buchstäblich blutüberströmt, und soviel ich auch mit meinem dicken Karohemd über Wangen, Hals und Schultern wischte, verlor ich doch immer mehr Blut. Auf den verschneiten Boulevards, die von der Place de la République ausgingen, wurde ich in dem ganzen qualmenden Durcheinander sogar für einen Verletzten gehalten. Ein Foto, das die Presseagentur von den Ereignissen gemacht hat, zeigt mich jedenfalls als Opfer polizeilicher Gewalt.
Fran musste so schnell wie möglich geholt werden, um mir das Gegengift zu bringen. Widerwillig gab ich Hardy seine Handynummer, ohne ihr richtig zu erklären, wer er war.
Und so lernte sie ihn kennen.
Ehrlich gesagt hatte ich dadurch, dass ich sie miteinander bekannt machte, das schamlose und unangenehme Gefühl, zum ersten Mal zwei entgegengesetzte Seiten meiner selbst zusammenzubringen.
Wir aßen zu dritt in einem China-Restaurant, ohne viel zu reden.
Wie nicht anders zu erwarten, mochte sie ihn überhaupt nicht, was auf Gegenseitigkeit beruhte. Als Hardy nach dem Essen zur Toilette ging, brachte Fran sein Tablett zur Theke und murmelte: »Sie wird dir nie glauben.« Durch Hardys Augen sah ich in ihm zum ersten Mal das, was er wohl war: ein langer Schlaks mit irrem Blick in einem dreckigen Hemd.
»Was ist denn das für ein Typ?«, fragte sie mich auf dem Heimweg.
Zuerst sagte ich ihr nicht die ganze Wahrheit: Ich lavierte herum. Im Frühling erzählte ich schließlich, so als müsse ich ihr etwas gestehen, dass ich von klein auf überzeugt gewesen sei, nicht sterben zu müssen, und dass Fran mir beigebracht habe, felsenfest daran zu glauben. Er halte mich für einen Auserwählten oder etwas in der Art. Ich selbst wisse nicht, was davon zu halten sei, obwohl ich ihn gernhabe.
Ich sehe die Szene vor mir: Hardy und ich lagen in der Gegend, aus der ich stamme, auf einem bewaldeten Hügel zwischen Ahorn und Espen ausgestreckt, unsere Räder neben uns auf dem Boden. Es war fast Mitternacht, und wir betrachteten die Sterne über den vereinzelt stehenden renovierten Höfen, deren Lichter in der Dunkelheit schon eines nach dem anderen erloschen. Hardy hatte meinen Kopf an ihren Bauch gelehnt und mir lange die Haare gekrault; ich merkte, dass meine heimliche Krankheit sie verunsicherte, doch sie war sehr geduldig.
»Ich glaube, Fran ist nicht dein Freund. Er tut dir nicht gut. Jeder von uns ist schon mal so einem begegnet. Wenn du weiter auf ihn hörst, wirst du nie anfangen zu leben. Ich hab dich sehr lieb, aber du bist verklemmt.«
Ich versuchte ihr zu erklären, dass ich als Kind keinen anderen Freund außer ihm gehabt hatte. Er war mein Weggefährte.
»Du musstest ihm vertrauen, solange du klein warst. Das ist ganz normal.«
Ich weinte, was ich in meinem Leben insgesamt selten getan habe, aber nur ein bisschen und nicht lange, weil ich mich schämte und große Angst davor hatte, mein Inneres preiszugeben. »Ich kann nicht anders, ich glaube, ich werde nie sterben. Wirklich. Ich bin nicht wie die anderen.« Ich hätte das gerne erklärt, meine Gedankengänge durch Beweise oder wenigstens Hinweise erhärtet, und doch konnte ich es nicht; ich schaffte es nicht einmal, ihr begreiflich zu machen, wie sehr ich daran glaubte, so sehr fürchtete ich, sie würde mich zum Arzt schicken (ich hatte Angst vor Analytikern und Psychiatern) oder mich auf der Stelle verlassen. Ich hatte angenommen, Frans Hirngespinste abgeschüttelt zu haben, aber jetzt, wo man von mir verlangte, alles zu leugnen, fand ich eine Art Glauben wieder, ich fühlte erneut das feste und kindliche Vertrauen, das ich diesem Spinner in meinen ersten Lebensjahren geschenkt hatte.
Hardy bewies große Geduld. »Denk doch mal nach: Du weißt, dass es falsch ist, es ist nicht möglich, nicht zu sterben. Werd mal ein bisschen erwachsen.« Und sie streckte ihre langgliedrige geäderte Hand nach meinem Nacken aus, schob mein beunruhigtes Gesicht auf ihren Unterbauch, ihrem Geschlecht unter dem Sommerkleid zugewandt. »Du wirst sterben, wie alle Menschen. Ich liebe dich.« Es war das allererste Mal, dass sie es aussprach. Ich musste eine Wahl zwischen ihrer Liebe und meinem Wahn treffen: Ich entschied.