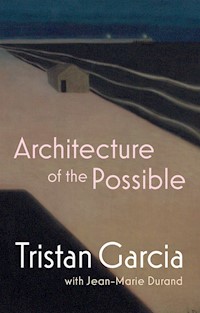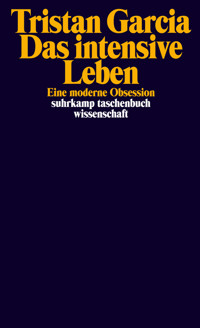
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im 18. Jahrhundert fasziniert ein neues Fluidum die Welt: die Elektrizität. Mit ihr wird die Intensität zu einem Ideal für den Menschen und zu einem Begriff der Philosophie. Von der Macht Nietzsches bis zum Vitalismus Deleuze', von der nervösen Erregung der Libertins bis zum Adrenalinkick der Begierde, der Leistung und der Extremsportarten: die Intensität organisiert seither unsere Welt. Sie ist der höchste Wert des modernen Lebens, wie der junge französische Philosoph Tristan Garcia in seinem mitreißenden Essay zeigt.
Die ständige Suche nach Intensität ist allerdings auch anstrengend: süchtig jagen wir neuen Höhepunkten und Extremen nach, immer unter Strom. Kein Wunder also, dass in unseren »Hochspannungsgesellschaften« das Unbehagen wächst. Die intensive Landwirtschaft zerstört die Natur, das Selbst ist erschöpft, Apathie, Mittelmäßigkeit und Depression signalisieren das Ende des großen Wachstums- und Intensitätsrauschs. Wie können wir dennoch das Gefühl bewahren, am Leben zu sein? Jenseits von Lebenshilfe und Glücksratgebern, die Weisheit und Seelenheil in einer Rückkehr zu Buddhismus oder Religion versprechen, und mit der E-Gitarre im Gepäck ruft Garcia zum Widerstand auf. Seine Forderung: Wir brauchen eine Ethik der Intensität.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Im 18. Jahrhundert fasziniert ein neues Fluidum die Welt: die Elektrizität. Mit ihr wird die Intensität zu einem Ideal für den Menschen und zu einem Begriff der Philosophie. Von der Macht Nietzsches bis zum Vitalismus Deleuze’, von der nervösen Erregung der Libertins bis zum Adrenalinkick der Begierde, der Leistung und der Extremsportarten: Die Intensität organisiert seither unsere Welt. Sie ist der höchste Wert des modernen Lebens, wie der junge französische Philosoph Tristan Garcia in seinem mitreißenden Essay zeigt.
Die ständige Suche nach Intensität ist allerdings auch anstrengend: Süchtig jagen wir neuen Höhepunkten und Extremen nach, immer unter Strom. Kein Wunder also, dass in unseren »Hochspannungsgesellschaften« das Unbehagen wächst. Die intensive Landwirtschaft zerstört die Natur, das Selbst ist erschöpft, Apathie, Mittelmäßigkeit und Depression signalisieren das Ende des großen Wachstums und Intensitätsrauschs. Wie können wir dennoch das Gefühl bewahren, am Leben zu sein? Jenseits von Lebenshilfe und Glücksratgebern, die Weisheit und Seelenheil in einer Rückkehr zu Buddhismus oder Religion versprechen, und mit der E-Gitarre im Gepäck ruft Garcia zum Widerstand auf. Seine Forderung: Wir brauchen eine Ethik der Intensität.
Tristan Garcia, geboren 1981, ist ein französischer Philosoph und Schriftsteller. Er ist ein Schüler von Alain Badiou, gegenwärtig Maître de conférences an der Universität von Lyon und gehört zum Kreis der philosophischen Bewegung des Spekulativen Realismus. Für seine in zahlreiche Sprachen übersetzten Werke wurde er mehrfach ausgezeichnet. Auf Deutsch erschien zuletzt sein von der Kritik gefeierter Roman Der beste Teil der Menschen, für den er den Prix de Flore erhalten hat. Sein Buch Das intensive Leben. Eine moderne Obsession stand in Frankreich auf der Shortlist des Prix Femina 2016 für den besten Essay.
Tristan Garcia
Das intensive Leben
Eine moderne Obsession
Aus dem Französischen von Ulrich Kunzmann
Suhrkamp
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel La vie intense. Une obsession moderne © Autrement, Paris, 2016.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2017
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2017
Erste Auflage 2017
© dieser Ausgabe Suhrkamp Verlag Berlin 2017
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Zur Gewährleistung der Zitierbarkeit zeigen die grau hinterlegten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner
eISBN 978-3-518-75106-0
www.suhrkamp.de
Inhalt
Einleitung
1 Ein Bild
Wie sich die Elektrizität auf das Denkenausgewirkt hat
2 Eine Idee
Um etwas mit sich selbst zu vergleichen
3 Ein Konzept
»Man müsste alles mit Intensitäten interpretieren«
4 Ein moralisches Ideal
Der intensive Mensch
5 Ein ethisches Ideal
Intensiv leben
6 Ein entgegengesetztes Konzept
Der Routineeffekt
7 Eine entgegengesetzte Idee
In der ethischen Zwickmühle
8 Ein entgegengesetztes Bild
Etwas widersetzt sich
Danksagung
Anmerkungen
Namenregister
Dank an Agnès
Einleitung
Pausenlos werden uns Intensitäten versprochen. Seit unserer Geburt und beim Heranwachsen suchen wir unausweichlich nach starken Empfindungen, die unser Leben rechtfertigen sollen. Diese plötzlichen Erregungen, die von sportlichen Leistungen, Drogen, Alkohol, Glücksspielen, Verführungen, Liebe, Orgasmus, Freude oder physischem Schmerz, dem Betrachten oder dem Schaffen von Kunstwerken, wissenschaftlichen Forschungen, schwärmerischem Glauben oder inbrünstigem Engagement verursacht werden, lassen uns aus der Monotonie, dem Automatismus und dem immer gleichen Stammeln, aus der existenziellen Plattitüde erwachen. Denn eine Art von Vitalitätsverlust bedroht ständig den Menschen, der sich bequem eingerichtet hat. Einst war eine solche Abstumpfung die Zwangsvorstellung des untätigen und übersättigten Herrschers, der faulen Schattenkönige, die verzweifelt nach einer Zerstreuung suchten, wie dies für Nero, Caligula oder die Eroberer galt, die bei dem einschlummerten, was man »die Wonnen von Capua« genannt hat: Das Paradox, das den Überlegenen bedrohte, bestand darin, dass er, wenn er triumphierte, all seine Wünsche befriedigte und all seine Ziele erreichte, nun spürte, dass in ihm die existenzielle Spannung und Nervenstärke nachließen, und dann verlor er diese unbestimmbare Empfindung, die es einem Lebenden ermöglicht, die Intensität seiner eigenen Existenz günstig zu bewerten.
10Je mehr sich der Westen wirtschaftlich weiterentwickelte, weil sich immer mehr Menschen sattessen konnten, ein Dach über dem Kopf hatten und Zeit für Vergnügungen fanden, hat sich diese Furcht des Siegers demokratisiert und durch die wachsende Befriedigung ihrer Bedürfnisse auf die frustrierten modernen Individuen übertragen. Den ruhiggestellten Menschen fehlt das Gefühl, wirklich zu leben, das sie denen zuschreiben, die unter schwierigen Umständen kämpfen und überleben. Nun wird aber dieses Gefühl eines nervösen Wachzustandes, wenn es schon oder bald verloren ist, oft mit einer sonderbaren inneren Kraft identifiziert, die sich nicht genau quantifizieren lässt, jedoch von der Intuition, die den Grad des Engagements eines Menschen bei seinen Empfindungen bestimmt, unfehlbar erkannt wird. Äußerlich kann man immer einschätzen, ob ein Mensch besitzt, was er benötigt, ob sein Leben leicht oder schwer ist, und sogar, ob er glücklich oder unglücklich ist. Niemand aber kann in das Herz eines Menschen eindringen, um an dessen Stelle zu ermitteln, ob sein Existenzgefühl schwach oder stark ist. So etwas kann man einer Subjektivität nicht nehmen: Dies ist ihre unverletzliche Festung. Es gibt das, was uns in den Augen eines Beobachters widerfährt, und dann gibt es das persönliche Maß, die innere Messlatte für das, was wir für uns selbst empfinden: Genau dies ist die Intensität. Selbstverständlich kennt man seit langem die physiologischen Zeichen, auf die unsere Art wie alle übrigen Säugetierarten achtet: beschleunigte Atmung, starkes Herzklopfen, rascher Puls, Kontraktion der Haarmuskeln, Schaudern, gerötete Wangen, erweiterte Pupillen und erhöhter Tonus – die Zeit des Adrenalinschubs. Doch es gibt auch diesen geheimnisvollen »In-11tensitätsgrad des Selbst in sich selbst«, der sich nicht auf die physische Erregung beschränken lässt. Dies ist das Gefühl, mehr oder weniger man selbst zu sein: Die gleiche Wahrnehmung, der gleiche Moment, das gleiche Zusammentreffen können bekanntlich mehr oder weniger stark empfunden werden. Nicht allein der Inhalt einer Erfahrung macht ihre Intensität aus: Ein harmlos scheinender Augenblick, eine tausendmal ausgeführte Geste, ein wohlbekannter Gesichtszug können plötzlich hervortreten und uns den epiphanischen Eindruck eines elektrischen Schlags vermitteln. Dieser Schlag setzt uns wieder der Intensität des wahren Lebens aus und reißt uns aus dem Morast der Routine, in dem wir versunken waren, ohne es überhaupt zu bemerken. Ebenso können wir auf einen lange erwarteten Moment, eine glückliche Nachricht, ein schreckliches Drama oder ein erhabenes Werk insgeheim gleichgültig reagieren. Warum? Es gibt keine genaue und unveränderliche Beziehung zwischen dem, was wir erfahren, und der Intensität unserer Erfahrungen. Wenn unser Wesen von diesem Blitzschlag getroffen wird, der es ermöglicht, einen Augenblick dem höchsten Grad unseres eigenen Existenzgefühls nahezukommen, ist dies etwas Unbeständiges. Von der Geburt bis zum Tode entwickeln wir uns in Abhängigkeit von der Modulation dieser Entladung, die wir erhoffen und fürchten, die wir hervorrufen wollen, wenn sie uns fehlt – und jeder von uns findet die Möglichkeit, deren Stärke und Häufigkeit zu bewerten. Die Technologie verspricht uns sogar, wenn schon nicht diese Intensitätsvariationen, so doch wenigstens ihre physiologischen Auswirkungen mit Statistiken zu messen und zu untersuchen. Die kürzlich auf den Markt gekommenen Fitness-Armbänder, die es dem 12Benutzer ermöglichen, seine Belastungsspitzen, seinen Herzrhythmus und die Tiefe seines Schlafs in Echtzeit zu überwachen, fördern somit einen bestimmten modernen Menschentypus, der Leser und ständiger Interpret der chiffrierten Variationen seines Wesens ist. Angeblich kontrollieren wir die Entwicklung unserer Lebensintensität, die sich wie ein kleiner, auf die Schleife einer Achterbahn geschickter Wagen auf und ab bewegt. Dem Charakter und den Interessen eines jeden entsprechend, kann dieses lebhafte Gefühl in dem Augenblick wieder auftauchen, wenn man beim Poker den Einsatz nach einem wenig aussichtsreichen Call einstreicht, wenn man bei einer besonders hart umkämpften Online-Partie siegt, sich auf einer einsamen Straße eine Spitzengeschwindigkeit erlaubt, in freiem Fall einen Bungee-Sprung wagt, sich von einer Klippe hinabstürzt, eine neue Kletterroute erschließt, auf die Jagd geht, mit vom Lampenfieber zugeschnürtem Magen auf eine Bühne tritt, sich über Sicherheitsempfehlungen hinwegsetzt, das Gesetz übertritt, sich mit Genossen zu einer erregenden Diskussion über den kommenden Aufstand trifft, auf die Straße geht, um es mit der Polizei aufzunehmen, wenn man sich auf einem Parkplatz für einen Fight unter Fans verabredet oder auch wenn man sich ins Bett legt und einen wie eine Droge wirkenden Thriller liest, dessen Umschlagrückseite versichert, dass er Sie in ganz neuer Weise schockieren wird, wenn man Filme ansieht, die immer krassere Gore-Szenen enthalten, wenn man Energy-Drinks genießt, eine Line Kokain zieht, masturbiert, sich zufälligen Ereignissen gegenüber öffnet, sich verliebt oder den Versuch unternimmt, sich wieder als Subjekt seines Lebens zu fühlen, wobei man sich jedoch paradoxerweise gehenlässt, um endlich ganz 13auf seine Selbstkontrolle zu verzichten. Vielleicht hat sich schließlich in jedem von uns so etwas wie ein zunächst rudimentäres und dann verfeinertes Messinstrument unserer Lebensintensität herausgebildet, deren Variation in unsere Interessenabwägungen eingeht; wir sind unter der Bedingung vernünftig, dass wir zunächst regelmäßig und mehr oder weniger gesteuert eine Intensität empfinden, die ausreicht, um uns lebendig zu fühlen.
Die liberale westliche Gesellschaft hat das seit sehr langer Zeit verstanden und wendet sich an den entsprechenden Menschentypus. Sie hat uns verheißen, dass wir dies werden: intensive Menschen. Oder genauer gesagt: Menschen, deren Lebenssinn in der Intensivierung aller Vitalfunktionen besteht. Die moderne Gesellschaft verspricht den Einzelnen nicht mehr ein anderes Leben oder ein seliges Jenseits, sondern lediglich das, was wir schon sind – mehr und besser. Wir sind lebendige Körper, wir empfinden Lust und Leid, wir lieben, unablässig überwältigen uns Emotionen, doch wir wollen auch unsere Bedürfnisse befriedigen, uns selbst erkennen und außerdem das erkennen, was uns umgibt; wir hoffen, frei zu sein und in Frieden zu leben. Was uns nun als erstrebenswertes Gut angeboten wird, ist eine Steigerung unserer Körper, eine Intensivierung unserer Freuden, unserer Liebesgefühle und Emotionen; es geht stets um weitere Reaktionen auf unsere Bedürfnisse, um eine bessere Selbst- und Welterkenntnis, um Fortschritt, Wachstum, Beschleunigung, größere Freiheit und einen besser gesicherten Frieden. Dies ist die eigentliche Formulierung aller modernen Verheißungen, wobei wir nicht mehr ganz genau wissen, ob man ihnen glauben soll: eine Intensivierung der Produktion, des Verbrauchs, der Kommunikation, unserer Wahr-14nehmungen wie auch unserer Emanzipation. Seit einigen Jahrhunderten verkörpern wir einen bestimmten Menschentypus: Menschen, die eher für das Streben nach Intensivierung als nach Transzendenz – wie dies für die Menschen anderer Zeitalter und Kulturen galt – herangebildet wurden.
Schon in frühester Jugend lernen wir, mehr von derselben Sache zu wollen und zu wünschen. Und paradoxerweise lernen wir gleichzeitig, Variationen und Neuheiten nachzujagen. In beiden Fällen lehrt man uns, nicht mehr irgendetwas Absolutes, Ewiges oder Vollkommenes zu erwarten: Man ermuntert uns, das herbeizuwünschen, was eine Maximierung unseres ganzen Wesens ist.
In dieser Formulierung gibt es nichts Abstraktes: Sie ist sogar unsere konkreteste und trivialste Seinsweise. Man braucht nur auf die Sprüche zu hören, mit denen sich die von uns verbrauchten Waren täglich an uns wenden. In der heutigen Welt ist das geringste Angebot einer Freude eine kleine Intensitätsverheißung: Die Werbung ist nichts anderes als die artikulierte Sprache dieses Rausches der Empfindungen. Was uns verkauft wird, ist nicht nur die Befriedigung unserer Bedürfnisse, sondern auch die Aussicht auf eine gesteigerte Wahrnehmung und den messbaren und zugleich unschätzbaren Fortschritt einer gewissen sinnlichen Lust. Schokolade (»intensiv 86 %«), Alkohol (»intensiver Wodka«), Eiscreme (»Magnum intense«), Geschmacksrichtungen, Düfte und Parfums sind »intensiv«. So urteilt man über Erfahrungen, Momente und Gesichter. Mit einem immer häufigeren Anglizismus sagt man sogar über eine bemerkenswerte Persönlichkeit, sie sei »intensiv«. Man äußert es auch über alles Starke, Plötzliche und Originelle, das man genossen hat. Man 15könnte glauben, dass die Intensität somit zum Hauptwortschatz der Warenwelt gehörte. Doch nicht nur dies. Das Erstaunliche an diesem Begriff ist, dass er von allen Lagern gemeinsam benutzt wird. Die ideologischen Feinde, die sich auf unserer heutigen Weltbühne gegenüberstehen, teilen mindestens dieses eine Ideal: das Streben nach existenzieller Intensität. Liberale, Hedonisten, Revolutionäre und Fundamentalisten vertreten vielleicht nur entgegengesetzte Ansichten über den Sinn dieser von unserer Existenz benötigten Intensität. Konsumgesellschaft und hedonistische Kultur verkaufen Lebensintensitäten, doch ihre radikalsten Gegner verheißen ebenfalls Intensität, eine in diesem Fall nicht quantifizierbare Intensität, die nicht vermarktet wird, eine seelische Ergänzung, welche die Gesellschaft der materiellen Güter den Einzelnen angeblich nicht mehr bieten kann. Der revolutionäre Heroismus, der sich der Warenwelt regelmäßig entgegengestellt hat, beruhte auf der Verteidigung des intensiven »wahren Lebens« gegen die egoistische Berechnung der Körper und Geister. Gedichte, Lieder, die Stimmen der Revolte und die kritischen Diskurse, die andere Lebensformen fördern wollten, haben der kapitalistischen Zivilisation, dieser Zivilisation allumfassender Berechnung, stets deren Unfähigkeit vorgeworfen, eine Selbsterfahrung zu bewirken, die ausreichend intensiv wäre, um wünschenswert und gemeinsam nutzbar zu sein. Den illusorischen Versprechungen starker, aber monetarisierbarer Erfahrungen werden andere »Vibrationen« (die Vibes der Hippies und Rastas) oder andere lyrische »Wechselfeuer« unablässig entgegengestellt. Das normale westliche Leben mit seiner niedrigen existenziellen Intensität wird von Rimbaud bis zum Surrealismus, von Thoreau bis zur Hippie-Bewe-16gung, von Ivan Illich bis zu Der kommende Aufstand häufig kritisiert. Regelmäßig erklärt man sogar das Auftreten von gewalttätigen und »devianten« Verhaltensweisen, ob es sich nun um Amok oder den Terrorismus handelt, mit einem geheimnisvollen seelischen Mangel in der Konsumgesellschaft, die unfähig sei, ihrer Jugend eine ausreichend stimulierende Lebensintensität zu bieten. Man stellt sich vor, dass die Jugendlichen, die ausgezogen sind, um im Dschihad zu kämpfen, sich von einer trübseligen und konturenlosen Gesellschaft abgewandt haben, die ihnen kaum noch existenziellen Glanz zu bieten hatte. Somit ist das Intensitätsideal nicht nur das der liberalen Welt, sondern auch das ihrer Feinde. Intensität als überlegener Existenzwert ist außerdem das, was bei uns am meisten geteilt wird: Sie ist unsere Seinsweise; sie ist die menschliche Seinsweise, die wir vielleicht von der Moderne geerbt haben. Sobald man diese gemeinsame Lage lediglich festgestellt hat, streiten sich diejenigen, die sich für die aus der Moderne hervorgegangene liberale Gesellschaft aussprechen, und diejenigen, die sich gegen sie wenden, über das, was intensiv sein sollte: die Befriedigung meiner Bedürfnisse oder vielmehr mein bedingungsloses Engagement für eine Idee.
Doch was ist in beiden Fällen diese eigenartige innere Intensität des Lebens, die sie uns alle verheißen? Das Gefühl, dass es nicht das Leben irgendeines beliebigen Menschen sein könnte. Die Überzeugung, selbst wenn sie flüchtig ist, dass ich tatsächlich das Subjekt dessen bin, was ich erlebe. Wenn ich mir schließlich dessen nicht durch ein gewisses Etwas sicher wäre, das nur von mir abhängt, könnte ebenso gut ein anderer mein Leben führen, und ich könnte das Leben eines anderen führen: Jeder ist 17ersetzbar. Äußerlich können sich die Existenzen gleichen. Was sie jedoch unterscheidet, ist diese innere Gewissheit, dass es eine Kraft gibt, die ich allein messen kann. Diese Gewissheit, die nur mir vorbehalten ist, möchte man mir durch Predigten oder Lektionen über das Gefühl des wahren Lebens offenbaren.
Was ist die Intensität meiner Empfindung? Das, was ich den anderen nicht erklären kann, was mich jedoch gerade aus dem Grund überzeugt, dass zumindest mein Gefühl mir gehört. Dieses irreduzible Wesen der Intensität gibt ihr die ganze ihr zukommende Bedeutung und verbreitet eine Aura des Geheimnisses und zugleich des Offenkundigen: Unter Intensität versteht man das Maß dessen, was sich nicht messen lässt, die Quantität dessen, was sich nicht quantifizieren lässt, den Wert dessen, was sich nicht bewerten lässt. Die Intensität widersetzt sich der Berechnung, obwohl sie die subjektive Zuschreibung einer Größe ermöglicht. Während die Moderne eine Rationalisierung der Kenntnisse, Produktionen und Tauschbeziehungen, die Mathematisierung des Realen, die Herstellung einer gleichwertigen Ebene zwischen allen auf einem Markt tauschbaren Dingen bedeutete, bezeichnete die Intensität nun, gleichsam zum Ausgleich, den höchsten ethischen Wert dessen, was dieser Rationalisierung widersteht: Intensität ist nicht eigentlich irrational, aber sie lässt sich nicht auf diese Figuren der Rationalität reduzieren, wie es Objektivität, Identifikation, Teilung in Raum, Zahl und Quantität sind. Nach und nach wurde die Intensität zum Fetisch der Subjektivität, der Differenz, des Kontinuierlichen, des Unzählbaren und der reinen Qualität.
Im ästhetischen, moralischen oder politischen Bereich 18hat die Intensität zuerst als Widerstands- und Ausdruckswert all dessen gedient, was einzigartig scheint. Sie hat das einmalige Wesen einer Rauschempfindung oder einer blitzartigen Erfahrung bedeutet, die der Zerstückelung und Zerlegung des Wesens der Welt durch die berechnende, klassifizierende und normative Rationalität entgegengesetzt sind. Dann ist die Intensität selbst zu einer Norm geworden: der Norm eines Vergleichs jedes Dings nicht im Verhältnis zu etwas anderem, sondern im Verhältnis zu sich selbst. Wenn wir alle möglichen Intensitäten in unserer täglichen Existenz messen, wollen wir nur die Quantität des eigenen Selbst bewerten, die jede Sache ausdrückt. Dies ist der Grundsatz des Menschentypus, der mit dem existenziellen Wert des Intensiven verbunden ist. Was halten wir nun für das Schönste? Das, was sein Wesen intensiv verwirklicht. Wir alle sprechen diese Sprache der Intensität. Als schön beurteilen wir eine Person, die sich zu ihren körperlichen Merkmalen und ihren Charaktermerkmalen bekennt, die nicht versucht, anders zu sein, jedoch im Höchstmaß danach strebt, »sich zu verwirklichen«.
Für diejenigen unter uns, die dazu bereit sind, das Erbe der zwei oder drei letzten Jahrhunderte der Geschichte unserer Werte anzunehmen, ist dies das tiefste Ideal: ein inhaltsleeres Ideal, ein rein formales Ideal. Intensiv das zu sein, was man ist.
So hat die »ästhetische Intensität« den klassischen Schönheitskanon langsam überlagert. Dieser Kanon existiert zum großen Teil in der Fantasie derjenigen, die ihm heute nachtrauern, und er setzte voraus, dass man der Vorstellung eines von vornherein vorhandenen Ideals entsprach. Das Ideal wurde von Gesetzen der Symmetrie, der 19Harmonie und des Wohlgefallens beherrscht. All diese Gesetze haben auf den modernen Betrachter wie eine unrechtmäßige Gewalt gewirkt, die man dem autonomen Bild, Musikstück oder Text antat. Nun ging es nicht mehr darum, den Wert eines Kunstwerks zu beurteilen, indem man einschätzte, ob es der Vorstellung, wie es zu sein habe, entsprach oder nicht. Nein, man hoffte vielmehr, dass ein Werk dem Betrachter eine ganz neue und blitzartige Erfahrung bringt. Denken wir an die Happenings, den Wiener Aktionismus oder das Living Theatre. In den meisten Kunstgattungen besteht das Ziel nunmehr darin, die Darstellung durch den Schock der Präsenz der Dinge zu übertreffen. Der Betrachter strebt in diesem Fall weniger danach, eine Darstellung zu genießen, vielmehr will er von dem Schauder erfasst werden, das unkontrollierbare Übermaß der Präsenz dessen zu spüren, was sich vor ihm zeigt. Gleichzeitig kann er sich selbst ein wenig mehr und ein wenig besser präsent fühlen: Erschauernd will er den verlorenen Sinn des Hier und Jetzt wiederfinden. Allmählich hat sich die Vorstellung durchgesetzt, dass man ein Werk nach dem Maß seines eigenen Prinzips einschätzen sollte. Die moderne Ästhetik bestand darin, ein Werk oder eine Situation weniger auf von außen auferlegte Konventionen, sondern möglichst weitgehend auf ihre inneren Regeln zu beziehen. Aus dieser Sicht lässt sich nichts vollständig mit irgendetwas anderem vergleichen: Ein Gesicht, eine Landschaft, eine Körperbewegung werden nicht in Bezug auf den vordefinierten Typus eines Gesichts, einer Landschaft oder einer Bewegung gemessen, außer für einen Geist, den man als »neoklassizistisch« oder »reaktionär« bezeichnen würde, der noch nach Regeln oder Gesetzen der Schönheit sucht. Zwar können die 20Einzelnen hässlich, anmutslos, unharmonisch oder falsch in Bezug auf diese oder jene kulturelle Norm sein. Doch man weiß seit langem, dass sich diese Normen wandeln. Sie sind nicht ewig: Sie bilden sich heraus, sie veralten und gehen unter. Was hier als schön beurteilt wird, ist es dort nicht; was es jetzt ist, wurde gestern vielleicht als hässlich angesehen, und so wird es morgen wieder sein. Mit der Romantik hat der Westen gelernt oder wieder gelernt, das Vulgäre ebenso wie das Schöne zu schätzen. Das Missgestaltete kann sich zum Anmutigen, das Groteske zum Sublimen wandeln. Es gibt kein absolutes Kriterium für den Wert eines Kunstwerks, das von dessen Inhalt abhängt. Selbst aus dem Grauen kann ein Künstler etwas Großartiges gewinnen. Aus Überdruss kann er eine Art von paradoxer Freude oder Euphorie entstehen lassen. Aus Falschheit und Lüge eine Art von Wahrheit.
Wie soll man dann urteilen? Was allein zählt, ist, dass man bestimmt, ob es sich um etwas Starkes handelt. Und auch die Schwäche kann noch geliebt, gelobt und gefeiert werden, wenn sie auf starke Weise schwach ist. Wenn Mittelmäßigkeit von einem Werk nicht auf mittelmäßige Weise wiedergegeben wird, findet sie ihre Rechtfertigung. Es gibt also kein objektives Kriterium des modernen ästhetischen Gefühls mehr, sondern lediglich ein Kriterium, das sich auf die Art und Weise bezieht: Ganz gleich, was die Sache sein mag, Hauptsache, sie ist es mit Intensität.
Diese Intensität ist nichts anderes als das Prinzip des systematischen Vergleichs eines Dings mit sich selbst. Intensiv ist, was mehr oder weniger stark das ist, was es ist. Mag es nun abscheulich sein, schrecklich, provozierend, anspruchsvoll, erregend, melancholisch, deprimierend, kühn, ergreifend, widerwärtig, verbrecherisch, alb-21traumhaft … Nichts verbietet sich von vornherein. Was die betreffende Sache ist, zählt nicht, Hauptsache, sie ist es im größten und besten Maße.
Diese einfache Vorstellung hat allmählich nicht nur die Richtung unseres ästhetischen, sondern auch unseres ethischen Bewusstseins vollständig bestimmt. Im Verlauf der hier vorliegenden Untersuchung will ich versuchen, den Leser davon zu überzeugen, dass dieser Intensitätswert zum Ethos unserer Humanität geworden ist. Tatsächlich beherrscht und orientiert er das Wesentliche unserer Auffassung, was wir sein können und müssen. Was ist ein Leben wert? Eine Existenz anhand eines moralischen Modells zu beurteilen ist für viele, insbesondere seit dem 18. Jahrhundert, etwas Konformistisches, ja sogar Autoritäres geworden. Die Emanzipation der Individuen hat zu der modernen intuitiven Vorstellung geführt, Ethik bestehe darin, dass sich jeder Mensch sein eigenes Gericht schaffe. Man richtet nicht über eine Existenz, indem man sie mit einer anderen vergleicht; man schreibt keiner Lebensform vor, dass sie einer anderen gleichen müsse, die ihr als Zwangsmodell dienen sollte. Dennoch beurteilt man den ethischen Wert eines Menschenlebens. Unablässig versucht man, sein eigenes Leben zu bewerten. Doch ein einziges Gesetz leitet den modernen Prozess, in dem das Selbst über sich selbst richtet: dass das, was getan wurde, mit glühendem Herzen getan wurde. Ganz offenkundig bleiben moralische Werte übrig (Würde, Treue, Achtung …), auf deren Grundlage jeder – seinen Überzeugungen entsprechend – die Handlungen und die ganze Existenz eines Menschen als gut oder schlecht ansieht. Doch diese äußere Moral wird durch eine Art von innerer Ethik ersetzt, die ins Herz der Menschen eindringt 22und den Wert eines Lebens an und für sich betrifft. Ist es schön, gut, weise oder verrückt? Ist es glücklich? Ist es das Leben eines Verbrechers, eines Heiligen, eines finsteren Dreckskerls, eines Kleinigkeitenkrämers, eines gewöhnlichen Menschen …? Darauf kommt es nicht an. Das einzige anerkannte Prinzip scheint das folgende zu sein: Was auch immer die Motivationen und Handlungen dieses Menschen gewesen sind, man muss sich schließlich fragen, ob er »gründlich« gelebt hat, wenn man sich an diesen prosaischen Ausdruck hält, der jedoch genau wiedergibt, was nunmehr von uns erwartet wird. Bei allem besteht die einzige wahre Sünde darin, dass es an Intensität gefehlt hat. Man kann mittelmäßig glanzvoll gewesen sein. Besser ist, wenn man glanzvoll mittelmäßig gewesen ist.
Die Romane, Filme und Lieder sagen seit nahezu zwei Jahrhunderten nichts anderes: »Lebe! Wie auch immer du lebst.« – »Liebe! Wen auch immer du liebst.« Doch vor allem: »Lebe und liebe, soviel du kannst!« – denn am Ende wird nichts anderes als diese Lebensintensität gezählt haben.
Was wir für offenkundig halten, unterscheidet uns gleichwohl von anderen Menschentypen, die als größten Wert der Existenz anerkannten, dass man durch einen höchsten Zustand (ein Leben nach dem Tod, Seelenwanderung, Seligkeit, Ewigkeit) oder durch ihre Abgeklärtheit infolge der Auslöschung der variablen Intensitäten des Lebens (Erleuchtung, Nirwana, Ataraxie) über sie hinausging. Offenbar gehören wir zu einem Menschentypus, der sich von der Betrachtung und Erwartung eines Absoluten, einer Transzendenz als des letzten Sinnes der Existenz abgewandt hat, um sich einer bestimmten Zivi-23lisation zuzuwenden, deren Mehrheitsethik von der unablässigen Fluktuation des Seins als Lebensprinzip abhängt.
Vielleicht können wir nur noch das empfinden, was intensiv ist, also das, was zunimmt, abnimmt, sich ändert. Vielleicht definiert uns dies sogar.
Unser demokratisches kulturelles Leben ist gewiss das kollektive Maß dieser variablen Energien: das Neue, das auf das Neue folgt; das Unerwartete und Unerhörte, dem der moderne, kritische Geist, ausgehend von den Vorgaben der Magazine, Blogs und sozialen Netzwerke, nachjagt, wobei man der Mode und dem Leben der Ideen folgt, das Déjà-vu, das Gewöhnliche und Routinemäßige zurückweist … Haarschnitte und -farben, Modeaccessoires, Kleidungszuschnitte, -formen und -farbtöne, Kochrezepte, alkoholische Getränke, Liköre und Cocktails, Romane, Fernsehserien und Schlager, Humor, sportliche Leistungen, Prominentenpaare, politische Anschauungen oder Automodelle sind den wechselhaften Erregungen, dem Überdruss und den blitzartigen Reaktionen des Menschen ausgesetzt, der von der Neuheit elektrisiert wird, und der Apathie des blasierten Individuums. Diese Tendenzen, diese wechselnden ideologischen und ästhetischen Fluten zeichnen im Geist eines jeden eine unendliche Sinuskurve, die manche Zeitungen buchstäblich mit Höhen und Tiefen, Tops und Flops, In und Out abbilden: der hohen und niedrigen Intensität der heutigen Kultur. Diese hat gelernt, nicht mehr dogmatisch über den Eigenwert der Werke und Ideen zu urteilen, vielmehr widmet sie sich der relativen Stärke aller Erscheinungen, indem sie in Diagrammen das Has been und die »neue Welle«, die auf- und absteigenden Tendenzen darstellt und dabei ver-24folgt, was ermüdet und was erregt. Die moderne Kultur ist an diese variable Intensität, eine Sinuskurve gesellschaftlicher Elektrizität, ein annäherndes Maß des kollektiven Erregungsgrades der Individuen, gebunden.
Die Ursache der Erregung ist selbstverständlich wichtig, doch die Erregung selbst zählt am meisten. Allein dieses Erregungsgefühl ermöglicht es, ein Leben vom Anfang bis zum Ende durchzuhalten, um es vor Bitterkeit und Ressentiment zu bewahren. Man vertritt die Ansicht, dass derjenige, der nicht mehr erregt werden kann, verloren ist: Noch lebt er, doch er hat gewissermaßen aufgehört, innerlich zu leben. Er führt die Existenz eines Toten. Er ist bei früheren Erregungsinhalten stehengeblieben, die er nicht zu erneuern vermag. Man bemitleidet ihn.
Erkennen wir also im Großen und Ganzen an, dass das moderne Leben durchaus positive Inhalte vertreten hat: Inhalte des Glaubens, Inhalte des Engagements, der Werte, Ideen, Lager oder Stellungen. Du, woran glaubst du? Was wünschst du dir? Was hältst du für gerecht? Es gibt moralische Kriterien. Über diese kommt es zu politischen Auseinandersetzungen. Dennoch hat sich in der liberalen Gesellschaft eine für alle Normen gültige Norm durchgesetzt, der offenbar beinahe alle zugestimmt haben. Sie ist zugleich sehr einfach und sehr schwer fassbar. Sie ist ein höherer ethischer Wert, der von der kulturellen Sinuskurve oder der individuellen Adrenalinvariation, von der Fluktuation der Wunschvorstellungen, der Lust und des Leids, der Überzeugungen, Wahrheiten und Moden verkörpert wird, ein ununterbrochener Strom, den dieses einfache, unsere Existenzen leitende Wort »Intensität« zugleich in unserem Herzen und unserem Geist bezeichnet.
Sie ist das Urmeter, womit wir messen, was unser per-25sönliches Leben und zugleich unsere Zeit wert sind: Ist dies genug? Wird dies größer oder kleiner? Und dieser Intensitätscharakter bezeichnet nicht nur lokale Ströme oder Zyklen, mit ihm lässt sich auch die allgemeine Entwicklung der Gesellschaft einschätzen. So etwa kann man feststellen, dass zwei zum Wortschatz der Intensität gehörende Begriffe seit dem 18. Jahrhundert als regulierende Grundsätze für Politik und Wirtschaft des Westens gedient haben: Wachstum und Fortschritt. Der geschichtliche Fortschritt äußerte sich durch den Kampf für die Stärkung bestimmter politischer Werte: Freiheit und Gleichheit. Man schätzte den allgemeinen Fortschritt der Menschheit danach ein, wie intensiv sich diese oder jene Idee unter den Menschen verbreitet hatte. Wirtschaftswachstum bedeutete hingegen die positive Veränderung von Warenproduktion und kommerziellen Dienstleistungen, was sich mit verschiedenen Indikatoren messen ließ, von Quesnays großem »Tableau« bis zum Bruttosozialprodukt, vom Bruttoinlandsprodukt bis zum Bruttonationaleinkommen, vom Index der menschlichen Entwicklung bis zum Gini-Koeffizienten. Im Auf und Ab von Booms und Krisen schienen Wachstum und Fortschritt endlos, ohne einen möglichen Abschluss. Beide leiteten die Menschheit nicht in das Paradies, den Gottesstaat oder ein Jenseits. Sie verwiesen lediglich auf eine Zunahme, eine rationale Entwicklung und die Hoffnung, dass diese irdische Welt sich ständig verbessern würde. Wir haben so gehandelt, dass wir uns unbegrenzt veränderten, Fortschritt und Wachstum erreichten, und dieses Ideal schien uns am gerechtesten. Wir hielten es sogar für das einzig annehmbare. Es setzte nicht voraus, unseren Menschheitstypus in Beziehung zu endgültigen, im Him-26mel angesiedelten Bildern oder Ideen zu bringen, sondern nur, die menschliche Natur sich selbst anzupassen und das in der menschlichen Natur zu stärken, was am menschlichsten ist und am besten. Das heißt, dass sich der moderne Mensch bei seinen Handlungen von dieser impliziten Maxime beeinflussen ließ: Verhalte dich deiner menschlichen Natur und jener der anderen gegenüber so, dass du die menschliche Natur immer menschlicher und auf bessere Weise menschlich machst. Intensiviere sie. Sorge für ihren Fortschritt, lass sie in dir und bei allen anderen wachsen.
Nun bekommt aber diese dem modernen Geist vertraute Vorstellung eine beunruhigende Wirkung, sobald wir sie isolieren und von außen betrachten. Hätten ein Gelehrter des Altertums, ein Denker des Mittelalters, ein unter der Han-Dynastie Lebender, ein Brahmane der vedischen Kultur alle ihre – ästhetischen, moralischen, politischen – Werte