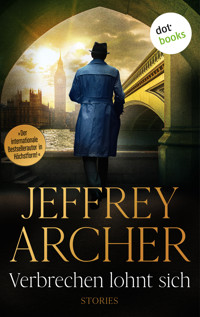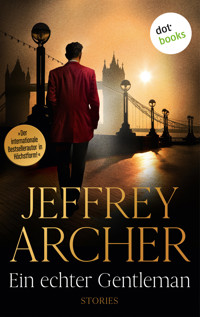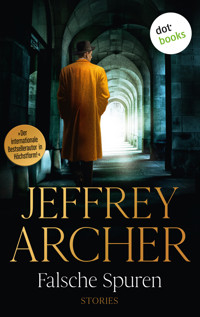2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Männer, grundverschieden und doch gleich: Der eine, Lubji Hoch, entstammt einer armen Familie osteuropäischer Juden. Er beginnt im Nachkriegs-Berlin mit dem Aufbau einer Zeitung. Der andere, Keith Townsend, Sohn eines Zeitungsbesitzers in Melbourne, steigt in wenigen Jahren zum bedeutendsten Verleger Australiens auf. Doch seine Träume gehen weit darüber hinaus. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich die Kreise dieser beiden Männer im Angesicht vom Kampf um Macht und Liebe schneiden werden. Jeder von ihnen hat das Ziel, das größte Medienimperium der Welt zu besitzen. Nur einer von ihnen wird überleben …
Dieses Buch erschien in Deutschland bereits unter dem Titel »Imperium«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 963
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
DAS BUCH
Zwei Männer, grundverschieden und doch gleich: Der eine, Lubji Hoch, entstammt einer armen Familie osteuropäischer Juden. Er beginnt im Nachkriegs-Berlin mit dem Aufbau einer Zeitung. Der andere, Keith Townsend, Sohn eines Zeitungsbesitzers in Melbourne, steigt in wenigen Jahren zum bedeutendsten Verleger Australiens auf. Doch seine Träume gehen weit darüber hinaus. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich die Kreise dieser beiden Männer im Angesicht vom Kampf um Macht und Liebe schneiden werden. Jeder von ihnen hat das Ziel, das größte Medienimperium der Welt zu besitzen. Nur einer von ihnen wird überleben …
DER AUTOR
Jeffrey Archer, geboren 1940 in London, verbrachte seine Kindheit in Weston-super-Mare und studierte in Oxford. Archer schlug zunächst eine bewegte Politiker-Karriere ein. Weltberühmt wurde er als Schriftsteller, »Kain und Abel« war sein Durchbruch. In Deutschland erscheinen seine großen Werke im Heyne Verlag. Mittlerweile zählt Jeffrey Archer zu den erfolgreichsten Autoren Englands, sein historisches Familienepos »Die Clifton-Saga« begeistert eine stetig wachsende Leserschar. Archer ist verheiratet, hat zwei Söhne und lebt in London, Cambridge und auf Mallorca.
JEFFREY ARCHER
DAS SPIEL
DER MÄCHTIGEN
ROMAN
Aus dem Englischen von Lore Strassl
Bearbeitet von Barbara Häusler
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe THE FOURTH ESTATE erschien erstmals 1996 bei HarperCollins, London
Der Roman erschien in Deutschland bereits unter dem Titel Imperium im Lübbe-Verlag.
Vollständige deutsche Erstausgabe 06 / 2019
Copyright © 1996 by Jeffrey Archer
Copyright © 2019 dieser Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Barbara Häusler
Copyright der deutschen Übersetzung by © Lore Straßl,
vermittelt durch Jörg Munsonius / Literaturagentur / Edition Bärenklau
Covergestaltung: DAS ILLUSTRAT, München
Covermotive: Getty Images / UpperCut Images und Shutterstock / amophoto_au
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-21800-3V003
www.heyne.de
Für Michael und Judith
Im Mai 1789 berief König Ludwig XVI. die sogenannten Generalstände ein. Der erste Stand umfasste 300 Adelige. Der zweite Stand umfasste 300 Geistliche. Der dritte Stand umfasste 600 Bürger und Bauern. Diese Stände sollten die Verteilung des Stimmrechts abbilden.
Einige Jahre nach der Französischen Revolution begab sich Folgendes. Bei einer Versammlung im englischen House of Commons deutete der Philosoph Edmund Burke zu der Galerie hinüber, die für die Vertreter der Presse vorgesehen war, und sprach: »Seht, dort drüben sitzt der vierte Stand – und er hat mehr Macht als alle anderen drei Stände zusammen!«
Extrameldung:
Schlacht der Medienzare um ihre Imperien
1
The Globe
5. November 1991
Armstrong vor dem Bankrott
Die Aussichten standen schlecht für Richard Armstrong. Doch schlechte Aussichten hatten Armstrong bisher nie Kopfzerbrechen bereitet.
»Faites vos jeux, mesdames et messieurs! Machen Sie Ihre Einsätze!«
Armstrong starrte auf den grünen Filz. Der Berg roter Jetons war in der kurzen Zeit von nur zwanzig Minuten zu einem einzigen kleinen Stapel geschrumpft. An diesem Abend hatte er bereits vierzigtausend Franc verspielt – aber was waren schon vierzigtausend Franc, wenn man in den letzten zwölf Monaten eine Milliarde Dollar verschleudert hatte?
Er lehnte sich vor und schob sämtliche übrig gebliebenen Jetons auf die Null.
»Les jeux sont faits. Rien ne va plus«, sagte der Croupier. Er setzte die Drehscheibe in Bewegung und ließ die kleine Elfenbeinkugel vom oberen Rand in den Kessel laufen. Sie flitzte im Kreis herum, ehe sie klappernd in die winzigen schwarzen und roten Fächer hinein- und wieder heraushüpfte.
Armstrong starrte ins Leere. Er senkte nicht einmal den Blick, nachdem die Kugel schließlich zur Ruhe gekommen war.
»Vingt-six«, verkündete der Croupier und machte sich sogleich daran, alle Jetons mit dem Rechen zu sich zu ziehen, außer denen auf der Sechsundzwanzig.
Ohne dem Croupier einen Blick zu gönnen, verließ Armstrong seinen Platz. Er schlurfte an den vollbesetzten Backgammon- und Roulette-Tischen vorbei zur Flügeltür, die aus der Welt des Glücksspiels in die Wirklichkeit hinausführte. Ein hochgewachsener Mann in blauer Livree öffnete dem weit bekannten Spieler die Tür und lächelte ihn in Erwartung des gewohnten 100-Franc-Trinkgelds an. Doch nicht einmal das war an diesem Abend drin.
Armstrong fuhr sich mit der Hand durch sein dichtes schwarzes Haar, schritt die üppig bepflanzten Terrassengärten des Casinos hinunter und vorbei am Springbrunnen. Seit der hastig einberufenen Vorstandssitzung in London waren vierzehn Stunden vergangen, und bei Armstrong machte sich die Erschöpfung bemerkbar.
Trotz seiner Körpermassen – Armstrong war seit Jahren nicht mehr auf eine Waage gestiegen – hielt er seinen schnellen, gleichmäßigen Schritt bei, als er über die Promenade eilte, bis er zu seinem Lieblingsrestaurant mit Blick über die Bucht gelangte. Er wusste, dass jeder Tisch seit mindestens einer Woche im Voraus reserviert war, und der Gedanke an den Ärger, den er bereiten würde, ließ ihn zum ersten Mal an diesem Abend lächeln.
Armstrong schob die Tür des Restaurants auf. Ein großer, hagerer Ober drehte sich um und versuchte seine Überraschung zu verbergen, indem er sich tief verbeugte.
»Guten Abend, Mr. Armstrong. Wie schön, Sie zu sehen. Wird sich Ihnen jemand anschließen?«
»Nein, Henri.«
Der Oberkellner führte den unerwarteten Gast durch das nahezu voll besetzte Lokal zu einem kleinen Tisch in einer Nische. Als Armstrong Platz genommen hatte, reichte ihm der Ober die große, ledergebundene Speisekarte.
Armstrong schüttelte den Kopf. »Nicht nötig, Henri. Sie wissen ja genau, was ich mag.«
Der Ober runzelte kaum merklich die Stirn. Weder Angehörige des europäischen Hochadels noch Hollywoodstars, ja, nicht einmal italienische Fußballprofis brachten ihn aus der Fassung, doch jedes Mal, wenn Richard Armstrong das Restaurant besuchte, überkam ihn ein leichter Anflug von Panik. Und jetzt sollte er, Henri, auch noch das Dinner für Armstrong auswählen. Zum Glück war wenigstens der Stammtisch dieses berühmten Gastes noch frei. Wäre Armstrong nur wenige Minuten später gekommen, hätte er an der Bar warten und sich auf das Improvisationstalent des Personals verlassen müssen.
Ehe Henri eine Serviette auf Armstrongs Schoß legte, schenkte der Weinkellner ihm bereits ein Glas seines Lieblingschampagners ein. Armstrong starrte durchs Fenster in die Ferne, doch er nahm die große Jacht gar nicht wahr, die am Nordende der Bucht vor Anker lag. Seine Gedanken befassten sich mit seiner Familie, seiner Frau und den Kindern, die viel weiter weg waren, einige Hundert Meilen entfernt. Was würden sie tun, wenn sie die Neuigkeit erfuhren? Der Ober servierte Armstrong eine Hummercremesuppe – nicht zu heiß, sodass er sie sofort essen konnte. Armstrong hasste es zu warten, bis irgendetwas abkühlte.
Zur Verwunderung des Oberkellners nahm der Gast den Blick nicht vom Horizont, als sein Glas zum zweiten Mal gefüllt wurde.
Wie schnell werden meine Kollegen im Vorstand, diese Strohmänner mit Titeln und Beziehungen, wohl anfangen ihre Spuren zu verwischen und sich von mir zu distanzieren, sobald ich erst die Zwischenbilanz der Gesellschaft vorgelegt habe, fragte sich Armstrong und konnte sich ein ironisches Lächeln nicht verkneifen. Lediglich Sir Paul Maitland würde seinen Ruf vermutlich retten können.
Armstrong nahm den Löffel, tauchte ihn in die Suppe und löffelte die Schale mit schnellen, kreisenden Bewegungen aus.
Gäste an den Nachbartischen blickten hin und wieder in seine Richtung und wisperten verstohlen mit ihrer Begleitung.
»Einer der reichsten Männer der Welt«, vertraute ein einheimischer Bankier der jungen Dame an, die er an diesem Abend zum ersten Mal ausführte. Sie wirkte angemessen beeindruckt. Normalerweise sonnte sich Armstrong in seiner Berühmtheit. Doch an diesem Abend hatte er keinen Blick für die anderen Gäste. In Gedanken befand er sich wieder im Sitzungssaal der Schweizer Bank, wo die Entscheidung gefallen war, den letzten Vorhang fallen zu lassen – und das alles wegen läppischer fünfzig Millionen Dollar.
Die leere Suppenschale wurde umgehend abserviert, während sich Armstrong mit der Leinenserviette die Lippen tupfte. Der Ober wusste nur zu gut, dass dieser Mann Pausen zwischen den Gängen nicht ausstehen konnte.
Gewandt wurde eine bereits entgrätete Dover-Seezunge – Armstrong verabscheute überflüssige Arbeit – vor ihn hingestellt, daneben eine Schüssel seiner geliebten besonders groß geschnittenen Pommes frites sowie eine Flasche Ketchup – die einzige in der Küche für den einzigen Gast, der sie je verlangte. Abwesend schraubte Armstrong den Verschluss ab, stülpte die Flasche auf den Kopf und schüttelte sie kräftig. Ein rotbrauner, breiiger Klumpen klatschte mitten auf die Seezunge. Armstrong griff nach dem Messer und verteilte den Ketchup gleichmäßig auf dem weißen Fischfleisch.
Die Vorstandssitzung am Vormittag war beinahe in ein Chaos ausgeartet, nachdem Sir Paul den Vorsitz niedergelegt hatte. Als der Tagesordnungspunkt »weitere geschäftliche Unternehmungen« abgehakt war, hatte Armstrong das Vorstandszimmer rasch verlassen und den Lift hinauf zum Dach genommen, wo sein Hubschrauber auf ihn wartete.
Der Pilot lehnte am Geländer und rauchte genüsslich eine Zigarette, als Armstrong erschien und »Heathrow!« bellte, ohne auch nur einen Gedanken an die Abfertigungsformalitäten zu vergeuden oder an die Frage, ob man momentan überhaupt eine Starterlaubnis bekommen konnte. Der Pilot drückte schnell seine Zigarette aus und rannte zum Landeplatz. Während der Helikopter über den Finanzdistrikt von London flog, dachte Armstrong darüber nach, was in den nächsten Stunden über ihn hereinbrechen würde, falls sich die fünfzig Millionen Dollar nicht noch wundersamerweise beschaffen ließen.
Fünfzehn Minuten später setzte der Hubschrauber auf dem privaten Landeplatz auf, der denen, die sich seine Benutzung leisten konnten, als Terminal Five bekannt war. Armstrong duckte sich aus dem Hubschrauber und schritt gemächlich zu seinem Privatjet hinüber.
Ein weiterer Pilot, der bereits auf Armstrongs Anweisungen wartete, begrüßte seinen Chef am Ende der Einstiegstreppe und erkundigte sich nach dessen Befinden.
»Danke, gut«, sagte Armstrong, ehe er sich auf den Weg in den hinteren Teil der Passagierkabine machte, während der Pilot sich ins Cockpit begab. Er ging davon aus, dass »Käpt’n Dick« auf seine Jacht nach Monte Carlo wollte, um ein paar Tage auszuspannen.
Die Gulfstream hob ab in Richtung Süden. Während des zweistündigen Flugs tätigte Armstrong nur einen Anruf; er sprach mit Jacques Lacroix in Genf. Doch sosehr Armstrong ihn auch bekniete, stets lautete die Antwort: »Sie haben noch bis zum heutigen Geschäftsschluss Zeit, die fünfzig Millionen zurückzuzahlen, Mr. Armstrong. Andernfalls bleibt mir keine andere Wahl, als die Angelegenheit unserer Rechtsabteilung zu übergeben.«
Außer dem Anruf bestand Armstrongs einzige Aktivität an Bord der Gulfstream darin, den Inhalt des Ordners zu zerreißen, den Sir Paul auf dem Konferenztisch des Sitzungssaales zurückgelassen hatte. Anschließend verschwand Armstrong auf die Toilette des Jet und spülte die kleinen Papierfetzen hinunter.
Als die Düsenmaschine auf der Landebahn des Flughafens von Nizza ausrollte, glitt sofort ein Mercedes heran, der von einem livrierten Chauffeur gelenkt wurde. Kein Wort wurde gewechselt, als Armstrong in den Wagen stieg und sich auf dem Rücksitz niederließ. Der Chauffeur brauchte seinen Chef gar nicht erst nach dessen Ziel zu fragen. Auf der Fahrt von Nizza nach Monte Carlo sprach Armstrong kein einziges Wort; sein Fahrer war schließlich nicht in der Lage, ihm fünfzig Millionen Dollar zu pumpen.
Als der Mercedes in den Jachthafen einbog, stand der Kapitän von Armstrongs Sir Lancelot stramm und wartete darauf, seinen Herrn und Meister an Bord willkommen zu heißen. Zwar hatte Armstrong niemanden wissen lassen, was er vorhatte, doch die dreizehnköpfige Besatzung der Jacht war bereits benachrichtigt worden, dass der Chef unterwegs sei. »Aber wohin er will, wissen nur er und der liebe Gott«, hatte seine Sekretärin hinzugefügt.
Sobald Armstrong beschloss, dass es an der Zeit sei, zum Flughafen zurückzukehren, würde man sie umgehend darüber informieren. Nur auf diese Weise konnte jeder seiner Untergebenen, die über die ganze Welt verstreut arbeiteten, darauf hoffen, länger als eine Woche in seinem Job überleben.
Der Kapitän machte sich Sorgen. Man hatte den Chef erst in drei Wochen wieder an Bord erwartet – zu einer vierzehntägigen Urlaubskreuzfahrt mit seiner Familie. Als am Vormittag der Anruf aus London gekommen war, hatte der Kapitän sich in der Werft aufgehalten, um auf erhebliche Kosten ein paar kleinere Reparaturen an der Sir Lancelot durchführen zu lassen. Doch es war ihm gelungen, die Jacht aus der Reparaturwerft und an ihren Anlegeplatz zu steuern – Minuten bevor sein Chef in Frankreich eingetroffen war.
Armstrong stieg die Gangway hinauf und schritt an vier strammstehenden und salutierenden Männern in blütenweißer, gestärkter Uniform vorüber. Er schlüpfte aus den Schuhen und stieg zu seiner privaten Kabinenflucht hinunter. Als er die Kajütentür öffnete, stellte er fest, dass man bereits mit seiner Ankunft gerechnet hatte: Mehrere Faxe lagen ordentlich übereinandergelegt auf dem Nachttisch.
Hatte Jacques Lacroix vielleicht seine Meinung geändert und gewährte ihm einen Zahlungsaufschub? Doch Armstrong ließ diese Hoffnung sofort wieder fahren. Nach jahrelangen Geschäftsbeziehungen mit den Schweizern hatte er sie nur zu gut kennengelernt. Sie waren und blieben Bürger eines fantasielosen Staates – Menschen, deren Bankkonten sich stets auf der Habenseite zu befinden hatten und in deren Wörterbüchern das Wort »Risiko« nicht vorkam.
Armstrong strich das Faxpapier glatt, das die Eigenart besaß, sich immer wieder zusammenzurollen, und blätterte die Mitteilungen durch. Das oberste Fax stammte von seinen New Yorker Bankiers, die ihm mitteilten, dass die Aktien von Armstrong Communications an der Börse weiter gefallen waren. Er überflog die Seite, bis sein Blick auf der gefürchteten Zeile haften blieb: »Keine Käufer, nur Verkäufer. Falls dieser Trend noch länger anhält, wird der Bank nichts anderes übrig bleiben, als die Konsequenzen zu ziehen.«
Armstrong fegte die Faxe zu Boden und ging zu dem kleinen Safe, der hinter einem großen gerahmten Foto versteckt war, auf dem die Queen ihm leutselig die Hand schüttelte. Er drehte die Nummernscheibe vor und zurück, bis sie bei der Ziffernfolge 10-06-23 stehen blieb. Die schwere Tür schwang auf, und Armstrong nahm mit beiden Händen sämtliche dicken Geldscheinbündel heraus: dreitausend Dollar, zweiundzwanzigtausend Franc, siebentausend Drachmen und ein besonders dicker Packen italienischer Lire. Kaum hatte er das Geld eingesteckt, ging er von Bord der Jacht und machte sich auf den direkten Weg zum Spielcasino, ohne jemandem von der Besatzung mitzuteilen, wohin er ging oder wann er vermutlich zurückkommen würde. Der Kapitän befahl einem Besatzungsmitglied, Armstrong zu beschatten, damit sie nicht überrascht wurden, sobald der Chef sich durch den Hafen auf den Rückweg zur Jacht machte.
Eine große Portion Vanilleeis wurde vor ihn hingestellt. Der Oberkellner goss heiße Schokoladensoße darüber; da Armstrong dem Mann nicht sagte, dass er aufhören solle, goss er so lange weiter, bis die silberne Sauciere leer war. Erneut setzten die hastigen, kreisenden Bewegungen des Löffels ein und endeten erst, als auch der letzte Tropfen Schokolade vom Becherrand verschwunden war.
Eine Tasse dampfenden schwarzen Kaffees nahm den Platz des leeren Bechers ein. Armstrong schaute weiterhin hinaus auf die Bucht. Falls bekannt wurde, dass er nicht mal eine so lächerliche Summe wie fünfzig Millionen aufbringen konnte, würde in Zukunft keine Bank der Welt auch nur in Erwägung ziehen, Geschäfte mit ihm zu machen.
Wenige Minuten später kehrte der Ober zurück und stellte erstaunt fest, dass der Kaffee unangetastet war. »Sollen wir Ihnen eine andere Tasse bringen, Mr. Armstrong?«, erkundigte er sich leise in respektvollem Ton.
Armstrong schüttelte den Kopf. »Nur die Rechnung, Henri.« Er leerte das Sektglas zum letzten Mal. Der Ober eilte davon und kam kurz darauf mit einem gefalteten weißen Blatt auf einem silbernen Tablett zurück. Armstrong war ein Gast, der auf gar nichts warten wollte, nicht einmal auf die Rechnung.
Er entfaltete das Blatt, zeigte jedoch kein sonderliches Interesse daran. Siebenhundertundzwölf Franc, service non compris. Armstrong unterschrieb und rundete den Betrag auf tausend Franc auf. Zum ersten Mal an diesem Abend erschien ein Lächeln auf dem Gesicht des Oberkellners – ein Lächeln, das ihm allerdings vergehen würde, wenn er erst erfuhr, dass das Restaurant der letzte in einer langen Reihe von Gläubigern war.
Armstrong schob den Stuhl zurück, warf die zerknüllte Serviette auf den Tisch und verließ das Restaurant ohne ein weiteres Wort. Blicke aus mehreren Augenpaaren verfolgten seinen Abgang; ein weiteres beobachtete ihn, als er auf den Bürgersteig trat. Er bemerkte das junge, vielversprechende Besatzungsmitglied seiner Jacht nicht, das in die Richtung der Sir Lancelot rannte.
Armstrong rülpste, als er die Promenade entlangschritt, vorbei an Dutzenden von Booten, die für die Nacht dicht nebeneinander vertäut am Steg lagen. Für gewöhnlich genoss er das Gefühl, dass die Sir Lancelot mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die größte Jacht in der Bucht war; es sei denn, der Sultan von Brunei oder König Fahd waren im Laufe des Abends eingetroffen. Heute jedoch überlegte Armstrong, welchen Preis er bei einem möglichen Verkauf für die Sir Lancelot erzielen könnte. Doch sobald die Wahrheit bekannt war – würde da überhaupt noch jemand eine Jacht erwerben wollen, die Richard Armstrong gehört hatte?
Sich an die Haltetaue klammernd, zog er sich die Gangway hinauf, wo ihn der Kapitän und der erste Offizier bereits erwarteten.
»Sofort in See stechen!«
Armstrongs Befehl überraschte den Kapitän nicht. Er wusste, dass sein Chef nicht länger im Hafen bleiben wollte als nötig. Selbst in tiefster Nacht konnte nur das sanfte Schaukeln des Schiffes Armstrong in den Schlaf wiegen. Der Kapitän erteilte seine Befehle, während Armstrong seine Schuhe abstreifte und unter Deck verschwand.
Beim Betreten seiner Kajüte erwartete ihn ein neuerlicher Stapel Faxe. Er griff danach, noch immer von der leisen Hoffnung erfüllt, dass es vielleicht doch einen Ausweg gab. Die erste Nachricht stammte von Peter Wakeham, dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden von Armstrong Communications. Offenbar saß Wakeham trotz der späten Stunde immer noch an seinem Schreibtisch in London. BITTE ANRUFEN. DRINGEND! stand auf dem Fax. Die zweite Nachricht war aus New York eingetroffen. Die Aktien des Unternehmens hatten einen neuen Tiefstand von 2,23 Dollar erreicht, sodass es Goldman & Sachs, Armstrongs Börsenmakler, »wenngleich widerstrebend für nötig erachtet« hatten, ihre eigenen Armstrong-Aktien auf den Markt zu werfen. Das dritte Fax stammte von Jacques Lacroix aus Genf, der »bedauerlicherweise feststellen« musste, dass die fünfzig Millionen Dollar zum vereinbarten Termin nicht eingegangen waren, weshalb ihm keine Wahl geblieben war, als …
In New York war es jetzt siebzehn Uhr zwölf Ortszeit, in London zweiundzwanzig Uhr zwölf, und in Genf dreiundzwanzig Uhr zwölf. Morgen um neun Uhr früh würde Armstrong nicht einmal mehr Einfluss auf die Schlagzeilen seiner eigenen Zeitung haben, geschweige denn auf die Zeitung von Keith Townsend.
Langsam zog er sich aus und ließ seine Sachen achtlos zu Boden fallen. Dann nahm er eine Flasche Cognac aus dem Sideboard, schenkte sich einen großen Schwenker ein und streckte sich auf dem Doppelbett aus. Ganz still lag er da, während die Maschinen aufheulend zum Leben erwachten. Augenblicke später hörte er, wie der Anker aus dem Wasser gezogen wurde. Langsam manövrierte die Jacht aus dem Hafen.
Stunde um Stunde verging, doch Armstrong rührte sich nicht – außer um den Cognacschwenker hin und wieder nachzufüllen –, bis er die kleine Uhr neben dem Bett vier Mal schlagen hörte. Er stemmte sich auf und wartete einen Augenblick; dann setzte er die Füße auf den flauschigen Teppich, erhob sich auf etwas unsicheren Beinen und tappte quer durch die unbeleuchtete Kajüte zum Bad. Als er die offene Tür erreichte, griff er zum Kleiderhaken und nahm einen weiten, cremefarbenen Morgenrock herunter, auf den mit Goldfäden die Worte Sir Lancelot aufgestickt waren. Dann schlurfte er zur Kajütentür, öffnete sie leise und trat barfuß auf den schummrig beleuchteten Gang. Er zögerte, ehe er die Tür hinter sich verschloss und den Schlüssel in die Tasche des Morgenrocks steckte. Dann blieb er regungslos stehen, bis er sicher war, nur noch die vertrauten Geräusche der Schiffsmotoren zu hören.
Armstrong wankte den schmalen Gang entlang und hielt kurz inne, als er die Treppe erreichte, die zum Deck führte. Dann stieg er langsam die Stufen hinauf, wobei er sich an den dicken Kordeln festhielt, die sich zu beiden Seiten an den Wänden befanden. Auf der obersten Stufe angelangt, schaute er nach links und rechts. Niemand zu sehen. Es war eine klare, kühle Nacht – nicht anders als neunundneunzig von hundert Nächten in dieser Gegend und zu dieser Jahreszeit.
Leise ging Armstrong weiter, bis er sich über dem Maschinenraum befand, dem lautesten Teil des Schiffes.
Er wartete einen Augenblick, bevor er die Gürtelkordel löste, den Morgenrock abstreifte und aufs Deck fallen ließ.
Dann stand er nackt in der warmen Nacht, starrte hinaus aufs dunkle Meer und fragte sich: Heißt es nicht, dass in einem solchen Augenblick das ganze Leben wie im Zeitraffertempo an einem vorüberzieht?
2
The Citizen
5. November 1991
Townsend vor dem Bankrott
»Irgendwelche Anrufe?«, erkundigte sich Keith Townsend, als er am Schreibtisch seiner Sekretärin vorbei zu seinem Büro ging.
»Der Präsident hat aus Camp David angerufen, kurz bevor Sie in die Maschine gestiegen sind«, antwortete Heather.
»Über welche meiner Zeitungen hat er sich diesmal geärgert?«, wollte Townsend wissen und setzte sich.
»Den New York Star. Ihm ist zu Ohren gekommen, dass Sie auf der morgigen Titelseite seinen Kontostand veröffentlichen wollen.«
»Es ist wahrscheinlicher, dass mein Kontostand morgen Schlagzeilen macht.« Townsends australischer Akzent war ausgeprägter als sonst. »Was noch?«
»Margaret Thatcher hat ein Fax aus London geschickt. Sie hat sich mit Ihren Bedingungen für einen Vertrag über zwei Bände einverstanden erklärt, obwohl Armstrongs Angebot höher lag.«
»Da kann ich nur hoffen, dass auch mir jemand sechs Millionen Dollar bietet, wenn ich meine Memoiren schreibe.«
Heather rang sich ein schwaches Lächeln ab.
»Sonst noch jemand?«
»Gary Deakins wird mal wieder vor den Richter zitiert.«
»Weshalb diesmal?«
»Auf der gestrigen Titelseite der Truth hat er den Erzbischof von Brisbane der Vergewaltigung beschuldigt.«
»Die Wahrheit, die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit«, meinte Townsend lächelnd. »Solange sie die Auflage steigert.«
»Bedauerlicherweise hat sich herausgestellt, dass die Frau, die Seine Eminenz angeblich vergewaltigt hat, eine sehr bekannte Laienpredigerin ist – und seit Langem eine gute Freundin der erzbischöflichen Familie. Da steht Gary wohl ein Gang nach Canossa bevor.«
Townsend lehnte sich in seinem Sessel zurück und hörte sich weiter die unzähligen Probleme anderer Menschen rund um den Erdball an: die üblichen Beschwerden von Politikern, Geschäftsleuten und sogenannten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die seine sofortige Stellungnahme erwarteten und verlangten, dass Townsend ihre unverzichtbaren Karrieren rettete. Morgen um diese Zeit würden die meisten von ihnen sich wieder beruhigt haben und durch ein anderes Dutzend gleichermaßen aufgeregter, gleichermaßen unverschämter Primadonnen verdrängt worden sein. Townsend wusste, dass jeder dieser selbsternannten VIPs sich diebisch freuen würde, wenn er wüsste, dass Townsends Karriere am Rande des Zusammenbruchs stand – und das, nur weil der Direktor einer kleinen Bank in Cleveland verlangte, dass ein Kredit von fünfzig Millionen Dollar bis zum Ende des Tages zurückbezahlt wurde.
Während Heather mit der Anrufliste fortfuhr – die meisten stammten von Leuten, deren Namen Townsend nichts sagten –, schweiften seine Gedanken zu der Rede zurück, die er am vergangenen Abend gehalten hatte. Eintausend seiner Spitzenkräfte aus der ganzen Welt hatten sich zu einer dreitägigen Konferenz auf Honolulu eingefunden. Bei seiner Schlussrede hatte Townsend ihnen versichert, dass die Global Corporation »optimal auf die Herausforderungen der neuen Medienrevolution vorbereitet« sei. »Unser Unternehmen ist der Konkurrenz überlegen, denn wir sind am besten dafür qualifiziert, die Medien ins einundzwanzigste Jahrhundert zu führen«, waren die letzten, von allen Anwesenden minutenlang bejubelten Worte seiner Rede gewesen. Beim Blick hinunter in den dicht gefüllten Saal voller zuversichtlicher Gesichter hatte Townsend sich gefragt, wie viele von diesen Trotteln ahnten, dass die Global in Wahrheit kurz vor der Pleite stand.
»Was soll ich wegen des Präsidenten unternehmen?«, fragte Heather bereits zum zweiten Mal.
Die Frage riss Townsend in die Wirklichkeit zurück. »Welcher Präsident?«
»Der Präsident der Vereinigten Staaten.«
»Warten Sie, bis er noch mal anruft. Bis dahin hat er sich vielleicht ein bisschen beruhigt. Ich werde inzwischen mit dem Herausgeber des Star telefonieren.«
»Und Mrs. Thatcher?«
»Schicken Sie ihr einen Blumenstrauß mit einem Briefchen. Wortlaut: ›Wir machen Ihre Memoiren zur Nummer eins auf den Bestsellerlisten – von Moskau bis New York.‹«
»Sollte ich nicht auch London hinzufügen?«
»Nein. Dass sie die Nummer eins in London wird, kann sie sich selbst denken.«
»Und was soll ich wegen Gary Deakins machen?«
»Rufen Sie den Erzbischof an, und versprechen Sie ihm, dass wir ihm das so dringend benötigte neue Dach für seine Kathedrale finanzieren. In einem Monat schicken wir ihm dann einen Scheck über 10 000 Dollar.«
Heather nickte, klappte ihren Block zu und fragte: »Möchten Sie irgendwelche Anrufe entgegennehmen?«
»Nur den von Austin Pierson.« Townsend machte eine Pause. »Stellen Sie ihn bitte sofort durch, wenn er sich meldet.«
Heather nickte wieder und verließ das Zimmer.
Townsend drehte seinen Sessel und blickte aus dem Fenster. Er versuchte sich an das Gespräch mit seiner Finanzberaterin zu erinnern, als sie ihn in seinem Privatjet auf dem Rückflug von Honolulu angerufen hatte.
»Die Bank in Zürich hat Ihrem Angebot zugestimmt.«
»Gott sei Dank«, hatte er erleichtert hervorgestoßen und einige Sekunden nachgedacht, ehe er die Frage aller Fragen stellte. »Und wie schätzen Sie meine Überlebenschancen ein?«
»Im Augenblick nicht höher als fifity-fifty-fifity-fifty.«
»Aber jetzt, da die anderen Banken kompromissbereit sind, kann Pierson doch nicht …«
»Er kann, und möglicherweise wird er auch. Vergessen Sie nicht, dass er Direktor einer kleinen Bank in Ohio ist. Es interessiert ihn nicht die Bohne, worauf Sie sich mit anderen Banken geeinigt haben. Und nach der schlechten Presse, die Sie in den vergangenen Wochen hatten, ist derzeit nur eines wichtig für ihn.«
»Und was?«
»Keine weiteren Risiken einzugehen«, erwiderte sie.
»Aber ist ihm denn nicht klar, dass die anderen Banken allesamt abspringen, wenn er nicht mitmacht?«
»O ja, durchaus. Doch als ich ihn darauf hinwies, zuckte er nur die Schultern und sagte: ›In diesem Fall werde ich das gleiche Risiko eingehen wie die anderen auch.‹«
Townsend hatte losgeflucht, als Miss Beresford hinzufügte: »Aber eins hat er mir versprochen.«
»Was denn?«
»Dass er sofort anruft, wenn der Ausschuss seine Entscheidung getroffen hat.«
»Wie zuvorkommend von ihm. Tja, was soll ich tun, wenn es schiefgeht?«
»Die Presseerklärung herausgeben, auf die wir uns geeinigt haben.«
Townsend hatte geschluckt. »Gibt es denn keine andere Möglichkeit? Kann ich denn gar nichts tun?«
Miss Beresfords Antwort war deutlich gewesen. »Überhaupt nichts. Warten Sie auf Piersons Anruf. – Tja, wenn ich den nächsten Flug nach New York kriegen will, muss ich jetzt los. Ich dürfte gegen Mittag bei Ihnen sein.« Dann hatte sie aufgelegt.
Townsend grübelte weiter über ihre Worte nach, während er sich nun erhob und im Zimmer auf und ab ging. Vor dem Spiegel über dem Kaminsims blieb er stehen und begutachtete den Sitz seiner Krawatte – er hatte keine Zeit gehabt, sich umzuziehen, seit er aus dem Flugzeug gestiegen war, und das sah man. Unwillkürlich musste er zum ersten Mal daran denken, dass er älter aussah als seine dreiundsechzig Jahre. Das war allerdings nicht weiter verwunderlich – nach allem, was Miss Beresford ihn in den letzten sechs Wochen hatte durchmachen lassen. Doch Townsend musste sich eingestehen, dass er jetzt nicht vom Anruf des Direktors einer kleinen Bank in Ohio abhängig wäre, hätte er sich Miss Beresfords Rat ein bisschen früher eingeholt.
Wie ein Hypnotiseur starrte Townsend auf das Telefon, doch es klingelte nicht. Er machte keine Anstalten, sich mit dem Stapel Briefe zu beschäftigen, die Heather ihm zur Durchsicht und Unterschrift auf den Schreibtisch gelegt hatte. Er wurde erst aus seinen Gedanken gerissen, als die Tür aufging und Heather ins Zimmer trat. Sie reichte ihm ein Blatt Papier: eine Liste alphabetisch geordneter Namen. »Ich dachte, Sie könnten die Liste vielleicht brauchen«, sagte Heather. Sie arbeitete seit fünfunddreißig Jahren für Townsend und wusste, dass es ihm gewaltig gegen den Strich ging, untätig herumzusitzen und zu warten.
Ungewohnt langsam fuhr Townsend mit dem Finger die Namensliste hinunter. Drei Namen waren mit einem Sternchen versehen, was bedeutete, dass die betreffenden Personen einmal für die Global gearbeitet hatten. Derzeit standen siebenunddreißigtausend Angestellte in Townsends Diensten, von denen er sechsunddreißigtausend nie zu Gesicht bekommen hatte. Doch auf dieser Liste gab es drei Personen, die irgendwann einmal bei ihm beschäftigt gewesen waren und inzwischen für den Cleveland Sentinel arbeiteten, eine Zeitung, von der Townsend noch nie gehört hatte.
»Wem gehört der Sentinel?«, fragte er in der Hoffnung, den Besitzer ein bisschen unter Druck setzen zu können.
»Richard Armstrong«, antwortete Heather dumpf.
»Das hat mir gerade noch gefehlt.«
»Leider gehört Ihnen nicht eine einzige Zeitung im Umkreis von hundert Meilen um Cleveland«, fuhr Heather fort. »Bloß eine Rundfunkstation südlich der Stadt.«
In diesem Moment hätte Townsend ohne Bedenken den New York Star gegen den Cleveland Sentinel eingetauscht. Wieder blickte er auf die drei Namen mit den Sternchen, doch sie sagten ihm auch jetzt noch nichts. Er schaute zu Heather auf. »Ob einer von denen wohl noch was für mich übrig hat?« Er bemühte sich um ein Lächeln.
»Barbara Bennett bestimmt nicht«, entgegnete Heather. »Sie ist die Moderedakteurin des Sentinel. Nachdem Sie das Lokalblatt von Seattle übernommen hatten, für das Barbara arbeitete, wurde sie nach wenigen Tagen gefeuert. Sie hat auf rechtswidrige Entlassung geklagt und behauptet, ihre Nachfolgerin habe eine Affäre mit dem Herausgeber. Wir mussten uns schließlich auf einen Vergleich einlassen. In der Verhandlung hat Barbara Sie als ›einen gewinnsüchtigen Pornohöker‹ bezeichnet. Daraufhin haben Sie die Anweisung erteilt, dass sie bei keiner Ihrer Zeitungen mehr eingestellt werden dürfe.«
Townsend wusste, dass auf dieser Liste die Namen von wahrscheinlich über tausend Leuten standen, von denen jeder Einzelne mit Freude seine Feder in Blut tauchen würde, um für die nächste Morgenausgabe seinen Nachruf zu verfassen.
»Mark Kendall?«, fragte er.
»Leitender Gerichtsreporter«, erklärte Heather. »Er hat einige Monate für den New York Star gearbeitet, aber es gibt keinen Beleg dafür, dass Sie ihm je begegnet sind.«
Townsend las einen weiteren Namen, der ihm nichts sagte, und wartete darauf, dass Heather ihm Einzelheiten dazu nannte. Er wusste, dass sie den besten Kandidaten für zuletzt aufgehoben hatte: Selbst Heather genoss es, ihren Boss ein bisschen in der Hand zu haben.
»Malcolm McCreedy, leitender Redakteur beim Sentinel. Hat von 1979 bis 1984 beim Melbourne Courier für die Corporation gearbeitet. Damals erzählte er jedem bei der Zeitung, Sie wären früher sein Saufkumpan gewesen. McCreedy wurde gefeuert, weil er seine Artikel ständig zu spät ablieferte. Offenbar galt sein Hauptaugenmerk nach der morgendlichen Redaktionskonferenz dem Whisky und nach dem Mittagessen allem, was Röcke trug. Doch trotz seiner Behauptungen konnte ich rein gar nichts finden, was beweisen könnte, dass Sie ihm jemals begegnet sind.«
Townsend staunte, wie viele Informationen Heather in so kurzer Zeit hatte beschaffen können. Anderseits war ihm klar, dass ihre Verbindungen, nachdem sie so lange für ihn arbeitete, fast genauso gut waren wie die seinen.
»McCreedy war zweimal verheiratet«, fuhr Heather fort. »Beide Ehen wurden geschieden. Mit seiner ersten Frau hatte er zwei Kinder – die jetzt siebenundzwanzigjährige Jill und Alan, vierundzwanzig Jahre alt. Alan arbeitet für die Corporation; er ist beim Dallas Comet in der Anzeigenabteilung.«
»Könnte nicht besser sein.« Townsend nickte. »McCreedy ist unser Mann. Er wird gleich einen Anruf von einem alten Freund bekommen, von dem er lange nichts gehört hat.«
»Ich wähle sofort seine Nummer. Hoffen wir, dass er nüchtern ist.«
Townsend nickte, und Heather kehrte in ihr Büro zurück. Der Besitzer von zweihundertsiebenundneunzig Zeitungen und Zeitschriften mit einer Gesamtleserschaft von über einer Milliarde weltweit wartete darauf, zum Redakteur eines Lokalblattes in Ohio – Auflage fünfunddreißigtausend – durchgestellt zu werden.
Townsend erhob sich und schritt wieder auf und ab. Dabei überlegte er sich, welche Fragen er McCreedy stellen wollte und in welcher Reihenfolge. Während er durchs Zimmer ging, schweifte sein Blick über die gerahmten Ausgaben seiner Zeitungen mit den aufsehenerregendsten Schlagzeilen:
Der New York Star vom 23. November 1963: »J. F. KENNEDY IN DALLAS BEI ATTENTAT GETÖTET«
Der Continent vom 30. Juli 1981: »Ewiges Glück!« über einem Bild von Charles und Diana am Tag ihrer Hochzeit.
Der Globe vom 17. Mai 1991: »Geständnis einer Jungfrau: Richard Branson raubte mir die Unschuld«
Ohne zu zögern, hätte Townsend eine halbe Million Dollar gegeben, hätte er schon jetzt die Schlagzeilen der morgigen Zeitungen lesen können.
Das Telefon auf seinem Schreibtisch klingelte schrill. Townsend eilte zu seinem Drehsessel zurück und griff nach dem Hörer.
»Malcolm McCreedy ist jetzt am Apparat«, meldete Heather und stellte ihn durch.
Kaum hörte er das Klicken, sagte Townsend: »Malcolm, bist du es?«
»Ja, sicher, Mr.Townsend«, antwortete eine erstaunte Stimme mit unverkennbar australischem Akzent.
»Ist lange her, Malcolm, alter Knabe. Zu lange, finde ich. Wie geht’s dir denn so?«
»Gut, Keith. Sehr gut.« Die Stimme klang allmählich selbstsicherer.
»Und wie geht’s den Kindern?«, fragte Townsend und blickte auf den Zettel, den Heather ihm auf den Schreibtisch gelegt hatte. »Jill und Alan, wenn ich mich recht entsinne. Arbeitet Alan nicht in Dallas für die Corporation?«
Ein längeres Schweigen trat ein, sodass Townsend sich schon fragte, ob sie unterbrochen worden waren. Schließlich sagte McCreedy: »Stimmt, Keith. Beiden geht’s sehr gut, danke. Und Ihren?« Offenbar erinnerte er sich weder an ihre Anzahl noch an ihre Namen.
»Ebenfalls sehr gut. Danke, Malcolm«, ahmte Townsend ihn mit voller Absicht nach. »Und? Wie gefällt dir Cleveland?«
»Na ja, ganz gut, aber ich wäre lieber wieder in Australien. Mann, wie gern würde ich an einem Samstagnachmittag mal wieder die Tigers spielen sehen.«
»Tja, das ist einer der Gründe, weshalb ich anrufe«, behauptete Townsend. »Aber zuerst hätte ich gern deinen Rat.«
»Selbstverständlich, Keith. Du kannst dich immer auf mich verlassen«, versicherte McCreedy. »Aber vielleicht sollte ich lieber meine Bürotür zumachen. Moment, bitte«, fügte er hinzu, nachdem er sicher sein konnte, dass inzwischen jeder Journalist auf dem Stockwerk wusste, wer am anderen Ende der Leitung war.
Townsend wartete ungeduldig.
»Also, was kann ich für dich tun, Keith?« Die Stimme klang nun ein wenig außer Atem.
»Sagt dir der Name Austin Pierson etwas?«
Wieder setzte längeres Schweigen ein. »Der ist ein großes Tier in der hiesigen Finanzwelt, oder? Ich glaube, der Chef einer Bank oder Versicherungsgesellschaft. Warte kurz, ich hol mir den Mann mal auf meinen Computer.«
Wieder wartete Townsend. Hätte mein Vater vor vierzig Jahren die gleiche Frage gestellt, ging es ihm durch den Kopf, hätte es Stunden, vielleicht sogar Tage gedauert, ehe einem jemand Auskunft hätte geben können.
»Ich hab’ den Burschen«, sagte der Mann aus Cleveland schon Augenblicke später. Er machte eine Pause, dann: »Jetzt weiß ich, warum mir der Name bekannt vorkam. Wir haben vor vier Jahren einen Bericht über ihn gebracht, als er Vorsitzender der hiesigen Handelskammer wurde.«
»Was kannst du mir über ihn sagen?«, fragte Townsend, der nicht gern noch mehr Zeit mit Nebensächlichkeiten vergeuden wollte.
»Nicht sehr viel«, antwortete McCreedy, während er den Monitor vor sich studierte und hin und wieder weitere Tasten drückte. »Scheint ein mustergültiger Staatsbürger zu sein. Hat sich in der Bank von ganz unten hochgearbeitet. Ist Schatzmeister des hiesigen Rotary Club, Laienprediger der Methodisten, seit einunddreißig Jahren mit derselben Frau verheiratet. Drei Kinder, die alle hier in der Stadt wohnen.«
»Kannst du mir irgendwas über die Kinder sagen?«
McCreedy drückte auf weitere Tasten, ehe er antwortete. »Ja. Der Älteste unterrichtet Biologie an der hiesigen Highschool. Die Tochter ist Oberschwester im städtischen Krankenhaus von Cleveland, und der Jüngste wurde erst vor Kurzem als Partner in die namhafteste Anwaltskanzlei dieses Staates aufgenommen. Falls du ein Geschäft mit Mr. Austin Pierson machen willst, Keith – es dürfte dich freuen, dass er einen makellosen Ruf genießt.«
Townsend freute sich ganz und gar nicht. »Es gibt also nichts in seiner Vergangenheit, das …«
»Nichts, von dem ich wüsste, Keith«, erwiderte McCreedy. Rasch überflog er die fünf Jahre alten Notizen – in der Hoffnung, vielleicht doch einen kleinen Leckerbissen für seinen ehemaligen Chef zu finden. »Ah, ja, jetzt fällt mir alles wieder ein. Der Mann war unglaublich geizig. Er hat nicht mal erlaubt, dass ich ihn während der Arbeitszeit interviewte. Als ich dann am Abend zu ihm nach Hause kam, hat er mir nichts weiter als einen verwässerten Ananassaft vorgesetzt.«
Townsend gelangte zu der Ansicht, dass er sowohl bei Pierson als auch bei McCreedy in einer Sackgasse angelangt war und es nichts bringen würde, das Gespräch fortzusetzen. »Danke, Malcolm. Du hast mir sehr geholfen. Ruf mich bitte an, falls du noch auf weitere Informationen über Pierson stößt.«
Er wollte gerade auflegen, als sein ehemaliger Angestellter fragte: »Was war denn die andere Sache, über die du mit mir reden wolltest, Keith? Weißt du, ich hatte gehofft, du könntest mir eine freie Stelle in Australien anbieten, vielleicht sogar beim Courier.« Er machte eine kurze Pause. »Glaub mir, Keith, ich würde sogar ein niedrigeres Gehalt in Kauf nehmen, wenn ich wieder für dich arbeiten dürfte.«
»Ich werde an dich denken, falls mal was frei wird, Malcolm, und dir sofort Bescheid geben.«
Townsend legte auf. Er war sicher, nie wieder mit diesem Mann zu sprechen. Er hatte von McCreedy lediglich erfahren, dass Mr. Austin Pierson ein Ausbund an Tugend war – nicht gerade die Sorte Mensch, mit der Townsend viel gemein hatte. Ja, er wusste nicht einmal, ob er mit so jemandem überhaupt umgehen konnte. Wie üblich erwies sich Miss Beresfords Rat als richtig. Ihm blieb gar nichts anderes übrig, als herumzusitzen und zu warten. Townsend lehnte sich in seinem Sessel zurück und schlug die Beine übereinander.
Es war elf Uhr zwölf in Cleveland, sechzehn Uhr zwölf in London und fünfzehn Uhr zwölf in Sydney. Ab achtzehn Uhr würde er wahrscheinlich nicht einmal mehr Einfluss auf die Schlagzeilen seiner eigenen Zeitungen nehmen können – geschweige denn auf die Zeitungen von Richard Armstrong.
Das Telefon läutete erneut. Ob McCreedy doch noch etwas Interessantes über Austin Pierson ausgegraben hatte? Townsend konnte durch nichts und niemanden von der Meinung abgebracht werden, dass jeder eine Leiche im Keller hatte.
Er nahm den Hörer ab.
»Ich habe zwei Anrufe für Sie, Mr. Townsend. Einen vom Präsidenten der Vereinigten Staaten und einen von Mr. Austin Pierson aus Cleveland, Ohio. Welchen wollen Sie zuerst annehmen?«
Frühausgabe
Geburten, Hochzeiten und Todesfälle
3
The Times
6. Juli 1923
Kommunistische Kräfte am Werk
Es hat seine Vorteile, aber auch viele Nachteile, als ruthenischer Jude geboren zu sein, doch es dauerte lange, bis Lubji Hoch wenigstens einige der Vorteile entdeckte.
Lubji war in einer kleinen Feldsteinhütte am Rand von Douski zur Welt gekommen, einer winzigen Stadt in einem Landeswinkel, der damals unmittelbar an den Grenzen zur Tschechoslowakei, Rumänien und Polen lag. Lubjis genaues Geburtsdatum ließ sich nie ermitteln; denn seine Familie besaß keine Dokumente wie Geburtsurkunden und dergleichen. Jedenfalls war er ungefähr ein Jahr älter als sein Bruder und ein Jahr jünger als seine Schwester.
Als seine Mutter, Zelta, den kleinen Lubji in den Armen hielt, hatte sie gelächelt. Das Kind war vollkommen, bis hin zum leuchtend roten Muttermal unter dem rechten Schulterblatt – genau an der gleichen Stelle, an der auch sein Vater eines hatte.
Die winzige Hütte, in der die Familie wohnte, gehörte Lubjis Großonkel, einem Rabbi. Der Rabbi hatte Zelta mehrmals gebeten, Sergei Hoch, den Sohn eines einheimischen Viehhändlers, nicht zum Mann zu nehmen. Das junge Mädchen hatte sich zu sehr geschämt, ihrem Onkel zu gestehen, dass sie bereits ein Kind von Sergei erwartete. Obwohl Zelta die Bitte des Rabbi enttäuscht hatte, überließ dieser dem frisch vermählten Paar die Hütte als Hochzeitsgeschenk.
Als Lubji das Licht der Welt erblickte, waren die vier Zimmer schon übervoll, und als er seine ersten Schritte tat, hatte er bereits einen zweiten Bruder und noch eine Schwester.
Lubjis Vater bekam die Familie kaum zu Gesicht. Jeden Tag verließ er kurz nach Sonnenaufgang ihr Zuhause und kehrte erst bei Einbruch der Dunkelheit zurück.
Lubjis Mutter erklärte, dass er zur Arbeit ginge.
»Und was macht er?«, wollte Lubji wissen.
»Er hütet das Vieh, das dein Großvater ihm hinterlassen hat.« Lubjis Mutter versuchte gar nicht erst, sich und den Kindern vorzumachen, die paar Kühe mit ihren Kälbern wären eine Herde.
»Und wo arbeitet Vater?«
»Auf den Weiden auf der anderen Seite der Stadt.«
»Was ist eine Stadt?«.
Zelta beantwortete weiter seine Fragen, bis das Kind schließlich in ihren Armen eingeschlafen war.
Der Rabbi sprach zu Lubji nie über seinen Vater, doch bei vielen Gelegenheiten erzählte er dem Jungen, dass seine Mutter als junge Frau von vielen Verehrern umschwärmt worden war und als schönstes und klügstes Mädchen der Stadt galt. »Wenn man diese Vorzüge bedenkt, hätte sie Lehrerin an der hiesigen Schule werden sollen«, erklärte der Rabbi dem Jungen. Jetzt musste sie sich damit begnügen, ihr Wissen an ihre ständig wachsende Familie weiterzugeben.
Doch von allen Kindern sprach allein Lubji auf ihre Bemühungen an. Er saß zu Füßen seiner Mutter, verschlang jedes ihrer Worte und die Antworten auf seine zahllosen Fragen. Im Laufe der Jahre zeigte der Rabbi Interesse an den Fortschritten Lubjis – und machte sich Sorgen darüber, welche Seite der Familie wohl größeren Einfluss auf den Charakter des Jungen haben würde.
Dieser Gedanke war dem Rabbi zum ersten Mal gekommen, als Lubji ins Krabbelalter kam und die Haustür entdeckte. Von da an galt die Aufmerksamkeit des Kindes nicht bloß seiner an Haus und Herd geketteten Mutter, sondern auch dem Vater und dem Rätsel, wohin er eigentlich ging, wenn er jeden Morgen das Haus verließ.
Sobald Lubji stehen konnte, drückte er die Türklinke herunter, und kaum vermochte er zu laufen, trat er hinaus auf den Gehweg und in die große weite Welt außerhalb des Hauses, in der sein Vater unterwegs war. Einige Wochen genügte es Lubji, an der Hand des Vaters über die kopfsteingepflasterten Straßen des schlafenden Städtchens zu der Wiese zu trippeln, auf der dieser das Vieh hütete.
Doch bald schon langweilten ihn die Kühe, die bloß kauend herumstanden und immer nur darauf warteten, gemolken zu werden und dann und wann Kälber zur Welt zu bringen. Lubji wollte herausfinden, was sich in der Stadt abspielte, die gerade erst erwachte, wenn er morgens mit dem Vater hindurchging.
Douski als Stadt zu bezeichnen war eigentlich eine Übertreibung. Der Ort bestand lediglich aus ein paar Reihen Steinhäusern, einem halben Dutzend Läden, einem Gasthof, einer kleinen Synagoge – zu der Lubjis Mutter jeden Samstag die ganze Familie mitnahm – und einem Rathaus, in dem Lubji noch nie gewesen war, das er jedoch für das aufregendste Gebäude der Welt hielt.
Eines Morgens band sein Vater ohne Erklärung zwei Kühen einen Strick um den Hals und führte sie in die Stadt. Glücklich trottete Lubji neben ihm her und bombardierte ihn mit Fragen, was er mit den Tieren vorhatte. Doch anders als die Mutter war der Vater nicht sonderlich mitteilsam, und seine Antworten waren nur selten aufschlussreich.
Lubji gab es schließlich auf, seinen Vater mit Fragen zu löchern, da er immer nur ein mürrisches »Wart’s ab« zu hören bekam. Als sie den Stadtrand von Douski erreichten, wurden die Kühe mit viel gutem Zureden durch die Straßen zum Markt geführt.
An einer wenig belebten Straßenkreuzung blieb der Vater plötzlich stehen. Lubji hielt es für sinnlos, ihn zu fragen, weshalb er ausgerechnet hier angehalten hatte, weil er Junge sicher war, dass er sowieso keine Antwort bekam. Also standen Vater und Sohn mit ihren Rindviechern schweigend da. Es dauerte eine ganze Weile, ehe sich jemand für die beiden Kühe interessierte.
Fasziniert beobachtete Lubji, wie die Leute langsam und mit prüfenden Blicken um die Tiere herumgingen. Einige berührten sie, andere gaben offenbar irgendwelche Angebote ab – in Sprachen, die Lubji noch nie zuvor gehört hatte. Ihm wurde klar, wie sehr sein Vater im Nachteil war, weil er sich hier, in diesem Vielvölkerstaat, nur in einer einzigen Sprache verständlich machen konnte. Er schaute die meisten Leute, die nach Begutachtung der hageren Kühe irgendetwas sagten, nur verständnislos an.
Als sein Vater schließlich ein Angebot in der einzigen Sprache erhielt, die er verstand, besiegelte er den Verkauf der Kühe sofort per Handschlag, ohne auch nur den Versuch zu unternehmen, um den Preis zu feilschen. Mehrere bunte Papierblätter wechselten von einer Hand in die andere, die Kühe wurden ihrem neuen Besitzer übergeben, und Lubjis Vater marschierte auf den Markt, wo er einen Sack Getreide erstand, eine Kiste Kartoffeln, einige geräucherte Fische, verschiedene Kleidungsstücke, ein Paar getragene Schuhe, die dringend neu besohlt werden mussten, und weitere Sachen, darunter einen Schlitten und eine große Messingschnalle, die – wie der Vater offenbar glaubte – irgendjemand in seiner Familie benötigte. Lubji fand es merkwürdig, dass sein Vater stets die verlangte Summe bezahlte, ohne mit den Händlern zu feilschen, wie die anderen Leute es taten.
Auf dem Heimweg ging der Vater in den einzigen Gasthof der Stadt und ließ Lubji draußen auf dem Erdboden sitzen, mit dem Auftrag, ihre Neuerwerbungen zu bewachen. Erst als die Sonne bereits hinter dem Rathaus untergegangen war und Lubjis Vater mehreren Flaschen Sliwowitz den Garaus gemacht hatte, kam er taumelnd aus dem Gasthof. Lubji bekam neue Aufgaben zugewiesen: mit einer Hand musste er den schweren Schlitten ziehen, der mit den Einkäufen beladen war, und mit der anderen Hand musste er den Vater stützen und nach Hause führen.
Als Lubjis Mutter die Haustür öffnete, taumelte der Vater an ihr vorbei und sank auf die Matratze. Augenblicke später schnarchte er.
Lubji half seiner Mutter, die Einkäufe in die Hütte schleppen. Doch so begeistert ihr ältester Sohn sich über die Waren ausließ – Zelta schien gar nicht erfreut darüber zu sein, was ihr Gatte als Gegenleistung für die Arbeit eines ganzen Jahres erworben hatte. Sie schüttelte den Kopf, während sie überlegte, was mit den verschiedenen Sachen geschehen sollte.
Den Sack Getreide stellte sie aufrecht in eine Ecke der Küche; die Kartoffeln ließ sie in ihrer Holzkiste, und den Fisch legte sie ans Fenster. Dann überzeugte Zelta sich von der Größe der Kleidungsstücke, ehe sie entschied, welches ihrer Kinder was davon bekommen sollte. Die Schuhe kamen neben die Tür für denjenigen, der sie gerade benötigte. Die Messingschnalle legte Zelta in eine kleine Pappschachtel, die sie dann, wie Lubji sah, unter einem losen Fußbodenbrett neben dem Bett des Vaters versteckte.
In dieser Nacht, während der Rest der Familie schlief, gelangte Lubji zu der Einsicht, dass er von nun an nichts mehr auf den Viehweiden zu suchen hatte. Als sein Vater am nächsten Morgen aufstand, ging Lubji zur Tür und schlüpfte in die neuen Schuhe, die ihm viel zu groß waren, und folgte dem Vater aus dem Haus. Diesmal jedoch begleitete er ihn nur bis zum Stadtrand und versteckte sich hinter einem Baum. Er schaute seinem Vater nach, bis dieser nicht mehr zu sehen war. Der Vater ging davon, ohne sich ein einziges Mal umzublicken, um festzustellen, ob der Erbe seiner kargen Besitztümer ihm folgte.
Lubji machte kehrt und rannte zurück zum Markt. Den ganzen Tag verbrachte er damit, zwischen den Buden und Ständen herumzuschlendern und sich anzuschauen, was es dort zu kaufen gab. Einige Händler boten Obst und Gemüse feil, während andere sich auf Möbel und Haushaltsgeräte spezialisiert hatten. Doch die meisten waren bereit, mit allem Möglichen zu handeln, sofern sie sich Gewinn davon versprachen. Es machte Lubji Spaß, die verschiedenen Methoden zu studieren, welche die Händler im Umgang mit ihren Kunden anwendeten; manche versuchten es mit Einschüchterung, andere mit Beschwatzen – und fast alle logen, was die Qualität ihrer Ware betraf. Besonders aufregend für Lubji war, dass die Leute sich der unterschiedlichsten Sprachen bedienten. Rasch erkannte er, dass die meisten Kunden – wie auch sein Vater – übers Ohr gehauen wurden. Im Laufe des Nachmittags hörte Lubji genauer zu und schnappte einige Brocken in anderen Sprachen als der eigenen auf.
Als der Junge an diesem Abend nach Hause kam, bombardierte er seine Mutter erneut mit Fragen. Zum ersten Mal machte Lubji die Erfahrung, dass es Fragen gab, die sogar seine Mutter nicht beantworten konnte. Ihr abschließender Kommentar zu der letzten unbeantworteten Frage an jenem Abend lautete: »Es wird Zeit, dass du zur Schule gehst, mein Kleiner.« Die Sache hatte nur einen Haken: In Douski gab es keine Schule für ein Kind in Lubjis Alter. Zelta beschloss, mit ihrem Onkel darüber zu reden, sobald sich die Gelegenheit bot. Es war ja immerhin möglich, dass ihr Sohn aufgrund seines brillanten Verstands einmal Rabbi wurde.
Am nächsten Morgen stand Lubji auf, noch bevor sein Vater erwachte. Wieder schlüpfte er in das eine Paar Schuhe und schlich aus dem Haus, ohne seine Brüder und Schwestern zu wecken. Er rannte den ganzen Weg bis zum Markt; dann schlenderte er wieder zwischen den Buden und Ständen herum und schaute den Händlern dabei zu, wie sie ihre Waren auslegten. Er lauschte, wie sie feilschten, und er verstand immer mehr von dem, was sie sagten. Allmählich erkannte Lubji, was seine Mutter meinte, als sie gesagt hatte, er habe eine von Gott gegebene Sprachbegabung. Dass er überdies ein unglaubliches kaufmännisches Talent besaß, das sich hier und jetzt zu entwickeln begann, wusste sie allerdings nicht.
Gebannt schaute Lubji zu, wie jemand ein Dutzend Kerzen gegen ein Hühnchen eintauschte, während ein anderer sich für zwei Sack Kartoffeln von einer Kommode trennte. Er stapfte weiter und beobachtete, wie eine Ziege für einen abgetretenen Teppich geboten wurde, und ein Karren Holz für eine Matratze. Lubji hatte den sehnlichen Wunsch, sich die Matratze leisten zu können, die breiter und dicker war als die eine, auf der seine ganze Familie schlief.
Morgen für Morgen kehrte er zum Marktplatz zurück. Er erkannte, dass die Tüchtigkeit eines Händlers nicht nur von seiner Ware abhing, sondern vor allem von seiner Fähigkeit, den Kunden zu überzeugen, dass er diese Ware benötigte. Lubji brauchte nur wenige Tage, um zu erkennen, dass diejenigen, die mit diesen bunten Scheinen handelten, nicht nur besser gekleidet waren als die anderen, sondern sich ohne Zweifel auch in der besseren Position befanden, ein gutes Geschäft zu machen.
Als Lubjis Vater die Zeit für gekommen hielt, die nächsten zwei Kühe zum Markt zu zerren, war der Sechsjährige bestens darauf vorbereitet, das Feilschen zu übernehmen. Auch an jenem Abend musste der junge Händler seinen Vater wieder von der Gaststube nach Hause führen. Doch nachdem der Betrunkene auf die Matratze gesunken war, starrte Zelta diesmal sprachlos auf den Berg von Gegenständen, den der Sohn vor ihr auftürmte.
Lubji verbrachte mehr als eine Stunde damit, der Mutter zu helfen, die Sachen unter den Familienangehörigen aufzuteilen. Er verschwieg ihr jedoch, dass er immer noch ein Stück buntes Papier mit einer »10« darauf hatte. Er wollte herausfinden, was er sonst noch damit erwerben konnte.
Am nächsten Morgen rannte Lubji nicht direkt zum Markt. Stattdessen begab er sich zum ersten Mal in die Schullstraße, um sich ein Bild davon zu machen, was in den Läden verkauft wurde, die sein Großonkel hin und wieder besuchte. Er betrachtete die Schaufenster eines Bäckers, eines Fleischers, eines Töpfers, eines Textilgeschäfts und schließlich das eines Juweliers, das einzige Geschäft, über dessen Tür in Goldbuchstaben ein Name prangte: Herr Lekski. Lubji starrte auf eine Brosche, die mitten im Schaufenster lag. Sie war sogar noch schöner als jene, die seine Mutter einmal im Jahr zu Rosch ha-Schana trug, dem jüdischen Neujahrsfest; Zelta hatte Lubji einmal erzählt, die Brosche sei ein Familienerbstück.
Als er an diesem Abend nach Hause kam, stellte er sich ans Feuer, während seine Mutter den Eintopf zubereitete. Er erzählte ihr, dass die Läden nichts weiter seien als Buden, die nicht abgebaut würden und Fenster an den Vorderseiten besäßen, und dass er – die Nase an die Glasscheibe gedrückt – gesehen habe, dass fast alle Kunden mit Papierscheinen bezahlten und gar nicht erst versuchten, mit den Ladenbesitzern zu feilschen.
Am nächsten Tag kehrte Lubji zur Schullstraße zurück. Er nahm sein buntes Papier aus der Tasche und betrachtete es eine Zeit lang. Er wusste immer noch nicht, was er im Tausch dafür bekam. Nachdem er ungefähr eine Stunde durchs Schaufenster der Bäckerei gestarrt hatte, marschierte er voller Selbstvertrauen in das Geschäft und reichte dem Mann hinter dem Ladentisch den Schein. Der Bäcker nahm ihn und zuckte die Schultern. Hoffnungsvoll zeigte Lubji auf einen Laib Brot im Regal hinter ihm, und der Ladenbesitzer reichte ihn dem Jungen. Zufrieden mit diesem Tausch, wandte Lubji sich zum Gehen, doch der Bäcker rief ihm nach: »Vergiss dein Wechselgeld nicht!«
Unsicher, was der Mann damit meinte, drehte Lubji sich um und beobachtete, wie der Bäcker den Schein in eine Metallschachtel legte, ein paar Münzen herausnahm und sie ihm über den Ladentisch hinweg reichte.
Wieder draußen auf der Straße, betrachtete der Sechsjährige die Münzen mit großem Interesse. Auf einer Seite waren Zahlen eingeprägt, auf der anderen Seite der Kopf eines Mannes, den er nicht kannte.
Durch diesen Handel ermutigt, betrat Lubji den Laden des Töpfers und erstand im Tausch gegen die Hälfte seiner Münzen eine Schüssel, von der er hoffte, dass seine Mutter sie brauchen konnte.
Als Nächstes blieb er vor Herrn Lekskis Laden stehen, dem Juweliergeschäft, wo sein Blick sich sofort auf die wunderschöne Brosche richtete, die in der Mitte des Schaufensters lag. Lubji schob die Tür auf und marschierte zum Ladentisch, hinter dem ein alter Mann in Anzug und Krawatte stand.
»Was kann ich für dich tun, kleiner Mann?«, fragte Herr Lekski und beugte sich über den Tresen, um zu seinem Kunden hinunterzublicken.
»Ich möchte die Brosche für meine Mutter kaufen.« Lubji deutete zum Schaufenster und hoffte, dass seine Stimme selbstsicher genug klang. Dann öffnete er die Faust, um Herrn Lekski die drei kleinen Münzen zu zeigen, die ihm nach seinen morgendlichen Geschäften noch geblieben waren.
Der alte Mann lachte nicht; stattdessen erklärte er Lubji freundlich, dass er sehr viel mehr Münzen bräuchte, ehe er darauf hoffen könne, die Brosche zu erstehen. Lubji lief rot an, schloss die Faust wieder um die Münzen und wandte sich rasch zum Gehen.
»Aber komm morgen ruhig noch einmal her«, schlug der alte Mann ihm vor. »Vielleicht kann ich doch etwas für dich finden.« Mit hochrotem Gesicht rannte Lubji auf die Straße, ohne sich umzudrehen.
In dieser Nacht fand er keinen Schlaf. Immer wieder sprach er im Geist jene Worte, die Herr Lekski zu ihm gesagt hatte. Am nächsten Morgen stand er wieder vor dem Juwelierladen – lange bevor der alte Mann erschien und die Ladentür öffnete. An diesem Tag erhielt Lubji von Herrn Lekski die erste Lektion. Sie lautete: Leute, die es sich leisten können, Schmuck zu kaufen, stehen nicht schon vor dem ersten Hahnenschrei auf.
Herr Lekski, ein Stadtältester, war von der Chuzpe des Sechsjährigen sehr beeindruckt gewesen. Immerhin hatte der kleine Kerl den Mut aufgebracht, mit einer Handvoll nahezu wertloser Münzen sein Geschäft zu betreten. Im Laufe der nächsten Wochen verwöhnte Herr Lekski den Sohn des Viehhändlers damit, dessen unaufhörlichen Strom von Fragen zu beantworten. Es dauerte nicht lange, und Lubji kam jeden Nachmittag auf ein paar Minuten ins Juweliergeschäft. Wenn der alte Mann jemanden bediente, wartete er jedes Mal vor dem Laden. Sobald der Kunde gegangen war, stürmte Lubji durch die Tür und rasselte seine Fragen herunter, die er sich in der vergangenen Nacht überlegt hatte.
Anerkennend stellte Herr Lekski fest, dass Lubji die gleiche Frage nie ein zweites Mal stellte und sich jedes Mal, wenn ein Kunde den Laden betrat, rasch in die Ecke zurückzog und sich hinter der Tageszeitung des alten Mannes versteckte. Obwohl er die Seiten umblätterte, konnte Herr Lekski nie sicher sein, ob der Junge las oder nur die Bilder ansah.
Eines Abends, nachdem Herr Lekski den Laden abgeschlossen hatte, nahm er den Jungen mit hinter das Geschäft, um ihm sein Auto zu zeigen. Lubji riss die Augen weit auf, als er erfuhr, dass dieses wundersame Ding sich bewegen konnte, ohne von einem Pferd gezogen zu werden. »Aber es hat doch keine Beine!« rief er ungläubig. Er öffnete die Wagentür und kletterte neben Herrn Lekski ins Innere. Als der alte Mann auf einen Knopf drückte, um den Motor anzulassen, empfand der Junge gleichermaßen Übelkeit wie Angst. Doch obwohl er kaum über das Armaturenbrett schauen konnte, wollte er schon kurz darauf mit Herrn Lekski den Platz tauschen und sich hinters Lenkrad setzen.
Herr Lekski fuhr Lubji durch die Stadt und setzte ihn vor seiner Hütte ab. Der Junge stürmte sofort in die Küche und rief seiner Mutter zu: »Eines Tages hab’ ich auch ein Auto!« Zelta lächelte bei dem Gedanken und verschwieg ihrem Sohn, dass sogar der Rabbi nur ein Fahrrad besaß. Dann fütterte sie ihr jüngstes Kind weiter – und schwor sich wieder einmal, dass es das letzte sein würde. Dieser neuerliche Familienzuwachs hatte zur Folge gehabt, dass sich der schnell wachsende Lubji nicht mehr zu seinen Schwestern und Brüdern auf die Matratze zwängen konnte. Seit einiger Zeit musste er mit den alten, in der Feuerstelle ausgelegten Zeitungen des Rabbi vorliebnehmen.
Sobald es dunkel wurde, balgten sich die Kinder um einen Platz auf der Matratze; die Hochs konnten es sich nicht leisten, ihren geringen Vorrat an Kerzen zur Verlängerung des Tages zu vergeuden. Nacht für Nacht lag Lubji in der ausgepolsterten Feuerstelle, dachte an Herrn Lekskis Auto und versuchte eine Möglichkeit zu finden, seiner Mutter zu beweisen, dass sie im Irrtum war. Dann erinnerte er sich an die Brosche, die sie nur zu Rosch ha-Schana trug. Er zählte die Tage an den Fingern ab und kam zu dem Ergebnis, dass er noch sechs Wochen warten musste, bevor er den Plan, den er sich ausgedacht hatte, in die Tat umsetzen konnte.
Den größten Teil der Nacht vor Rosch ha-Schana lag Lubji wach. Kaum hatte seine Mutter sich am nächsten Morgen angezogen, folgte ihr Lubjis Blick – beziehungsweise vielmehr der Brosche, die sie trug.
Nach dem Gottesdienst, als sie die Synagoge verlassen hatten, fragte sich Zelta, weshalb ihr Sohn auf dem gesamten Heimweg ihre Hand nicht losließ. Seit seinem dritten Geburtstag hatte er das nicht mehr getan. Sobald sie in ihrer kleinen Hütte waren, setzte sich Lubji mit übereinandergeschlagenen Beinen in die Ecke des Zimmers, in der sich die Feuerstelle befand, und beobachtete, wie seine Mutter das winzige Schmuckstück von ihrem Kleid löste. Einen Augenblick betrachtete Zelta das Erbstück; dann kniete sie nieder, hob die lose Bodendiele neben der Matratze an und legte die Brosche behutsam in die alte Pappschachtel, ehe sie das Bodenbrett zurückschob.
Während Lubji der Mutter zuschaute, verhielt er sich so still, dass Zelta sich Sorgen machte und ihn fragte, ob er sich nicht wohlfühle.
»Mir geht’s gut, Mama«, beruhigte er sie. »Aber heute ist Rosch ha-Schana, und da hab’ ich darüber nachgedacht, was ich im neuen Jahr tun soll.«
Seine Mutter lächelte, denn sie hegte noch immer die Hoffnung, dass sie ein Kind geboren hatte, aus dem vielleicht ein Rabbi wurde. Lubji schwieg, weil er über das Problem mit der Schachtel nachdenken musste. Er verspürte keinerlei Gewissensbisse, dass er in den Augen seiner Mutter eine Sünde beging, wenn er seinen Plan verwirklichte; schließlich hatte er sich fest vorgenommen, bis zum Ende des Jahres alles an seinen alten Platz zurückzulegen, sodass niemand je etwas davon erfahren würde.
In dieser Nacht, als die anderen Familienmitglieder sich auf die Matratze geklettert waren, kuschelte sich Lubji in die Feuerstelle und tat so, als würde er schlafen, bis er sicher war, dass alle anderen es taten. Er wusste, dass für die sechs unruhigen, dicht aneinander gedrängten Leiber – zwei Köpfe oben, zwei unten, und Mutter und Vater an den Rändern – der Schlaf ein Luxus war, der selten länger als ein paar Minuten dauerte.
Als Lubji glaubte, dass außer ihm niemand mehr wach war, kroch er vorsichtig an den Wänden des Zimmers entlang, bis er zur gegenüberliegenden Seite der Matratze gelangte. Sein Vater schnarchte dermaßen laut, dass Lubji befürchtete, jeden Moment müsse eines seiner Geschwister aufwachen und ihn entdecken.
Er hielt den Atem an, als er suchend über die Bodendielen tastete, um festzustellen, welche sich hochheben ließ.
Die Sekunden dehnten sich zu Minuten, doch plötzlich bewegte sich eine der Dielen leicht. Indem er die rechte Hand auf ein Ende drückte, konnte Lubji sie langsam anheben. Dann schob er die linke in die kleine Vertiefung und ertastete den Rand eines Gegenstandes. Er ergriff ihn und zog behutsam die Pappschachtel hervor. Anschließend schob er das Bodenbrett wieder an Ort und Stelle zurück.
Lubji verharrte völlig regungslos, bis er sicher sein konnte, dass niemand etwas bemerkt hatte. Einer seiner jüngeren Brüder drehte sich auf die Seite, woraufhin seine Schwestern aufstöhnten und dem Beispiel des Bruders notgedrungen folgten. Lubji nutzte die Gunst des Augenblicks und beeilte sich, an der Wand entlang zurückzuhuschen, bis er zur Haustür gelangte.
Vorsichtig erhob er sich von den Knien und tastete nach der Türklinke. Sein schweißnasser Handteller bekam sie zu fassen, und langsam drückte er sie hinunter. Die Angel knarrte laut, wie es Lubji nie zuvor aufgefallen war. Er schlich hinaus auf den Gehweg, stellte die Pappschachtel auf den Boden, hielt den Atem an und schloss die Tür hinter sich.
Die kleine Schachtel an die Brust gedrückt, rannte Lubji fort von der Hütte. Er schaute nicht zurück; deshalb sah er nicht, dass sein Großonkel ihn aus seinem Haus beobachtete, das gleich hinter der elterlichen Hütte stand. »Genau wie ich befürchtet habe«, murmelte der Rabbi vor sich hin. »Er schlägt ganz nach der Familie seines Vaters.«