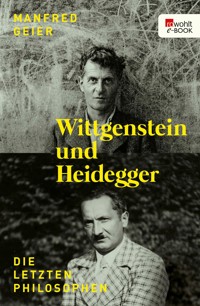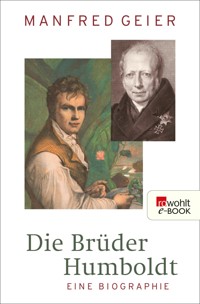14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Immer wieder wird die Philosophie totgesagt: Ende der Metaphysik, Ende der Vernunft, Ende der Wahrheit ... Aber diese Rede vom Ende gehört selbst zum Sprachspiel der Philosophen, durch die es sich lebendig hält. Es gibt kein Regelverzeichnis dieses Spiels; denn die Philosophie ist keine Lehre, sondern eine Tätigkeit. Diesem Hinweis Ludwig Wittgensteins folgend, wird die Geschichte des europäischen Philosophierens nicht nacherzählt als Abfolge großer Systeme und Entwürfe, sondern es werden die Probleme erhellt, die seit den griechischen Anfängen bis in die Gegenwart die Entwürfe der Sprachphilosophie und Logik von Parmenides bis Wittgenstein beherrschen. Sie alle haben eine antinomische Spannung, die immer wieder staunen läßt und zum unaufhörlichen Nachdenken herausfordert. So liefert der philosophische Diskurs denn auch keine endgültigen Antworten, sondern bietet mögliche Lösungsversuche mit stets neuen Verwicklungen. Sie alle wollen die rätselhaften Knoten lösen, die den Menschen fesseln, sobald er philosophisch zu fragen beginnt. Insofern richtet sich dieses Werk an jeden, der sich zur philosophischen Tätigkeit verführen lassen und am Sprachspiel der Philosophen teilnehmen möchte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Manfred Geier
Das Sprachspiel der Philosophen
Von Parmenides bis Wittgenstein
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Immer wieder wird die Philosophie totgesagt: Ende der Metaphysik, Ende der Vernunft, Ende der Wahrheit ... Aber diese Rede vom Ende gehört selbst zum Sprachspiel der Philosophen, durch die es sich lebendig hält. Es gibt kein Regelverzeichnis dieses Spiels; denn die Philosophie ist keine Lehre, sondern eine Tätigkeit. Diesem Hinweis Ludwig Wittgensteins folgend, wird die Geschichte des europäischen Philosophierens nicht nacherzählt als Abfolge großer Systeme und Entwürfe, sondern es werden die Probleme erhellt, die seit den griechischen Anfängen bis in die Gegenwart die Entwürfe der Sprachphilosophie und Logik von Parmenides bis Wittgenstein beherrschen.
Sie alle haben eine antinomische Spannung, die immer wieder staunen läßt und zum unaufhörlichen Nachdenken herausfordert. So liefert der philosophische Diskurs denn auch keine endgültigen Antworten, sondern bietet mögliche Lösungsversuche mit stets neuen Verwicklungen. Sie alle wollen die rätselhaften Knoten lösen, die den Menschen fesseln, sobald er philosophisch zu fragen beginnt.
Über Manfred Geier
Manfred Geier, geboren 1943, lehrte viele Jahre Sprach- und Literaturwissenschaft an den Universitäten Marburg und Hannover. Jetzt lebt er als freier Publizist in Hamburg. Er veröffentlichte u.a.: «Kants Welt. Eine Biographie» (2003), «Worüber kluge Menschen lachen. Kleine Philosophie des Humors» (2006), «Die Brüder Humboldt. Eine Biographie» (2009), «Aufklärung. Das europäische Projekt» (2012), «Geistesblitze. Eine andere Geschichte der Philosophie» (2013). Außerdem mehrere Bände in der Reihe rowohlts enzyklopädie sowie die Rowohlt-Monographien «Karl Popper», «Martin Heidegger» und «Der Wiener Kreis».
Inhaltsübersicht
Vorwort
Es ist ja kein böses Geschick, das dich fortgeleitet hat über diesen Weg, um ans Ziel zu gelangen – einen Weg, der weitab vom üblichen Pfad der Menschen liegt –, sondern göttliche Fügung und dein Recht.
Parmenides
Die Sprache ist ein Labyrinth von Wegen. Du kommst von einer Seite und kennst dich aus; du kommst von einer andern zur selben Stelle und kennst dich nicht mehr aus.
Ludwig Wittgenstein
1. Der ganzen bisherigen Naturgeschichte verdankt der Mensch seine fünf Sinne. Mit ihnen sieht, hört, schmeckt, riecht und tastet er, was für ihn da ist, stets jetzt und immer hier. Dieses paradiesische Dasein sinnlicher Präsenz mußte der Mensch verlassen. Er lernte das Abwesende, das Nichtexistierende, das Imaginäre kennen. Er muß denken, was es nicht gibt, und sich vorstellen, was möglich ist. Das Sprachvermögen ist sein sechster Sinn, Organ eines kulturgeschichtlichen Sprachspiels, in dem er mitzuspielen gelernt hat. Im Sinn der Sprache entwickelt sich sein Sinn für dies Andere, das nicht präsent ist und oft genug nur eine Chimäre, deren Trugkraft ohne Ende ist.
2. Die unaufhebbare Trennung vom sinnlichen Dasein der Dinge, vom Ich-Jetzt-Hier der sinnlichen Gewißheit, fordert zur Frage heraus: Wie steht es um die Differenz zwischen Sein und Nichtsein, konkreten Tatsachen und sprachlichem Ausdruck, Zeigbarem und Sagbarem, Wirklichkeit und Möglichkeit? Gedacht und gesagt werden kann und muß etwas, das nicht oder nur möglich ist. Wie steht es um dieses Etwas?
3. Mit dieser Verschiebung öffnet sich ein endloser Horizont des philosophischen Fragens. Denn keine philosophische Frage kann abschließend beantwortet werden. Jede Lösung wirft neue Folgeprobleme auf, jeder lösende Einfall verstrickt aufs neue in eine Situation des Erstaunens, der Rätselhaftigkeit, oft auch der Ratlosigkeit im eingespielten Medium der Sprache selbst. Mit jeder Antwort verschiebt sich der Horizont des philosophischen Fragens in eine neue Ferne. Angetrieben durch den vordergründigen Wunsch, eine unantastbare und definitive Antwort zu finden und die Probleme endgültig zu beseitigen, begibt sich die Philosophie auf einen endlosen Weg. Immer erneut läßt sie sich durch ihre Rätsel verführen und versucht, sie zu lösen im ungesagten Bewußtsein ihrer Unlösbarkeit. Aus dieser Paradoxie bezieht sie ihre Kraft und Ausdauer.
Im Innern des philosophischen Diskurses taucht das Unlösbare als inimicus auf, als geliebter Provokateur. Gegen ihn wird kein Krieg geführt, um ihn als gegnerischen Feind, als hostis, gewaltsam zu schlagen oder zu vernichten. Statt dessen wird er für jenen anregenden Kampf beansprucht, den Heraklit ursprünglich als polemos (Fragment 53) dachte und Heidegger durch ‹Aus-einander-setzung› übersetzte, Platon als ‹Feindschaft mit dem Befreundeten› begriff und Lyotard als ‹Widerstreit› (le différend) entfaltete. Nicht die ungebrochene Liebe zu einer unerschütterlichen Wahrheit oder einem letztbegründenden Fundament, sondern der ständige Zwiespalt mit dem unlösbaren inimicus des eigenen Denkens konstituiert die Philosophie und läßt sie beweglich bleiben.
4. Zwar möchte die Philosophie seit dem anfänglichen Staunen, das sie diskursiv durchherrscht, mehr und besser wissen. Aber sie weiß zugleich, daß ihre Bewegung keinen Anfang und kein Ende hat, sondern sich einem überzeitlichen Gestus verdankt, der Parmenides und Heidegger, Sokrates und Wittgenstein als Gesprächspartner und Zeitgenossen zusammenführt. Es sind auch heute noch die gleichen Fragen, die philosophisch beunruhigen: die Fragen nach dem tragfähigen Grund sprachlicher Referenz, nach dem gesicherten Sinn des Sagbaren, nach der überzeugenden Wahrheit des Denkbaren. Jeder radikale Philosoph nimmt teil an einer unaufhörlichen Odyssee. Sisyphus und der Ritter von der traurigsten Gestalt sind seine liebsten Gefährten. Er kennt weder den Optimismus der wissenschaftlichen Denkweise, die jeder Beunruhigung mit einer Erklärung antworten will, noch die besinnliche Ruhe des religiösen Glaubens, auch nicht die Erfüllung im poetischen Dichten. Er findet keine Erlösung. Um so intensiver setzt er sich der Unruhe eines Denkens aus, das zu einer Lust verführt, die sich im Verlust jedes gesicherten Ruhepunkts kultiviert. Nichts wünscht sich sein Geist mehr, als ein guter Tänzer zu sein.
5. Das Sprachspiel der Philosophen hat seine eigene Zeit. Es lebt in einer unaufhörlichen Erneuerung seiner Probleme und gewinnt so seine eigentümliche Beweglichkeit: Indem es fortschreitet in einer Folge stets neuer Problemlösungsversuche, die immer wieder neu hervorgebracht werden müssen, zieht es zugleich seine reflexiven Kreise. Es ist permanente Rückwendung zu seiner eigenen Spur, in der sich seine Kraft und sein Sinn vereinen.
6. Die Philosophie ist nicht am Ende, sowenig ihr Anfang abgeschlossen hinter uns liegt. Man kann es nicht zuletzt am Weg der modernsten Wissenschaften sehen, die heute wieder mit jenen anfänglichen philosophischen Fragen konfrontiert sind, die mit dem Sprachvermögen des Menschen die Szene betreten haben: Die Suche nach dem Kleinsten (in Mikrophysik und Mikrobiologie) und nach dem Größten (in Astronomie und Kosmologie), die Entschlüsselung der Prinzipien des Denkens und des Wissens (in den Forschungen zur Künstlichen Intelligenz, in Neuropsychologie und Linguistik), aber auch die aktuellen Fragen nach den Grundlagen von Logik und Mathematik, all das verweist zurück auf die besondere Qualität eines sechsten Sprachsinns, der sich vom zugänglichen Normalbereich des sinnlich Erfahrbaren getrennt hat und nur semantisch imaginierbar und philosophisch reflektierbar ist. Mag sie es wissen und wollen – oder nicht: eine Wissenschaft ohne Philosophie wüßte buchstäblich nicht, wovon sie redet.
7. Es hat sich eingebürgert, das stabile semiotische Dreieck von Dingen, Seelenregungen und Wörtern (Aristoteles) oder, modern gesprochen, von Referenzobjekten, Signifikaten und Signifikanten (Saussure) für eine philosophiegeschichtliche Epocheneinteilung zu benutzen. Intendierte das ontologische Philosophieren anfänglich auf das, was ist, und orientierte sich am Sein, so wurde es zunächst unter dem Druck von Skepsis und Zweifelsargument auf einen selbstreflexiven Weg nach Innen gedrängt. Mentalistisches Philosophieren zielte auf das, was gewußt werden kann, und richtete sich am Denken aus. Linguistisches Philosophieren wendet dagegen seine Aufmerksamkeit auf das, was sinnvoll sagbar ist, und versucht gegenwärtig zu rekonstruieren, was verstanden werden kann. – Gegen diese triadomanische Leidenschaft der Zeichentheorie, die auch für die Philosophiegeschichtsschreibung beherrschend geworden ist, gilt es die Einsicht festzuhalten, daß die philosophischen Rätsel als solche sich gleich geblieben sind, auf welcher Ebene man sie auch anzusiedeln versucht hat. Sie betreffen gleichermaßen Sein, Erkenntnis und Sprache. Das garantiert ihre Übersetzbarkeit und eine Transformation der Philosophie, die bleibt, was sie war: unerschöpfliche geistige Auseinandersetzung, an der das Leben nicht verarmt. Für dieses Ganze der Philosophie steht Wittgensteins Bild des ‹Sprachspiels›. In ihm ist integriert, was ist, was gewußt und was gesagt werden kann. Es soll uns als Wegweiser dienen auf den labyrinthischen Wegen des Philosophierens.
8. Es sind Rätselabenteuer, die es auf diesen Wegen zu bestehen gilt. Stets aufs neue erprobt sich an ihnen der philosophische Geist. Sie alle haben, seit uns die griechischen Philosophen ihre Probleme hingeworfen haben, etwas Spielerisches, sind oft Scherzfrage und Denkaufgabe zugleich. Das philosophische Sprachspiel wird gespielt. Eleatische Paradoxien und eristische Streitigkeiten, sokratische Zweifelsfragen und aristotelische Knoten, sophistische Fallstricke und skeptische Verunsicherungen, kynische Frechheiten und zynische Spöttereien, scholastische Unlösbarkeiten und vernunftkritische Antinomien, dialektische Widersprüche und sprachlogische Paradoxien – sie alle dienen nicht einer Beruhigung des Denkens, sondern seiner aufreizenden Störung. Nicht zuletzt dokumentiert ‹Das Sprachspiel der Philosophen›, daß aus solchen Reizungen äußerst geschätzte Geisteszustände entstehen können, mag man sich auch noch so sehr mit ihnen herumquälen. Auch die Beulen, die sich der Verstand auf seinen Wegen durchs philosophische Labyrinth holt, lassen uns den Wert seiner Wanderungen erkennen.
9. Der Modus dieses Buches ist philosophisch, seine Intention politisch. Mit ihm ist eine verschwindende Kultur des Staunens und des Zweifelns zu verteidigen versucht worden gegen ihre zivilisatorischen Gegner: gegen den ökonomischen Diskurs eines Fortschritts, der für jedes Problem eine bessere Lösung verspricht und dabei immer katastrophaler wird, und gegen die Begrenzungen eines wissenschaftlichen Wissens, das zunehmend nur noch als ein Mittel wirksam ist, das Staunen einzuschläfern, aus dem es einst entstand. Die philosophische Auseinandersetzung, deren widerstreitender Form hier gefolgt wird, wird nicht geschlichtet. Sie wird bejaht als Modell einer Kultur, die sich ihre Rätsel geschaffen hat, um sich an ihren unlösbaren Spannungen bewähren zu können.
Der Anfang
oder: Ich kenne mich nicht aus
Man hört immer wieder die Bemerkung, daß die Philosophie keinen Fortschritt mache, daß die gleichen philosophischen Probleme, die schon die Griechen beschäftigten, uns noch beschäftigen. Die das aber sagen, verstehen nicht den Grund, warum es so sein muß. Der ist aber, daß unsere Sprache sich gleich geblieben ist und uns immer wieder zu denselben Fragen verführt. Solange es ein Verbum «sein» geben wird, das zu funktionieren scheint wie «essen» und «trinken», solange es Adjektive «identisch», «wahr», «falsch», «möglich» geben wird, solange von einem Fluß der Zeit und von einer Ausdehnung des Raumes die Rede sein wird, usw., usw., solange werden die Menschen immer wieder an die gleichen rätselhaften Schwierigkeiten stoßen, und auf etwas starren, was keine Erklärung scheint wegheben zu können.
Ludwig Wittgenstein
Die Philosophie ist am Ende.» Wieder einmal ist, mit einem vornehmen apokalyptischen Ton, ihr Tod beschworen worden. Nicht ohne geheime Schadenfreude hat es auch die bürgerliche Presse zur Kenntnis genommen. Denn einer der tiefsinnigsten ‹Denker in dürftiger Zeit› hat es selbst erschüttert eingestanden. In einem SPIEGEL-Gespräch (23. September 1966) hat Martin Heidegger es der Öffentlichkeit offenbart: Die Zukunft gehört der Kybernetik, einer von den Göttern verlassenen Welt der Elektronik, der Berechenbarkeit, der technischen Kalkulation, deren technisch-praktische Erfolge sich nicht mehr philosophisch in Gedanken fassen lassen. Philosophie biete keine Möglichkeit mehr, die Grundzüge des Zeitalters denkend zu erfassen oder problematisierend in Frage zu stellen. Was bleibt? «Nur noch ein Gott kann uns retten», prophezeite Heidegger und forderte visionär eine letzte verzweifelte Bereitschaft:
Die einzige Möglichkeit einer Rettung sehe ich darin, im Denken und im Dichten eine Bereitschaft vorzubereiten für die Erscheinung des Gottes oder für die Abwesenheit des Gottes im Untergang; daß wir nicht, grob gesprochen, «verrecken», sondern wenn wir untergehen, im Angesicht des abwesenden Gottes untergehen (Antwort. Martin Heidegger im Gespräch, 1988, S. 100).
Die Philosophie ist bescheiden geworden. Sie spielt, Jürgen Habermas zufolge, nur noch eine Rolle, «die nach meinen Erfahrungen zunehmend Ärger einbringt und zu nichts mehr privilegiert» (Habermas 1983, S. 27). Der Gestus der Verabschiedung der Philosophie, das Eingeständnis ihrer eigenen ‹Inkompetenz› (Marquard 1981) hat sich breitgemacht in einer Situation, in der die Vernunft nicht mehr nach Kriterien der Wahrheit oder Allgemeingültigkeit befragt, sondern nur noch nach der Verwertbarkeit von erfolgversprechenden Aussagen beurteilt wird. Die Philosophie hat es schwer, noch ‹an der Zeit› zu sein (Rötzer 1987). Sie scheint anachronistisch zu sein gegenüber den Erfolgen zunehmender Berechenbarkeit. In ihrer neuesten amerikanischen Variante zieht sie sich nicht zufällig auf einen pragmatischen Common sense zurück, den sich die Gemeinschaft der liberalen Intellektuellen als ein ungesichertes demokratisches Refugium noch offenhält (Rorty 1988).
Es mag durchaus Ärger einbringen, in dieser Situation mehr denken zu wollen als das, was wissenschaftlich oder gesellschaftlich der Fall ist. Aber ärgerlich war das europäische Philosophieren schon immer. Denn die gesellschaftlich eingespielte Praxis konnte ihm nie als Maßstab dienen, und technisch verwertbare Erfolge waren ihm schon immer versagt. (Was einzelne Philosophen in dieser Hinsicht gelegentlich geleistet haben, geht auf Bemühungen zurück, die nicht spezifisch philosophisch waren. Ich denke an die mathematischen Entdeckungen von Leibniz oder Russell, an Humes psychologische Forschungen, an die logischen Systematisierungen Carnaps oder Quines, an die physikalischen Theorien Machs oder Heisenbergs, an die strukturalistische Rekonstruktion der Wissenschaftssprache durch Stegmüller etc.) – Welchem einstigen ‹Privileg› könnte hier nachgetrauert werden? Verloren ging allein das einmal mächtig gewesene Leitbild, das die Philosophie zu einer Zeit beherrscht hat, in der sie sich als totalisierende Synthese und universalistische Letztbegründung der wissenschaftlichen Erkenntnis und der gesellschaftlichen Lebensformen verstanden hat. Davon scheint heute, nach der Metaphysik, nur noch der zurückgenommene Anspruch auf Rationalität übrigzubleiben, als deren letzte Hüterin sich die Philosophie zu behaupten sucht, und sei es auch nur mit dem traurigen Eingeständnis, keine starken Ansprüche auf Theorie, Wahrheit und System mehr anzumelden, sondern allein auf jene Begründungen zu bauen, die das philosophische Interesse trotz allem noch auf die Unbedingtheit des rationalen Diskurses festlegen oder dem Wunsch nach möglichst umfassender Erweiterung von Intersubjektivität unterstellen.
Vielleicht ist auch dieses rationalistische Selbstverständnis nur eine altehrwürdige Fiktion, die das philosophische Denken einem ihm fremden und äußerlichen Zweck überantwortet. Vielleicht signalisiert der Gestus der Verabschiedung nur das Ende einer langen Illusion, die nicht das Philosophieren, sondern allein das Bild beherrscht, das man sich von ihm gemacht hat. Die Philosophie wäre immer schon am Ende gewesen, wenn sie sich ihren Ideologen ausgeliefert hätte. Sie hat es nie. Denn die Kraft, die sie beseelt (hat), die Intention, die ihre Anspannung lebendig sein läßt, erschöpfte sich nie im Willen nach endgültigem Wissen, umfassender Systematik und ungebrochener Rationalität. Es war immer ein Verlangen nach Staunen, Zweifel und Konfusion, das sie bewegt hat. Vielleicht ist es seltener geworden. Möglicherweise hat es sich verschoben, vom akademischen Interesse an der Philosophie zum philosophischen Interesse (Martens und Schnädelbach 1985, S. 22ff). Aber es war von Anfang an da. Wenn die Philosophie am Ende ist, dann immer noch am Ende ihres Anfangs: keine systematischen Antworten, sondern bewegende Fragen, keine abschließenden Wahrheiten, sondern herausfordernde Provokationen, keine technisch-praktischen Erfolge, sondern ständige Problematisierungen. In einem «Handbuch für Anfänger» hat es der amerikanische Philosoph Jay F. Rosenberg so formuliert:
Was ist das Anliegen des Philosophen? Irgendwann einmal verspürt jeder einen gewissen Impuls. Gewöhnlich taucht er als ein Gefühl, als ein Staunen oder als Beunruhigung auf, und oft genug verwandelt er sich in eine vage, aber anregende Frage: Dauern Raum und Zeit immer fort? Was ist, wenn es keinen Gott gibt? Was, wenn es einen gibt? Bin ich wahrhaft frei? Ist jemals etwas wirklich richtig oder falsch? Gibt es absolute Wahrheiten? Gibt es wirklich so etwas wie gute Kunst? Und natürlich: Was ist der Sinn des Lebens? Gerade darin liegt ein Impuls für philosophische Tätigkeit. Mit dem Staunen beginnt die Philosophie, sagt Aristoteles (Rosenberg 1986, S. 16).
Philosophieren ist eine lebendige Tätigkeit, keine Lehre. Wer noch Lust am Denken hat (und sei es auch nur eine Lust am selbstreferentiellen Bezug des Denkens auf sich selbst), kann sich nur schwer ihrem Reiz entziehen. Und wen das nicht herausfordert, dürfte auch kaum zu begeistern sein. Denn die Philosophie kann immer nur einladen. Entweder springt ihr Funke über – oder nicht. Sie kann nichts erzwingen. Das charakterisiert ihre Ohnmacht – und ihre Chance. Denn sie bietet die Gelegenheit zu einem beunruhigenden Staunen, das nicht nur am historischen Beginn des abendländischen Philosophierens steht, sondern es in seiner eigentlichen Intention bestimmt, als jenes pathos, das Sokrates, der unhandliche Philosoph, als ‹Typ› (Böhme 1988) vorlebte, auch wenn er dafür mit seinem Leben zahlen mußte. Es kennzeichnet die Paradoxie des Philosophierens, daß sein Tod zu ihrem Zeichen wurde, zum Index eines Nachdenkens, das keine Ruhe finden kann, weder angesichts der Fragen, die er gestellt hat, noch angesichts jener ungestellten Fragen, die uns noch bevorstehen und einfallen werden. – Ein Rückgang in die geschichtlichen Anfänge des philosophischen Denkens kann uns dabei helfen, diese Intention zu vergegenwärtigen.
Theaitetos: Wahrlich, bei den Göttern, Sokrates, ich erstaune ungemein, wie doch dieses wohl sein mag; ja bisweilen, wenn ich recht hinsehe, schwindelt mir ordentlich.
Sokrates: Theodoros, du Lieber, urteilt eben ganz richtig von deiner Natur. Denn dies ist der Zustand (pathos) eines gar sehr die Weisheit liebenden Mannes (philosophos), das Erstaunen (thaumazein); ja, es gibt keinen anderen Anfang (arche) der Philosophie als diesen.
(Theaitetos 155 d)
Kurz vor seinem Tode hat sich Sokrates mit Theaitetos, einem geistreichen, aufmerksamen und liebenswerten Jüngling, getroffen. Sie philosophieren über die Frage: Was ist Erkenntnis? Im Verlauf des Gesprächs stellt Theaitetos mehrere Thesen auf. Sokrates läßt sie alle scheitern. Schritt für Schritt werden die vorgebrachten Vermutungen und ihre Begründungen geprüft. Sie alle halten den sokratischen Einwänden nicht stand. Am Ende weiß Theaitetos zwar mehr als zuvor: Er durchschaut seine Irrtümer, die ihn jetzt nicht mehr täuschen können. Aber er weiß zugleich auch weniger: Er ist leer geworden und bildet sich nun nicht mehr ein zu wissen, was er nicht weiß. Unbeschwertheit, Sanftmut und Besonnenheit füllen den freigewordenen Raum dieser Leere aus, die durch keine dogmatische Lehre oder Meinung mehr gefüllt werden kann. Denjenigen, die einen technisch verwertbaren Rat suchen, mag der Philosoph deshalb lächerlich erscheinen, worüber er selbst «ganz ordentlich» und albern (174d) zu lachen vermag. Denn er weiß, daß er gerade mit seinem philosophischen Nichtwissen frei geworden ist von Kleingeistigkeit, knechtischen Dienstleistungen und illusionären Verblendungen.
Die Philosophie ist keine Lehre, sondern eine Tätigkeit (Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus 4.112). Im schwindeligen Erstaunen (thaumazein), mit dem etymologisch an Thaumas, den Gott des Wunders, erinnert wird, hat sie ihr pathos, ihre Passion, Leidenschaft und Intensität, ihre Stimmung. Allein dieses Staunen liefert der Philosophie ihren anfänglichen Grund. Dabei meint das griechische arche dasjenige, woher etwas ausgeht und entsteht. Dieses Woher darf nicht mißverstanden werden als ein bloßer Anfang, der die Menschen nur zu philosophieren beginnen läßt, um dann überflüssig zu werden, sobald die Lösungen gefunden sind. Als arche bleibt es vielmehr lebendig, solange überhaupt philosophiert wird. Staunen ist anfänglicher Grund und treibendes Motiv des Philosophierens. Aristoteles hat diese platonische Charakterisierung unterstützt. In seiner Metaphysik kann er bereits zustimmend daran erinnern, daß die Philosophie keine technische Herstellung (poietike) beabsichtigt, auch keinen ‹nützlichen› Wert beansprucht.
Denn Verwunderung (thaumazein) veranlaßte zuerst wie noch jetzt die Menschen zum Philosophieren, indem man anfangs über die unmittelbar sich darbietenden unerklärlichen Erscheinungen sich verwunderte, dann allmählich fortschritt und auch über Größeres sich in Zweifel einließ, z.B. über die Erscheinungen an dem Monde und der Sonne und den Gestirnen und über die Entstehung des All. Wer aber in Zweifel und Verwunderung über eine Sache ist, der glaubt sie nicht zu kennen. Darum ist der Freund der Sagen (mythos) auch in gewisser Weise ein Philosoph; denn die Sage besteht aus Wunderbarem. (982b)
‹Zuerst wie noch jetzt‹! Als Liebhaber der Weisheit bleibt der Philosophos dem ‹Wunderbaren› verhaftet, über das er erstaunt. Was aber ist der Grund seines Staunens? Wo liegt die Quelle des Wunderbaren? Welche Weisheit soll geliebt werden?
Diese Fragen verweisen zurück in eine frühere Zeit, die der Epoche der Philosophie vorausliegt, in eine Vergangenheit, in der es wirklich noch den Weisen (sophos) und die Weisheit (sophia) gab.[1] Die Philosophie ist bereits nachträglich. Ihre arche trägt nicht nur die philosophische Tätigkeit, sondern ist anfänglicher Nachtrag, der ergänzt, was sich als Weisheit zurückgezogen hat. Die Philosophie supplementiert die Erfahrung des Wunderbaren in Wahrsagung und Orakel. Denn die griechische Weisheit erschien zuerst im Phänomen einer göttlichen Sprache, deren geheimnisvolle Vieldeutigkeit, Dunkelheit und Unenträtselbarkeit sich dem Weisen offenbarten, ohne in eine wissende Klarheit und Deutlichkeit übersetzt werden zu können. Der philosophierende Geist kann auf eine solche Weisheit nicht mehr bauen. Aber er bleibt ihr dennoch eingedenk. Er weiß noch um das geheime Rätsel des göttlichen Wortes, das seine Herkunft aus einer unbekannten Welt verrät.
Schon in den indischen Upanischaden hieß es: «Denn die Götter lieben das Rätsel, und was offenbar ist, ist ihnen zuwider» (Brhad-Aranyaka-Upanisad IV, 2.2). Auch Apollo offenbarte den Menschen sein Wissen nur, um sie zugleich zu verwirren, mit einem boshaften Zug von Grausamkeit. Sein Wort, das sich im Orakel mitteilte, spannte auf die Folter des Ungewissen. Die Wahr-sage (mantike) blieb geheimnisvoll – und nur in erleuchteten Augenblicken des Wahnsinns (mania) und der Wahn-sage (manike) ließ sich ihr Schleier lüften (Platon, Phaidros 244 b). Sie lockte den Menschen ins verführerische Netz des Rätsels, dessen Verschlingungen durchlaufen werden müssen, ohne jemals ganz entwirrt werden zu können.
Aber auch dieses Rätsel ist nicht ursprünglich. Es verweist zurück auf eine noch frühere Zeit, auf einen Ursprung, dessen Spur kaum noch zu entziffern ist. Im Mythos des Labyrinths läßt er sich noch am deutlichsten erkennen. Sein Urbild mag er im alten Ägypten haben. In der sagenhaften minoisch-mykenischen Welt, die in der Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends ihr Zentrum in Kreta hatte, findet sich das Labyrinth bereits als Zeichen einer tödlichen Gefährdung, die den Menschen in die Ausweglosigkeit einer unbegreiflichen Verwirrung lockt. Nur der Weise (und der Held) kann ihr entrinnen. Mehr als tausend Jahre später wird Platon darauf anspielen. Angesichts ihrer dunklen und unlösbaren Probleme gerieten die Philosophen «in ein Labyrinth, und wo wir glaubten, am Ende zu sein, mußten wir wieder umwenden und befanden uns wie am Anfang der Untersuchung, indem uns noch immer ebensoviel fehlte, als da wir zuerst die Frage aufwarfen» (Euthydemos 291 b). – Bis in unsere Gegenwart, in der das Wissen eine ungeahnte Expansion erreicht hat, hat dieses mythologische Bild seine Kraft bewahrt. Auch das moderne Denken sieht sich noch immer jener tragischen Herausforderung und tödlichen Bedrohung ausgeliefert, mit denen einst die Götter den Menschen narrten und an der Nase herumführten. Ja, es scheint, als führe gerade die ungeahnte Zunahme des wissenschaftlichen Wissens zu einer zunehmenden Verwirrung.
Denken heißt, ins Labyrinth eintreten, einen Irrgarten erstehen zu lassen, während wir uns auch «zwischen die Blumen/gegenüber dem Himmel» hätten lagern können. Denken heißt, sich in den Gängen verlieren, die es nur deshalb gibt, weil wir sie unablässig graben; am Ende einer Sackgasse umkehren, deren Zugang sich hinter unseren Schritten wieder verschlossen hat, bis endlich dieses Herumtappen im Kreise – ohne daß man wüßte, wie – begehbare Öffnungen in der Wand auftut (Castoriadis 1983, S. 7).
Vom Mythos des Labyrinths über die Wahrsage des Orakels bis hin zu den rätselhaften Problemen der Sprache, die uns trügerisch zu irritieren droht, weil wir nicht klar und deutlich erkennen können, was sich uns in ihr mitteilt – das ist der historische Weg, den die Philosophie ursprünglich zurückgelegt hat in der Stimmung eines Staunens, das die Menschen ‹zuerst wie noch jetzt› gefährdet und begeistert, fesselt und befreit, schwindelig und weise sein läßt.
Das Rätsel zeigt sich in der Sprache. Im «Charmides» hat Platon es als ein Zeichen des Rätsels zu bedenken gegeben, daß das Gedachte vom Wortlaut nicht bestimmt ausgedrückt werden kann. In der Unsagbarkeit dessen, was gesagt werden will, manifestiert sich der Grund des philosophischen Fragens, wenn wir ihn sprachtheoretisch rekonstruieren.
Denn allewege ist nicht darauf zu sehen, wer etwas gesagt hat, sondern ob es richtig gesagt ist oder nicht. – Beim Zeus …, ob wir aber auch nur finden werden, was dies eigentlich bedeutet, das soll mich wundern; denn es sieht aus wie ein Rätsel. – Weshalb doch? – Weil doch gewiß derjenige es nicht so gemeint hat, wie die Worte lauten. (161 c)
Damit war der Philosophie ein gangbarer Weg gewiesen. Die Sprache wird zum geheimnisvollen Grund der Verwunderung. Sie ist die rätselhafte Quelle all jener Probleme, die der Philosoph zu klären versucht. (‹Problema›: das bedeutete ursprünglich soviel wie Hindernis, Herausforderung, das Vorgeworfene. Später ist damit eine Aufgabe gemeint, der etwas Munteres, ja fast Spielerisches anhaftet, ähnlich einem Rätsel, das eh und je mit der Nuß verglichen worden ist, die es zu knacken gilt. Davon hat sich wenig erhalten. Mit Problemen soll heute nicht mehr gespielt werden. Mit Problemen ringt man, obwohl jedermann weiß, daß sie allesamt unlösbar sind.) Eine philosophische Untersuchung ist notwendig, um zu klären, was der ‹Weise› als Problem in Frage stellt, was er «als Rätsel hinwirft» (Charmides 162b), um die denkende Konzentration auf das zu lenken, was das Gesagte eigentlich bedeutet. Denken heißt, ins Labyrinth der Sprache eintreten, in der Hoffnung, an ihrem Leitfaden zugleich einen Ausweg zum Licht der Erkenntnis zu finden. Sprache als Irrgarten und als Öffnung in der Wand, zugleich verführerisches Netz des Scheins und führender Faden zur Erkenntnis: Mit dieser paradoxen Doppeldeutigkeit der Sprache wird seither jede philosophische Diskussion eröffnet. Unübersehbar ist hier die obskure Antinomie, die uns verwirrt: Sobald das menschliche Subjekt am Leitfaden der Sprache zu denken versucht, erfährt es sich in seiner Sprachlichkeit als unvollkommen. Der überzeitliche Anspruch richtigen Denkens und Erkennens prallt gegen die begrenzten Möglichkeiten, über die der Mensch als Mitglied einer kulturgeschichtlichen Sprachgemeinschaft verfügt.
Wie läßt sich diese Antinomie auflösen? Läßt sie sich überhaupt außer Kraft setzen? Vier Lösungsversuche sind traditionsbildend geworden, die hier nur in ihren Grundzügen skizziert werden können.
1. Der Mensch erhofft und imaginiert eine Sprache göttlicher Offenbarung, die ihn nicht täuscht. Es wäre eine Art ‹adamitischer Sprache›, wie sie innerhalb unserer biblischen Tradition als Sprache des Paradieses gedacht wurde, eine Sprache, in der das Sein der Dinge unverstellt zum Ausdruck kommt. Walter Benjamin hat, im Anschluß an das erste Genesiskapitel, diese paradiesische ‹Namensprache› als eine vollkommen erkennende zu denken versucht mit dem melancholischen Bewußtsein, daß der Mensch aus dem Paradies vertrieben worden ist und ihm diese Sprache verlorenging. Vor dem bloßen Zeichen, vor dem Urteil und seiner Logik, vor der sprachlichen Abstraktion taucht die Idee einer ‹reinen Sprache› auf, einer Übersetzung des Namenlosen in den Namen, deren Richtigkeit von Gott verbürgt ist (Benjamin 1966, S. 9–26). Von ihr hat Emanuel Swedenborg, der Geisterseher in aufgeklärter Zeit, als einer himmlischen ‹Sprache der Engel› geträumt. Sie ist unmittelbare Kommunikation, einem jeden (Engel) eingepflanzt und direkt verständlich, «tönende Neigung und artikuliertes Denken» (Swedenborg 1976, S. 69). Phantasten, Seher, Schwärmer und Mystagogen haben immer wieder für eine solche Sprache Zeugnis abzulegen versucht. Innerhalb der mystischen Tradition verbindet sich mit ihr ein unbeschreibliches Erlebnis göttlichen Lichts, in dessen Schein alles klar und offenbar ist. Nur leider ist es nicht möglich, diese mystische Spracherfahrung auch denjenigen zu vermitteln, die nicht erleuchtet worden sind. «Der Herr gebe, daß es mir gelingt, etwas zu sagen»: Mit diesem Gebet heben viele Versuche an zu sagen, was sich nicht sagen läßt, ist jede Mitteilungssprache doch dem entfremdet, wovon hier gesprochen werden will. Auch der poetische Bilderreichtum der Mystik konnte dieses Dilemma nicht beheben. Mystisches Schweigen allein bot einen paradoxen Ausweg. Es fällt nicht leicht, in diesem Schweigen die reine Sprache zu vernehmen, für die es bürgen soll.
2. Das Subjekt versucht, frei von Sprache zu denken, und inszeniert sich als ein reines (transzendentales) Subjekt des Gedankens. So kommt eine Vorstellung von Denken und Vernunft ins Spiel, die wie eine Sollensnorm sich gegen die Begrenztheit des menschlichen Sprachvermögens behaupten will. Das Subjekt wird zum reinen Gedankensubjekt und stellt sich nachdenkend wie ein ‹göttliches Subjekt› vor, das sich aus seiner sprachlich bedingten Endlichkeit befreit hat. Bereits Platon hat diesen Weg empfohlen, und ihm hat sich die abendländische Philosophie weitgehend angeschlossen. Als Erkenntnistheorie versucht sie sich freizuhalten von den sozialgeschichtlich vorgegebenen Sprachformen und fixiert sich auf Ideen, Vernunft, Denken, Rationalität etc. als rein gedanklichen Modalitäten. Besonders Kant spielt innerhalb dieser sprachpuristischen Strategie eine herausragende Rolle.
3. Diese Abstinenz vermag heute kaum noch zu überzeugen. Bereits Hamann hatte den kantischen Purismus der Vernunft zurückgewiesen und die Aufmerksamkeit auf die Sprache hin orientiert als «das einzige erste und letzte Organon und Kriterion der Vernunft, ohne ein ander Creditiv als Überlieferung und Usum» (Hamann 1967, S. 222). Auf diesen überlieferten Gebrauch will die moderne sprachanalytische Philosophie sich allerdings nicht verlassen. Sie versucht einen dritten Weg zu gehen, indem sie dem Denken eine eigene Sprache schafft, welche sich aus der Bindung an eine wildgewachsene Gebrauchssprache gelöst hat. Dem Selbstbewußtsein des denkenden Subjekts entsprechend, das sich im Medium logisch deutlicher Begriffe und exakter syntaktischer Regelungen bewegen will, wird eine ‹reine Sprache des Denkens› konstruiert, die kein usualistischer Mangel mehr befleckt, eine ‹kalkülisierte› Formalsprache, deren Elemente (calculi) sich gemäß festgelegter Form- und Umformungsregeln verketten lassen. Bereits 1677 hat Leibniz eine solche Sprache entworfen, eine characteristica universalis, eine mathematische Kunstsprache, die das Projekt einer ‹Gedankenrechnung› realisierbar erscheinen läßt. Es ist eine vollkommene Sprache, sofern sie die gedankliche Ordnung direkt repräsentiert. Es ist eine universale Sprache, die sich von jeder besonderen, natürlichsprachlich gebundenen Wissensform gelöst hat und jedem möglichen Gedanken einen sprachlichen Raum zur Verfügung stellt. Und es ist eine mathematische Sprache, in der Folgern und Rechnen dasselbe sind, in der die gedanklichen Operationen sich unmittelbar an den manipulierten Zeichenoperationen ablesen lassen. Das ist der Weg, den die moderne, logisch orientierte Sprachphilosophie geht. Eine Kalkülsprache wird entwickelt, die zugleich als Medium sinnvoller Gedanken dienen soll, eine ‹Ideal-Sprache›, welche die natürliche Sprache supplementiert. Freges «Begriffsschrift», die «Principia Mathematica» von Russell und Whitehead, die «Logische Syntax» und «Symbolische Logik» Carnaps, die Tarski-Semantik, die Sprachsysteme Quines, die konstruktivistischen Entwürfe Lorenzens, die logische Semantik Montagues etc.: – immer wird ein syntaktisch-semantisch durchsichtiger Formalismus nach strengen Regeln aufgebaut, der mit dem szientistischen Selbstverständnis eines denkenden Subjekts zusammenpaßt, das sich der vollkommenen, universalen und mathematischen Mechanik seines Entwurfs unterwirft, um sich nicht länger der Unvollkommenheit natürlicher Sprachen ausgeliefert zu sehen.
4. Besonders Ludwig Wittgenstein ließ diese formalistische Ausrichtung des philosophischen Denkens, die er in seinem Frühwerk selbst favorisiert hatte, zunehmend problematisch werden. In seinen «Philosophischen Untersuchungen» (PU) hat er offensiv die Kehre vollzogen. «Die Betrachtung muß gedreht werden, aber um unser eigentliches Bedürfnis als Angelpunkt» (PU 108). Die Kristallreinheit des Kalküls wird als einengendes Vorurteil enttarnt. Sie entpuppt sich als leere Forderung. Gerade in ihrer formalen Präzision läßt sie das Denken erstarren. «Wir sind auf Glatteis geraten, wo die Reibung fehlt, also die Bedingungen in gewissem Sinne ideal sind, aber wir eben deshalb auch nicht gehen können. Wir wollen gehen; dann brauchen wir die Reibung. Zurück auf den rauhen Boden!» (PU 107). Es ist der Boden des gewöhnlichen Sprachgebrauchs. Nur auf ihm kann das philosophische Denken Fuß fassen, in der Reibung zwischen gedanklicher Strenge und alltäglicher Sprachverwendung. So kehrt Wittgenstein zurück an den Ursprung der Philosophie. Es gilt, die Rätsel zu lösen, sich wieder in die Mäander des Labyrinths zu begeben und sich jenen Herausforderungen zu stellen, die das philosophische Denken beweglich sein lassen.
«Ich kenne mich nicht aus» (PU 123). Das ist der allgemeinste Ausdruck einer philosophischen Problemsituation. Wittgenstein spielt damit bewußt auf das ursprüngliche Erstaunen an, mit dem das Philosophieren der Griechen einst begann. «Wer aber in Zweifel und Verwunderung über eine Sache ist, der glaubt sie nicht zu kennen.» So hatte Aristoteles das Staunen als arche des Philosophierens bejaht. Wittgenstein folgt dieser Intention. Er liefert sich ihrem beherrschenden Pathos aus, voller Leidenschaft, und weiß zugleich, daß dieses pathos mit leiden zusammenhängt, mit ertragen, erdulden, sich tragen lassen von, sich bestimmen lassen durch (Heidegger 1956, S. 26).
«Ich bin in einem Wirrwarr» (PU 153). Es sind freilich keine empirischen Fragen, die hier zu einer wissenschaftlichen Forschung provozieren. Vielmehr ist es noch immer jene Dunkelheit, die sich ursprünglich im göttlichen Orakel zeigte und im Rätsel seine abstrakte Symbolisierung fand. Nur aus dieser Dunkelheit empfängt die philosophische Untersuchung «ihr Licht» (PU 109). Die Erhellung, auf die sie zielt, versteht sich als eine Einsicht, die uns vor Augen führt, was uns die Sprache wirklich sagt, was die Worte und Aussagen eigentlich bedeuten. Es handelt sich noch immer um die gleichen Hindernisse, mit denen bereits Platon zu kämpfen hatte. Das Arbeiten der Sprache soll erkannt werden, «entgegen einem Trieb, es mißzuverstehen … Die Philosophie ist ein Kampf gegen die Verhexung unsres Verstandes durch die Mittel der Sprache» (PU 109). Dazu hat Herbert Schnädelbach einen erhellenden Kommentar geliefert:
«Ein philosophisches Problem hat die Form: Ich kenne mich nicht aus.» Mit dieser Bemerkung und durch den Kontext, in dem sie erscheint, trifft er sehr genau die Tatsache, daß die so gezeichnete Problemlage weder durch das Fehlen empirischer Informationen noch durch die Unkenntnis einer bestimmten Sprache – etwa einer Wissenschaftssprache – als Kommunikationsmedium verursacht ist; also kann sie auch nicht durch einfache Übersetzungsleistungen behoben werden. Jenes Sich-nicht-Auskennen ist vielmehr eine Situation der Verwirrung, der Ratlosigkeit, des Orientierungsverlustes im Medium der Sprache selber, das dem, der ‹Ich kenne mich nicht aus› sagt, sonst das vertrauteste ist (Schnädelbach 1977, S. 312f).
Weder die wissenschaftliche Forschung noch die linguistische Systematisierung können in dieser Situation weiterhelfen. Nur der Weg einer reflexiven Erläuterung kann hier Erfolg versprechen. Erläutert wird, was uns staunen läßt, was uns verwirrt und uns das sokratische Eingeständnis entlockt: Ich kenne mich nicht aus. Immer wieder werden wir philosophisch darauf verwiesen: Wir sind in der Endlichkeit unseres Sprachvermögens gefangen, die durch keine mystische Namenssprache, kein reines Denken, keine kalkülisierte Idealität aufgehoben werden kann. Die Sprache, die unsere Heimat ist, ist keine Idealsprache. Wir durchschauen sie nur bruchstückhaft und müssen uns auf das paradoxe Spiel einer Erläuterung einlassen, deren Explikanda uns zu verhexen drohen, während von ihren Explikata Schärfe und Präzision verlangt wird (Stegmüller 1969, 2. Aufl., S. 87). Es ist ein paradoxer Akt, mit dem wir uns auf die Sprache zurückwenden, sobald wir ihre Probleme philosophisch zu lösen versuchen in einem endlosen Prozeß der Reflexion dessen, was uns zugleich das Vertrauteste und das Fremdeste ist.
Solange die Philosophie dieser Ambivalenz treu bleibt, kann sie kein Ende finden. Was zusammenbricht, sind nur die großen (metaphysischen) Systeme, die umfassenden, geschlossenen und endgültigen Sprachgebäude, die ‹großen Erzählungen› (Lyotard), die sich als Philosophie in Szene setzen wollten, die sich königlich über den Wissensformen der forschenden Praxis, der Epistemologie des hypothetischen Erkennens und die eingespielte Sicherheit der Lebensformen inthronisierten. Es sind meist nur gleißende Tautologien gewesen, die vergaßen, was philosophieren heißt: sich dem Staunen zu öffnen und sich ins Wirrwarr des Labyrinths zu begeben.
Kant hatte es als Antinomie zwischen unbedingtem Vernunftanspruch und endlichem, bedingtem Erkenntnisvermögen reflektiert und demonstriert, daß die philosophischen Grundfragen nur auf selbstbezüglichen und daher selbst antinomischen Denkwegen eingekreist werden können (Kulenkampff 1970). Der Sprachphilosoph thematisiert es als unauflösbare Spannung zwischen unserer sprachlichen Kompetenz und dem drängenden ‹Trieb› zum sprachlichen Mißverständnis. Philosophieren heißt, sich diesen Spannungen auszuliefern, die es nur deshalb gibt, weil wir sie unablässig benötigen, um zum verborgenen Grund unseres ‹Sprachspiels› vorzudringen, dessen Probleme uns im Wege stehen.
Dieser Grund, der das philosophische Staunen begründet, kann selbst kein sicheres Fundament sein. Mag sein, daß auch Wittgenstein hoffte, eine solche Sicherheit in der Unbezweifelbarkeit eines ‹so handle/spreche ich eben› finden zu können, dort, wo sich die Begründungen erschöpfen und der harte Felsen erreicht ist, auf dem sich der Spaten der Reflexion zurückbiegt (PU 217). Aber er wußte, daß auch dieses Fundament nur ein Luftgebäude sein kann. Denn der letzte Grund der Sprache, auf den die Philosophie tätig reflektiert, ist trügerisch. Er selbst ist das eigentliche Problem. Kein Gott und kein Philosoph kann es lösen. Und die Weisen sind tot.
Nur als Rätsel ist die Sprache philosophisch interessant. Es sind in der Regel unauflösbare Gegensatzpaare, deren Spannung bereits Heraklit als Wesen jedes Rätsels erkannt hatte. Er glaubte allerdings noch an eine Lösung in der Einheit, in einem Gott, der alles trägt. «Der Gott ist Tag und Nacht, Winter und Sommer, Krieg und Frieden, Sättigung und Hunger» (Fragment 67). Auch dieser Gott ist tot. Heidegger hat ihn vergeblich angerufen. Was bleibt, ist allein die permanente Reflexion, in der sich die Struktur des philosophischen Problems als paradox, als antinomisch, als dialektisch, als aporetisch zeigt. Wenn es etwas hinter dem Rätsel zu entdecken gibt, so nur seine eigene immanente Spannung, die das Philosophieren ‹autopoietisch› weitertreibt, ohne sich der poietike eines kalkulierbaren Nutzens auszuliefern. Diese Spannung trägt das philosophische Denken in sich, um sich als autonome Prozessualität innerhalb seines eigenen Sprachspiels selbst zu organisieren.[2]
Um seine Dynamik zu verstehen, soll hier ein traditionsreicher Weg eingeschlagen werden: seinen Wegen und Umwegen nachfolgen, sich auf seine Spuren begeben, ‹historisches Philosophieren› also, das den verschlungenen Pfaden des Philosophierens nachspürt, von Parmenides bis Wittgenstein, von Eubulides bis Gotthard Günther, ohne festes Leitbild und verläßliche Richtschnur. Es wird sich zeigen, daß die Philosophie, so gesehen, nicht am Ende sein kann.
Sechs Probleme des philosophischen Denkens werde ich in den folgenden Kapiteln exemplarisch[3] vorstellen und diskutieren. Sie alle lassen sich in Form unauflösbarer Gegensatzpaare entwickeln, die Passmore im Modell des Two-Worlds-Argument’s (Passmore 1961, S. 38ff) fixiert hat:
Sein
Nichts
Wahrheit
Falschheit
Einzelnes
Allgemeines
Zeigen
Sagen
Körper
Seele
Wirklichkeit
Möglichkeit
Das philosophische Sprachspiel ist ein Spiel solcher Oppositionen im Für und Wider dessen, was sich ausschließt und vermittelt, sich in seinen Gegensätzen bekämpft und zugleich widerspiegelt. Widerstreit, Auseinandersetzung und Zwist sind seine Antriebskräfte. Es kennt keine Einheit und keinen festen Grund. Alle Versuche, es zu zentrieren, im Zeichen einer festgefügten Systematik oder einer unbedingten Rationalität, im Namen der Wahrheit oder eines verborgenen Gottes, verraten seinen Gestus, stellen seine rückhaltlose Bewegung still und verhindern die antinomische ‹Reibung›, die das Philosophieren braucht, um ‹gehen› zu können. Auch der Logos, in dem das Wesen des Seienden, die Wahrheit des Erkennens und die Richtigkeit der Sprache einst glücklich zusammenfallen sollten, war nur eine vordergründige Maske, eine zentrierende Verkleidung, hinter der sich der Zwiespalt des philosophischen Spiels versteckte, um insgeheim das Denken zu provozieren. Der Logozentrismus, gegen den die dekonstruktive Strategie des ‹französischen› Philosophierens (Descombes, Derrida, Lyotard) gerichtet ist, war nur eine Illusion. Denn das Philosophieren kennt von Anfang an keinen Mittelpunkt, sondern nur dezentrierte Pfade, kein Fundament, sondern nur eine freischwebende Rotation, keine Heimat, sondern nur eine ununterbrochene Odyssee. Sein Gang ist kein Fortschritt zu einem totalisierenden Ziel, auch keine Rückkehr zu einem verlorengegangenen Ursprung. Philosophieren ist ständiger Aufschub möglicher Lösungen im Netz jener Differenzen, in denen es sich von Anfang an, wie «eine Fliege im Fliegenglas» (Wittgenstein PU 309), verfangen hat. Nur in dieser Gefangenschaft ist die Philosophie souverän und autonom. Sie ist keine «Hüterin der Rationalität im Sinne eines unserer Lebensform endogenen Vernunftanspruchs» (Habermas 1985, S. 247), keine Platzhalterin des Logos im Rahmen einer Kultur, die sich pragmatisch eingerichtet hat und auf den klassischen Anspruch der Vernunft pfeift. Sie folgt ihrem eigentlichen Bedürfnis, dem autopoietischen Spiel der unlösbaren Differenzen, die sie für sich entdeckt hat, um sich an ihnen zu beweisen. Nur so ermöglicht sie jene intensive Zirkulation im Innern ihres sich selbst organisierenden Systems und hält jene fieberhafte Erregung wach, mit der sie über ihre eigenen Entdeckungen staunt, von denen sie sich immer wieder ‹verhexen› läßt.
Auch über die Philosophie hinauszugehen kann deshalb nicht heißen, «ihr den Rücken zuzukehren (was meistens schlechte Philosophie zur Folge hat), sondern die Philosophen auf eine bestimmte Art und Weise zu lesen» (Derrida 1972, S. 435). Die folgenden sechs Kapitel sind auch Versuche einer solchen Lektüre. Die Geschichte, von der sie erzählen, ist keine lineare Historie. Es ist die rotierende Geschichte eines verwegenen Abenteuers, auf das sich jeder radikale Philosoph eingelassen hat, oft genug gegen sein eigenes Selbstverständnis, das am Widerstreit der philosophischen Rätsel zu verzweifeln oder verrückt zu werden drohte, weil durch die Dynamik des Philosophierens kein ‹Friede in den Gedanken› zu finden war.[4]
Ich werde nicht dulden, daß man sich bei diesem, auch nicht, daß man sich bei jenem beruhigt, damit, wenn man ohne Stützpunkt und Ruhe ist … (Pascal 1954, S. 187).
1 Nichts ist nicht
Parmenides und die ontologische Bannformel
Als Heraklit das Ganze nun in Bewegung bringen wollte, rief Parmenides Halt und reduzierte die Philosophie auf die Formel «Es ist», womit er natürlich meinte, «Es ist nicht», oder, um aus einer kurzen Geschichte eine lange zu machen: «Schaut euch den Schlamassel an, in den wir geraten sind!»
Nelson Goodman
Als er schon hoch bejahrt war, ganz weißhaarig, aber edlen Ansehens, hat Parmenides sich mit seinem Liebling Zenon auf eine weite Reise begeben. Er verließ sein süditalienisches Provinzstädtchen Elea und besuchte seine Athener Kollegen. Von der Begegnung mit dem noch jungen Sokrates, etwas außerhalb der Stadt, berichtet Platon im Dialog «Parmenides», dem wohl kompliziertesten Gespräch der Philosophiegeschichte. Parmenides, der Weise, begegnet Sokrates, dem Liebhaber der Weisheit. Sophia und Philosophia treffen aufeinander, um sich gegenseitig zu erproben. Denn was Parmenides über das Sein weiß, verdankt er einer göttlichen Offenbarung, die er in einem lichten Augenblick mysterienhafter mania aus göttlichem Mund empfangen hat. Jetzt stellt er es zur Diskussion. Die entborgene Wahrheit wird zum Problem, zum rätselhaften Thema einer philosophischen Untersuchung. Das ‹es ist› des Seienden, das Sein, dessen Geheimnis dem Weisen wahr-gesagt worden ist, wird philosophisch ‹in-Fragegestellt›. Alle nur denkbaren Argumente werden ins Spiel gebracht, um zu klären, was der Fall ist, wenn Eines ist, wenn es nicht ist, wenn es ist oder nicht ist. Die Weisheit des Eleaten wird diskursiv geprüft. Wird sie damit ihres göttlichen Ursprungs beraubt? Muß sie nicht ihre mystagogische, esoterische Macht verlieren, wenn sie philosophisch ins Für und Wider von Argument und Gegenargument verstrickt wird?
Pythodoros, ein stiller Zuhörer, dem wir die Erzählung dieses denkwürdigen Gesprächs zwischen Weisheit und Philosophie verdanken, informiert uns über die Reaktion des Parmenides:
Indem Sokrates dieses sprach, sagte Pythodoros, habe er seinesteils geglaubt, Parmenides und Zenon würden über jedes fast verdrießlich sein; sie aber hätten auf seine Rede sehr genau achtgegeben und oftmals einander lächelnd angesehen, als freuten sie sich sehr über den Sokrates. Welches auch, nachdem er aufgehört, Parmenides geäußert und gesagt: Wie sehr, o Sokrates, verdienst du gerühmt zu werden wegen deines Eifers für die Forschungen (Platon, Parmenides 130 a).
Der Weise lächelt über den klugen Denker. Und rühmt ihn, nicht ohne freundliche Überlegung, wegen seines forschenden Eifers. Ihm selbst ist dieser Eifer fremd. Lächelt er deshalb, weil er die Aufwanddifferenz wahrnimmt zwischen der intellektuellen Anstrengung des jungen Dialektikers und dem erleuchteten Wissen, über das er, dem die Wahrheit des Seins als Wahrsage offenbart worden ist, sich völlig und problemlos sicher sein kann?
Aber vielleicht lächelt er auch, um seine eigene Spannung und innere Unruhe aufzulösen. Denn die Wahrheit über das Wesen des Seienden, die ihm durch eine göttliche Stimme mitgeteilt worden ist, ist von Anfang an durch eine immanente, strittige Verwirrtheit bedroht, die sein Wissen auf eine beunruhigende Weise beherrscht. Parmenides hat sie als Drohung des ‹Nichts› erfahren. Er hat sie abzuwehren versucht mit den Mitteln einer Positivsprache, die sich allein dem Seienden in seiner Positivität verschreibt. Es gibt nur das, was seiend ‹ist›. Auch an Qualitäten kann es nur uneingeschränkt positive geben: ganz, all und voll. Parmenides, der weise Jasager, Denker eines Ja, «das kein Wunsch erreicht, das kein Nein befleckt» (Nietzsche, Werke II, S. 1263). Aber er mußte zugleich Nein sagen, Nein zur doppelköpfigen Menge, die am Nichtsein hängt: «Nichts ist nicht». Was er verwarf, nahm er in Anspruch, um es zu bekämpfen. Nein, das Nichts gibt es nicht.
Was verworfen wird, kehrt real wieder. In Martin Heidegger wird Parmenides seinen Opponenten finden. Gegeben sein soll nur das Seiende und sonst – nichts. Wie steht es um dieses Nichts? fragt Heidegger und versucht, metaphysisch rückgängig zu machen, was von Parmenides inauguriert worden ist. «Ist es ein Zufall, daß wir ganz von selbst so sprechen? Ist es nur so eine Art zu reden – und sonst nichts?» (Heidegger 1975, 11. Aufl., S. 26).
Mit dieser sprachgewendeten Frage nach den Bedingungen einer Negativsprache ist die Erinnerung an ein philosophisches Rätsel wachgehalten worden, über das heute noch genauso gestaunt werden kann wie am Anfang des griechischen Philosophierens. Denn das Nichts hat nie gesprochen und wird immer schweigen. Grund genug, es zu fürchten. Und wenn man es zum Sprechen zwingen will, um seine Bedrohung zu begreifen, scheint es noch immer die menschliche Sprache in jenes hilflose Lallen zu verwandeln, das auch die offenbarte Wahrheit des Parmenides – «Nichts ist nicht» – verwirrte und ebenso ‹unsinnig› erscheinen läßt wie die späte Entgegnung: «Das Nichts selbst nichtet.» In einer Welt, in der die totale Vernichtung denkbar geworden ist, drängt es sich auf, diese Formeln zu untersuchen. Vielleicht gelingt es, etwas Licht in ihre Dunkelheit zu bringen. Wie steht es um den Referenten, wenn wir – mit literarischem, linguistischem, metaphysischem, logischem oder apokalyptischem Ton – vom Nichts sprechen?
1.1 Vorspiele um Nichts
I am here, and there is nothing to say. If among you are those who wish to get somewhere, let them leave at any moment. What we require is silence; but what silence requires is that I go on talking … I have nothing to say and I am saying it and that is poetry as I need it. This space of time is organized. We need not fear these silences, – we may love them.
Mit diesen Worten begann John Cage 1949 seine berühmte «Lecture on Nothing» (1961, S. 109). Er wollte ‹nichts sagen›, keine sachhaltige Information mitteilen, keinen kognitiven Aussageinhalt behaupten. Aber er wollte reden, um die Stille aufzuheben, die wir brauchen, um so sprechen zu können, wie sie es von uns fordert. Cage sprach, und in der Art, wie er sprach und wie er schwieg, machte er selbst noch einmal das ‹Nichts›, das er sagen wollte, in Gestalt des Schweigens zum Gegenstand einer aufmerksamen, nichts-hörenden Wahrnehmung.
Aber geht das überhaupt: nichts sagen und nichts hören? Vom Nichts zu reden und es im Schweigen zu zeigen? Was kann hier ‹nichts›, ob adverbial oder substantiviert gebraucht, bedeuten? Wie kann etwas zur Sprache kommen, das doch eigentlich nicht ist? Und kann man denn auch die Stille und das Schweigen wahrnehmen als ein Etwas? Was hört man da, wenn man nichts hört?
Dieser Frage hat Franz Kafka in einem Gleichnis eine rätselhafte Wendung gegeben und ein raffiniertes Verwirrspiel entworfen, das im Innern des Schweigens vielfältige Brechungen entstehen läßt: «Das Schweigen der Sirenen» (1986, S. 58f). Nur schweigend nämlich glaubten die Sirenen dem listenreichen Odysseus, der sich vor ihrem verführerischen Gesang durch verstopfte Ohren zu schützen versuchte, beikommen und ihn in den Tod locken zu können. Wie hätte sich Odysseus vor diesem Schweigen retten können? Aber ironischerweise hörte er auch dieses Schweigen nicht, weil er glaubte, die Sirenen sängen und nur er sei davor behütet, den Gesang zu hören. Indem er nichts hörte, überhörte Odysseus auch die furchtbare Waffe der schweigenden Stille. – Doch das ist nicht das Ende der Geschichte. Kafka hat noch einen Anhang überliefert, der das Nichts-Hören des Odysseus als eine raffinierte Simulation in Frage stellt: «Vielleicht hat er, obwohl das mit Menschenverstand nicht mehr zu begreifen ist, wirklich gemerkt, daß die Sirenen schwiegen, und hat ihnen und den Göttern den obigen Scheinvorgang gewissermaßen als Schild entgegengehalten» (S. 59). Der listenreiche Fuchs tat nur so, als ob er sich vor dem Gesang, den er nicht zu hören simulierte, schützen würde. Gerade damit war es ihm möglich, das bemerkte Schweigen zu überhören und sich vor seiner Waffe zu schützen. – Es wird nicht gesungen, und es wird nicht gehört. Zwischen den Schweigenden und dem Hörenden sind wächserne Stöpsel als Hörkappe wirksam. Und doch wird in diesem Raum der Stille ein kompliziertes Spiel gespielt, voll von imaginären Spiegelungen, Täuschungen und Simulationen. Seine Negativität wird nicht zu verdrängen oder positiv aufzulösen versucht. Sie wird paradox bejaht und ästhetisiert als Anreiz zu einem listigen Spiel, das sich von der verständlichen Bestimmtheit eines Gesagten freihält.
Für Anni und Simmerl, die sich heimlich zum Stelldichein im Heuschober getroffen haben, ist dieser Rätselcharakter des Schweigens, den Kafka als Gleichnis jedes wahren Kunstwerks zu bedenken gab, nur ein ‹spaßiges› Problem. Albern spielen sie mit dem, was man nicht hört, wenn man es in der Sprache wahrzunehmen versucht.
SIMMERL:
Hörst mi denn aa, wenn i nix red?
ANNI:
Sell woaß i net; red amal nix, ob i nacha was hör.
SIMMERL:
Ja, jetzt paß auf, jetzt red i nix. – – – – – Hast des jetzt ghört, wia i nix gredt hab?
ANNI:
Ja tadellos – und des hab i nacha ghört, wias d’gsagt hast:
SIMMERL:
So, des hast ghört? – Aber das andere net?
ANNI:
Was für a anders?
SIMMERL:
No, ja, wia i nix gredt hab.
ANNI:
Na, zuagehört hab i scho, aber ghört hab i nix.
SIMMERL:
Des is gspaßig, gell, mit dera Hörerei.
(Valentin 1978, S. 190)
Sie hat also zugehört und doch ‹nix› gehört. Hat sie da nicht gehört oder das Nichts gehört? Sie wollte doch etwas hören, und sie hat aufmerksam gelauscht. Sie war ja nicht plötzlich taub. Aber was hat sie da gehört, als ihr Freund geschwiegen hat? Hörbar ist für Annie, was sinnlich wahrnehmbar ist. Wie steht es um das, was sie nicht hört? Ist es ein fehlendes Wort, das die Leerstelle des Gesagten ausfüllt? Welches Wort hätte das jedoch sein können? – Es ist ‹spaßig›, für das Schweigen einen Anhaltspunkt in der sinnlichen Wahrnehmung finden zu wollen. Lieber will Annie nicht hören als das Nichts hören.
Das ist nur ein kleines Beispiel der komischen Sprach-, Erkenntnis- und Lebensphilosophie Karl Valentins. Denn immer versucht sein Held in der Präsenz des Daseins zu leben: Was es gibt, ist für ihn das Hörbare, das Sichtbare, das, was da ist, unverborgen und sinnlich greifbar. Das Nicht-Sein der Objekte, auch ihr Fort- oder Anderswo-Sein, ist für ihn nicht. Gegenwärtiges Dasein ist für ihn das einzig wirkliche. Nur davon ist er überzeugt, da kennt er sich aus. Wie ein Kind, das er gewesen ist, läßt sich der Komiker Valentin nicht ein auf die symbolische Differenz von Anwesenheit und Abwesenheit, von Da und Fort, von Präsenz und Nichtsein. Er will das Nichts nicht akzeptieren. Er ist der absolute Jasager. Zum Nichts hätte er gesagt: ‹Da kenne ich mich nicht aus› (Geier 1979, S. 124–154).