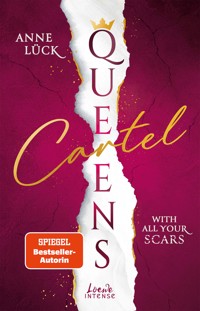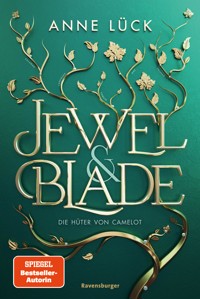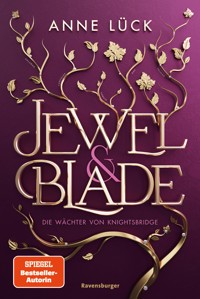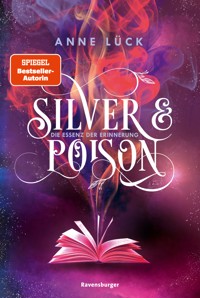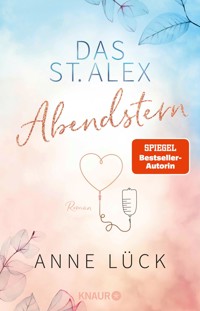
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die New-Adult-Reihe Das St. Alex
- Sprache: Deutsch
Wenn dein Herz ins Stolpern gerät, vertraue der Liebe: Im 3. eigenständigen New-Adult-Roman der St.-Alex-Reihe muss Maya auf der Intensivstation neue Herausforderungen annehmen – und wird von der Liebe überrascht. Die junge Krankenschwester Maya ist nicht gerade begeistert, als sie ausgerechnet auf die Intensivstation versetzt wird. Die neuen kräftezehrenden Aufgaben und die große Verantwortung bereiten ihr Sorgen. Zum Glück unterstützen ihre neuen Kolleginnen und Kollegen sie, wo sie nur können. Besonders die stellvertretende Stationsleiterin Ella steht Maya zur Seite und geht ihr zunehmend unter die Haut. Maya ist hin- und hergerissen zwischen Hoffnung und Zweifeln, hat sie bisher doch nicht die besten Erfahrungen in Sachen Liebe gemacht. Und dann erfährt sie etwas, das die Schmetterlinge in ihrem Bauch endgültig ins Straucheln bringt … Queer, emotional und wunderschön romantisch! Anne Lücks New-Adult-Liebesromane um drei junge Krankenschwestern aus Berlin bieten ein außergewöhnliches Setting, ergreifende Schicksale und ganz viel Herzklopfen – perfekt für Fans romantischer Krankenhaus-Serien wie »Grey's Anatomy« und die Leser*innen von Ava Reeds Whitestone-Hospital-Reihe. »Authentische Charaktere, berührende Schicksale und medizinisches Fachwissen on point. Absoluter Suchtfaktor mit Herzklopfgarantie!« - Ava Reed über »Das St. Alex - Tagmond« Die Liebesromane der New-Adult-Reihe »Das St. Alex« sind in folgender Reihenfolge erschienen: - Das St. Alex – Nachtleuchten (Sami & Louis) - Das St. Alex – Tagmond (Tessa & Beck) - Das St. Alex – Abendstern (Maya & Ella)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 492
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Anne Lück
DAS ST. ALEX
Abendstern
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Die junge Krankenschwester Maya ist nicht gerade begeistert, als sie ausgerechnet auf die Intensivstation versetzt wird. Die neuen kräftezehrenden Aufgaben und die große Verantwortung bereiten ihr Sorgen. Zum Glück unterstützen ihre neuen Kolleginnen und Kollegen sie, wo sie nur können. Besonders die stellvertretende Stationsleiterin Ella steht Maya zur Seite und geht ihr zunehmend unter die Haut. Maya ist hin- und hergerissen zwischen Hoffnung und Zweifeln, hat sie bisher doch nicht die besten Erfahrungen in Sachen Liebe gemacht. Und dann erfährt sie etwas, das die Schmetterlinge in ihrem Bauch endgültig ins Straucheln bringt …
Der dritte eigenständige New-Adult-Roman am St. Alex: queer, emotional und wunderschön romantisch.
Inhaltsübersicht
Triggerwarnung - Hinweis
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Danksagung
Triggerwarnung
Liebe Leser*innen,
bei manchen Menschen lösen bestimmte Themen ungewollte Reaktionen aus. Deshalb findet ihr am Ende des Buches eine Triggerwarnung.
Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch.
Wir wünschen euch gute Unterhaltung mit Das St. Alex – Abendstern.
Anne Lück und der Knaur Verlag
Für Melina – die ab dem ersten Wort der Sankt-Alex-Reihe dabei war und die mich so oft motiviert hat, wenn ich eigentlich schon dachte, dass ich nicht mehr kann. Danke, dass du jeden meiner Zweifel gnadenlos zerschlägst und dass du so eine großartige Freundin bist!
Kapitel 1
Ich werde Sie jetzt ein wenig herrichten, in Ordnung, Frau Kallier?«
Ich beugte mich mit einem Lächeln über die Patientin, die seit einer Woche auf unserer Station lag, eine Hand auf ihren kalten Arm gelegt. Die Wintersonne schien durchs Fenster und tauchte das blasse Gesicht der alten Frau in ein warmes Licht. Aus irgendeinem Grund machte der Anblick mich melancholisch. Sanft strichen meine Finger über ihre Haut. Sie war ganz kalt.
Frau Kallier antwortete nicht. Natürlich nicht. Sie musste irgendwann zwischen der Mittagsrunde und meiner kurzen Pause verstorben sein. Ihr Mund war leicht geöffnet, ihr Gesicht wirkte friedlich.
Ich erinnerte mich an ein Gespräch, das wir am Morgen zuvor geführt hatten. Wie immer, wenn ich ihr das Frühstück brachte, hatte sie mich mit einem strahlenden Lächeln begrüßt. Und dann hatte sie mich ganz unvermittelt mit ihrer brüchigen Stimme gefragt: »Was glauben Sie eigentlich, was nach dem Tod passiert, Schwester Maya?«
Während ich das Tablett mit Brötchen und Marmelade auf ihren Tisch gestellt hatte, war ich im Kopf meine bisherigen Antworten durchgegangen. Auf der Erwachsenenpalliativstation kam diese Frage oft. Für die meisten Patienten war das hier ihre letzte Station vor dem Tod, oder sie gingen nach ihrem Aufenthalt ins Hospiz, wenn der Tod zwar unvermeidbar war, aber noch nicht unmittelbar bevorstand. Es gab Standardsätze, an die auch ich mich oft hielt, weil ich die Erfahrung gemacht hatte, dass die Patienten gut damit leben konnten.
Bei einem Blick in Frau Kalliers strahlendes Gesicht hatte ich mich aber gegen eine solche Antwort entschieden. Ich hatte ihr Lächeln erwidert und gefragt: »Was denken Sie denn, was passiert?«
In ihre Augen war ein beinahe schalkhafter Ausdruck getreten. »Ich denke nicht, dass es nach dem Tod einfach vorbei ist. Das halte ich für unmöglich. Ich glaube, dass wir wiedergeboren werden, als ein ganz anderes Lebewesen.« Sie hatte das Brötchen mit dem Messer über den Teller geschoben, weil ihr bereits vor Tagen der Appetit vergangen war. Ein typisches Anzeichen dafür, dass der Tod nicht mehr fern war. »Wollen Sie wissen, als was ich wiedergeboren werde?«
Obwohl mir bei dem Gespräch das Herz wehtat, setzte ich mich auf ihre Bettkante und versuchte, Zuversicht auszustrahlen. »Als was denn?«
»Als ein kleines Blümchen in einem wunderschönen, großen Garten. Und neben mir wird mein Mann stehen, der wartet bestimmt schon ganz sehnsüchtig auf mich. Aber nicht als Blümchen, das würde nicht zu ihm passen. Er ist bestimmt eine alte Eiche. Oder ein Kaktus.« Sie hatte gekichert und einen Schluck Kaffee getrunken, bevor ihre funkelnden Augen sich mir wieder zuwandten. »Aber eins weiß ich ganz sicher: Ich werde ihn auf jeden Fall erkennen.«
Ob sie jetzt schon dort war? Ich atmete tief durch den Mund, bevor ich ihr vorsichtig die grauen Haare aus dem Gesicht strich und dann sanft das steife Krankenhaushemd auszog. Ich ließ mir Zeit dabei, sie zu waschen und herzurichten. Dabei dachte ich wieder an ihr sonst so warmes Lächeln, das heute Morgen zu Dienstbeginn aus ihrem Gesicht verschwunden gewesen war. Über Nacht hatte Frau Kallier wahnsinnig abgebaut. Sie hatte mich kaum noch angesehen und gleich wieder rausgeschickt. Da hatte mein heftig schlagendes Herz gewusst, dass sie mit dem Kopf wahrscheinlich schon irgendwo auf der anderen Seite war.
Ich suchte das zartrosa Nachthemd aus dem Kleiderschrank, von dem sie mir vor ein paar Tagen erst erzählt hatte, dass es sich hierbei um ihr Lieblingsstück handelte. Es hatte feine Rüschen am Kragen, und als ich es ihr vorsichtig anzog, entfuhr mir ein Seufzen.
Ursprünglich hatte ich nicht vorgehabt, direkt nach der Ausbildung auf einer Palliativstation für Erwachsene anzufangen. Eigentlich hatte ich schon bei meinem Praxiseinsatz wahnsinnige Angst vor der Station gehabt. Aber im Endeffekt war es nicht so schlimm wie befürchtet, und ich lernte die Zeit zu schätzen, die ich hier für meine Patienten hatte. Hier gab es keine Hektik, der Tagesablauf konnte leicht an die Bedürfnisse der Patienten angepasst werden. Und gleichzeitig war es frustrierend, dass man selten einen Patienten gesund nach Hause schicken konnte. Selbst die Leute, die nur zum Aufpäppeln zwischen den Chemos kamen, verstarben häufig. Ich hatte mir gewünscht, nie an einem Punkt anzukommen, an dem ich von all dem Leid abstumpfte. Aber jetzt, nach zwei Jahren auf dieser Station, war es doch passiert. Zwar nur ein wenig und auch nicht bei allen Patienten, aber trotzdem.
Ich stützte meine Arme auf die Bettkante und mein Kinn darauf. Nachdenklich betrachtete ich das friedliche Gesicht der alten Dame. »Schick sehen Sie aus«, flüsterte ich und musste nun doch wieder lächeln. »Wenn Sie auf der Wiese stehen und Ihren Mann gefunden haben – vielleicht können Sie mir dann irgendwie ein Zeichen schicken? Ich wüsste gern, dass es Ihnen da drüben gut geht. Und ehrlich gesagt würde ich auch zu gern wissen, wie das Leben nach dem Tod denn jetzt wirklich aussieht.« Ich strich noch einmal sanft über ihre Haare, bevor ich aufstand und tief durchatmete.
Dann öffnete ich das Fenster und räumte meine Waschutensilien weg. Zuletzt schlug ich die Decke etwas auf und legte vorsichtig Frau Kalliers Arme darauf. Es wirkte beinahe, als würde sie schlafen, genau, wie ich es beabsichtigt hatte. Ein paar Sekunden stand ich noch an ihrem Bett, die Hand auf meinem Brustbein, und betrachtete die Frau. Irgendwann wurde es zu bedrückend, und ich verließ das Zimmer.
Frau Kallier war zu uns gekommen, weil ihr Leben zu Ende ging. Sie hatte es gewusst und es akzeptiert. Sie hatte keine Angst vor dem Sterben gehabt, keine Probleme, loszulassen. Wieso also hatte ich welche?
Ihre Familie, ihre drei Kinder plus Partner und Enkel, kamen nur etwa fünfzehn Minuten später auf Station. Ihre Kinder hatten alle rot geweinte Augen, aber wie Frau Kallier selbst lächelten sie mich an. Ich sprach ihnen mein Beileid aus, und sie nahmen mich bei der Hand und hielten sie sehr lang. Dankten mir für die Pflege ihrer Mutter und betonten, wie gern sie von mir gesprochen hatte. Ich zeigte ihnen das Zimmer, in dem die Verstorbene lag, und schloss die Tür hinter ihnen.
Danach musste ich erst mal für ein paar Minuten auf dem Klo verschwinden und tief durchatmen. Okay, vielleicht war ich doch nicht so abgestumpft. Die meiste Zeit schon, aber es kamen immer wieder Patienten, die mich berührten und von denen der Abschied mir schwerfiel. Ich betrachtete nachdenklich mein Spiegelbild, bevor ich den hohen Messy Bun, den ich mir bei der Arbeit am Patienten immer machte, öffnete. Vorsichtig durchkämmte ich die schwarzen, brustlangen Haare mit den Fingern, dann wischte ich die verschmierte Wimperntusche weg. Mein Spiegelbild sah mich ein wenig geknickt aus seinen dunklen Augen an, und ich zwang mich, die Mundwinkel nach oben zu ziehen. Ich zwang mich, das Gesicht mit den vollen Lippen und der Nase, die ich früher zu breit und flach gefunden hatte, anzulächeln. Es dauerte einen Moment, aber dann funktionierte es. Das Lächeln im Spiegel sah mit den verstreichenden Sekunden immer weniger gezwungen aus, und vor allem fühlte es sich immer besser an. Echter. Ich atmete noch mal tief durch, dann war ich bereit, das Bad zu verlassen. Da Frau Kallier die letzte Patientin auf meinem Rundgang gewesen war und sonst keine Notfalllampen über den Zimmern brannten, ging ich zurück ins Schwesternzimmer. Wie immer roch es nach billigem Kaffee und teurem Parfüm. Meine Kollegin Inka saß auf ihrem Lieblingsstuhl in der Ecke – den mit dem noch nicht durchgesessenen Sitzpolster – und schlürfte das dampfende Gebräu aus einer »Meine Schwester ist die Beste«-Tasse. Ich hatte vor Inka noch nie einen Menschen kennengelernt, der so viel Koffein in sich schütten konnte, ohne Herzrasen davon zu bekommen. Sie stand in jedem Dienst mindestens viermal da und kochte eine neue Kanne. Vermutlich trank sie nichts anderes – ich hatte sie jedenfalls noch nie mit einem Glas Wasser gesehen.
Sie hob den Kopf. »Kaffee?«
»Nein danke.« Wir arbeiteten schon seit zwei Jahren zusammen, aber sie konnte sich einfach nicht merken, dass ich Kaffee hasste. Oder sie wollte es nicht, das lag definitiv auch im Bereich des Möglichen. Einen kleinen Moment lang fragte ich mich, ob ich die Erwachsenenpalliativstation wohl lieber mögen würde, wenn das Team ein anderes wäre. Inka und ich waren nicht wirklich auf einer Wellenlänge, und die meisten meiner Kollegen waren um die fünfzig und schon deutlich abgestumpfter als ich.
Inka nippte erneut an ihrer Tasse. »Na, haste alles erledigt?«
Alles erledigt war ihr Standardsatz dafür, einen verstorbenen Patienten für seine Angehörigen fertig zu machen. Ich hasste es, wenn sie das sagte, versuchte aber wie immer, es mir nicht anmerken zu lassen. »Das klingt, als wären wir bei der Mafia.«
Inka brummte nur. Es war offensichtlich, dass es sie eigentlich gar nicht interessierte. Sie lehnte sich in ihren Stuhl. »Susann will gleich mit uns reden. Klang ernst.«
»Okay?« Das brachte mich nicht aus der Ruhe. Unsere Stationsleiterin war eine dieser Personen, die sich selbst viel zu wichtig nahmen. Unsere alte Leitung war erst vor ein paar Wochen in Rente gegangen, und Susann hatte sich direkt nach ihrer Übernahme auf ein Podest gestellt. Alles, was sie tat, war unheimlich wichtig und konnte auf keinen Fall warten, egal, was man gerade tat. Dass sie noch nicht in der Tür stand und auf ihre Armbanduhr tippte, war verwunderlich.
Ich hatte eigentlich nicht die geringste Lust auf eine Standpauke oder eine ihrer wichtigen Reden, bei denen meistens eh nur heiße Luft kam. Der Tod von Frau Kallier saß mir noch ein wenig in den Knochen, und am liebsten hätte ich mit irgendjemandem darüber gesprochen. Aber als ich zu Inka hinübersah, hatte die ihre Nase schon wieder in einer Zeitung. Für dieses Thema hatte keine meiner Kolleginnen ein offenes Ohr für mich. Ich hatte einmal, ganz am Anfang, probiert, mit ihnen über einen verstorbenen Patienten zu reden. Sie hatten mir lediglich einen mitleidigen Blick geschenkt, mir auf die Schulter geklopft und gemeint: »Da musste dich aber ganz schnell dran gewöhnen, Schätzchen. Der Tod ist hier Dauergast.« Sie hatten nicht verstanden, dass ich nicht über den Tod hatte reden wollen – sondern über das Leben meiner Patienten. Jetzt gerade hätte ich gern über Frau Kallier gesprochen, darüber, wie sie mich immer angelächelt und meine Hand gedrückt hatte, um Trost zu bekommen. Über ihre strahlenden Augen, wenn sie über ihre Familie geredet, oder die Sorge in ihrem Gesicht, wenn sie über den Tod nachgedacht hatte.
Ich überlegte gerade, ob ich mich vor dem Gespräch mit Susann drücken könnte, wenn ich Beschäftigung bei meinen anderen Patienten vorgab, da ging die Tür zum Schwesternzimmer bereits auf. Eine dichte Parfümwolke strömte in den Raum, und gleich darauf folgte Susann Gottlieb, mit perfekt gescheiteltem Haar und einem besorgten Gesichtsausdruck. Kein Grund zur Beunruhigung, denn wie ich in den letzten Wochen festgestellt hatte, sah sie immer aus, als stünde der Weltuntergang kurz bevor.
»Ist Jens noch gar nicht hier?«, fragte sie und umschlang das blaue Klemmbrett in ihrem Arm etwas fester.
»Der räumt bestimmt wieder den Behandlungsraum auf«, sagte Inka über ihre Zeitung hinweg.
Ich versteckte mein Schmunzeln hinter einem Wasserglas. Noch so ein Standardsatz, den man hier oft hörte – zumindest öfter, als man einen Behandlungsraum wirklich aufräumen konnte. Jens war ein paar Jahre älter als Inka, und sein Energielevel war definitiv nicht mehr ganz auf dem Stand. Er bekam meist nur einen Patienten pro Tag zugeteilt, und wenn er von dessen Pflege ein wenig Erholung brauchte, räumte er den Behandlungsraum auf. Kurz: Er schloss sich im Behandlungsraum ein und pennte eine Runde auf der Liege. Jens hatte es perfektioniert, zwanzig Minuten wie ein Stein zu schlafen und dann ohne Wecker einfach wieder aufzuwachen und an die Arbeit zu gehen. Wirklich geheim halten ließ sich das natürlich nicht, schließlich hatten alle Mitarbeitenden einen eigenen Schlüssel. Ich konnte mich noch lebhaft daran erinnern, wie ich vor einem Jahr hinter sein »Geheimnis« gekommen war, als ich außer der Reihe Material aus dem Behandlungsraum hatte holen wollen. Mir war es nicht seltsam vorgekommen, dass er abgeschlossen war, weil wir es meistens so hielten. Aber als ich schließlich eingetreten war, hatte ich mich furchtbar erschrocken. Denn Jens sah, wie er da auf dem Rücken auf der Liege lag, die Augen geschlossen und den Mund weit geöffnet, wie ein Toter aus. Ansonsten schien das hier aber niemanden zu stören – was wahrscheinlich alles über diese Station aussagte.
Susanns Gesichtsausdruck wurde noch eine Spur leidender, der Griff um ihr Klemmbrett noch fester. Ihre Fingerknöchel schimmerten bereits weiß. »Ich verstehe. Könntest du ihn bitte holen, Inka?«
Inka und ich rissen gleichermaßen die Augen auf und starrten unsere Stationsleitung an. Okay, jetzt mache ich mir doch Sorgen. Dass Susann Inka losschickte, war mehr als eigenartig. Normalerweise war ich diejenige, die auf die Piste geschickt wurde – um Kollegen zu holen, Verbandsmaterialien, Kaffee, egal was. Ich war schließlich mit Abstand die Jüngste im Team, gerade einmal zweiundzwanzig, und wie Inka immer betonte: »Du hast noch Energie, im Gegensatz zu uns alten Leuten.«
Das dachte sie wohl auch in diesem Moment, denn sie schnaubte nur, bevor sie die Zeitung auf den Tisch knallte und sich, leise über ihr kaputtes Knie schimpfend, erhob. Wahrscheinlich, um Susann ein schlechtes Gewissen zu machen. Die beachtete sie aber gar nicht, sondern wendete sich mir zu.
»Die Familie von Frau Kallier hat mich gerade auf dem Gang angehalten und Sie noch einmal für die Pflege ihrer Mutter gelobt. Also: gute Arbeit, Maya.« Susann lächelte mich an, klopfte mir sanft auf die Schulter und schob sich dann die Haare hinters Ohr.
Ich sah sie irritiert an. »Ähm, danke.« Das war ungewöhnlich. Und besorgniserregend, irgendwie.
Unsere Stationsleitung setzte sich zu mir an den Tisch und behielt mich die ganze Zeit mit einem seltsamen Lächeln im Blick, während wir darauf warteten, dass Inka mit unserem fehlenden Kollegen wiederkam.
Irgendwann schob sich Jens durch die Tür. »Sorry, habe den Behandlungsraum aufgeräumt«, nuschelte er in Susanns Richtung. Ja, das konnte man sehen – seine Haare waren durcheinander, und der Kasack saß etwas schief. Hinter ihm ließ sich Inka schnaubend auf ihren Platz sinken. Sie klang, als hätte sie gerade einen Marathon hinter sich.
Susann nickte nur. »Ich wollte eigentlich noch auf den Spätdienst warten, damit es so viele wie möglich direkt von mir hören, aber ich möchte nur ungern Zeit verschwenden.« Stationsleitersprache für: Die Informationen könnt ihr auch gern selbst verbreiten. Sie räusperte sich, bevor sie weitersprach: »Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wird das Sankt Alexander gerade von einer besonders üblen Grippewelle in Atem gehalten. Viele Kollegen sind auf anderen Stationen ausgefallen, und so langsam bekommen die Leitungen überall große Probleme.«
Ich stützte mein Kinn auf die Hand. Tatsächlich war das gerade das Thema Nummer eins in der Klinik. Ständig fielen Leute aus, auch uns hatte es schon das ein oder andere Mal erwischt. Außerdem wusste ich, dass meine Freundin Tessa sich in letzter Zeit oft darum bemühen musste, auf ihrer Station Leute ranzukriegen. Wir waren gemeinsam in der Ausbildung gewesen, und mittlerweile war sie die stellvertretende Stationsleitung der Kinderonkologie. Wenn sie darüber sprach, war sie immer wahnsinnig gestresst.
»Manche Stationen haben dadurch ein größeres Problem als andere – weil patientenbedingt ein höherer Personalschlüssel gebraucht wird«, erklärte Susann, obwohl wir das natürlich alle wussten. »Und nun sind wir in der Pflicht, diesen Stationen auszuhelfen, um den Patienten, die es am meisten brauchen, gerecht werden zu können. Deshalb haben die Krankenhausleitungen entschieden, dass die bessergestellten Stationen, wie wir, zeitweise Personal abgeben – an die Stationen, die es dringender brauchen.« Das war also die Hiobsbotschaft.
Jens und Inka gaben Geräusche von sich, die an einen gestrandeten Fisch erinnerten. Empörung, nahm ich an. Dabei war mir in dem Moment, in dem Susann es aussprach, eigentlich bereits klar, dass Jens und Inka nichts zu befürchten hatten. Die lobenden Worte, das entschuldigende Lächeln, das sie mir zuwarf – ich war todsicher diejenige, die in den sauren Apfel beißen musste. Ich richtete meinen Rücken und versuchte, die Nervosität in meinem Inneren nach unten zu kämpfen. Ich war an die Ruhe der Palli gewöhnt, und ich war sicher, dass ich seit meiner Ausbildung schon eine ganze Menge vergessen hatte, was relevant für die Arbeit auf normalen Stationen war. Aber wie viel konnte man für einzelne eingesprungene Dienste von mir schon erwarten? Und vielleicht war es ganz nett, ab und zu in andere Stationen hineinzuschnuppern. Das würde ich hinbekommen, ganz sicher.
Susann seufzte. »Es geht um einen vierwöchigen Einsatz auf einer anderen Station.«
Oh, fuck. So viel zum Thema einzelne Dienste.
»Und zwar auf einer Station, die es ganz besonders nötig hat, gut besetzt zu sein: die Intensivstation unseres Hauses.«
OH, FUCK. Augenblicklich stockte mir der Atem. Die Intensivstation?! Die Station, auf der die kränksten Patienten lagen? Die Station, auf der man wahrscheinlich am allerwenigsten einen Fehler machen durfte, weil jedes Leben dort auf der Kippe stand?! Bitte nicht.
Jens und Inka murmelten etwas vor sich hin, das nach Protest und Unwillen klang, doch sie wurden schnell erlöst.
»Maya, ich habe gedacht, dass es am besten wäre, wenn du das machst. Du bist noch jung, hast Energie, und deine Ausbildung ist noch nicht so lange her. Ich bin sicher, dass du dich dort gut einfinden wirst, und es ist ja auch nicht für lange. Wäre das in Ordnung für dich?«
Meine Kollegen rissen ihre Köpfe herum. Ich wurde von sechs Paar Augen angestarrt, von denen ich wusste, dass sie nur eine Antwort von mir akzeptieren würden. Mein Herz schlug mir bis zum Hals, und meine Hände waren feucht von Schweiß. Aber obwohl mir die Meinung der anderen über mich eigentlich egal war und ich mich mehr als überfordert bei dem Gedanken an die Intensivstation fühlte, zwang ich mir ein Lächeln ins Gesicht. Zwang mich, Susann in die Augen zu sehen und gespielt gleichgültig mit den Schultern zu zucken. »Wenn du meinst, dass das die beste Lösung ist, mache ich das gern.«
Herr im Himmel, bitte nicht. Ich will das nicht machen.
Aber wer sollte es sonst machen? Jens, der seine drei Schlafpausen im Dienst brauchte? Inka, die ohne vier Liter Kaffee nicht mal aus ihrem gepolsterten Stuhl kam? Einer der anderen Kollegen, die alle kurz vor der Rente standen?
Susann hatte recht, ich war wahrscheinlich die beste Wahl. Auch wenn das nicht unbedingt das war, was ich mir gewünscht hätte.
»Ich wusste, dass du das sagen würdest«, sagte Susann. Sie klang beinahe fröhlich.
Natürlich hatte sie das. Wie die meisten Menschen in meinem Leben hatte sie noch nie ein Nein von mir gehört. Trotzdem war die Erleichterung im Raum beinahe greifbar.
Susann schien ihr Klemmbrett nun auch nicht mehr ganz so verkrampft festzuhalten. »Dafür habe ich auch direkt eine gute Nachricht für dich: Du musst den Samstagsdienst morgen nicht machen, den Tag kannst du also zur Erholung nutzen und um dir von der Intensivstation deine nötigen Schlüssel zu holen. Ich bin sicher, dass du dich großartig schlagen wirst, und die Zeit geht bestimmt ganz schnell vorbei.«
Ein letztes Lächeln, ein kurzes Tätscheln meiner Schulter, dann stand unsere Stationsleiterin auf und verließ den Raum. Beinahe augenblicklich gingen Jens und Inka dazu über, auf die Grippewelle zu schimpfen. Bereits nach wenigen Sekunden war es, als hätten sie meine Anwesenheit völlig vergessen.
Obwohl ich ihnen gerade quasi den Arsch gerettet hatte.
Obwohl ich immer noch einen Schweißausbruch hatte, weil die Intensivstation nach einer ganz schön großen Nummer klang.
Oh, fuck, hoffentlich vergeige ich das nicht.
Kapitel 2
Der Rest des Dienstes ging wie in einem weißen Rauschen an mir vorbei. Als der Spätdienst kam und Inka ganz brühwarm die Neuigkeiten berichtete, zuckte ich nur müde mit den Schultern. Während der Übergabe starrte ich die meiste Zeit aus dem Fenster zu den vorbeitreibenden Schneeflocken und fragte mich, wie wohl eine plötzliche Kündigung in meinem Lebenslauf aussehen würde. Nicht ganz ernsthaft natürlich, tief in meinem Inneren wusste ich, dass ich mir die Situation schlimmer ausmalte, als sie im Endeffekt sein würde. Aber ein wenig streifte der Gedanke mich trotzdem.
Zum Abschied versicherten mir meine Kollegen noch einmal, wie gut ich meinen Job dort machen würde und dass ich die beste Wahl dafür war. Als würde es sie wirklich kümmern. Wie immer lächelte ich nur und drückte mich durch die Stationstür. Versuchte, nicht daran zu denken, dass ich mit den meisten von ihnen schon seit zwei Jahren zusammenarbeitete und trotzdem nicht wusste, ob sie bei meiner Rückkehr in vier Wochen überhaupt noch meinen Namen kennen würden. Im Fahrstuhl nach unten in den Eingangsbereich des Sankt Alex, auf dem kalten Weg bis zur Tram, und auf der Fahrt nach Hause lösten sich meine Zweifel langsam ein wenig auf und machten der Neugierde Platz. Vielleicht war es gar nicht schlecht, mal eine Weile andere Luft zu schnuppern. Andere Leute und Krankheitsbilder zu sehen. Das große Vergessen nach der Ausbildung hatte mich ohnehin schon etwas beunruhigt, mein Gehirn würde sich für diese Auffrischung wahrscheinlich bedanken.
Außerdem war mir klar, dass ich eh keinen Rückzieher machen konnte. Nicht nur, weil meine Kollegen dann wahrscheinlich einen Krieg anzettelten, sondern auch, weil ich wusste, dass die Intensivstation wirklich auf dem Zahnfleisch lief. Ich hatte erst letztens im Krankenhausklatsch gehört, wie schlimm es um sie stand, und allein bei dem Gedanken, mich der Station zu verweigern, nagte schon das schlechte Gewissen an mir. Das war absolut keine Option. Ich musste es durchziehen und nahm mir vor, den Grundsatz zu befolgen, den mir mein Klassenlehrer in der Ausbildung beigebracht hatte: SABA – sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit.
Oh, Himmel.
Als ich aus der Bahn stieg, verbarg ich die untere Gesichtshälfte in meinem Schal, um dem beißenden Wind etwas zu entgehen. Vorbei an den kleinen Restaurants und Shops, an den Altbauten, für die Friedrichshain bekannt war. Meine Wohnung lag über einem kleinen Kiosk, und Ahmed, der Kioskbesitzer, stand bei jedem Wind und Wetter vor der Tür und paffte. Auch jetzt stand er da, in seinem dicken Anorak, und winkte mir zu. Ich hob die Hand zum Gruß, bevor ich versuchte, mit meinen vor Kälte tauben Händen irgendwie den Schlüssel in das Schloss der dunklen Haustür zu bekommen. Nach ein paar Sekunden gelang es mir, und endlich konnte ich in die etwas erträglicheren Temperaturen des Hausflures stolpern. Sofort kam mir das Babygeschrei entgegen, das zu meiner täglichen Musik geworden war. Im zweiten Stock, wo auch ich wohnte, war es am lautesten, und ich spürte Mitleid in mir aufsteigen, als ich die Tür von meinem Nachbarn Paul betrachtete. Das Weinen war in den letzten Tagen mehr geworden – wahrscheinlich zahnte sein Kleiner gerade. Paul war alleinerziehend, und ich wusste, dass er gerade kaum zum Schlafen kam.
Es waren zwei Wochen vergangen, seit meine ehemalige Mitbewohnerin ausgezogen war, und am Anfang war ich froh darüber gewesen. Clara war kein einfacher Mensch, und langsam hatte ich keine langen roten Haare mehr in meiner Dusche sehen können. Mittlerweile hatte ich mich daran gewöhnt, in eine absolut ruhige Wohnung zu kommen, und war daran erinnert worden, dass mir die Stille seit meiner Kindheit noch nie besonders gutgetan hatte. Auch wenn ich mich manchmal danach sehnte, spürte ich doch schnell die Unruhe in mir aufsteigen, wenn ich sie endlich hatte.
Aber als ich an diesem Tag die Tür aufschloss, war das Erste, was ich wahrnahm, ein lautes Hämmern. Dicht gefolgt von einem Geruch nach Wandfarbe. Ich hängte den Schlüssel an das Brett neben der Tür und merkte, wie meine Mundwinkel unwillkürlich nach oben wanderten. Die Zeit der Ruhe war vorbei. »Tessa?«
Ein erneutes Hämmern, dann das Geräusch von etwas, das auf den Boden geworfen wurde – schließlich gefolgt von einem leisen Fluch. Mir entfuhr ein Kichern, als ich mich aus dem Mantel schälte. Das Zimmer, das vor Kurzem noch Clara gehört hatte, stand offen. Überall – in der Küche, im Wohnzimmer, sogar im Bad – verstellten Umzugskartons die Wohnung. Einen Moment fragte ich mich, wie viele Sachen ein Mensch haben konnte, aber dann erinnerte ich mich an die Wohnung, in der Tessa zuvor gewohnt hatte. Dieses Riesenteil in Charlottenburg, das sie sich mit ihrem Ex-Freund Martin geteilt hatte. Es war wahrscheinlich schwierig, so viel Leben in so wenig Raum zu quetschen.
»Kommst du zurecht?« Ich ging hinein und grinste Tessa an, die gegenüber ihrem neu aufgestellten Bett stand. Sie hatte offensichtlich gerade versucht, einen Nagel in die Wand zu hauen – so, wie ich es bereits Hunderte Male versucht hatte –, und warf mir jetzt einen frustrierten Blick zu. »Gibt es dafür einen Trick?«
»Klebenägel. Die Wände sind an den meisten Stellen zu hart, um etwas reinzuhämmern.« Ich kicherte. »Ich glaube, ich habe noch welche in meinem Zimmer, soll ich dir einen holen?«
Tessa seufzte tief und lehnte das große gerahmte Bild einer wunderschönen Schneelandschaft gegen die Wand. »Schon gut. Um ehrlich zu sein, ist das eine gute Ausrede, für heute Feierabend zu machen.« Sie streckte sich und schenkte mir ein entschuldigendes Lächeln. »Sorry, dass ich in deiner Wohnung so viel Unordnung mache. Ich schwöre, dass ich das alles heute noch irgendwie wegräumen werde.« Wie zum Beweis deutete sie auf die bereits aufgebauten Schränke und Kommoden, die sich an den Wänden aneinanderreihten und kaum Platz für etwas anderes mehr ließen. Himmel, sie hatte echt viel Zeug.
»Schon gut. Und es ist jetzt UNSERE Wohnung, vergessen?« Ich setzte mich auf die Kante ihres Bettes. »Wo sind denn die anderen, wollten die dir nicht eigentlich beim Umzug helfen?«
»Haben sie«, gab Tessa seufzend zurück und ließ sich rücklings neben mich aufs Bett fallen. »Aber Louis und Beck haben beide Spätdienst, und Sami muss sich um ihre zwei jüngsten Brüder kümmern, weil ihr ältester Bruder Fynn nicht in Berlin ist. Ich sag’s dir, ich bin völlig durch.«
Man sah ihr die Erschöpfung an, und ich klopfte ihr aufmunternd auf den Oberschenkel. »Wie wäre es dann mit einer Pause mit Kakao und Matcha Latte, und danach helfe ich dir beim Einräumen? Zu zweit sind wir sicher schnell fertig.«
»Du bist ein Engel, Maya.« Tessa sah mich an. »Aber bist du nicht auch völlig fertig von der Arbeit?«
»Quatsch«, wehrte ich ab, obwohl es eigentlich so war. Körperlich war die Arbeit auf der Palliativstation nicht unbedingt anstrengend, aber der Tod meiner Patientin und die Hiobsbotschaft von Susann hatten mir heute den Rest gegeben. Allerdings wusste ich, dass sie mich niemals helfen lassen würde, wenn ich es zugäbe. Und ich war so froh, dass Tessa heute hier eingezogen war, dass ich ihr am liebsten ALLES abgenommen hätte, nur damit sie sich wohlfühlte. Ich stand auf. »Na los.«
»Deine Energie will ich haben, Maya.«
»Du klingst, als wärst du siebzig, Tessa.« Ich lachte und schlug den Weg zu der gemütlichen Küche ein, die direkt an ihr Zimmer grenzte. Es war mein absoluter Lieblingsraum in der Wohnung und damals der Grund gewesen, warum ich unbedingt hier hatte einziehen wollen. Die Küche war riesig und in einem urigen Landhausstil eingerichtet. Sie hatte eine große Kücheninsel in der Mitte, und in den letzten zwei Jahren hatte ich sie immer mehr und mehr mit Pflanzen vollgestellt. Im hinteren Bereich grenzte ein kleiner Balkon an, auf dem man großartig frühstücken konnte – wenn gerade nicht Winter war. Ich öffnete die Tür ein wenig, um zu lüften, und betätigte dann den Knopf der modernen Kaffeemaschine, die Tessa aus der Wohnung ihres Ex-Freundes hatte mitgehen lassen. Das Teil war sicher ordentlich teuer gewesen, aber es konnte auch wirklich alles. Ich machte erst Tessas Matcha Latte und dann eine heiße Schokolade für mich, während meine neue Mitbewohnerin in die Küche geschlurft kam, sich auf einen der Stühle an der Kücheninsel setzte und den Kopf auf die Holzplatte legte.
»Umzüge sind echt anstrengend.«
»Den größten Teil hast du hinter dir«, munterte ich sie auf und stellte die Tasse vor ihr ab, bevor ich mich ihr gegenübersetzte.
Tessa blickte auf. Sie hatte dunkle Ringe unter den Augen, wahrscheinlich weil sie kaum geschlafen hatte. Sie griff nach der Tasse. »Und noch einmal: Deine Energie möchte ich haben.«
»Extravertierte Menschen ziehen ihre Energie aus dem Kontakt mit Menschen. Habe ich zumindest mal gelesen.« Ich hielt die Tasse mit dem Kakao an meine Nase und sog den großartigen Geruch ein. Da fehlte noch Zimt!
Während ich das Puder aus einem Schrank unter der Anrichte kramte und auf meinem Getränk verteilte, brummte Tessa: »Dann bin ich das auf jeden Fall nicht. Du hast nicht zufällig Lust, die Kartons allein auszuräumen, während ich mich ins Bett lege?«
Ich lachte auf. »Leider habe ich keine Ahnung, wie du alles eingerichtet haben willst. Hast du mal mein Zimmer gesehen? Ich bin nicht gut in so etwas.«
Sie hob die Augenbrauen. »Dein Zimmer ist … schlicht. Das ist nichts Schlechtes.«
Das war auch eine Art, es auszudrücken. In meinem Zimmer befand sich lediglich ein Bett, das ganz Berlin-klassisch aus Holzpaletten gebaut war, und ein winziger Schreibtisch in der Ecke, der eigentlich nur als Ablage diente. Ich hatte nicht einmal einen Kleiderschrank – die saisonalen Klamotten hingen an einer Kleiderstange, den Rest bewahrte ich in Kartons im Keller auf. Mein Zimmer war klein, und bis auf ein paar Pflanzen hatte ich nichts, das irgendwie wohnlich wirkte. Tessa hatte angeboten, dieses Zimmer zu übernehmen, aber ich brauchte nicht viel Platz – ganz abgesehen davon, dass Tessa ihren ganzen Kram dort nie im Leben untergebracht hätte.
Ich zuckte mit den Schultern, und irgendetwas erwachte in Tessas Augen. Sie schmunzelte mir über die Insel zu. »Wenn du willst, kann ich dir ein bisschen mit der Deko helfen. Muss doch alles hübsch aussehen, wenn du mal eine Bekanntschaft mit nach Hause bringst, oder?« Sie zwinkerte, und mein Lächeln hätte beinahe einen kleinen Knacks bekommen.
»Ach komm, du weißt, dass das seit der Ausbildung nicht mehr vorgekommen ist.«
»Warum eigentlich nicht? Damals warst du immer die mit den meisten … Bekanntschaften von uns.« Tessa nippte an der Tasse, und ich zuckte mit den Schultern.
»Zu viel Arbeit. Zu viel Sozialleben.«
Zumindest in den letzten Monaten. Nach der Ausbildung hatte ich mich sofort in die Arbeit gestürzt und war oft eingesprungen, hatte Überstunden gemacht und mich beinahe komplett ausgebrannt. Abgesehen davon, dass ich mich nebenher noch viel um meine Tante kümmerte, war kaum Zeit für etwas anderes geblieben. Doch als ich vor ein paar Monaten meine Freundschaft mit Tessa und Sami wieder aufleben ließ, war ich auf der Arbeit etwas kürzergetreten.
Wir hatten damals zusammen die Ausbildung gemacht und wahnsinnig viel Zeit miteinander verbracht, aber als wir in den »echten« Arbeitsalltag starteten, hatte sich unsere Freundschaft etwas verlaufen. Erst letztes Jahr hatten wir uns wiedergefunden, als Sami uns gebraucht hatte. Sie kümmerte sich um zwei ihrer drei jüngeren Brüder, weil ihre Mutter dazu nicht in der Lage war – oder besser: keine Lust darauf hatte. Und weil sie nach einem Krankenhausaufenthalt von ihrem Bruder Jannis Hilfe gebraucht hatte, waren wir wieder eng zusammengerückt. Hatten wieder mehr Zeit miteinander verbracht. Ich ging wieder mehr aus dem Haus und spürte selbst, wie viel besser es mir damit ging. Beinahe augenblicklich lehnte ich mich bei diesem Gedanken über den Tisch und ergriff Tessas Hand.
Sie wirkte im ersten Moment überrascht, drückte dann aber zurück. »Danke noch mal, dass du mich hier wohnen lässt«, sagte sie.
Ich schüttelte den Kopf. »Kein Ding.« Schließlich wusste sie nicht, dass das wahrscheinlich für mich noch um einiges wohltuender war als für sie.
Tessa trank ihren Matcha Latte in großen Schlucken aus, obwohl er bestimmt noch heiß war. »Puh, das tat gut. Jetzt habe ich auch wieder Energie zum Weitermachen.« Sie blickte zu meiner heißen Schokolade, die noch kaum angerührt war, und schüttelte den Kopf. »Aber du solltest dich wirklich erst mal von der Arbeit erholen und in Ruhe deinen Kakao trinken. Ich komme schon klar.«
»Ich mache das wirklich gern«, wehrte ich ab. »Außerdem habe ich morgen spontan doch keinen Dienst, da kann ich mich noch genug erholen.«
Sie sah mich skeptisch an. »Spontan frei? Auf deiner Station müsste man arbeiten.«
»Na ja. Gewissermaßen tue ich das selbst jetzt auch nicht mehr.«
Tessa starrte mich an. »Moment, was? Du wurdest gefeuert? Nein, warte, lass mich die Frage zurückziehen – niemand feuert eine Krankenschwester. Nicht bei dem Personalmangel. Also, hast du hingeschmissen?«
Sie klang ein wenig zu euphorisch, wahrscheinlich weil sie an meine Storys von meinen Kollegen dachte, und das brachte mich zum Lachen. »Quatsch, natürlich nicht. Aber der Personalmangel hat tatsächlich etwas damit zu tun, allerdings der auf der Intensivstation. Ich muss für vier Wochen dort aushelfen und bekomme deshalb als Trostpflaster morgen frei.«
»Oh.« Tessa verschränkte die Arme vor der Brust. »Wieso hat es dich getroffen?«
Ich nahm einen Löffel und tat so, als müsste ich ganz konzentriert in meiner Tasse herumrühren. »Na ja, ich bin die Jüngste auf Station und wahrscheinlich am besten geeignet.«
»Oder ist es vielleicht, weil du nicht Nein sagen konntest?«
Als ich sie angrinste, seufzte Tessa. »Maya, es ist in Ordnung, etwas nicht zu machen, wenn du dich dafür nicht bereit fühlst. Scheiß drauf, was deine Kollegen und deine Stationsleitung dazu sagen, du musst auf dich selbst achten.«
»Klar, weiß ich doch«, gab ich zurück, obwohl sie damit genau den Kern meiner Ängste traf. Ich überspielte es. »Aber ich krieg das schon hin, ganz sicher. Ich meine – ich werde da doch sicher gut eingearbeitet. Vielleicht mache ich auch nur die einfachen Sachen und arbeite den Schwestern dort zu, das klappt schon. Das wird easy.«
Doch Tessa ließ sich nicht so leicht täuschen. »Das waren eine Menge Zusicherungen in wenigen Sätzen. Und warum klang das, als wäre am Ende des letzten Satzes ein Fragezeichen?«
»Unsinn, du interpretierst zu viel.« Langsam wurde es ein wenig schwer mit meinem aufgesetzten Lächeln. War da wirklich ein Fragezeichen? Hatten meine Zweifel die Oberhand über meine Stimme gewonnen? »Ich meine … ich habe ja jetzt eine sehr fähige Krankenschwester als Mitbewohnerin. Kinderonko, Intensiv, das ist doch alles nicht so weit voneinander entfernt. Dann musst du mir eben einen Crashkurs geben und mir bei Fragen Rede und Antwort stehen.«
Tessa starrte mich noch ein paar Sekunden zweifelnd an, dann pustete sie sich eine Strähne der blonden Haare aus dem Gesicht. »Mann, deine Zuversicht will ich auch, neben deiner Energie. Du lässt dich einfach von nichts unterkriegen.«
Oh, Mann, wie sehr ich mir wünschte, das wäre wahr. »SABA«, sagte ich.
Tessa schmunzelte. »Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Etwas, das mir nie gelungen ist.«
»Und im Gegensatz zu dir habe ich es gemeistert. Also, räumen wir jetzt deine Sachen aus?« Voller Tatendrang ließ ich mich von dem Stuhl rutschen. Ich hatte schon eine Playlist im Kopf, die wir laut über die Boxen schallen lassen konnten, während wir arbeiteten, da piepste mein Handy in meiner Hosentasche. Ich zog es hervor. Britta. Mir lief ein kalter Schauer über den Rücken. Ich hatte gar nicht mitbekommen, dass sie vor einer Stunde versucht hatte, mich anzurufen. In der Zwischenzeit hatte sie mehrere Nachrichten geschrieben und wurde mit jedem Wort angepisster. Ich biss mir auf die Unterlippe. »Also, um ehrlich zu sein, muss ich vorher doch noch was erledigen.«
Tessa, die schon an der Tür angekommen war, sah mich über ihre Schulter hinweg aufmerksam an. »Alles in Ordnung?«
»Jaja, alles okay. Meine Tante hat mir nur geschrieben, dass sie mal wieder etwas ganz Bestimmtes aus einem ganz bestimmten Laden braucht, der natürlich nicht bei ihr um die Ecke ist. Und wenn ich nicht morgen noch einmal quer durch Berlin fahren will, bevor ich zu ihr fahre, sollte ich es jetzt besorgen. Ich beeile mich und komme sofort danach zurück, um dir zu helfen, okay?«
»Klar, kein Problem.« Meine Freundin zuckte mit den Schultern, als ich mich an ihr vorbei auf den Flur drückte. Meine Füße protestierten, als ich sie wieder in die Winterstiefel steckte. Ich war müde, und ich hatte keine Lust, wieder in die Kälte hinauszugehen. Wirklich nicht. Aber ich hatte keine Wahl. Das war ich meiner Tante schuldig, nachdem sie sich einen großen Teil meines Lebens um mich gekümmert hatte und nun in einem Alter war, in dem sie selbst Hilfe benötigte. Es war schlimm genug, dass ich heute nicht zu ihr fuhr.
Als ich den dicken Winterschal um meinen Hals schlang, warf ich Tessa noch einen entschuldigenden Blick zu. »Sorry, dass ich dich so damit allein lasse. Erst der Umzug an sich und jetzt noch das Einräumen. Du wirst meine großartigen Mitbewohnerqualitäten aber noch zu Gesicht bekommen, das schwöre ich.«
Tessa lachte laut. »Jetzt hör schon auf, du kannst da doch nichts dafür. Wir brauchen einfach ein paar mehr Freunde, die nicht im Krankenhaus arbeiten und Schichtdienst haben.« Sie stockte einen Moment, bevor ihr Lächeln etwas verschlagen wurde. Sie lehnte sich mit der Schulter an die Wand, während ich mich in meinen Mantel quälte. »Oder einfach einen Boyfriend für Maya. Einen, der wenig arbeitet und ordentlich Muskeln hat, mit denen er beim nächsten Umzug alle Kisten allein tragen kann.«
»Wenn du so einen findest, hast du ja meine Adresse.« Ich schmunzelte, die Hand schon an der Klinke. »Auch wenn ich hoffe, dass wir so schnell keinen weiteren Umzug haben werden. Du wirst doch nicht nach ein paar Stunden schon wieder den Gedanken hegen, von hier abzuhauen?«
»Bei der perfekt gelegenen, wunderschönen und bezahlbaren Wohnung direkt in Friedrichshain? Hier kriegen mich keine zehn Pferde mehr raus, Schwester.«
Ich öffnete grinsend die Tür. »Dann hoffe ich, dass nicht mein Umzug in der Planung ist, damit du mit Beck und deinem kleinen Luca hier einziehen kannst?«
Tessa verschränkte die Arme vor der Brust und tat so, als würde sie nachdenken. »Vielleicht nicht, wenn du auf dem Heimweg etwas Süßes mitbringst?«
»Frechheit. Ich werde in meiner eigenen Wohnung bestochen. Die gleichen Tartelettes wie immer?«
»Du bist ein Schatz.«
Ich zog die Tür zu und konnte schon hören, wie schwere Kartons durch die Wohnung geschoben wurden. Der Ausblick auf Tartelettes schien Tessa tatsächlich zu motivieren.
Der Anflug von guter Laune verflog sofort beim Blick auf mein Handy. Zwei weitere, sehr vorwurfsvolle Nachrichten waren angekommen. Ich seufzte tief und schrieb Britta, dass ich besorgen würde, was sie wollte. Dann hastete ich die Treppe nach unten.
Kapitel 3
Die Aufzugtüren teilten sich, und als ich die milchige Glastür zur Intensivstation ins Auge fasste, traten mir Schweißperlen auf die Stirn. Ich versuchte, tief durchzuatmen. Bloß keine Panik, Maya, sagte ich mir wie ein Mantra in meinen Gedanken. Du holst nur die Schlüssel und stellst dich kurz vor. Da kann gar nichts schiefgehen.
Aber als meine Hand nach der kalten Türklinke griff, sank mir das Herz sofort in die Hose. Ich hatte die halbe Nacht nicht geschlafen, hatte mich nur hin und her gewälzt und versucht, nicht an die Verantwortung zu denken, die ich mir am Vortag aufgehalst hatte. Ein letztes Mal straffte ich meine Schultern, sprach mir selbst Mut zu, und dann öffnete ich die Tür.
Es war laut auf der Station. So laut, dass ich beinahe wieder zurückgestolpert wäre. Ich sah sofort, dass die Räumlichkeiten hier größer waren als unsere Palli zwei Stockwerke drüber. Neben dem kleinen Empfang auf der rechten Seite, hinter dessen Tresen niemand saß, konnte ich nur ein paar große Räume auf der linken Seite sehen, die sich in einem Halbkreis um den Empfang verloren. Von mindestens zwei Zimmern war das Läuten einer Alarmglocke zu hören, außerdem ertönte ein stetiges Piepen von EKGs. Wo ich auch hinsah, rannten Leute umher, in türkisen Kasacks oder weißen Arztkitteln. Obwohl »rannte« eigentlich der falsche Begriff war – sie gingen schnell, als hätten sie es eilig, aber niemand schien wirklich in Panik zu sein. Auf ihren Gesichtern lag Gelassenheit, während sie von Zimmer zu Zimmer hetzten. Als wären sie es gewohnt, was hier gerade los war. Als würden sie es gar nicht anders kennen.
Ein junger Typ, der offensichtlich von der Pflege war und gerade an mir vorbeilief, hob den Kopf und musterte mich neugierig. »Ich bin gleich bei Ihnen«, sagte er, bevor er in einem der Zimmer verschwand. Der Alarm erlosch sofort. Und ich stand nur da und atmete tief durch. Zumindest musste ich nicht lange nach jemandem suchen, mit dem ich sprechen konnte.
Es kam mir ein bisschen lächerlich vor, dass ich so nervös war. Schließlich war ich nicht das erste Mal neu auf einer Station. Und mit der Intensiv hatte ich während meiner Ausbildung schon einmal zu tun. Damals hatte ich alle paar Wochen ein neues Team und ein neues Fachgebiet kennengelernt, und es hatte mir nichts ausgemacht. Im Gegenteil, ich hatte es sogar spannend gefunden.
Aber jetzt war ich zwei Jahre auf der Palliativ gewesen und hatte das Gefühl, absolut nichts mehr zu wissen, was man auf anderen Stationen brauchte. Ich ratterte in meinen Gedanken alle Infos durch, die ich noch von meiner letzten Reanimationsfortbildung im Kopf hatte, und umklammerte die Tupperdose unter meinem Arm. Weil es schon früh mit dem Schlaf vorbei gewesen war, hatte ich mich dazu entschieden, Muffins zu backen. Als Einstand sozusagen. Meine Backkünste waren nicht die besten, jedenfalls würden die in der Dose eingequetschten Muffins keinen Schönheitswettbewerb gewinnen. Aber Tessa und ich hatten sie probiert und als verschenkungswürdig eingestuft. Hoffentlich waren hier alle kurzsichtig – auch wenn es mir für die Patienten leidtäte.
Die Tür des Patientenzimmers ging wieder auf, und ich richtete schnell meine Haare. Auch wenn ich keine Ahnung hatte, warum ich das tat. Vielleicht ein neuer nervöser Spleen von mir, der sich zu den tausend anderen addierte.
Der Typ kam zurück auf den Flur und lächelte mich erneut freundlich an. Er hatte ein Grübchen auf der linken Wange und verwuschelte braune Haare. Er wirkte so lieb, dass ich mich direkt etwas beruhigte. »Entschuldigung. Sind Sie Besuch?«
Ich blickte an mir herunter und verstand, warum er das fragte. Ich hatte erst überlegt, ob ich meine Krankenhausklamotten anziehen sollte, aber weil ich heute frei hatte, wäre es mir irgendwie seltsam vorgekommen, mich noch umzuziehen, daher trug ich meinen dunkelgrünen Jumper und einen schwarzen Pulli. »Nein«, antwortete ich. »Ich bin Maya, von der Palliativstation oben. Ich soll ab morgen für vier Wochen bei euch arbeiten und dafür heute meine Schlüssel abholen.« Nervös grinsend hob ich ihm die Tupperdose entgegen. »Ich hab Muffins dabei.«
Er strahlte erst die Dose an, dann mich. »Oh, wir bekommen Verstärkung? Davon wusste ich noch gar nichts.« Er nahm die Muffins und sah aus, als würde er sich wirklich darüber freuen. »Damit hast du auf jeden Fall schon mal einen Stein im Brett. Allerdings habe ich keine Ahnung von den Schlüsseln, dafür solltest du wahrscheinlich Ella fragen. Die ist gerade kurz von Station, aber ich bin sicher, dass sie gleich zurück ist. Am besten, du wartest einfach im Schwesternzimmer.«
Sein Lächeln verschwand, als hinter ihm erneut die Alarmglocke losging. »Sorry, heute ist irgendwie der Wurm drin. Es ist nicht immer so bei uns, das schwöre ich. Schon sehr häufig, aber nicht immer.« Er stellte die Muffins auf einem Stuhl hinter sich ab. »Ich muss los, aber danke für die Muffins und bis morgen!« Er winkte mir, vollführte eine halbe Drehung in Richtung Zimmer und schaute sich dann doch noch mal um. »Ich bin übrigens Noah!«
Dann war er verschwunden.
Ich stieß die Luft aus, die ich unwillkürlich bei seinen schnellen Worten angehalten hatte. Da hatte ja jemand Feuer unter dem Hintern.
Das Schwesternzimmer fand ich schnell. Es lag direkt hinter dem Tresen und beinhaltete vor allem einen großen Tisch, auf dem alle möglichen Süßigkeiten und Snacks verstreut lagen – von Marshmallows bis hin zu Keksen, Salzstangen und Schokolade. Ein wenig erinnerte mich der Anblick an einen Kindergeburtstag, und irgendwie war mir das sympathisch.
Ich lehnte mich in den Türrahmen, um den Gang im Blick zu haben, damit ich hoffentlich merkte, wenn die mysteriöse Ella, die Noah erwähnt hatte, zurück auf Station kam. Es war ein seltsames Gefühl, weil man von hier einen ungewohnt guten Einblick in die Patientenzimmer hatte. Ich verstand, dass man die intensivpflichtigen Patienten von draußen immer im Blick haben musste. Aber es kam mir trotzdem komisch vor, dass ich so gut durch die Glasscheiben sehen konnte. Die Patienten dahinter waren fast alle an Tausende Infusionen, Beatmungsschläuche und andere Geräte angehängt. Die meisten dieser Utensilien hatte ich das letzte Mal in meiner Ausbildung gesehen, und ich bekam eine Gänsehaut. Ganz kurz hatte ich das Bild von jemandem vor Augen, der ebenfalls an tausend Schläuche angeschlossen gewesen war, und ich erschauderte. An dieses Bild hatte ich so lange nicht mehr gedacht …
In diesem Moment gingen die automatischen Eingangstüren der Intensivstation auf, und sofort wurde es noch eine ganze Spur lauter auf dem Gang. Ich reckte den Hals und sah einen Arzt und zwei Pflegerinnen mit einem Patientenbett reinkommen. Der Arzt rief etwas von Zimmer eins, seine Stimme klang ruhig, aber eindringlich.
Die Schwester, die an seiner Seite stand, antwortete, und weil sie dem Schwesternzimmer näher kamen, konnte ich ihre ruhige Stimme verstehen: »Wir machen sie direkt an die Beatmung und schicken Blutkulturen raus. Viertelstündig Blutdruck?«
Der Arzt lächelte sie an. »Danke, Ella, das wäre perfekt.«
Ohne auf mich zu achten, schoben die drei das Patientenbett an mir vorbei. Darin lag eine junge Frau, eine Sauerstoffmaske auf dem Gesicht. Ihre Augen waren groß und voller Angst, und ich konnte sehen, wie aufgeregt sie atmete. Sie murmelte etwas vor sich hin, das man durch die Maske schwer verstehen konnte, aber es klang wie »Bär«, immer wieder und wieder. Sie verschwanden im hintersten Zimmer, und als ich den Kopf wieder in Richtung Eingang drehte, konnte ich dort einen Plüschbären liegen sehen. Wahrscheinlich war er vom Bett gefallen. Ich ging zu ihm rüber und hob ihn vom Boden auf. Es war offensichtlich, dass er schon sehr lange im Besitz und sehr geliebt war, denn eins seiner Knopfaugen fehlte, und das Fell war abgegriffen und verfärbt. Erst wollte ich ihn einfach auf den Tresen legen und wieder im Schwesternzimmer warten. Dann aber kamen mir wieder die großen Augen der Patientin in den Sinn, die Angst in ihrem Blick, und ich drückte den Bären an meine Brust. Ohne weiter darüber nachzudenken, eilte ich den Flur entlang und stellte mich in die offene Zimmertür, durch die die anderen verschwunden waren. Die Pflegerinnen waren gerade dabei, die Sauerstoffmaske an die Wand zu schließen und die Patientin zu beruhigen, während der Arzt ihr seelenruhig Blut abnahm. Ich griff den Bären etwas fester, als die Patientin zu wimmern begann und versuchte, ihre Arme zu befreien.
»Sie müssen sich beruhigen, Frau Toll.« Die blonde Pflegerin, die der Arzt Ella genannt hatte, legte eine Hand auf den Arm der Patientin. Ihr Gesicht wirkte etwas angestrengt, so sehr kämpfte sie gegen die Kraft der Patientin an. Und doch konnte man sehen, wie sie trotzdem versuchte, behutsam mit ihr umzugehen. »Sonst tun Sie sich noch weh.«
Das schien die junge Frau wenig zu interessieren. Mit jeder Sekunde wurde sie unruhiger, begann, um sich zu schlagen und nach der Sauerstoffmaske zu greifen. Ich sah, wie blutunterlaufen ihre Augen waren. Und wie zerstochen ihre Arme. Erst jetzt wurde mir klar, dass ich eine Patientin mit eindeutigen Entzugserscheinungen vor mir hatte.
Die andere Schwester gab ein Keuchen von sich, als die Frau nach ihr schlug und zu brüllen begann. Mein Körper setzte sich von ganz allein in Bewegung. Als ich mich ans Fußende stellte, wo ich hoffentlich niemandem im Weg war, und den Bären hob, riss die Patientin die Augen auf. »Ich habe Ihren Plüschbären gefunden«, sagte ich mit klarer Stimme, obwohl meine Finger etwas zitterten. »Ich war mir sicher, dass Sie ihn bei sich haben wollen. Er sieht aus, als würde er sehr geliebt werden.«
Die Patientin hielt still, wenn auch nur einen Moment. Aber er reichte, damit der Arzt mit der Blutabnahme fertig werden und Ella ein Beruhigungsmittel über den Zugang verabreichen konnte. Die Frau murmelte etwas Unverständliches und streckte die Hand nach mir aus. Ich gab ihr den Bären, und Ella warf mir einen kurzen Blick zu. Kühl. Abschätzend. Schwer einschätzbar. Ich beeilte mich, zurückzutreten und wieder auf dem Flur zu verschwinden. Mein Herz legte einen Marathon hin, weil ich schon lange nicht mehr Zeugin einer solchen Szene geworden war. Hatte ich eine Grenze überschritten? War es unangebracht gewesen, einfach mit zur Patientin zu gehen?
Ich schlang die Arme um meinen Körper und wartete darauf, dass Ella aus dem Zimmer kam.
Es dauerte etwas, doch dann gingen erst der Arzt und die andere Pflegerin an mir vorbei, dann verließ auch Ella den Raum. Trotz dem, was gerade passiert war, strahlte sie eine unheimliche Ruhe aus, ihr Gesicht wirkte beinahe entspannt, obwohl ihre Augen fast schon kalt wie Eis waren. Sie sah mich an, mehrere Sekunden lang, bevor sie eine Hand in die Tasche ihres türkisen Kasacks steckte. »Kann ich Ihnen helfen?«
Das mit dem guten ersten Eindruck hatte offensichtlich nicht geklappt. War sie sauer, weil ich einfach in die Patientensituation geplatzt war?
»Äh, ja, hoffentlich. Noah hat mich zu dir geschickt.« Ich spürte, wie mein Lächeln breiter wurde, und hasste mich ein wenig dafür. Wer zum Teufel lächelte denn, wenn er nervös war? »Ich bin Maya. Meine Stationsleitung hat mich vielleicht angekündigt … Ich fange morgen für vier Wochen hier auf der Intensiv an.«
Ihre Augen wurden sofort weniger eisig. »Ich verstehe.« Ella hatte ein schönes Gesicht, beinahe schon wie eine Porzellanpuppe. Große blaugrüne Augen, die irgendwie an einen arktischen Ozean erinnerten. Eine kleine Stupsnase. Volle Lippen. Sie strich sich eine verirrte blonde Strähne hinters Ohr. »Freut mich, Maya«, sagte sie mit ruhiger Stimme. »Ich bin Ella, die stellvertretende Stationsleitung. Dann kommst du sicher, um deine Schlüssel zu holen.«
Ich war ein wenig irritiert davon, dass sie nicht lächelte, und um ihren Mund war jetzt wieder eine leichte Anspannung zu sehen. Vermutlich, weil sie mit den Gedanken bei ihren Patienten war. Natürlich war sie das, hier war schließlich die Intensivstation. Während unseres Gesprächs herrschte immer noch reges Treiben hinter mir, und in diesem Moment wurde es mir wieder deutlich bewusst. Plötzlich hatte ich das Gefühl, zu stören. »Es tut mir leid«, platzte ich deshalb heraus und steckte unsicher die Hände in die Taschen meines Jumpers. »Ich wollte mich da eben nicht einmischen. Ich dachte nur, ich kann irgendwie helfen, aber das war wahrscheinlich übergriffig.«
Ella blickte mich mit ihrem abschätzenden Blick eine viel zu lange Zeit an. Dann zuckte sie mit den Schultern, und ich hatte das Gefühl, dass ihr Blick etwas weicher wurde. »Es hat geholfen. Das ist das, was wichtig ist.« Ihr Ton war noch etwas distanziert, aber ihre Worte waren ehrlich. Das konnte ich hören. Obwohl ich eigentlich sehr gut darin war, Leute einzuschätzen, gelang mir das bei Ella nicht sofort. Es war ein wenig irritierend. »Komm.« Sie deutete mir mit einer Bewegung an, ihr zu folgen.
Ich trottete ihr über den Gang in Richtung Schwesternzimmer nach und versuchte, ein Gespräch in Gang zu bringen, um mich selbst ein bisschen zu beruhigen. »Sah ja stressig aus eben. Ist bestimmt nicht einfach, mit solchen Situationen umzugehen, wenn man noch dazu unterbesetzt ist, was?«
Ella zuckte mit den Schultern. »Es könnte besser sein.«
Okay, Small Talk war offensichtlich nicht ihr Ding. Gut. Oder auch nicht.
»Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen unterstützen kann«, sagte ich zu ihrem Rücken.
Ella verschwand hinter dem Infotresen. »Das hoffe ich auch.« Sie kramte in einer Schublade, und ich spürte, wie mein Herz wieder etwas sank. Nach der netten Begrüßung durch Noah hatte ich irgendwie gehofft, dass es mir hier leicht gemacht werden würde. Aber wenn der Rest eher wie Ella war, würden das lange vier Wochen werden.
Doch vielleicht tat ich ihr auch unrecht. Vielleicht war sie einfach im Stress, auch wenn sie äußerlich ruhig wirkte. Hinter mir piepten direkt mehrere Maschinen, um die sie sich wahrscheinlich lieber kümmern würde als um mich.
Als sie den Kopf wieder hob, sah ich sie deshalb mit diesem Lächeln an, das Sami immer als »absolut unverwüstlich« bezeichnete. »Ich verspreche, ich gebe mein Bestes.«
Ella schien kurz in ihrer Bewegung zu stoppen, als hätten meine Worte sie aus dem Konzept gebracht, dann nickte sie langsam und reichte mir einen Bund Schlüssel über die Theke. »Die hier hat unsere Leitung für dich hinterlegt.« Sie deutete auf die drei Schlüssel, um sie mir zu erklären. »Der große ist für alle Türen hier. Der mittlere ist für den Medikamentenschrank, der kleinste für den Spind, den du nutzen kannst, solange du hier bist.«
»Danke«, gab ich zurück und schloss meine Hand vielleicht etwas zu fest um den Schlüsselbund. Er drückte mir unangenehm in die Haut, aber irgendwie konnte ich nicht mehr von dieser Anspannung lassen. Hinter mir klingelte wieder ein Alarm, irgendjemand röchelte und hustete laut, jemand anders rief irgendetwas, und in meinem Nacken war die Gänsehaut zurück. Jetzt starrte mich auch noch Ella von der anderen Seite der Theke abwartend und eine Spur zu intensiv an. Ihr Gesicht wirkte beinahe emotionslos, aber in ihren Augen schien etwas Neugier erwacht zu sein. Sie blickte kurz zu dem Zimmer, in dem der Alarm losgeschrillt war und in das gerade eine Kollegin von ihr eilte, dann sah sie wieder zu mir. »Intensiverfahrung?«
»Drei Wochen in meiner Ausbildung«, gab ich knapp zurück. Das nervöse Lächeln war wieder da, wenn auch wahrscheinlich so schief wie eine EKG-Linie.
»Und die ist wie lange her?«
Oje. »Zwei Jahre. Seitdem war ich nur auf der Erwachsenenpalliativ.«
»Mhm.« Sie verschränkte die Arme vor der Brust, ihr Blick immer noch so merkwürdig intensiv. »Das ist eine ganz schöne Umstellung, was?« Ihre Stimme war etwas sanfter geworden.
Die ganzen Laute, das Piepen und Rufen des Teams um mich herum, schienen mich beinahe ein wenig zu verhöhnen, als ich steif nickte. »Aber ich bin anpassungsfähig und sehr lernwillig. Ich bekomme das hin.« Wow, das hatte jetzt nach weit mehr Überzeugung geklungen, als ich wirklich verspürte.
Ella schien das wohl auch gemerkt zu haben, denn sie hob eine ihrer Augenbrauen. »Na, dann ist ja alles klar.« Jetzt war ich sicher, dass wirklich so etwas wie Amüsement in ihrem Blick zu sehen war. »Aber nur zur Sicherheit wird dir morgen erst einmal jemand zugeteilt, der über dich wacht und jeden deiner Schritte begleitet.«
Tja, sonderlich viel Vertrauen hatte ich in ihr offensichtlich nicht erweckt. Ich wünschte mir nichts sehnlicher, als dass ich endlich dieses dämliche nervöse Grinsen aus meinem Gesicht wischen könnte, aber wie immer in solchen Situationen wollte mir das absolut nicht gelingen. »Ja, klingt gut«, sagte ich. Und weil ich unter ihrem strengen Blick einfach keine Ahnung hatte, was ich noch sagen sollte, fügte ich an: »Ich habe Muffins mitgebracht.«
Ellas zweite Augenbraue wanderte nach oben. Ganz langsam blickte sie an mir hinab, und ich merkte erst in diesem Moment, dass sich die Tupperdose ja gar nicht mehr in meiner Hand befand. Jetzt hielt sie mich wahrscheinlich für nicht zurechnungsfähig.
»Äh, ich habe sie Noah gegeben. Und er hat sie …« Ich drehte mich etwas fahrig um die eigene Achse. »... irgendwo in den Flur auf einen Stuhl gestellt. Keine Ahnung. Er weiß es bestimmt noch.« Jetzt kam ich auch noch ins Stottern. Na super. »Sorry. Ich bin normalerweise nicht so durch den Wind.«
Als ich mich wieder zu ihr umdrehte, stand Ella noch genau so da – mit verschränkten Armen und erhobenen Augenbrauen. Ihr Blick war etwas milder. »Schon gut. Der Gedanke zählt«, wischte sie meine Bemerkung einfach fort. »Ich muss leider zu meinen Patienten zurück, deshalb kann ich dir keine Stationsführung geben. Hast du noch irgendwelche Fragen?«
Ja, allerdings: Gibt es hier bereits ein Loch, in dem ich versinken kann, oder muss ich mir selbst eins buddeln? Dann würde ich jetzt direkt damit anfangen, danke.
»Nein, keine Fragen mehr. Danke. Sorry.« Ich presste die Lippen zusammen, damit nicht noch mehr Worte den Weg nach draußen fanden.
Ella zog ihre Augenbrauen tatsächlich noch einen Millimeter höher, auch wenn ich das gar nicht für möglich gehalten hätte. Aber ihre Mundwinkel machten zum Glück ein kleines Stückchen mit. Wenn es auch eher belustigt aussah. »Na dann – bis morgen früh um sechs Uhr, Maya.«
»Ja, bis dann.« Bevor ich meine freche Hand davon abhalten konnte, war sie auch schon in der Höhe und winkte Ella zu wie ein kleines Schulmädchen. Beinahe zeitgleich spürte ich Hitze in meinen Kopf schießen, die man hoffentlich von außen nicht zu sehr sah.
Als Ella sich abwandte, machte sie ein leises, schnaubendes Geräusch. Es klang nach einem unterdrückten Lachen, aber ganz sicher war ich mir da nicht. Ich sah ihr noch nach, bis sie mit eiligem, aber nicht gehetzt wirkendem Schritt wieder in dem Patientenzimmer am Ende des Flures verschwunden war.
Mit einem lauten Stöhnen ließ ich den Kopf auf den Tresen sinken. Ich war nie besonders gut in ersten Eindrücken gewesen, aber der hier hatte dem noch mal die Krone aufgesetzt. Hoffentlich konnte ich das am nächsten Tag wieder einigermaßen gutmachen.
Ich trottete den Flur zurück und fand meine einsame Muffin-Tupperdose tatsächlich auf einem der Stühle stehen. Noah schien noch im Zimmer dahinter beschäftigt zu sein, also nahm ich das Gebackene, machte noch einmal kehrt und stellte es im Schwesternzimmer auf den Tisch zu den anderen Sachen.
Ich blickte mich in dem Raum etwas genauer um und sah eine bunte Glückwunschkarte herumliegen. Offenbar war tatsächlich ein Geburtstag gefeiert worden. Irgendwie gab mir das für meinen Aufenthalt in den nächsten vier Wochen ein wenig Hoffnung auf das Team. Es konnte ja eigentlich nur besser werden als auf der Palliativstation.
Kaum dass ich die Intensiv verlassen hatte, atmete ich so tief ein wie schon lange nicht mehr. Das eben hatte sich aus irgendeinem Grund sehr unangenehm angefühlt, und irgendwie hatte ich den Eindruck, dass ich daran selbst schuld war. Ich und meine ständigen Erwartungen.
Während ich auf den Fahrstuhl wartete, zog ich mein Handy aus der Tasche. Wieder drei Nachrichten von Britta, die ich für den Moment ignorierte, und eine von Tessa. Schreib mir dann, wie es lief,

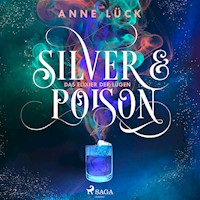
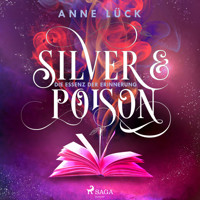
![Jewel & Blade. Die Wächter von Knightsbridge [Band 1 (ungekürzt)] - Anne Lück - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/ce22490997b3e6e0e807c8b632e07b21/w200_u90.jpg)




![Jewel & Blade. Die Hüter von Camelot [Band 2 (ungekürzt)] - Anne Lück - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/c7d0b6bb9c33b9a1b2b09f490d3cfe2a/w200_u90.jpg)