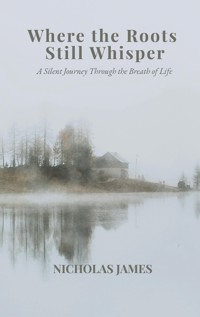Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Tagebuch von Lord Wyndhorm entführt Sie in das England des 19. Jahrhunderts, eine Zeit des Wandels, geprägt von Herausforderungen und getragen von leiser Hoffnung. Francis Wyndhorm, ein traditionsbewusster Landadeliger, hält in seinen Aufzeichnungen jene Momente fest, die ihn prägten. Es sind Begegnungen, die nachwirken, Gedanken über den Fortschritt und die stille Suche nach einem Platz in einer Welt, die sich verändert. Ein literarischer Rückzugsort voller Menschlichkeit, Tiefe und leiser Schönheit für Leserinnen und Leser, die das Wesentliche nicht im Lärm, sondern im Innehalten erkennen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
VORWORT
4. OKTOBER 1856
7. OKTOBER 1856
8. OKTOBER 1856
10. OKTOBER 1856
12. OKTOBER 1856
14. OKTOBER 1856
16. OKTOBER 1856
22. OKTOBER 1856
24. Oktober 1856
28. OKTOBER 1856
3. NOVEMBER 1856
6. NOVEMBER 1856
8. November 1856
11. NOVEMBER 1856
16. November 1856
18. NOVEMBER 1856
19. NOVEMBER 1856
20. NOVEMBER 1856
25. November 1856
30. NOVEMBER 1856
2. DEZEMBER 1856
7. DEZEMBER 1856
15. DEZEMBER 1856
18. DEZEMBER 1856
19. Dezember 1856
20. DEZEMBER 1856
21. Dezember 1856
24. Dezember 1856
25. Dezember 1856
28. Dezember 1856
29. DEZEMBER 1856
1. Januar 1857
5. Januar 1857
6. Januar 1857
10. Januar 1857
12. Januar 1857
14. Januar 1857
15. Januar 1857
16. Januar 1857
17. Januar 1857
18. Januar 1857
19. Januar 1857
20. Januar 1857
21. Januar 1857
22. Januar 1857
23. Januar 1857
24. Januar 1857
28. Januar 1857
29. Januar 1857
21. Februar 1857
24. März 1857
4. April 1857
11. April 1857
30. April 1857
20. Mai 1857
26. MAI 1857
VORWORT
Es mag seltsam erscheinen, dass ein Mann meines Standes – ein Erbe alter Traditionen und Pflichten – ein Tagebuch führt. Doch Worte haben eine Macht, die das Schwert nicht besitzt. Sie bewahren Gedanken, Gefühle und Momente, die sonst im Strom der Zeit verloren gingen. Dieses Tagebuch ist kein Werk für die Nachwelt oder die Geschichtsschreibung, sondern eine Sammlung von Eindrücken, die ich für mich selbst festhalten möchte.
Ich bin Francis Wyndhorm, und ich schreibe diese Zeilen nicht, um die großen Ereignisse meines Lebens zu schildern, sondern um die leisen Momente zu bewahren, die uns zu dem formen, was wir sind. In diesen Seiten finden sich keine Heldentaten, sondern Gedanken eines Mannes, der die Welt durch die Brille der Stille und Reflexion betrachtet.
Mein Zuhause, ein altes Herrenhaus an der Ouse, ist nicht nur ein Ort, sondern ein Zufluchtsort. Hier, umgeben von der Weite der Natur, pflegen meine Frau Elenore und ich ein Leben, das vom Gleichgewicht zwischen Pflicht und innerer Einkehr geprägt ist. Elenore, die Seele dieses Hauses und meines Lebens, erinnert mich immer wieder daran, dass ein Mensch nicht allein in seinen Gedanken verweilen sollte. Es war ihre sanfte Überzeugung, die mich dazu brachte, die Feder in die Hand zu nehmen und diesem Tagebuch Leben einzuhauchen.
Warum heute? Heute, an Elenores Geburtstag, fühle ich die Vergänglichkeit der Zeit und die Kraft der kleinen Freuden, die das Leben ausmachen. Vielleicht schreibe ich, um diese Momente zu begreifen. Vielleicht schreibe ich, weil ich nicht anders kann.
Dies ist kein Buch der großen Worte, sondern der stillen Gedanken. Sie sind für mich wie ein Spiegel, der die leisen Nuancen meines Lebens einfängt, um sie nicht im Fluss der Zeit verblassen zu lassen.
Francis Wyndhorm
4. OKTOBER 1856
Heute ist ein Tag, den ich nicht übersehen könnte, selbst wenn ich es wollte – Elenores Geburtstag. Das Haus trägt eine gewisse Lebhaftigkeit, etwas Warmes, das selbst der kühle Herbstmorgen nicht ersticken kann. Unsere Vorbereitungen begannen bereits gestern: Elenore bestand darauf, den Kuchen selbst zu backen, obwohl es doch eigentlich ihr Ehrentag ist. Ein Apfelkuchen, wie nur sie ihn machen kann, wartet nun in der Küche darauf, serviert zu werden.
Am Nachmittag haben wir im Salon eine kleine Gesellschaft empfangen. Es war eine überschaubare Runde, bestehend aus engen Freunden und Nachbarn – Elenore mag es nicht, wenn es zu aufwendig wird. Ich habe dafür gesorgt, dass der Raum mit Blumen geschmückt wurde, die dem Herbst Ehre machen: Dahlien und letzte Rosen, deren Farben noch immer den Sommer in sich tragen.
Es war angenehm, die vertrauten Stimmen und das Lachen der Gäste zu hören, während der Duft von Tee und Gebäck den Raum erfüllte. Elenore schien in ihrem Element, wie sie mit ihrer sanften, herzlichen Art jeden willkommen hieß und dafür sorgte, dass sich niemand übersehen fühlte. Es ist eine dieser Eigenschaften, die ich an ihr so bewundere – eine Fähigkeit, Menschen zu erreichen, ohne sich aufzudrängen.
Am Abend, nachdem die Gäste gegangen waren und das Haus wieder zur Ruhe kam, saßen wir zu zweit in der Bibliothek. Ich schenkte ihr eine kleine Brosche in Form eines Herbstblattes, das in seiner goldenen Farbe an die Wälder erinnert, die uns hier umgeben. Sie nahm sie mit einem Lächeln entgegen, das mehr sagte als jedes Wort.
Während ich nun schreibe, ist sie in der Küche und summt leise vor sich hin. Ich blicke auf diesen Tag zurück und empfinde eine tiefe Dankbarkeit. Nicht nur für Elenore, sondern für all das, was uns umgibt: das Haus, die Natur, die Stille, die uns gehört.
Das Leben ist ein Mosaik aus kleinen Momenten, und heute war ein Bild, das ich nicht vergessen werde.
7. OKTOBER 1856
Heute fühlte ich mich gezwungen, dem Haus zu entfliehen, wenn auch nur für eine Stunde. Der Herbst hat die Bäume in ein prachtvolles Kleid aus Gold und Rot gehüllt, und ich konnte nicht widerstehen, einen Spaziergang zu machen. Der Weg führte mich durch den alten Ahornhain, wo die Blätter in der Mittagssonne ein warmes Licht ausstrahlten.
Es ist seltsam, wie der Herbst gleichzeitig so lebendig und doch so vergänglich sein kann. Mit jedem Schritt raschelt das Laub unter meinen Füßen, und doch ist es still – eine Stille, die nur diese Jahreszeit mit sich bringt. Es fühlt sich an, als würde die Natur für einen Moment innehalten und zuhören. Die Ouse, die ich bald erreichte, floss ruhig dahin, und ich verweilte dort eine Weile. Das Wasser trug die Blätter mit sich, und ich fragte mich, wie weit sie wohl reisen würden. Vielleicht treiben sie bis zur Mündung der Ouse, vielleicht nur bis zur nächsten Stromschnelle. Eine merkwürdige Parallele zu unserem eigenen Leben – wir wissen selten, wohin uns die Strömung trägt.
Ich begegnete niemandem, außer einer kleinen Gruppe Rehe, die mich aus sicherer Entfernung beobachteten. Es gibt etwas im Blick dieser Tiere, das mich immer wieder demütig stimmt. Sie wirken wachsam, und doch völlig im Einklang mit ihrer Umgebung – etwas, das wir Menschen längst verloren haben.
Elenore hatte mich zuvor ermahnt, mich warm anzuziehen, und wie recht sie damit behielt. Der Wind war frischer, als ich erwartet hatte. Ich konnte mir ein Lächeln nicht verkneifen, als ich daran dachte, wie sie mich mit ihrer leisen, aber bestimmten Art überredete.
Nun, da ich zurück bin und diese Zeilen schreibe, frage ich mich, wie oft wir die einfachen Freuden des Lebens übersehen. Ein Spaziergang, ein ruhiger Moment am Fluss – sie erscheinen unbedeutend, doch vielleicht sind sie genau das, was uns am meisten fehlt.
8. OKTOBER 1856
Heute war ein Tag der Pflichten. Der Morgen begann früh, mit einem Treffen in der Halle, bei dem ich mit Mr. Larchmont, unserem Verwalter, die anstehenden Arbeiten besprach. Der Herbst bringt nicht nur Farbe in die Wälder, sondern auch eine lange Liste von Aufgaben. Die Ernte der letzten Äpfel steht bevor, ebenso wie die Vorbereitungen für den Winter. Es scheint, als wäre die Arbeit auf einem Anwesen niemals vollständig erledigt.
Mr. Larchmont berichtete, dass einige der Zäune entlang des südlichen Waldes beschädigt seien. Ich erinnere mich, dass dort vor einigen Wochen ein Sturm durchgezogen ist. Es wird Zeit, die Arbeiter dorthin zu schicken, bevor wir den ersten Frost sehen. Elenore hat bereits vorgeschlagen, einige der Männer mit warmen Gebäck zu versorgen – eine ihrer kleinen Gesten, die oft mehr bewirken, als sie selbst ahnt.
Nach unserem Treffen zog ich mich in mein Arbeitszimmer zurück, um die Papiere durchzugehen. Unter anderem waren es Abrechnungen von den Pächtern, Korrespondenz mit einem Händler in York und eine Anfrage aus dem Dorf, ob wir Holz für den bevorstehenden Winter bereitstellen könnten. Ich habe lange überlegt, doch schließlich zugestimmt. Es ist eine Kleinigkeit, die für viele einen großen Unterschied macht.
Am Nachmittag besichtigte ich den Garten. Elenore und Mary, unsere Gärtnerin, waren dabei, die Beete für den Winter vorzubereiten. Der Garten ist ein Ort, der mich immer wieder zur Ruhe bringt, selbst an Tagen wie diesen, die mit Pflichten beladen sind. Elenore sah mich kommen und winkte mir zu. Sie wusste, dass ich kurz innehalten musste, bevor ich mich wieder an die Arbeit machte.
Der Tag endete, wie er begann – mit Gedanken an alles, was noch zu tun bleibt. Und doch fühle ich mich zufrieden. Ein Anwesen wie dieses ist mehr als nur ein Stück Land. Es ist eine eigene kleine Welt, und es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie gut erhalten bleibt.
10. OKTOBER 1856
Heute hatte ich ein längeres Gespräch mit Mr. Larchmont über die Holzlieferung ins Dorf. Die Nachfrage ist wie jedes Jahr groß, doch es mangelt uns nicht an Vorräten. Unser Wald liefert genug, um sowohl unser Anwesen als auch die umliegenden Haushalte zu versorgen.
Mr. Larchmont hatte, wie immer, die Listen der Haushalte vorbereitet, die dieses Jahr auf unsere Unterstützung angewiesen sind. Während er die Namen vorlas, fiel mir auf, wie sehr einige Familien vom vergangenen Winter gezeichnet waren. Besonders die Witwe Ainsley und ihre drei Kinder wurden erwähnt. Ich nickte ihm zu, als er vorschlug, diesen Familien etwas mehr Holz zukommen zu lassen.
Elenore, die kurz hereinkam, hörte das Ende unseres Gesprächs. „Vielleicht könnten wir zusätzlich für diese Familien einige Decken oder Lebensmittel bereitstellen,“ schlug sie vor. Ich sah, wie Mr. Larchmont diesen Vorschlag zustimmend notierte. Ihre Fürsorge ist immer wieder eine Inspiration – sie denkt an Dinge, die ich manchmal übersehe.
Am Nachmittag inspizierten wir gemeinsam die Holzstapel im südlichen Lager. Es war beruhigend zu sehen, dass alles gut vorbereitet ist. Der Geruch von frischem Holz und die leuchtenden Farben des Herbstes erinnerten mich daran, wie sehr ich die Jahreszeit schätze. Der Wind trug einen Hauch von Kälte mit sich und überbrachte die Botschaft des nahenden Winters.
Ich bin dankbar, dass wir in der Lage sind, den Menschen hier zu helfen. Es ist eine Verantwortung, die ich nicht auf die leichte Schulter nehme. Dieses Land, dieses Dorf – es gehört ebenso zu mir wie das Herrenhaus selbst.
12. OKTOBER 1856
Heute früh habe ich ein Rotkehlchen im Garten beobachtet. Es hüpfte zwischen den Blättern, als suche es noch die letzten Überbleibsel des Sommers. Ich frage mich, wie es den kommenden Winter übersteht – eine Frage, die ich auch mir manchmal stelle.
14. OKTOBER 1856
Der Morgen war ungewöhnlich still. Selbst der Wind schien innezuhalten, als ob er auf etwas wartete.
16. OKTOBER 1856
Heute musste ich ins Dorf, um mit Mr. Thorburn, dem Schmied, ein paar Dinge zu klären. Der Weg dorthin war ruhig, die Straßen übersät mit Laub, das der Wind von den Bäumen geweht hatte. Als ich ankam, war er gerade dabei, ein Hufeisen zu schmieden, und der Klang seines Hammers war überall zu hören.
Er erzählte mir, dass die Lieferung von Kohle und Eisen, die ich letzten Monat arrangiert hatte, rechtzeitig angekommen sei. „Damit kann ich den Winter gut überstehen, Milord,“ sagte er. „Die Kälte bringt mehr Arbeit – kaputte Wagenräder, Hufeisen, alles Mögliche.“ Es war gut zu hören, dass alles planmäßig lief.
Auf dem Rückweg begegnete ich Mrs. Ainsley, die Witwe, mit einem Korb Gemüse aus ihrem Garten. Sie hielt kurz an, um mit mir zu reden. „Milord,“ sagte sie, „das Holz, das Sie geschickt haben, wird uns gut durch den Winter bringen. Ich wollte Ihnen dafür danken.“
Ich wusste nicht, was ich darauf sagen sollte. Solche Worte fühlen sich immer zu groß an für so eine einfache Tat. Also nickte ich nur und sagte: „Es freut mich, dass es Ihnen hilft.“ Sie lächelte und ging weiter. Während ich ihr nachsah, fragte ich mich, wie oft wir das übersehen: Diese kleinen Begegnungen, diese kurzen Momente, in denen Dankbarkeit so greifbar ist. Sie lebt ein schweres Leben, und doch ist sie so voller Anstand.
Manchmal braucht es nicht viel, um zu erkennen, wie sehr unser Leben von anderen abhängt.
22. OKTOBER 1856
Heute erreichte mich ein Brief aus Kanada, was selten genug vorkommt. Er war von einem alten Freund, Charles, den ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe. Der Umschlag war von der Reise gezeichnet – leicht zerknittert und mit dem Stempel der Post aus Québec versehen.
Charles schrieb über das Leben in der Kolonie, das so anders zu sein scheint als alles, was ich hier kenne. „Francis,“ schrieb er, „hier ist die Luft klar und kalt, und die Wälder scheinen endlos. Es ist ein Land voller Möglichkeiten, aber auch voller Gefahren. Manchmal sehne ich mich nach der Wärme eines englischen Kamins, nach dem Lachen alter Freunde.“
Ich konnte nicht anders, als zu lächeln. Charles war schon immer ein Mann der großen Worte, doch ich spürte auch die Ehrlichkeit dahinter. Sein Brief erinnerte mich daran, wie unterschiedlich unsere Leben verlaufen sind. Während ich hier in den vertrauten Mauern meines Hauses sitze, baut er sich in einem fremden Land eine neue Existenz auf.
Er fragte, ob ich mich noch an unsere gemeinsamen Tage in Oxford erinnere – lange Abende voller Diskussionen über Bücher, Politik und das Leben. Es ist seltsam, wie leicht solche Erinnerungen in Vergessenheit geraten, bis jemand sie wieder hervorholt.
Ich überlege, ihm bald zu antworten. Doch was soll ich schreiben? Dass die Wälder hier nicht endlos sind, dass die Luft oft neblig ist und ich mein Leben zwischen Büchern und den Pflichten des Hauses verbringe? Aber was könnte ich ihm erzählen, das er nicht schon kennt? Diese Welt hat er hinter sich gelassen – vielleicht sucht er in meinem Brief nur eine Erinnerung an das, was er zurückgelassen hat. Oder sollte ich ihm schreiben, dass ich manchmal davon träume, diese Mauern zu verlassen und die Welt zu sehen, die er beschreibt? Für heute lege ich den Brief beiseite. Vielleicht bringt die Nacht die richtigen Worte.
24. Oktober 1856
Heute hat der Regen den ganzen Tag nicht aufgehört. Die Tropfen prasselten auf die Fenster, und der Garten wirkte, als wäre er in einen grauen Schleier versunken. Elenore und ich verbrachten den Nachmittag am Kamin, mit einer Tasse Tee und einem Buch in der Hand. Es war einer dieser stillen Tage, die nichts verlangen – und gerade deshalb in Erinnerung bleiben.
28. OKTOBER 1856
Heute war einer dieser Tage, an denen die Zeit scheinbar stehen bleibt. Der Morgen begann mit einem Spaziergang über die Felder, wo ich Mr. Thorburn bei der Arbeit beobachtete. Er reparierte das große Gatter zum westlichen Weideland, das letzte Woche durch den Sturm beschädigt wurde. Die Männer arbeiteten schnell, und ich bewunderte ihre Effizienz.
Als ich zurückkehrte, fand ich Elenore im Garten, vertieft in die Pflege der letzten Rosen des Jahres. „Sie verdienen es, ein bisschen länger zu blühen,“ sagte sie und lächelte dabei.
Es ist seltsam, wie viel Ruhe solche Momente bringen können. Die Welt mag hektisch sein, doch hier, inmitten dieser kleinen Aufgaben, scheint sie sich auf das Wesentliche zu besinnen. Vielleicht ist es genau das, was ich an diesem Ort so schätze – die Möglichkeit, in den kleinen Dingen einen Sinn zu finden.
Am Montag werde ich nach York reisen, um einige Angelegenheiten zu regeln. Es ist lange her, dass ich die Stadt besucht habe, und ich bin gespannt, was mich erwartet.
3. NOVEMBER 1856
Es war noch früh, als ich das Herrenhaus verließ. Der Nebel lag dicht über den Feldern, und das einzige Geräusch, das die Stille durchbrach, war das entfernte Schlagen eines Hammers von der Schmiede. Elenore stand im Türrahmen, eine Hand an ihrem Schal, die andere zum Abschied gehoben. Ich erwiderte die Geste, bevor ich in die Kutsche stieg. Es war ein vertrauter Moment, doch eine gewisse Schwere lag auf dem Tag.
Die Fahrt nach York verlief wie erwartet – ruhig und eintönig. Die Felder, die Wälder, die kleinen Höfe – sie zogen langsam an mir vorbei, wie ein stilles Gemälde. Ich lehnte mich zurück und ließ meine Gedanken wandern. Es war Jahre her, seit ich das letzte Mal in der Stadt gewesen war. Was hatte sich verändert? Was war gleich geblieben?
Als wir die Stadtgrenzen erreichten, schlug mir der Geruch von Rauch und feuchtem Stein entgegen. Die Luft war schwer, und die Geräusche – Wagenräder, Rufe, das Kreischen von Maschinen – wirkten beinahe überwältigend. Es war ein Kontrast, wie er größer nicht hätte sein können, und ich musste einen Moment innehalten, um mich an diese Unruhe zu gewöhnen.
Mein erster Halt war bei Mr. Hemsley, einem Händler, den ich seit Jahren kenne. Sein Laden war, wie immer, bis oben hin mit Waren gefüllt. Wir sprachen kurz über die Lieferung – Werkzeuge, Nägel, kleinere Geräte für das Anwesen. Es war ein nüchternes Gespräch, geschäftlich und ohne Umschweife. Doch als ich ging, konnte ich nicht anders, als darüber nachzudenken, wie sehr auch er sich an diese neue Welt anpassen musste. Auf der Hauptstraße hielt ich dann an einem kleinen Stand. Ein Junge, vielleicht zwölf Jahre alt, bot Holzspielzeug an. Seine Hände waren rau, sein Blick fest, doch ich spürte, dass er sich um jeden Kunden bemühte. „Ich habe sie selbst geschnitzt,“ sagte er, als er mir ein kleines Pferd zeigte. Ich kaufte es, nicht aus Bedarf, sondern aus dem Gefühl heraus, dass es ihn ermutigen könnte. Sein Lächeln, als ich bezahlte, blieb mir lange im Gedächtnis.
Die Straßen waren voll von Menschen, doch ihre Gesichter erzählten Geschichten von Mühe und Müdigkeit. Arbeiter, die ihre Werkzeuge trugen, Frauen, die mit schweren Körben eilten, und Kinder, die irgendwo Schutz suchten. Es war keine Freude in ihren Bewegungen, nur das ständige Streben, den Tag zu überstehen. Ich suchte Zuflucht in einer Gaststube, die ich von früher kannte. Der Wirt erkannte mich und begrüßte mich herzlich. „Milord,“ sagte er mit einem breiten Lächeln, „lange nicht gesehen.“ Ich nickte und setzte mich in eine Ecke, wo der Lärm des Raumes gedämpfter war. Der Tee war heiß, der Raum warm, doch selbst hier spürte ich die Veränderungen der Stadt. „Die Fabriken bringen Arbeit,“ sagte der Wirt, als ich nach den letzten Jahren fragte, „aber sie nehmen auch etwas. Die Leute haben Arbeit, aber sie verlieren sich darin. Es ist nicht wie früher.“ Seine Worte ließen mich nachdenklich zurück.
Auf dem Platz vor der Gaststube sah ich eine Dampfmaschine, die zur Schau gestellt wurde. Sie war laut, mächtig und ein Versprechen auf eine neue Zeit. Der Mann, der sie präsentierte, sprach in großen Worten von Fortschritt und Zukunft. Die Menschen hörten zu, doch ihre Blicke waren eher gemischt – Bewunderung bei einigen, Unsicherheit bei den meisten.
Die Kutsche brachte mich zurück in die Stille der Felder. Der Himmel war klarer hier, die Luft leichter. Als ich das Herrenhaus erreichte, wartete Elenore bereits auf mich. „Wie war die Stadt?“ fragte sie. „Anders,“ sagte ich schließlich. Ich konnte ihr nicht mehr antworten, zumindest nicht in diesem Moment.
Während ich schreibe, denke ich an die Menschen, die ich heute gesehen habe. Ihr Leben, ihre Mühen, und die Frage, wie lange Orte wie unser Zuhause noch unberührt bleiben. Der Fortschritt ist unausweichlich, doch ich frage mich, ob er am Ende mehr nimmt, als er gibt.
6. NOVEMBER 1856
Es sind nun einige Tage vergangen, seit ich aus York zurückgekehrt bin. Dennoch tauchen die Bilder immer wieder auf. Die Straßen, der Rauch, die Gesichter – es ist, als ob die Stadt mir etwas sagen wollte, das ich nicht ganz greifen kann. Gestern, während ich durch den Garten ging, fiel mein Blick auf die letzten verbliebenen Rosen. Elenore hatte sie sorgfältig zurückgeschnitten, wie sie es immer tut, um ihnen einen würdigen Abschied zu geben. Ich dachte an die Stände auf dem Markt in York, an das unaufhörliche Hämmern der Maschinen und die müden Augen der Menschen. Es ist schwer, diese beiden Welten miteinander zu verbinden. Hier, auf dem Anwesen, scheint alles geordnet, beinahe zeitlos. Dort, in der Stadt, herrscht eine rastlose Energie, die keine Ruhe zulässt. Ich frage mich, ob das wirklich Fortschritt ist – oder nur ein anderer Name für Chaos.
Elenore bemerkte wohl meine stille Grübelei. „Du denkst noch immer an York, nicht wahr?“ fragte sie gestern Abend, als wir zusammen in der Bibliothek saßen. Sie reichte mir eine Tasse Tee, und ich konnte nur nicken. Es gibt Dinge, die sich nur schwer in Worte fassen lassen. Heute sprach ich mit Mr. Larchmont über die Pachtverträge. Ich erwäge, einen Teil der Einnahmen zu nutzen, um den Dorfbewohnern zusätzliche Unterstützung für den Winter zukommen zu lassen. Die Kinder in York, barfuß und in Lumpen, kommen mir nicht aus dem Kopf. Hier ist die Not nicht so sichtbar, aber das heißt nicht, dass sie nicht existiert. Der Winter steht vor der Tür, und die Kälte wird kommen – das ist gewiss. Doch ebenso gewiss ist, dass wir mit kleinen Gesten viel bewirken können. Vielleicht liegt darin die einzige Sicherheit, die wir wirklich haben: füreinander da zu sein, wenn es darauf ankommt
8. November 1856
Heute Morgen brachte Mr. Larchmont einen Stapel Briefe ins Arbeitszimmer, den die Postkutsche gestern Abend geliefert hatte. Während ich die Umschläge durchging, fiel mir ein besonders sorgfältig versiegelter auf. Die geschwungene Handschrift auf dem Pergament war unverkennbar: Lady Ravensbrook…
Ihre Briefe haben stets einen gewissen Charme, der irgendwo zwischen Herzlichkeit und einem Hauch von Selbstgefälligkeit liegt. Sie erinnerte mich daran, dass mein Geburtstag bald bevorsteht, und fragte in ihrem üblichen Stil, ob ich plane, „diesen Tag gebührend zu würdigen oder mich, wie üblich, in meinen Büchern zu vergraben.“ Sie schrieb weiter: „Solltest du Elenore erlauben, den Abend so ruhig wie den