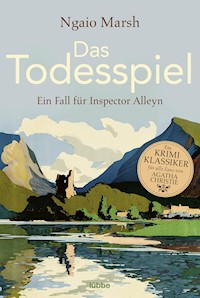
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Krimi
- Serie: Inspector-Alleyn-Reihe
- Sprache: Deutsch
Eine seltsam gemischte Gesellschaft trifft sich zu einem Wochenende auf einem Landsitz in England. Sir Hubert Handesley, der Gastgeber, ist bekannt für seine geistreichen Gesellschaftsspiele. Diesmal schlägt er das Todesspiel vor, bei dem einer der Beteiligten den Mörder, ein anderer den Ermordeten spielen muss. Doch aus dem Spiel wird bitterer Ernst ...
Ein Klassiker der Detektivliteratur in Neuübersetzung - Detective Inspector Roderick Alleyns erster Fall
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Über dieses Buch
Eine seltsam gemischte Gesellschaft trifft sich zu einem Wochenende auf einem Landsitz in England. Sir Hubert Handesley, der Gastgeber, ist bekannt für seine geistreichen Gesellschaftsspiele. Diesmal schlägt er das Todesspiel vor, bei dem einer der Beteiligten den Mörder, ein anderer den Ermordeten spielen muss. Doch aus dem Spiel wird bitterer Ernst …
Über die Autorin
Edith Ngaio Marsh DBE (* 23. April 1895 in Merivale, Christchurch; † 18. Februar 1982 in Christchurch, Neuseeland) war eine neuseeländische Schriftstellerin, Schauspielerin und Theaterregisseurin. Marsh gilt als eine der bedeutenderen Verfasserinnen der klassischen Detektivgeschichten. Zwischen 1934 und 1982 schrieb sie 32 Detektivromane. Serienheld ist Roderick Alleyn, wie der Prototyp vieler englischer Autoren von adeliger Abstammung, zugleich aber Inspektor bei Scotland Yard. Die Mystery Writers of America (MWA) nominierten Marsh zwei Mal für den Edgar Allan Poe Award. 1978 erhielt Marsh die höchste Auszeichnung der MWA, den Grand Master Award für ihre Leistung für die Kriminalliteratur. Marsh setzte sich über mehrere Jahrzehnte dafür ein, in Neuseeland eine feste Schauspielgruppe zu etablieren. Eines der ersten festen Theaterhäuser in Christchurch wurde nach ihr Dame Ngaio Marsh Theatre benannt. 1966 wurde Marsh »für ihre Leistungen auf dem Theatersektor« von Königin Elisabeth II. als Dame Commander of the Order of the British Empire geadelt.
Ngaio Marsh
Das
Todesspiel
Ein Fall für Inspector Alleyn
Kriminalroman
Aus dem Englischen vonHolger Hanowell
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Copyright © 1934 by Ngaio Marsh
Titel der englischen Originalausgabe: A Man Lay Dead
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Wolfgang Neuhaus, Oberhausen
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: North Wales for Holidays (colour litho), Mace, John (b.1889) / Private Collection / Photo © Christie’s Images / Bridgeman Images
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-7789-7
www.luebbe.de
www.lesejury.de
Für meinen Vater
und zur Erinnerung
an meine Mutter
VORWORT
Roderick Alleyn, CID
An einem regennassen Samstagnachmittag des Jahres 1931 erblickte Roderick Alleyn, seines Zeichens Detective Chief Inspector bei der Kriminalpolizei, in einer Souterrainwohnung unweit des Sloane Square in London das Licht der Welt.
Es goss den ganzen Tag. Das Wasser spritzte unter den Schuhen der Passanten nach allen Seiten davon, genau auf Augenhöhe draußen vor meinen regennassen Fenstern. Das Wasser wurde zu gischtenden Fontänen unter surrenden Autoreifen, rauschte in Kaskaden die Stufen zu meiner Wohnung hinunter – »unerbittlich« trifft es wohl am besten – und überflutete gurgelnd ganze Straßenabschnitte, begleitet vom beharrlichen Trommeln des Regens als ermüdender Begleitmusik. Bedenkt man jedoch, was sich daraus entwickelte, waren diese wenig erbaulichen äußeren Umstände fast zu schön, um wahr zu sein.
Ich las eine Detektivgeschichte, die ich mir aus einer kleinen Leihbücherei beschafft hatte, welche in einem Schreibwarenladen untergebracht war, nicht weit von meiner Wohnung entfernt. Es muss ein Roman von Agatha Christie oder Dorothy L. Sayers gewesen sein; ich weiß es nicht mehr. Gegen vier Uhr am Nachmittag, es wurde bereits dunkel, hatte ich das Buch durch. Draußen schüttete es noch immer wie aus Eimern. Ich weiß noch, dass ich in meinem altertümlichen Ofen Kohlen nachlegte, eine Zeit lang in die Glut starrte und mich fragte, ob ich das Zeug hätte, selbst eine solche Geschichte zu Papier zu bringen. Zu jener Zeit war in England das »Mörderspiel« auf Wochenendpartys sehr beliebt. Dabei wird einem der Gäste heimlich ein Kärtchen zugeschoben, wodurch er – oder sie – am Abend der Party zum »Mörder« wird. Der oder die Auserwählte muss dann eine Gelegenheit abwarten, um sich ein Opfer auszugucken. Nach begangener Tat wird für gewöhnlich eine Gerichtsverhandlung abgehalten.
Mir kam der Gedanke, dies könne die Grundidee für einen klassischen »Whodunnit« werden, wie man die Krimis damals schon bezeichnete, nur dass es in meiner Story eine echte Leiche geben sollte. Rückblickend glaube ich, dass ich großes Glück hatte, denn ich erfuhr erst viel später, dass ein französischer Autor auf die gleiche Idee gekommen war.
Ich ließ also diese Gedanken reifen, während ich in der Glut stocherte, und feilte im Geiste an meiner Figur. Nach und nach nahm ein Ermittler Gestalt an. Ein Mann, der Kriminalfälle löst.
In meinem Zimmer war es längst dunkel geworden, als ich in meinen Regenmantel schlüpfte, mir den Schirm schnappte und die Stufen zum Bürgersteig hinaufeilte, um durch die Regenschleier, die im Schein der Straßenlaternen wie eine gelb leuchtende Schraffur aussahen, zum Laden des Schreibwarenhändlers zu laufen, bei dem es nach feuchten Zeitungen, billigen Magazinen und Leuten in klammen Sachen roch. Ich kaufte sechs Schreibblöcke und einen Bleistift samt Anspitzer, ehe ich durch die Pfützen zurück in meine Wohnung platschte.
Dann, mit dem eigenartigen Gefühl, mir damit etwas Gutes zu tun, dachte ich eingehender über die Figur nach, die immer deutlicher Konturen annahm.
In der Kriminalliteratur jener Zeit war der Ermittler häufig eine Person, die ein mehr oder weniger exzentrisches Verhalten an den Tag legte: Der Ermittler hatte ein ganzes Arsenal schrulliger Angewohnheiten, die einen Wiedererkennungseffekt besaßen. Zu diesen Figuren gehört ohne Zweifel Sherlock Holmes. Natürlich auch Agatha Christies köstlicher Hercule Poirot mit seiner Schnurrbart-Manie – ein Mann, der sich nur wohlfühlte, wenn er für Ordnung gesorgt hatte, und der des Öfteren auf seine »kleinen grauen Zellen« Bezug nahm. Dann gab es Dorothy L. Sayers’ Lord Peter Wimsey, der durchaus witzig sein konnte, wie ich inzwischen zu glauben geneigt bin. Der sympathische Reggie Fortune schließlich pflegte gern zu sagen: »Alter Junge! Oh, alter Freund!« (Zumindest legte sein Schöpfer H. C. Bailey ihm diese Worte oft in den Mund.) Zu guter Letzt gab es jenseits des Atlantiks Philo Vance, den Amateurdetektiv, der sich einer eigentümlich gespreizten Sprache bediente, die sein Erfinder, S. S. van Dine, jedoch nur teilweise auf das Studium seines Helden am Balliol College in Oxford zurückführte.
Angesichts dieser Schar illustrer Exzentriker sagte ich mir an jenem längst vergangenen regennassen Nachmittag vor vielen Jahren, dass ich wahrscheinlich gut beraten wäre, mir einen Ermittler auszudenken, der vergleichsweise normal daherkam. Also erschuf ich eine Figur, bei deren Herkunft und Werdegang ich mich an Freunden orientierte, die ich in England kennengelernt hatte. Doch wie ich bereits erwähnt habe, hütete ich mich davor, dem neuen Ermittler allzu exzentrische Eigenarten auf den Leib zu schreiben (obwohl ich gestehen muss, diesem Vorsatz in meinen ersten Romanen nicht ganz treu geblieben zu sein).
Ich überlegte mir, mein Ermittler könne ein ganz normaler Polizist sein. Trotzdem sollte er in mancher Hinsicht nicht der Norm entsprechen: Es sollte ein durchaus attraktiver und kultivierter Mann werden, ein höflicher Gesprächspartner und angenehmer Zeitgenosse, mit dem man es sich andererseits aber lieber nicht verscherzte.
Allmählich gewann die Figur Konturen.
Von Anfang an war mir klar, dass ich bereits eine Menge über meinen Helden wusste. Heute glaube ich, ich wäre auch dann auf meine Romanfigur gekommen – allerdings in einem vollkommen anderen Kontext –, hätte ich mich für ein seriöseres Genre entschieden, anstatt mir an jenem Regennachmittag in den Kopf zu setzen, Kriminalromane zu schreiben.
Mein Ermittler war groß und schlank, ein Mann mit Bildung und Stil, und wirkte anspruchsvoll, bisweilen wählerisch, sodass man sich unweigerlich fragen musste, was für einem Beruf er eigentlich nachgeht. Er war ein einfühlsamer Mensch mit Sinn für Humor, aber derberen Späßen keineswegs abgeneigt. Doch in der Regel legte er ein Verhalten an den Tag, das man hierzulande mit »britischem Understatement« in Verbindung bringt. Allerdings konnte er trotz seiner zurückhaltenden und unaufdringlichen Art ein Mann sein, der Autorität ausstrahlte. Was seine Herkunft betraf, war ich mir ziemlich schnell darüber im Klaren, dass er der jüngere Sohn einer Familie aus Buckinghamshire war und das Eton College besucht hatte. Sein älterer Bruder, mit dem es mitunter Reibereien gab, stand in diplomatischen Diensten; seine Mutter, der er überaus zugetan war, stellte ich mir als eigenwillige Lady vor.
Ich weiß noch, wie erfreut ich war, als mein Held in einer Rezension als »der sympathische Alleyn« bezeichnet wurde – und das schon zu Beginn meiner schriftstellerischen Karriere! Denn genauso hatte ich ihn mir vorgestellt: Als sympathischen Kerl, der jedoch mehr Biss hat, als man auf den ersten Blick vermutet – viel mehr Biss, wie ich hoffe. Zu Beginn seiner Karriere wurde er in der Presse als »der gut aussehende Inspector« bezeichnet – eine Charakterisierung, die ihm oft unangenehm war.
An jenem Regentag, als Roderick Alleyn Gestalt annahm, spielte ich mit dem Gedanken, in einer Nebenhandlung zu schildern, weshalb er aus dem diplomatischen Dienst ausgeschieden und zur Polizei gegangen war, doch letzten Endes habe ich dieses Vorhaben nie verwirklicht.
Wie alt mein Held ist? Nun, da muss ich ein bisschen ausholen. Das genaue Alter von Roderick Alleyn würde sogar jemand mit Einsteins Verstand nicht herausfinden. Aber was das angeht, steht mein Ermittler nicht allein da. Hercule Poirot war, wie ich mir sagen ließ, bei seinem Tod fast 122 Jahre alt. Woran das liegt? Um ehrlich zu sein, Ermittlungsarbeit in Romanen bewegt sich in einem ganz speziellen Raum-Zeit-Kontinuum, das so beschaffen ist, dass etwa ein Inspector Bucket aus Dickens’ Bleak House bei seinen polizeilichen Ermittlungen den sehr viel jüngeren Grünschnäbeln der neuesten Kriminalliteratur leibhaftig über den Weg läuft. Es genügt vielleicht, wenn ich sage, dass ich mir an jenem Nachmittag, als mein Ermittler das Licht der Welt erblickte, keine Gedanken darüber machte, wie alt er sein soll, und daran hat sich bis heute nichts geändert. Man könnte vielleicht sagen, dass Alleyn gänzlich unerwartet, wie aus dem Nichts die literarische Bühne betrat.
Autoren werden häufig gefragt, ob die Figuren in ihren Romanen Gemeinsamkeiten mit Personen aus dem wirklichen Leben haben. Bei einigen meiner Figuren gibt es solche Parallelen tatsächlich, nur wurden sie einigen Veränderungen unterzogen und entfernten sich dabei in vieler Hinsicht von ihren ursprünglichen Vorbildern. Roderick Alleyn hat, soweit ich es sagen kann, kein solches Vorbild; er ist ein ausschließliches Produkt der Fantasie seiner Autorin, das unangekündigt die Bühne betrat. Mag sein, dass ihm aus diesem Grund etwas Unwirkliches anhaftet, aber für mich war Alleyn immer sehr real und ist es bis heute geblieben.
Man hat Dorothy L. Sayers zum Vorwurf gemacht, zu vernarrt in ihren Wimsey gewesen zu sein. Möglicherweise ist diese Kritik bis zu einem gewissen Punkt gerechtfertigt. Vielleicht kann man es als Mangel an Geschmack und Urteilsvermögen bezeichnen, wenn ein Autor sich zu sehr mit seiner Hauptfigur identifiziert, obwohl Sayers’ eingefleischte Fans ihr niemals ein solches Fehlverhalten vorwerfen würden.
Ich glaube nicht, dass ich meinem Ermittler je auf eine solche Weise erlegen bin, bestreite aber keineswegs, dass ich ihn mag und wie einen alten Freund und Vertrauten schätze. Ich gebe sogar zu, dass ich bisweilen das Gefühl hatte, er sei wirklich und wahrhaftig mit mir in einem Zimmer. Und wir sind weit gereist, wir zwei. Wir fuhren in einem Nachtzug über die Nordinsel Neuseelands, vorbei an brodelnden Geysiren und schneebedeckten Bergen. Wir spazierten Seite an Seite über die Straßen Roms, beeindruckt von den Monumenten der Antike. Wir fuhren über idyllische englische Kanäle. Wir besuchten eine Insel vor der Küste der Normandie, auf die meinen Helden seine Arbeit als Polizist verschlagen hatte. Wir drangen in mehreren Schauspielhäusern in die bisweilen düsteren Bereiche hinter den Bühnen vor. In einem Fall segelte Alleyn sogar mit einem psychopathischen Killer von Tilbury nach Kapstadt. Er hat Täter an den unterschiedlichsten Orten festgenommen: auf mindestens drei Landsitzen, im Krankenhaus, in einer Kirche, auf einem Flussschiff und in einem Pub. Wen wundert’s, dass wir angesichts solch spektakulärer Unternehmungen beide unseren Horizont erweitern konnten. Das alles hätte ich an jenem regnerischen Nachmittag in London niemals voraussehen können.
Bei seinem ersten Auftritt war Alleyn Junggeselle, lebte aber keineswegs wie ein Mönch, als er seinem Beruf nachging. Er war dem weiblichen Geschlecht sehr zugetan, doch ohne dass er gleich von einem Bett ins andere sprang. Falls er Affären hatte, habe ich es nicht mitbekommen. Er war in jeder Hinsicht frei und ungebunden, und das sollte auch so bleiben – so lange jedenfalls, bis er auf einer Schiffsreise zu den Fidschi-Inseln einer gewissen Agatha Troy begegnete, die an Deck des Passagierdampfers Ölgemälde schuf. Das alles ereignete sich erst in der Zukunft, nach einem guten halben Dutzend Romanen, doch als Miss Troy schließlich Alleyns Antrag annahm, rief es bei Lektoren und Verlegern Verwunderung hervor. Wie dem auch sei – sie und die Kritiker wurden vor vollendete Tatsachen gestellt, und ich selbst hatte es von da an mit einem verheirateten Ermittler, seiner geliebten Frau und später mit deren Sohn zu tun.
Aufgrund von Zufällen und gegen Alleyns Willen wurden seine Frau und sein Sohn gelegentlich in seine Polizeiarbeit verwickelt, aber im Großen und Ganzen gelang es ihm, Arbeit und Familienleben zu trennen. An den meisten Fällen arbeitete er gemeinsam mit seinem Partner, Inspector Fox, der zu seinen besten Freunden zählte. Fox, ein stämmiger, gelassener, geradeaus denkender Mann, beteiligte sich auf seine ruhige Art an den Ermittlungen. Die beiden arbeiteten eine ganze Weile zusammen und erlaubten mir bisweilen, sie zu begleiten.
Doch »an dem fraglichen Abend« lag das alles noch »in weiter Ferne«, wie Krimiautoren zu sagen pflegen. Das Feuer war nahezu erloschen, und die Glut zauberte flackernde Muster an die Wände meiner Londoner Souterrainwohnung, als ich das Licht einschaltete, ein Schreibheft aufschlug, meinen Bleistift spitzte und zu schreiben begann, während Alleyn geduldig im Hintergrund wartete, bereit für seinen ersten Auftritt im vierten Kapitel meines ersten Krimis, Das Todesspiel.
Fortan war ich nicht mehr allein, sondern stets in Gesellschaft von … hm, ja, wem? Gute Frage. Wie sollte er heißen? Natürlich musste ich meinem Helden einen Namen geben.
Wenige Tage zuvor hatte ich dem Dulwich College einen Besuch abgestattet, einer Privatschule in London, die in elisabethanischer Zeit von einem berühmten Schauspieler gegründet worden war, einem Mann namens Edward Alleyn (man spricht den Namen wie »Allen« aus). Die Schule verfügt über eine bedeutende Porträtgalerie und eine beachtliche Sammlung von Erinnerungsstücken aus der Zeit, als Autoren wie Shakespeare und Christopher Marlowe die Theaterlandschaft prägten. Ich war beeindruckt, da ich dem Schauspiel immer schon zugetan war.
Hinzu kam, dass mein Vater Schüler am Dulwich College gewesen war und somit ein »alter Alleynianer«, wie die Ehemaligen nach dem elisabethanischen Schauspieler und Gründer der Schule genannt werden.
Detective Inspector Alleyn, CID.
Hörte sich gut an.
Über seinen Vornamen war ich mir nicht sofort im Klaren, aber während eines Besuchs bei Freunden in den schottischen Highlands hatte ich Leute mit wohlklingenden Namen um mich, darunter ein Roderick (Rory) MacDonald.
Roderick Alleyn, Detective Chief Inspector, CID.
Hörte sich noch besser an.
– Ngaio Marsh
1. KAPITEL
Zugegen waren …
Nigel Bathgate war, in der Sprache seiner Klatschkolumne, »hellauf begeistert« von der Aussicht auf das Wochenende, das er auf Frantock verbringen würde, dem Ziel seiner Reise. Schon bei dem Gedanken daran fühlte er sich in »Bombenform«. Dabei hätte man eigentlich erwarten können, dass er mit fünfundzwanzig Jahren den maßlosen Überschwang abgelegt hatte, der für junge Heranwachsende so bezeichnend ist.
Nigel lehnte sich auf seinem Ecksitz in der ersten Klasse zurück und musterte seinen Cousin, der ihm gegenübersaß. Ein schwieriger Fall, der gute alte Rankin. Man wusste nie, was sich hinter seiner meist ernsten Miene verbarg. Doch Rankin sah blendend aus, wie Nigel einräumen musste. Die Frauen bewunderten ihn, liebten seine Schmeicheleien und lagen ihm zu Füßen, obwohl er in die Jahre gekommen war. Bestimmt war er schon sechs- oder siebenundvierzig.
Rankin erwiderte den forschenden Blick seines jungen Cousins mit jenem rätselhaften Lächeln, das Nigel stets an einen Faun denken ließ.
»Wir sind gleich da«, sagte Rankin. »An der nächsten Station steigen wir aus. Dort, linker Hand, beginnt Frantock.«
Nigel schaute über die abwechslungsreiche Landschaft aus kleinen Feldern und Anhöhen zu dem kahlen grauen Wald, der, verschlafen in winterlicher Einsamkeit, die warmen Töne einer alten Backsteinfassade halb verdeckte.
»Das ist das Herrenhaus«, sagte Rankin.
»Wer kommt denn alles?«, fragte Nigel nicht zum ersten Mal. Er hatte schon viel gehört über Sir Hubert Handesleys »einzigartige und erfrischend originelle Hausgesellschaften«, vor allem aus dem Munde eines Journalistenkollegen, der an einer dieser Veranstaltungen teilgenommen hatte und dessen Begeisterung keine Grenzen kannte, wenn man ihm Glauben schenken durfte. Rankin, ein großer Kenner derartiger Veranstaltungen, hatte sogar mehrere beneidenswerte Einladungen von Angehörigen der High Society ausgeschlagen, um an diesen vergleichsweise anspruchslosen Wochenenden teilnehmen zu können. Nun sollte auch Nigel, wie sie es beim Dinner in Rankins Apartment besprochen hatten, in diese vornehme Welt eingeführt werden. Deshalb fragte er noch einmal: »Wer kommt denn alles?«
»Oh, die üblichen Verdächtigen, würde ich sagen«, erwiderte Rankin geduldig. »Außerdem ein gewisser Dr. Foma Tokareff. Ich nehme an, Handesley kennt ihn noch aus seiner Zeit als Botschafter in Petrograd. Natürlich werden auch die Wildes dabei sein – Arthur Wilde, der Archäologe, und seine Frau Marjorie, eine ziemlich attraktive Dame. Die beiden müssten übrigens hier irgendwo im Zug sitzen. Vermutlich kommt auch Angela North. Du bist ihr schon einmal begegnet, nicht wahr?«
»Sir Huberts Nichte? Ja, an dem Abend in deinem Apartment hat sie beim Dinner neben ihm gesessen.«
»Wenn ich mich recht erinnere, habt ihr zwei euch ganz gut verstanden.«
»Wird auch Miss Grant da sein?«, wollte Nigel wissen.
Rankin stand auf und zog umständlich seinen Mantel an. »Du meinst Rosamund? Ja, die müsste auch da sein.«
Wie ausdruckslos seine Stimme manchmal werden kann, sinnierte Nigel, als der Zug in den kleinen Bahnhof ratterte und mit einem langgezogenen, dampfenden Seufzer zum Stehen kam.
Die Luft hier oben war auffallend frisch und kalt nach der stickigen Atmosphäre im Zuginnern. Rankin ging voraus und folgte dem Verlauf einer unbefestigten Landstraße, bis sie auf drei Reisende stießen, dick eingehüllt, die sich angeregt unterhielten, während ein Chauffeur das Gepäck in einem Bentley Sechssitzer verstaute.
»Hallo, Rankin«, rief ein dünner, bebrillter Mann. »Dachte mir schon, dass du auch im Zug bist.«
»Ich habe in Paddington nach euch Ausschau gehalten, Arthur«, erwiderte der Angesprochene. »Habt ihr schon meinen jungen Cousin kennengelernt?« Die Frage war an alle drei gerichtet. »Darf ich vorstellen? Nigel Bathgate. Nigel – das sind Mrs. und Mr. Wilde. Rosamund und du, ihr kennt euch ja bereits, nicht wahr?«
Nigel machte eine Verbeugung, als er Rosamund Grant begrüßte, eine große, dunkelhaarige Frau von aparter Schönheit, die man nicht so schnell vergaß. Von der ehrenwerten Mrs. Wilde sah Nigel nur die großen blauen Augen und die Spitze einer kurzen Nase. Besagte Augen bedachten Nigel nun mit einem kurzen, abschätzenden Blick; dann erklang hinter dem üppigen Pelzkragen eine hohe, affektiert klingende Stimme.
»Guten Tag. Sie sind ein Verwandter von Rankin? Wie schrecklich für Sie! Mein lieber Rankin, du wirst zu Fuß gehen müssen. Ich hasse es, hinter beschlagenen Scheiben eingepfercht zu sein, selbst wenn es nur ein kurzes Stück ist.«
»Du kannst gern auf meinem Schoß sitzen«, erbot Rankin sich leichthin.
Nigel musterte seinen Cousin und bemerkte in dessen Blick eine Mischung aus Kühnheit und Herausforderung. Der Blick galt indes nicht Mrs. Wilde, sondern Rosamund Grant. Es war, als hätte Rankin zu ihr gesagt: »Ich will meinen Spaß. Wehe, du sagst Nein.«
Als Rosamund sich daraufhin das erste Mal zu Wort meldete, hob ihre klangvolle Stimme sich deutlich von Mrs. Wildes exaltiertem Sopran ab: »Da kommt ja Angela in ihrem Flitzer! Dann ist doch genug Platz für alle!«
»Wie schade«, meinte Rankin. »Marjorie, wir müssen uns geschlagen geben.«
»Keine zehn Pferde bringen mich dazu, zu Angela in diese Blechkiste zu steigen«, erklärte Arthur Wilde entschieden.
»Mich auch nicht«, pflichtete Rankin ihm bei. »Berühmte Archäologen und ausgewiesene Erzähler sollten sich nicht auf einen Flirt mit dem Tod einlassen. Bleiben wir lieber bei unserem Bentley.«
»Soll ich zu Miss North in den Wagen steigen?«, erbot sich Nigel.
»Wenn Sie so gut wären, Sir«, meldete der Chauffeur sich zu Wort.
»Komm, Marjorie, mein Schatz, steig ein«, drängte Arthur Wilde, der bereits auf dem Beifahrersitz des Bentleys Platz genommen hatte, seine Frau. »Ich brauche dringend einen Tee und Gebäck.«
Seine Gattin sowie Rosamund Grant nahmen auf der Rückbank der Limousine Platz; Rankin setzte sich zwischen sie.
In diesem Moment hielt der Sportwagen neben ihnen.
»Tut mir leid, wenn ich zu spät bin!«, rief Angela North über das Motorengebrumm des Zweisitzers hinweg. »Wer hat Lust, sich frische Luft um die Nase wehen zu lassen und den Wind in den Haaren zu spüren?«
»Das hört sich alles gleichermaßen furchtbar an!«, rief Mrs. Wilde mit schriller Stimme aus dem Bentley. »Du kannst ja mit Rankins Cousin vorliebnehmen.« Sie blickte Nigel bedeutungsvoll an. »Er ist ein netter, gut geratener junger Brite. Genau dein Typ, Angela!« Der Bentley fuhr rasant an und brauste die Landstraße hinunter.
Da Nigel im Augenblick keine passende scherzhafte Bemerkung einfallen wollte, wandte er sich Angela zu und nahm in Belanglosigkeiten Zuflucht: »Sind wir uns nicht schon mal begegnet?«
»Aber natürlich«, erwiderte Angela. »Ich fand Sie sehr nett. Kommen Sie, steigen Sie ein. Vielleicht können wir den Bentley ja einholen.«
Kaum hatte Nigel auf dem Beifahrersitz Platz genommen, verschlugen ihm Miss Norths Vorlieben für rasante Beschleunigungen und riskante Fahrmanöver schlichtweg den Atem.
»Sie sind also zum ersten Mal auf Frantock zu Besuch«, stellte Angela fest, nachdem sie geschickt eine rutschige Kurve der Landstraße gemeistert hatte. »Ich hoffe, es gefällt Ihnen dort. Wir alle haben immer großen Spaß an Onkel Huberts Partys! Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Eigentlich tut sich gar nicht viel. Alle Gäste zeigen sich von ihrer kindischen Seite und veranstalten dumme Spielchen. Aber den Leuten gefällt’s. Sie sind jedes Mal völlig aus dem Häuschen. Diesmal soll es ein Mörderspiel werden, und … Ah, da sind sie ja!«
Angela betätigte die Hupe, die ein anhaltendes, tiefes Quäken von sich gab, erhöhte die Geschwindigkeit noch einmal um vielleicht fünfzehn, zwanzig Meilen die Stunde und überholte den Bentley so rasant, als ginge es um den Sieg im englischen Derby.
»Haben Sie schon mal bei einem Mörderspiel mitgemacht?«, wollte sie dann wissen.
»Nein, und auch bei keinem Selbstmord-Spiel – auch wenn ich den Eindruck habe, dass Sie selbst gerade dabei sind«, erwiderte Nigel atemlos.
Angela lachte lauthals.
Sie lacht wie ein kleiner Junge, schoss es Nigel durch den Kopf.
»Ängstlich?«, rief sie. »Keine Sorge, ich bin eine vorsichtige Fahrerin.« Mit diesen Worten drehte sie sich fast ganz auf dem Sitz herum und winkte dem Bentley zu, der immer weiter zurückfiel, ehe sie sich wieder nach vorn zur Straße drehte. »Wir haben es gleich geschafft!«
»Hoffentlich«, hauchte Nigel.
Die schmiedeeisernen Flügel einer Toreinfahrt huschten an ihnen vorüber, ehe sie in das triste winterliche Grau eines Waldstücks eintauchten.
»Im Sommer ist der Wald viel schöner«, rief Miss North.
»Oh, er sieht auch jetzt ganz nett aus«, stieß Nigel hervor und schloss die Augen, als sie in halsbrecherischem Tempo auf eine schmale Brücke zuhielten, hinter der sie dann schwungvoll der Biegung einer Schotterauffahrt folgten, um schließlich abrupt vor einem einladenden Backsteingebäude zum Stehen zu kommen.
Nigel kletterte erleichtert aus der Enge des Sportwagens und folgte der Gastgeberin ins Haus.
Er fand sich in einer geschmackvollen Eingangshalle wieder, die im rauchigen Grau der alten Eichenvertäfelung ein wenig düster wirkte, doch die tänzelnden Flammen im großen offenen Kamin sorgten für Behaglichkeit. Der riesige Kronleuchter an der Decke fing das Licht der Flammen auf und blitzte und funkelte mit außergewöhnlicher Strahlkraft. Im Zwielicht des zu Ende gehenden Tages, das in dem alten Gebäude bereits um sich griff, schien die breite Treppe am anderen Ende der Eingangshalle im Nichts zu enden.
Nigel ließ den Blick über die Trophäen und Waffen an den Wänden schweifen, die üblichen Insignien eines herkömmlichen Landsitzes. Dabei kam ihm eine Bemerkung Rankins in den Sinn, der ihm erzählt hatte, Sir Hubert besäße eine der schönsten Sammlungen alter Waffen in ganz England.
»Machen Sie sich einen Drink, wenn Sie möchten, und wärmen Sie sich ein wenig am Feuer auf«, flötete Angela. »Ich sage in der Zwischenzeit Onkel Hubert Bescheid. Ihr Gepäck ist ja noch im Bentley, aber die anderen müssten jeden Augenblick hier sein.«
Sie sah ihn offen an und lächelte.
»Ich hoffe, ich habe Ihre Männlichkeit nicht allzu sehr in Mitleidenschaft gezogen – durch meinen Fahrstil, meine ich.«
»Doch, haben Sie, aber nicht durch Ihren Fahrstil«, antwortete Nigel und staunte selbst darüber, was er da gesagt hatte.
»Oh, schwingt da ein Kompliment mit? Sie hören sich ja schon wie Rankin an!«
Irgendwie dämmerte es Nigel, dass es womöglich ein Nachteil war, sich wie Rankin anzuhören.
»Ich bin gleich wieder da«, verkündete Angela. »Die Drinks stehen da drüben.« Sie deutete flüchtig auf eine Ansammlung von Gläsern und Karaffen und entschwand in die Schatten der Halle.
Nigel schenkte sich einen Whisky mit Soda ein und schlenderte zur gewundenen Treppe, wo ihm ein langer Lederriemen auffiel, der an der Wand hing und in dessen Schlitzen eine beängstigende Anzahl gebogener Klingen mit verschnörkelten Griffen steckte. Er streckte die Hand nach einem Malaiendolch mit schlangenartig gewellter Klinge aus, als unvermittelt ein Lichtreflex auf dem glänzenden Stahl funkelte und ihn abrupt innehalten ließ. Eine Tür auf der rechten Seite schwang auf, und aus dem Raum dahinter fiel helles Licht in die Eingangshalle. Im Türrechteck zeichneten sich die Umrisse einer Gestalt ab, die regungslos auf der Schwelle stand.
»Entschuldigung!«, dröhnte eine tiefe Stimme. »Ich fürchte, wir sind uns noch nicht begegnet. Sie gestatten, dass ich mich vorstelle? Dr. Foma Tokareff, meine Name. Wie ich sehe, Sie sind an orientalischen Waffen interessiert.«
Nigel war beim unerwarteten Auftauchen des Mannes zusammengezuckt, erholte sich aber rasch von dem Schreck und trat vor, um den Russen zu begrüßen, der ihm lächelnd und mit ausgestreckten Händen entgegenkam. Die Hand des jungen Journalisten schloss sich um auffallend dünne Finger, die für die Dauer eines Herzschlags seltsam schlaff und leblos wirkten, ehe der Russe zu einem kräftigen Händedruck überging.
Nigel kam sich ein wenig linkisch und fehl am Platz vor. »Oh, ich …«, stammelte er. »Ja, Waffen interessieren mich sehr, nur verstehe ich leider nichts davon.«
»Keine Bange«, rief Dr. Tokareff mit seinem dröhnenden Organ. »Sie von ganz allein etwas über Waffen von Vorfahren lernen, wenn Sie bleiben auf Frantock. Sir Hubert ist Koryphäe auf diesem Gebiet und begeisterter Sammler.«
Der Russe sprach übertrieben förmlich, und seine Worte klangen wegen der eigenartigen Modulation pedantisch und nachlässig zugleich. Nigel erwiderte leise, er kenne sich auf diesem Gebiet kein bisschen aus, und war erleichtert, als er die Hupe des Bentleys hörte.
Mit einem Mal kam Leben in die Halle. Angela kehrte aus den Schatten zurück; wie aus dem Nichts tauchte ein Butler auf; dann trafen binnen kürzester Zeit die übrigen Gäste ein. Schließlich erklang vom oberen Treppenabsatz die fröhliche Stimme von Sir Hubert Handesley, der die Stufen herunterkam, um seine Gäste willkommen zu heißen.
Gut möglich, dass der Grund für den Erfolg der Partys auf Frantock der Charme des Gastgebers war, denn Handesley war ein ausgesprochen attraktiver und umgänglicher Mann, über den Rosamund Grant einmal gesagt hatte, es sei nicht fair, dass ein Einzelner so viele beneidenswerte Eigenschaften auf sich vereine. Handesley war hochgewachsen und besaß noch immer die sportliche Figur eines jungen Mannes, obwohl er die fünfzig bereits überschritten hatte. Seinem schlohweißen Haar war der Kahlschlag mittleren Alters erspart geblieben; voll und weich schmiegte es sich an den schön geformten Kopf. Seine Augen, die unter dichten Brauen lagen, waren von einem außergewöhnlich lebhaften Blau, und seine Lippen waren fest und verjüngten sich zu den Mundwinkeln hin. Alles in allem war er ein Mann, der beinahe schon zu gut aussah, um wahr zu sein. Noch dazu konnte sein Verstand mit den Vorzügen seiner äußeren Erscheinung mithalten. Vor dem Krieg war er ein fähiger Diplomat gewesen; danach hatte er sich im Kabinett als Minister hervorgetan und fand seither obendrein Zeit, gelehrte Abhandlungen über seine Leidenschaft zu verfassen, die Waffen älterer Zivilisationen. Vor allem aber frönte er hingebungsvoll seiner Lieblingsbeschäftigung, aus der er beinahe eine Wissenschaft gemacht hatte, der Organisation und Veranstaltung amüsanter Hausgesellschaften.
Es war bezeichnend für Handesley, dass er sich nach der allgemeinen Begrüßung Nigel zuwandte, dem unbedeutendsten seiner Gäste.
»Ich bin froh, dass Sie kommen konnten, Bathgate«, sagte er. »Angela hat Sie vom Bahnhof aus im Wagen mitgenommen, nicht wahr? Eine schreckliche Erfahrung, ich weiß. Rankin hätte Sie warnen sollen.«
»Oh, der gute Nigel war überaus tapfer«, rief Mrs. Wilde. »Angela zwang ihn in ihr scheußliches kleines Fahrzeug. Als sie dann an uns vorbeiflogen, war der arme Mann ganz grün im Gesicht. Doch er blickte unerschrocken in die Fratze des Todes! Rankin ist mächtig stolz auf seinen jungen Verwandten – nicht wahr, Charles?«
»Nigel ist ein standhafter Kerl, ein Pukka Sahib, wie wir in Indien sagen«, ließ Rankin sich seltsam ernst vernehmen.
»Spielen wir wirklich das Mörderspiel?«, fragte Rosamund Grant. »Ich wette, Angela gewinnt!«
»In der Tat, wir werden ein Mörderspiel veranstalten«, erklärte Angela. »Eine ganz spezielle Variante des Hausherrn, nicht wahr, Onkel Hubert?«
Handesley nickte. »Ich werde euch meinen Plan darlegen«, verkündete er, »sobald ihr alle einen Cocktail habt. Die Leute finden andere Menschen immer viel amüsanter, wenn sie einen Drink in Händen halten. – Würdest du bitte nach Wassili läuten, Angela?«
»Spiel mit Mord?«, fragte Dr. Tokareff, der eines der Messer genauer betrachtet hatte und sich nun umwandte. Der flackernde Feuerschein spiegelte sich in seinen großen Brillengläsern, was ihm ein »ziemlich bedrohliches Aussehen« verlieh, wie Mrs. Wilde Rankin zuraunte. »Spiel mit Mord? Das wäre wirklich Riesenspaß! Aber ich nicht kenne dieses Spiel.«
»Zurzeit ist die klassische Version sehr beliebt«, erklärte Arthur Wilde, »aber ich bin mir sicher, dass Handesley einige Feinheiten ersonnen hat, die dem Spiel erst den richtigen Schliff geben.«
Eine Tür links von der Treppe schwang auf, und ein älterer Mann erkennbar osteuropäischer Herkunft erschien und brachte einen Cocktailshaker. Die Gäste nahmen sein Erscheinen mit Begeisterung auf.
»Wassili Wassiliewitsch!« Mrs. Wilde trällerte den klangvollen Namen wie die Darstellerin in einer komischen Oper und streckte den Arm in Wassilis Richtung aus. »Liebes Väterchen! Sei so gut und bedenke diese Unwürdige mit einem kleinen Schluck von deiner gepriesenen Mischung.«
Wassili nickte und lächelte freundlich, ehe er den Cocktailshaker öffnete und mit bemerkenswerter, beinahe übertriebener Konzentration eine klare gelbliche Flüssigkeit in die Gläser gluckern ließ.
»Probier mal, Nigel«, forderte Rankin seinen Cousin auf. »Das ist Wassilis eigenes Rezept. Marjorie nennt es ›Oktoberrevolution‹.«
»Nicht viel Revolutionäres dabei«, murmelte Arthur Wilde.
Nigel nahm einen kleinen Schluck und war geneigt, Arthur beizupflichten.
Dann beobachtete er den alten Russen, der sich erfreut inmitten der Gäste tummelte. Wie er von Angela erfuhr, hatte Wassili bereits im Dienst ihres Onkels gestanden, als dieser noch ein junger Attaché in Petersburg gewesen war. Nigels Augen folgten dem Butler, als dieser sich inmitten der kleinen Gruppe erwartungsvoller Gäste bewegte, mit deren Schicksal seines eigenes bald so eng und auf so furchtbare Weise verschmelzen sollte, ohne dass er es ahnte.
Nigels Blick richtete sich auf seinen Cousin, Charles Rankin, über den er, wie er zugeben musste, ziemlich wenig wusste, doch es war unübersehbar, dass zwischen Rankin und Rosamund Grant irgendeine emotionale Verbindung bestand. Nigel entging nicht, dass Rosamund aufmerksam beobachtete, wie Rankin sich in der Pose eines Schwerenöters zu Marjorie Wilde hinüberbeugte.
Mrs. Wilde ist wohl mehr nach seinem Geschmack als Rosamund, ging es Nigel durch den Kopf. Rosamund ist ihm anscheinend zu wild. Er mag es lieber gemütlich.
Nigel schaute zu Arthur Wilde hinüber, dem Archäologen, der in ein ernstes Gespräch mit ihrem Gastgeber Handesley vertieft war. Wilde besaß nichts von Handesleys eindrucksvoller äußerer Erscheinung, doch sein schmales Gesicht war durchaus attraktiv, jedenfalls aus Nigels Sicht. Die Form seines Schädels und seine Kinnpartie waren prägnant, und um seinen Mund lag ein schwer fassbarer Ausdruck von Sinnlichkeit. Beiläufig fragte sich Nigel, woran es liegen mochte, dass zwei so unterschiedliche Typen wie dieser trockene Gelehrte mittleren Alters und seine schrille, modebewusste Gattin je zueinander gefunden hatten.
Hinter den beiden, halb in den Schatten verborgen, stand der russische Arzt, aufrecht und regungslos, den Kopf leicht nach vorn geneigt.
Was er wohl von uns hält?, sinnierte Nigel.
»Warum so ernst?«, riss Angelas Stimme ihn aus seinen Grübeleien. »Haben Sie schon eine griffige Zeile für Ihre Klatschspalte im Sinn? Oder überlegen Sie sich, wie Sie beim Mörderspiel vorgehen werden?«
Bevor Nigel antworten konnte, unterbrach Sir Hubert mit lauter Stimme die Gespräche der Versammelten. »In wenigen Minuten ertönt die Ankleideglocke!«, verkündete er. »Falls Sie alle sich gestärkt fühlen, werde ich Ihnen nun die Grundlagen meiner Version des Mörderspiels darlegen.«
»Kompanie – stillgestanden!«, rief Rankin gut gelaunt.
2. KAPITEL
Der Dolch
»Ihr alle kennt sicherlich die normale Version des Mörderspiels«, begann Sir Hubert, während Wassili diskret nachschenkte. »Einer der Spieler, dessen Identität den anderen verborgen bleibt, ist der Mörder. Die Spieler verteilen sich im Haus, und der Mörder nutzt den geeigneten Moment, um eine Glocke zu läuten oder den Gong zu schlagen. Der Gongschlag steht dabei für den Augenblick der Tat. Die Spieler kommen wieder zusammen und halten eine Art Gerichtsverhandlung ab, wobei einer zum Staatsanwalt ernannt wird. Er untersucht den Fall gründlich und versucht herauszufinden, wer der Mörder ist …«
»Bitte um Vergebung«, warf Dr. Tokareff ein. »Ich bin immer noch, wie sagt man … nichtsahnend. Ich hatte bislang nicht Vergnügen, an solch lustigem Zeitvertreib teilzunehmen. Würden Sie mir das alles bitte näher erläutern?«
»Ist er nicht putzig?«, fragte Mrs. Wilde ein wenig zu laut.





























