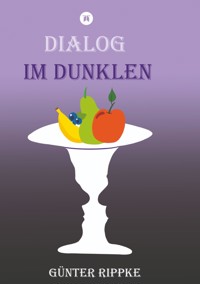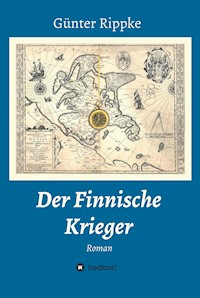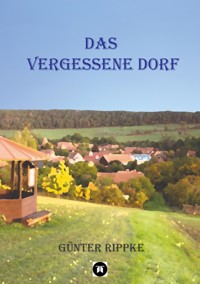
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Zugereister erlebt in einem kleinen Dorf die Jahre unmittelbar nach der deutsch-deutschen Wiedervereinigung und sieht sich dabei unerwartet in das laufende Geschehen hineingezogen. Er wird vom bloßen Betrachter zum Zeitzeugen und schließlich zum Chronisten einer ungewöhnlichen Entwicklung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Günter Rippke
Das vergessene Dorf
© 2023 Günter Rippke
Umschlag und Layout: Astrid Rippke
Cover-Photo: Günter Rippke
Softcover 978-3-347-82188-0
Druck und Distribution im Auftrag:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
Inhalt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
KAPITEL 1: ANKUNFT IM DORF
KAPITEL 2: HISTORISCHES
KAPITEL 3: TIEFENORTER EIGENARTEN
KAPITEL 4: SUCHE NACH EINER NEUEN CHRONIK
KAPITEL 5: RÜCKBLICK AUF DIE GROßE WENDE
KAPITEL 6: DORFLEBEN
KAPITEL 7: UNSER DORF SOLL SCHÖNER WERDEN
KAPITEL 8: GRIFF NACH GOLD
KAPITEL 9: ZEITENWENDE
KAPITEL 10: DIE NEUE ZEIT
Das vergessene Dorf
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
KAPITEL 1: ANKUNFT IM DORF
KAPITEL 10: DIE NEUE ZEIT
Das vergessene Dorf
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
KAPITEL 1: ANKUNFT IM DORF
Mitte Mai 1995 erschien ein Fremder in Tiefenort. Er ging umher und betrachtete aufmerksam die Häuser. Ein einheitlicher Stil war nicht zu erkennen, sie wirkten weder neu noch alt, bäuerliches Fachwerk stand wie selbstverständlich neben farbig gestrichenen Fassaden. Das Dorf wirkte wie ausgestorben. Alle Hoftore waren verschlossen; es gab keine sichtbaren Stromleitungen, die Straße schien neu gepflastert, die Dächer frisch gedeckt – der Anblick erinnerte etwas an ein extra für die Betrachtung hergerichtetes Museumsdorf. Allerdings parkten einige ganz reale Autos an der Straße, auch der Dorfteich mit dem grünen Teppich von Wasserlinsen und Schilf am Rande wirkte echt.
Aus einem der Höfe erschien ein Alter und fragte ohne Umschweife:
„Suchste was Bestimmtes?“
„Ja – vielleicht“, erwiderte der Besucher, „gibt es hier im Dorf eventuell eine Unterkunft?“
„Unterkunft? Wie meenst’n das?“
„Na zum Wohnen.“
„Haste denn keene Wohnung?“
„Schon, aber ich möchte gern in ein kleines Dorf ziehen.“
„Wo kommst’n her?“
„Ist das wichtig?“
„Bist du’n Wessi?“
„Nein; ich bin gelernter Ossi.“
Der Alte blickte eine Weile bedächtig zu Boden. Dann sagte er: „Nee, gibt’s hier nicht.“
„Aber es heißt doch immer, in den Dörfern hätten viele Bauern das private Wirtschaften nach der Wende nicht wieder aufgenommen, und dass die Jugend fortgezogen wäre. Es würden ganze Höfe fast leer stehen.“
„Hier hat keener fort gemacht.“
„Gibt es denn Ferienwohnungen im Dorf? Vielleicht finde ich da etwas.“
„Ferienwohnungen?“
„Zum Vermieten an Urlaubsgäste.“
„Weeß ich nicht. Manchmal sind Wanderer oben am Wald unterwegs. Wer soll’n hier Urlaub machen? Wir ham’ doch nicht die Ostsee vor der Tür.“
„Aber schön habt ihr’s hier auch.“
„Schön kann man nicht essen; schön ist was für Städter. Unser Boden gab nicht viel her, und die Hanglagen waren schwer zu bearbeiten. Jetzt sind sie aufgegeben. Du kommst wohl aus der Stadt?“
„Ja, aus Erfurt.“
„Na komm, setz dich erst mal.“ Der Bauer wies auf die Bank vor dem Haus. „Ich bin der Heinz“, sagte er.
„Theo“, erwiderte der Besucher. Sie gaben sich die Hand und schwiegen einige Zeit vor sich hin.
„So, du möchtest also hier wohnen“, begann der Hausbesitzer. „Nur wohnen gab es früher überhaupt nicht; entweder wollte man beim Bauern arbeiten oder einen Hof übernehmen. Und dann musste man auch ins Dorf passen; man musste ja miteinander leben. Das war auch, sich aufeinander verlassen können.“
„Selbstverständlich.“
„Viele sagen ja, heute sind andere Zeiten – meinetwegen. Aber miteinander leben müssen wir immer noch, das ändert sich nicht.“
„Das meine ich ebenfalls. Aber es gibt wohl nicht nur Bauern im Dorf, dazu gehören ja auch einige Handwerker, ein Pastor, der Lehrer; dort müsste man doch wohnen können, wenn die Landarbeit nicht mehr geht. Oder?“
„Ja, früher war das so. Ein Dorf musste selbstständig sein. Hier ging ja nicht mal die Straße durch. Wir hatten wohl einen Lehrer, aber einen Pastor hatten wir nicht.“
„Aber ihr habt doch diese große Kirche da!“ Der Besucher wies auf die Dorfmitte, wo sich das den Ort kennzeichnende Bauwerk erhob.
„Seit 1382. Aber 500 Jahre sind wir schon Filial von Hohnfeld. Der Kirchenbau hängt mit der Klostergeschichte in dieser Gegend zusammen. Aber eigentlich ging die Sache erst mit der Schenkung der Besitzungen des kinderlosen Grafen Witzlawik an das Zisterzienserkloster in Berkheim los. Das war auf jeden Fall vor 1289 …“ Der Dörfler redete weiter, während der Besucher sich fragte, was das zu bedeuten habe.
„Du bist wohl der Ortschronist?“, fragte er.
„Was? – Ach nee; manche sagen das wohl, aber es stimmt nicht. Ich hab das alles nur in der Chronik gelesen.“
„Immerhin. So neben der Arbeit in Feld und Hof setzt das schon ein besonderes Interesse voraus, finde ich.“
„Das kann sein, aber aufgeschrieben habe ich nichts.“
„Wann wurde der Ort gegründet, sagst du?“
„Das weiß natürlich keiner. Man geht immer von der Ersterwähnung aus; demnach wären wir etwas über 700 Jahre alt. Ich habe aber schon bei der Feier gesagt, dass unser Dorf auch fast 200 Jahre älter sein könnte, aber das hat keinen interessiert.“
„Und warum nicht?“
„Sie meinen, dass mit der Erwähnung eines Ortes ‚Dephenburnen‘ in einer Urkunde von 1119 nicht unser Tiefenort gemeint sein kann.“
„Das ist allerhand. Gibt es denn keine weiteren Hinweise darauf, wer hier Recht hat?“
„Ist mir egal; ändern tut sich deswegen ja nichts.“
„Aber korrekt sollten die historischen Daten schon sein.“
„Wer will hier was entscheiden? Aus der belegbaren Geschichte des Dorfes ergibt sich die Bezeichnung Tiefenort erst nach der Erweiterung einer kleineren Ansiedlung, über die nichts weiter bekannt ist. Es kann aber angenommen werden, dass es sich dabei um Dephenburnen gehandelt hat, denn unterhalb der ersten Ansiedlung … Also weeste was, ich zeig dir’s; komm mal mit.“
Während sie die leicht ansteigende Dorfstraße entlanggingen, redete der Alte unentwegt weiter.
„Das alles hier musst du dir durch das Hangwasser versumpft vorstellen, die Gründung des Dorfes Tiefenort machte zuvor eine Trockenlegung erforderlich. Der ursprüngliche Siedlungsplatz lag etwas höher, da kommen wir gleich hin. Der kleine Teich vor uns sammelt seit frühesten Zeiten das Wasser der Dorfquelle. Man sieht sie nicht, sie ist durch einen Überbau geschützt. Aber nun pass auf: Wo liegt die Quelle, wenn man davon ausgeht, dass die ersten Siedler ihre Hütten nur auf dem einzigen ebenen und trockenen Platz errichten konnten?“ Er sah den Besucher erwartungsvoll an. Der wusste nicht, was er antworten sollte.
„Nämlich?“, fragte der deshalb.
„Na, sieh hin: Vor uns das kleine Siedlungsplateau, hier die lebenswichtige Quelle mit immer frischem Wasser – was fällt da auf?“
„Sie mussten es holen.“
„Klar. Aber wo lag die Quelle aus ihrer Sicht?“
„Dicht dran würde ich sagen – man könnte auch denken, weit ab, es käme auf die Umstände an, also wenn die Wasserstelle von wilden Tieren umlagert wäre, von Bären und Wölfen etwa. Die gab es vor 700 Jahren ja noch.“
„Wir stehen vor 900 Jahren, aber das soll jetzt egal sein; die Quelle lag jedenfalls tiefer als der Siedlungsplatz. Mann, ich hätte gedacht, dass du heller wärst als die anderen; denk doch mal an die Bezeichnung Dephenburnen. Klingt das nicht fast schon wie Tiefenborn, also eine Bezeichnung für die tiefer gelegene Wasserstelle?“
„Scheint fast so.“
„Und dann hier oben …“ Der Dorfchronist eilte seinem Gast voran. „Die kleine Siedlungsfläche. Es gab hier in der Nähe nicht leicht etwas Vergleichbares: Schutz von allen Seiten und immer frisches Wasser.“
„Klingt logisch. Das Plateau dürfte dafür aber zu klein gewesen sein.“
„Ach, gar nicht. Aus Untersuchungen an anderen Orten ist bekannt, das die damaligen Ansiedlungen im slawisch - deutschen Grenzgebiet selten größer waren als vier bis sechs Hütten im Kreis. Hier sind leider keine Grabungen möglich; die alte Sieglungsfläche ist eine große Gesteinsscholle.“
„Schön“, sagte der Besucher, „jetzt haben wir also den Ursprung von Tiefenort gefunden; ich suchte allerdings mehr nach einer Wohnung. Weißt du darüber nicht doch etwas? Du hast dich hoffentlich von meinem ernsthaften Interesse einer Ansiedlung in diesem ‚ehemaligen Grenzgebiet‘ überzeugen können.“
„Das geht schon in Ordnung – äh, wie war doch gleich dein Name?“
„Theo. Theo Wagner.“
„In Ordnung Theo. Ich bin übrigens der Heinz. Aber Wohnung hier? Glaub ich nicht. Ich kann ja mal rumhören; du kommst doch wieder?“
„Bestimmt.“
„Dann mach ich dir einen Vorschlag: Komm her, wenn im Dorf was los ist, und mach einfach mit als ob du schon dazugehörst.“
„Was gibt es denn hier so Besonderes?“
„Wirst du schon sehn. Das nächste Dorfereignis ist jedenfalls die Himmelfahrtwanderung. Aber dann solltest du vor um 8 Uhr schon hier sein.“
„Ich hab’s nicht so mit den kirchlichen Traditionen.“
„Ist keine Wallfahrt; der Termin heißt bei manchen auch nur Männertag.“
„Eine von diesen Sauf- und Gröhlpartien?“
„Überhaupt nicht. Getrunken wird schon, aber betrunken ist keiner. Es ist halt die traditionelle Frühlingswanderung in die nähere Umgebung.“
„Schön – ich werde da sein. Hoffentlich hast du dann auch gute Nachrichten zum Wohnen im Dorfe. Ich will meine Runde jetzt noch beenden. Danke für die Begleitung und die historischen Informationen, Heinz!“
„Die meisten interessieren sich ja nur für das, was als sie selbst erlebt haben“, meinte der Chronist etwas resigniert. Er nickte dem Besucher kurz zu und ging in Richtung auf sein Haus zurück, während der Ortsfremde seine Erkundung fortsetzte. Viel Neues war nicht zu entdecken; es gab nur die eine Straße. Sie führte um die Kirche herum und brachte ihn wieder zu der Stelle, von wo aus er das Dorf betreten hatte. Er blieb stehen und blickte in beide Richtungen zurück: Nein, dachte er, gibt’s das wirklich? Dann ging er zu seinem Fahrzeug zurück, das er oberhalb des Dorfes geparkt hatte. Von dort betrachtete er nochmals das Panorama: Tiefenort lag in einem abseitigen Tal wie eine Modellbauanlage auf dem Boden einer großen Schüssel. Die umgebenden Hänge waren im oberen Bereich bewaldet und liefen als Wiesen auf die Siedlung zu. Viel Platz hatten sie dem Dorf nicht geboten, die Dächer scharrten sich eng um den Kirchturm. In der flacher auslaufenden Richtung zeigten sich Felder. Nach ausgiebiger Betrachtung des Anblicks stieg er ein und fuhr nach Hause.
Wieder in seiner Stadtwohnung angekommen, suchte er weitere Information über das Minidorf zu finden. Im Autoatlas fand er das größere Berkheim und auch Hohnfeld, doch ein Tiefenort war nirgends verzeichnet Etwas ernüchtert, aber auch entschlossen nahm er sein Tagebuch zur Hand: Er müsse seine Entdeckung dann eben ohne weitere Unterstützung festhalten, fand er. Unter dem 12. 5. 95 schrieb er: „Heute fand ich ein kleines abgelegenes Dorf ohne Ausgang. Es lag fast versteckt in einer Senke der hügeligen Landschaft. Der Anblick der Siedlung, vom Rande des Erdfalls aus, wo ich hielt, sprach mich sofort an. Ich konnte mir spontan vorstellen, dort meine letzten Jahre zu verbringen. Die Verwirklichung dürfte jedoch schwierig werden. Ein Einheimischer, den ich traf, machte mir keine Hoffnung auf verfügbaren Wohnraum in Tiefenort. Er beeindruckte mich jedoch mit seinen Kenntnissen über das scheinbar eingeschlafene Dorf. Ich traf keinen weiteren Menschen an, obwohl die Häuser alle bewohnt sein müssten, wenn es doch keinen freien Wohnraum gibt. Die ehemaligen Bauernhöfe verbargen sich hinter breiten verschlossenen Toreinfahrten, das Dorf machte dadurch einen etwas abweisenden, aber auch geheimnisvollen Eindruck: Was mag sich hinter den Toren alles verstecken an Platz und darüber hinaus vielleicht auch an Jahrhunderte alten Geschichten? Die negative Auskunft in der Wohnungsfrage ist nicht als endgültig anzusehen; ich werde es im Dorf weiter versuchen; es soll dort nach Auskunft des Alten durchaus lebhaft zugehen.“ Mit diesen Notizen war er sehr zufrieden – als habe er damit einen Entschluss nochmals bestätigt und so unumstößlich gemacht.
KAPITEL 2: HISTORISCHES
In der nächsten Zeit fuhr Wagner mehrfach nach Tiefenort. Stets traf er Heinz an, der immer wieder auf die historischen Ereignisse zurückkam. Er sprach von wechselnden Herrschaftsverhältnissen und den drückenden Abgabelasten, unter denen die Dorfbevölkerung über die Jahrhunderte zu leiden hatte. Der Besucher hatte Mühe, das Gespräch auf die näheren Zeiten und auf seine Angelegenheit zu lenken. In der Wohnungsfrage konnte der Alte jedoch nichts Neues berichten. Nein, gebaut werde im Dorf auch nicht, erklärte er, es stehe ja alles unter Denkmalschutz, schon seit DDR-Zeiten.
„Was ist denn hier so besonders schützenswert?“, fragte Wagner.
„Die ganze Ortslage; Tiefenort ist eines der letzten unverändert erhalten gebliebenen Rundplatzdörfer des Landes.“
„Es gibt keine weiteren Dörfer in dieser Siedlungsform?“
„Sagt die Denkmalpflege. Ich weiß es nicht. Ursprünglich waren natürlich alle Neugründungen in dieser Art angelegt. Wenn genügend Platz zur Erweiterung vorhanden war, wuchs das Anwesen den Bedürfnissen entsprechend, der ältere Teil fiel dann den Neuerungen zum Opfer. Hier war das nicht möglich. Unser Dorf steht seit der Gründung vor 700 Jahren in seiner Grundform unverändert, weil kein Platz für Erweiterungen bestand. Selbstverständlich sind die Häuser nicht so alt – das wäre ja auch zum Lachen, hahaha, – nein; die meisten stammen aus den achtzehnhundertfünfziger Jahren oder später. Ein neues Haus konnte immer nur an der Stelle eines zuvor abgetragenen Gebäudes errichtet werden.“
„Man sieht jedoch auch einige größere Höfe. Wie ist das bei dem Platzmangel zu erklären?“
„Einige Bauern waren erfolgreicher als andere. Sie konnten Nachbargrundstücke erwerben oder durch Erbschaft und Tausch in ihren Besitz bringen; für jede bauliche Erweiterung mussten jedenfalls Nachbargebäude weichen.“
„Seit 700 Jahren unverändert, sagst du. Waren wir letztens nicht bei 900 Jahren?“
„Das betraf den ursprünglichen Siedlungsplatz Dephenburnen. 200 Jahre später sah es anders aus. Die der Kirche vermachten umfangreichen Ländereien des Grafen Witzlawik konnten vom Kloster in Berkheim nicht bearbeitet werden. Der Erzbischof von Mainz, dem die ganze Region unterstand, ordnete daher die Gründung eines Nebenklosters an. Zur Sicherstellung der Feldbestellung und Versorgung war aber auch ein Dorf erforderlich. Da die klösterlichen Besitzungen nun fast an die Kleinsiedlung Dephenburnen heran reichten, die wenigen Bewohner des Rundlings für die Bearbeitung aber nicht ausreichten, beschloss Mainz die Erweiterung des Fleckens zu einem größeren Dorf. Das war wegen landschaftlichen Gegebenheiten nur in der heute noch bestehenden Form möglich.“
„Was die Trockenlegung des Sumpfgebiets voraussetzte – verstehe“, ergänzte Wagner. „Das war gewiss eine Mammutaufgabe. Wie haben sie das mit den damaligen Mitteln geschafft?“
„So gering waren die damaligen Mittel auch nicht, man war ja in der Lage, große Bauten zu errichten. Hier dürften die Anforderungen geringer gewesen sein: Es genügte fast, dem Hangwasser den Weg ins Dorf zu verwehren. Der Boden in der Senke dürfte danach nicht sehr tief durchnässt gewesen sein, hier seht überall Kalkgestein an. Komm mal mit, ich zeig dir wie sie’s wahrscheinlich anpackten.“ Er führte den Besucher zu einem breiten, steinigen Weg, der zwischen den Häusern bergan zum Wald führte.
„Dies war früher der einzige Weg ins Dorf“, erklärte Heinz. „Er musste mit kleinen und größeren Steinen für die Feldarbeiten immer befahrbar gehalten werden. Die Chronik berichtet von einer Wasserflut, die diesen Weg ins Dorf nahm und ihn so stark ausspülte, dass 300 Fuhren Steine erforderlich waren, ihn wiederherzustellen.“
„Das klingt fast unglaublich“, meinte Wagner. „Und die Siedlung kam heil davon?“
„Einigermaßen; einige Hütten wurden mitgerissen oder beschädigt, habe ich gelesen; die genaue Zahl habe ich vergessen.“
„Es gibt eine Chronik von Tiefenort?“
„Ja – gab es zumindest. Niemand weiß, wo sie geblieben ist. Aber wir sind angekommen“, sagte er. „Der Weg geht bis in den Wald dort oben und verzweigt sich dann. Was ich dir zeigen wollte, ist dieser Graben hier. Er wurde damals zur Trockenlegung der Dorflage und zum Schutz vor Hochwasser angelegt und zieht sich oberhalb des Dorfes über die ganze Ortsbreite hin. Das herausgeschaufelte Erdreich bildete einen Damm, der mit Dornengebüsch besetzt eine wichtige Wehr gegen Raubtiere darstellte; es war den Bewohnern bei Strafe verboten, diesen Damm zu betreten oder anderweitig zu beschädigen.“ Er legte eine kleine Pause ein, damit dem Gast genügend Zeit zum ehrfürchtigen Staunen blieb. „Bevor du nun fragst, wo der Damm geblieben ist, denn man sieht ja keinen – wir stehen gerade auf ihm! Er ist von den Jahrhunderten mehr und mehr eingeebnet worden. Heute wird er als Obstlehrpfad bezeichnet, um Besuchern die Streuobstwiesen, hier beginnen, in Erinnerung zu bringen.“
„Ja, ich sehe hier auffallend viele blühende Obstbäume. Wie viele mögen es wohl sein?“
„Man spricht von tausend in der gesamten Ortslage. Ich habe sie noch nicht gezählt.“
„Hier könnte man doch gut bauen und wohnen, findest du nicht auch?“
„So eine Gelegenheit würde wohl zahlreiche Interessenten anziehen – zu viele, wie wir meinen. Mit den Besonderheiten des Dorfes und seiner Umgebung wäre es dann bald aus. Nein; Tiefenort steht komplett unter Flächendenkmalschutz. Die Wiesen waren früher Ackerland, sie sind immer noch in Eigentum nach den damaligen Grenzen.“
„Schade“, meinte Wagner.
„Glücklicherweise!“, entgegnete Heinz. „Aber schau her: Siehst du, wie tief es hier vom Lehrpfad bis zu den angrenzenden Gärten abgeht? Das waren die ursprünglichen Wasserrisse. So ´n Berghang ist ja keine Konstruktion aus dem Lehrbuch; da gibt es immer Unregelmäßigkeiten, in denen Regenwasser zu Tal laufen kann. Mit der Zeit entstanden daraus tiefe Einschnitte in der Landschaft. Hier war so eine Stelle, wo das Hangwasser von Natur aus seinen Weg nahm.“
„Hm – mindestens drei Meter tiefer als unser Weg“, urteilte Wagner und trat vom Zaun zurück.
„Ja. Das musste mit Steinen und Erdreich erst zu einem Damm aufgeschüttet werden. Man kann mehrere Stellen so tiefer Einschnitte durch früheres Hangwasser finden. Am deutlichsten sind diese Spuren an den Enden des Grabens, wo man den Wassermassen freien Ablauf gab. Sie flossen dann am Dorf vorbei.“
„Alles sehr interessant, Heinz, aber das ist Vergangenheit. Ich dachte mehr daran, im heutigen Dorf zu wohnen; sieht es damit bald besser aus?“
„Was kann besser werden, wenn sich nichts ändert? Zieht ja keiner weg aus Tiefenort, und bauen tut auch keiner.“
„Hast du ja erklärt: Denkmalschutz. Aber so’n kleines leeres Nebengebäude müsste sich doch auf manchem Hof finden lassen.“
„Und was dann? Meint du, jemand baut dir’n leeren Stall aus? Das kannst du vergessen; ganz abgesehn vom Geld, das niemand hat – man holt sich doch keine Fremden auf den Hof! Werd’ du erst mal bekannt im Dorf – irgendwann findet sich dann schon was. Lern die Geschichte des Dorfes kennen. Hier auf dem Obstlehrpfad liegt sie für jedermann offen, man muss nur hinsehen und lesen. Zum Beispiel die Wasserrisse. Es gab, wie gesagt, mehrere. Aber nun aufgepasst: Wall und Graben können nicht in einem Stück erbaut sein. Man kann deutlich mehrere Bauabschnitte erkennen, die sich aus dem Anwachsen der Siedlung erklären lassen. Zunächst musste der Dorfeingang und östliche Teil des Dorfes geschützt werden, wo die ersten Kolonisten sich angesiedelt hatten, weil hier der Siedlungs-Kessel in flacheres Land auslief. Hier gab es den besten Boden und gute Bedingungen zum Bauen. Der Graben führte das Wasser mit leichtem Gefälle ein Stück hinter die Gebäudegrenzen und ließ es dann frei ablaufen. Woher ich das weiß? Man sieht es; das von einem Großteil des Hanges gesammelte Niederschlagswasser stürzte am Ende des Grabens mit entsprechend vergrößerter Gewalt zu Tal und riss dabei gleich mehrere tiefe Bahnen in die Landschaft. Das ist heute noch zu sehen. Anhand solcher Anhaltspunkte lassen sich drei Besiedlungsabschnitte erkennen.“
„Ist ja nun gut, Heinz, ich habe es verstanden. Aber sag mal – wie kam es trotz der schwierigen Verhältnisse zu so zahlreichen Bewohnern? Ist darüber etwas überliefert?“
„Nicht direkt; es ist aber bekannt, dass Siedler für Neugründungen mit besonderen Vergünstigungen angeworben wurden. Sie blieben zum Beispiel freie Bauern. Das bedeutete im Mittelalter, das durch Bauern im Frondienst geprägt war, bereits sehr viel. Für unser Dorf ist ferner das Braurecht verbürgt, dass also jeder Hof unabhängig von herrschaftlicher Erlaubnis und Steuern Bier brauen durfte; das galt schon als besonderes Privileg, ebenso auch das eigene Backrecht.“
„Von den skandalösen Ausbeutungen der Bauern habe ich gehört, die wirkliche Bedeutung aber kaum erfasst“, räumte Wagner ein. „Den Kolonisten gab man also Land zum Siedeln und Wirtschaften. Und dann?“
„Dann machten sie das so – was weiß ich. Ich war doch nicht dabei! Jedenfalls waren sie keinem Herrn verpflichtet – bis auf die Bearbeitung der Klosterfelder, was aber keinen Frondienst darstellte; Tiefenort erhielt einen geringen Teil des klösterlichen Landes zur eigenen Nutzung. Die Gesamtlage hieß dennoch ‚das Fronefeld‘. Spuren der Eigenbewirtschaftung eines Teils davon lassen sich bis zur Zeit der Kollektivierung im vorigen Jahrhundert nachweisen: Der Kuchen wurde in zahlreiche kleine Parzellen aufgeteilt, die nach Auflösung des Klosters 1525 ins Eigentum der Bearbeiter übergingen. Erst mit der Gründung von LPGn fielen die privaten Grenzen.“
Heinz holte Luft. Doch bevor Wagner etwas dazu sagen konnte, ergänzte der Chronist seinen Vortrag: „Ja, die Kette der Vergangenheit ist lang, an manchen Stellen auch sehr dünn, da müssen dann mündliche Überlieferungen oder Lebensgewohnheiten als Nachweis dienen. In unserem Sprachgebrauch hat sich die Bezeichnung ‚im Quaren‘ für die Lage des Fronefelds erhalten. Das macht für Außenstehende keinen Sinn, selbst wenn ihnen erklärt wird, dass damit ‚im Queren‘ gemeint ist. Was kann da so quer gelegen haben, dass es einen ganzen Landstrich bezeichnete?“ Heinz sah seinen Begleiter wieder erwartungsvoll an.
„Keine Ahnung“, sagte der.
„Die Ackerfurche natürlich. Auf den Hängen pflügte man die zahlreichen schmalen Streifen auf das Dorf zu, weil die Flurstücke so lagen. Das Fronefeld wurde aber quer dazu bearbeitet.“
„Hangabwärts pflügen macht aber keinen Sinn, zumal du ja schon betont hast, welche Mühe ihnen die Niederschläge bereiteten; Längsfurchen erleichtern dem Wasser ja geradezu den Weg nach unten.“
„Richtig.“ Heinz nickte. „Und doch hielt man Jahrhunderte an diesem Unsinn fest; Regen spülte die Ackerkrume zu Tal – man trug sie in Tragekörben wieder hoch; eine heute unvorstellbare Plackerei. Aber so war der Grundbesitz nun mal angelegt: Von jedem Hof lief ein entsprechend breiter Streifen als Eigentum den Hang hinauf bis in den Wald. Geht man von einigen Dutzend Höfen aus, liegen die engen Verhältnisse beim Ackerland auf der Hand. Wie hätten sich die Dörfler bei so vielen unterschiedlichen Interessen über eine gemeinsame Feldbestellung einigen sollen? Sie konnten es in Jahrhunderten nicht, sie scheinen daran gar keinen Gedanken verschwendet zu haben. Jeder beackerte sein Handtuch breites Stück stur bergauf. Das war Tradition, und dabei blieb es.“
„Wir haben uns nun aber genug in der Vergangenheit des Dorfes aufgehalten, denke ich. Können wir auch wieder in der Jetztzeit ankommen?“ Wagner schien etwas genervt zu sein.
„Ja – eine Wohnung kam dabei nicht raus; die kann ich nicht herbeireden“, räumte Heinz ein. „Aber wenn du hier Nachbar werden möchtest …“
„Ich weiß, ich weiß! Wahrscheinlich weiß ich über Tiefenort jetzt schon mehr als die meisten hier. Oder hast du die alle in Ortsgeschichte unterrichtet?“
„Nee, davon will keiner etwas hören. Mich nennen sie zwar Dorfchronist, obwohl ich das nicht bin. Aber damit hat sich die Sache mit der Historie für sie auch schon erledigt; ich soll für die Vergangenheit zuständig sein, damit sie sich nicht damit beschäftigen müssen. So wird es irgendwie wohl sein, ich weiß es nicht.“
„Die meisten werden keine Zeit zur Beschäftigung mit der Dorfgeschichte haben“, meinte der Besucher.
„Das Interesse fehlt“, beharrte Heinz.
KAPITEL 3: TIEFENORTER EIGENARTEN
„Gibt’s im Dorf demnächst etwas Neues?“, fragte Wagner. „Ich denke dabei an den 1. Mai; da hat man ja auch hier den Maibaum aufgerichtet, wie ich gesehen habe. War das ein größeres Ereignis für die Einwohner? In so einem kleinen, abgeschiedenen Dorf hat man ja vielleicht nur geringere Möglichkeiten zum Feiern.“
„Damit befindest du dich aber sehr im Irrtum, mein lieber Theo“, entgegnete Heinz. „Das Gegenteil ist der Fall. Gerade weil wir so klein und abgeschieden sind, haben wir fast unsere eigene Kultur. Das kannst du bald hautnah erleben. Nach der Maifeier, wo sich das ganze Dorf um das große Feuer in den Streuobstwiesen versammelt und in die Nacht hinein feiert, folgt jetzt das traditionelle Vatertagswandern, von dem wir schon gesprochen haben. Da musst du unbedingt mitmachen, es ist die beste Gelegenheit, mit den Dörflern bekannt zu werden. Und darauf, zu Pfingsten, feiern wir das Blütenfest. Du siehst, was hier los ist; dabei hab ich noch vergessen, das Brauen des Pfingstbiers zu erwähnen. Dieses Ereignis findet allerdings in Hohnfeld statt, wo das alte Brauhaus mitsamt der Einrichtung noch erhalten ist.“
„Ein richtiges altväterisches Bierbrauen?“
„Selbstverständlich. Ich war allerdings noch nicht dabei – es ist mehr etwas für junge und kräftige Männer. Aber das Original Hohnfelder Mittelalterbier wird dann auch hier ausgeschenkt.“
„Wann findet dieses Brauen denn statt?“
„Irgendwann in den nächsten Tagen, denke ich.“
„Toll; kann man sich das auch ansehen?“
„Komm erst mal im Dorfe an; alles andere findet sich dann schon.“
Sie gingen zurück. Wagner bedankte sich für die Führung samt Informationen und fuhr nach Hause.
Sobald es ihm möglich war, schlug er nun nach jedem Besuch das Tagebuch auf; es drängte ihn, die neuen Eindrücke gleich festzuhalten. Er blieb überzeugt, dass Tiefenort der Platz seiner letzten Bestimmung sei. Über die Fragwürdigkeit einer solchen Zuordnung machte er sich keine Gedanken. Er hatte sich von Heinz auch in die Feierabendrunde der Dorfleute einführen lassen, die in Ermangelung einer richtigen Bierstube in der Waschküche des offensichtlichen Dorfkönigs saßen. Der Hausherr wurde seltsamerweise mit „Bär“ angeredet, wobei unklar blieb, ob es ein tatsächlicher Name war oder auf seine Statur anspielte, die lebhaft an einen Tanzbären erinnerte. Er war in Erscheinung und Auftreten jedenfalls die Hauptperson der Versammlung. „Ein Tiefenörter willste werde?“, sagte er. „Das hör’n wir doch gerne. Nimm Platz, Theo – ein Bier?“ Die Männer auf der Bank rückten ein wenig zusammen. Wo kommst’n her, bist du’n Wessi? Das war fast schon das ganze Aufnahmeritual. Theo gab eine Runde aus.
„In Behrends Waschküche herrschte eine familiäre Atmosphäre aus Gemütlichkeit und Wohlwollen, die sogar den Kater Carlo einschloss“, schrieb er ins Tagebuch. „Es ging eng zu auf der Bank, aber sein Körbchen auf dem Eckplatz wurde nicht angerührt; das war sein Stammplatz, ob nun anwesend oder nicht. Als die Tür aufging, nutzte Carlo jedoch die Gelegenheit, an der Runde teilzunehmen. Er sprang hoch und spazierte in aller Ruhe und Selbstverständlichkeit quer über unsere Knie zu seinem Lager. Niemand schien darüber verwundert zu sein. Carlo wurde ohne Frage als Stellvertreter des Hausherrn anerkannt. Man übertrug die Wertschätzung für den Vorstand der Waschküche auch auf sein Lieblingstier. Eine weitere Rangfolge gab es offenbar nicht; wer erschien, war willkommen.“
Die näheren Umstände zum Entstehen dieses seltsamen Versammlungsorts waren jedoch nur allmählich in Erfahrung zu bringen. Nach der Wende gab es im Dorf keine Kneipe mehr oder einen sonstigen Raum, wo man sich etwa nach Feierabend zwanglos zu einem Plausch versammeln konnte. Und jede Flasche Bier musste man aus der Stadt holen. Das wurde anders, als Behrends, so hieß ‚der Bär’ in Wirklichkeit, nebenberuflich einen Flaschenbierverkauf eröffnete. Die Vorräte lagerte er, notwendigerweise besonders im Winter, in eben dieser Waschküche. Es war gleichzeitig auch der Raum für die Heizungsanlage des Hauses. Ein Tisch und eine umlaufende Bank fanden noch Platz, aber sonst fast nichts mehr. Holte jemand einen Kasten des beliebten Getränks, so setzte er sich wohl auch auf die Bank und probierte schon mal die neueste Sorte, denn viel Biererfahrung gab es zu Anfang noch nicht. Das wollte Behrends seinen Kunden nicht erschweren; sicherheitshalber hatte er aber ein Schild mit der Aufschrift „Privat“ an die Waschküchentür geschraubt, damit sichtbar wurde, dass hier nicht etwa ein Ausschank stattfinde. Gläser gab es bei so einem Probetrunk nicht, auch keine Bedienung. So war von Anbeginn sichergestellt, dass jeder, der die Waschküche betrat, dies als Besuch bei einem Freund verstand, und wenn dabei eine Flasche Bier getrunken wurde, so war das jedenfalls eine Privatangelegenheit.
Der Beleibte hatte aber so viele Freunde, dass Einzelbesuche eher selten waren. Oft wurde es regelrecht eng auf der Bank. Zumal auch Jäger aus der Umgebung hinzukamen, um Fragen der Jagd zu besprechen, denn Tiefenort stellte traditionsgemäß das Gros der Treiber, und vom Biertisch aus verbreitete sich jede Nachricht am schnellsten. So entwickelte sich Hermann Behrends Waschküche, obwohl ganz am Rande gelegen, fast zum Zentrum des Dorfes. Hier wurden die aktuellen Dorfereignisse kommentiert und bewertet, aber auch im gemeinsamen Austausch Entscheidungen über Feste und Feiern getroffen und die entsprechenden Aufgaben festgelegt. Die Waschküche entwickelte sich zum Ort für die täglichen, ungeplanten, freundschaftlichen Feierabendtreffen. In der Waschküchenrunde ging es nie ohne elementare Fröhlichkeit zu, doch Gesang war dort eher selten zu hören. Man betrank sich beim Bär nicht bis zur Ausgelassenheit. Gelegentlich erklang schon mal „Ein Horrido!“ auf einen erfolgreichen Schützen, zumal dieser sich dann „reinigen“ musste, das heißt, eine Lage zu spendieren hatte. Es soll schon vorgekommen sein, dass dabei die Leber eines kurz zuvor geschossenen Rehs gleich von der Hausfrau gebraten und dann gemeinsam verspeist wurde. Und es war fast selbstverständlich, dass, wenn jemand geschlachtet hatte, die verschiedenen Wurstsorten und das Gehackte dort dem fachkundigen Publikum zum Verkosten vorgelegt wurden. Wer anwesend war oder hinzukam, öffnete sein Messer und tafelte mit. Häufiger holte auch jemand ein Spiel Karten hervor, um in der Runde mit Skat oder „Siebzehn und Vier“ die Zeit zu vertreiben. Dabei konnte es durchaus vorkommen, dass die Hausfrau mit einem Arm voller Wäsche erschien und ihre Maschine damit fütterte. Noch häufiger, ja regelmäßig, klickten die Relais der Heizung und nahmen ihre Arbeit auf. Das störte niemanden. Das Phänomen „Bärs Waschküche“ konnte man eigentlich nicht erklären. Der Raum war eher klein, kahl, nichtssagend, mit technischem Gerät und allerlei Rohrleitungen an den Wänden, fast ohne natürliches Licht, oft eng und auf längere Zeit auch unbequem. Aber hier schlug das eigentliche Herz des Dorfes.
Alte Braukunst
Über das Brauen wurde zu Wagners Enttäuschung nicht gesprochen, auch zu den anderen bevorstehenden Terminen, die Heinz erwähnt hatte, fiel nur ab und zu eine halbe Bemerkung; es schien alles so selbstverständlich zu sein, dass es keiner weiteren Erwähnung oder Erinnerung bedurfte. An einer passenden Stelle warf Theo ein:
„Ich habe gehört, dass im Ort auch gebraut wird.“
„Wir brauen in Hohnfeld“, antwortete jemand aus der Runde, der schon mehrfach als ‚Großer‘ angeredet worden war.
„Das ist interessant; könnte jeder damit beginnen, wenn er wollte?“
„Nee, wir sind ein Brauverein. Einige aus der Runde hier machen mit.“ Er wies auf zwei, drei Anwesende und nannte ihre Namen. „Ich natürlich auch“ ergänzte er.
„Sind eventuell auch Gäste erlaubt, die den Vorgang kennenlernen möchten?“
„Kann ich mal fragen; fürs kommende Wochenende ist der nächste Braugang angesetzt.“
Wer erfahren möchte, wie unsere Vorfahren Bier herstellten, musste früh aufstehen. Theo war mit dem Großen schon bei Tagesbeginn vor Ort, das Brauhaus dampfte bereits aus allen Fugen, das Dach hüllte sich in eine weiße Wolke, im Innern herrschte dichter Nebel. Aber man hörte Stimmen und Arbeitsgeräusche. Hier schien ein Räderwerk zu gehen, dort schürte jemand den Ofen. Zurufe von irgendwo her: Die Pumpe besetzen! Theo nahm die beschlagene Brille ab; der Nebel blieb undurchdringlich. Der Große war verschwunden. Als einsamer Besucher stand Wagner nun in einer gegenstandslosen Welt. Nur allmählich unterschied er Einzelheiten. Der Dampf entwich aus einem Riesenbottich, zu dessen oberen Rand man erst über eine Treppe gelangte, und richtig, dort bewegten zwei Brauknechte mit einer Kurbel ein mechanisches Rührwerk in dem überdimensionalen Fass. Er traute seinen Augen kaum. Waren denn die Heinzelmännchen wieder erwacht? Nein, es waren Mitglieder des Hohnfelder Brauvereins, die hier einen traditionellen Dorftrunk nach alter Art brauen wollten, ganz so wie vor drei- oder vierhundert Jahren. Im Nebel war noch Holger auszumachen, ferner Harald, Diggi und tatsächlich – unübersehbar stand auch der Große schon unter ihnen. Nun, dann konnte ja überhaupt nichts schiefgehen.
Also: Zu 15 Hektolitern heißem Wasser gehörten 450 Kilo Darrmalz in den Maischebottich. 78 Grad mussten hier gehalten werden, nicht mehr und nicht weniger, das brachte die Enzyme in Schwung. Und immer schön das Rührwerk bewegen; soll der Sud etwa absetzen? Fiel die Temperatur im Bottich, musste Wasser aus dem dampfenden Kessel helfen, aber mit Vorsicht.
Ein kleinerer, wohlbeleibter Mensch ging stillvergnügt umher, stand mal hier, mal dort und beobachtete den Verlauf der Arbeiten in Ruhe und Unauffälligkeit. Anweisungen gab er nicht, dafür waren andere zuständig. Das war ‚Amsel‘, der Vorsitzende des Brauvereins – er ließ heute brauen! Stets führte er einen hoch gefüllten Humpen vom letzten Braugang mit sich. Aber auch die Arbeitenden standen nie weit von ihren Krügen. Amsel empfahl Wagner ebenfalls einen Humpen, aber der lehnte ab – er sei mit dem Auto unterwegs. Doch ob er vielleicht einen kleinen Schluck aus dem übervollen Humpen probieren dürfte?
Das Produkt war etwas gewöhnungsbedürftig, fand er, hellbraun und hefetrüb, malzig und alkoholisch im Geschmack, mit wenig Kohlensäure. So wurde früher gebraut im Dorf, versicherte Amsel, und so schmecke das Produkt auch, einfach und ehrlich; eben wie ein altväterischer Dorftrunk. Der höhere Alkoholgehalt mache Sinn, erklärte Amsel, denn so hielte das Bier sich länger. Er könne vom gleichen Ansatz noch ein weiteres Gebräu als Dünnbier folgen lassen, aber die beengten Verhältnisse ließen das nicht zu.
Im Nebelhaus wurde nach gehöriger Zeit des Rührens und der ständigen Temperaturkontrolle die Maische in den jetzt leeren Kochkessel gepumpt, wo höheres Erhitzen die Arbeit der Enzyme stoppte. Danach beförderten die Brauknechte den Ansatz auf gleiche Weis zur Filterung zurück in den großen Ansatzbottich. Der hieß jetzt aber „Läuterbottich“. Ja, so war das früher eben, hin und her und rauf und runter. Und alles im Handbetrieb. Es ging mehr als eng zu im Brauhaus, aber wenn man nach historischem Vorbild brauen wollte, dann auch unter den damaligen Umständen, hatte Amsel gemeint. Auch das Filtern war hier, wie früher, ein Naturprozess: Nach gehöriger Standzeit im Läuterbottich hatte sich das ausgelaugte Gerstenschrot abgesetzt und bildete auf dem Siebboden eine dicke Schicht, die als natürlicher Filter wirkte. Öffnete man dann unten den Abfluss, fing man ein trübes, süßliches Produkt auf, das noch keine Ähnlichkeit mit Bier aufwies. Das Filtrat musste erneut hoch in den Kessel. Dort hatte das Ganze zwei Stunden mit einer gut dosierten Hopfengabe zu kochen, wieder unter ständigem Rühren. Spätestens an dieser Stelle geriet historisches Brauen zum gefährlichen Abenteuer; die Männer stehen auf dem Rand des Kochkessels und rührten ohne Unterlass mit meterlangen Löffelhölzern den blubbernden und spritzenden Inhalt, nur durch eine Holzwehr notdürftig vor dem Absturz geschützt. Dann endlich pumpte man den heißen Sud ins „Kühlschiff“ – eine flache Eisenwanne von der Größe des halben Obergeschosses. Dort konnte, sollte und musste er über Nacht langsam abkühlen und ausdampfen. Bier war es so aber mitnichten; die ganze Gärung stand ja noch aus. Dazu durfte der Ansatz nicht mehr als vier Grad haben, denn der Prozess setzte Wärme frei. Man öffnete also erst am nächsten Morgen den Abfluss und fing den Inhalt des Kühlschiffes in den auf der unteren Ebene stehenden Gärbottichen auf. Zugesetzte Bierhefe verwandelte dann den im bisherigen Prozess gebildeten Zucker in Alkohol. Und selbst mit dem Gären war es noch nicht getan; das Produkt musste lagern. Bei großem Glück, so schien es, konnte man das Ergebnis dieser Mühen frühestens zu Pfingsten begutachten. Richtig, Bier musste zum richtigen Zeitpunkt angesetzt werden. Brauen gehörte früher wie auch Backen zum fest gefügten Rhythmus des Lebens. Wie ja es auch im Märchen hieß: Heute back ich, morgen brau ich.
Die Himmelfahrtswanderung
Wagner sah der Probe dieses Braugangs mit einiger Spannung entgegen. Zuvor lag aber noch die Vatertagswanderung, die Heinz ihm als beste Gelegenheit zum Kennenlernen der Dorfgewohnheiten empfohlen hatte. Doch dazu hieß es am Vorabend in der Waschküche nur: also morgen um Acht! Erst Fohdo klärte ihn näher auf. Während des gemeinsamen Heimwegs bemerkte der wie nebenbei: „Hoffentlich regnet’s morgen nicht, ich soll das Ereignis doch festhalten.“
„Welches Ereignis?“ Theo wusste nicht gleich, wovon die Rede war.
„Die Einweihung des Vatertag-Steins.“
„Was ist das denn?“
„Die Kerle haben auf dem Kellerberg die illegale Müllkippe beseitigt und dort einen großen Stein aufgestellt. Hast du das nicht gewusst?“
„Nein.“
„Deshalb geht die Wanderung doch dorthin. Ich mache mir nur Sorgen um den Fotoapparat; Regen wäre nicht gut.“
„Ach, du bist wohl der Fotograf für die ganze Angelegenheit?“
„Was heißt Fotograf – ich knipse die Leute bei ihren Aktionen, das ist alles.“
„Und dann verkaufst du die Fotos?“
„Nee, das wird hier nicht so gemacht. Die Bilder sind nur für die Freunde.“
„Bleibt da eventuell auch eins für mich übrig?“
„Klar – wenn du pünktlich bist, sonst sind wir schon weg.“
Theo fand sich früh vor Behrends Hof ein, wo die anderen bereits auf das Erscheinen der Hauptperson warteten. Erst mit dessen Erscheinen ging die Wanderung los. Der Tiefenorter Vatertag zeichnete sich dadurch aus, dass stets die gleiche Strecke und die gleichen Haltepunkte genommen wurden. Zu den Klängen eines Akkordeons ging es durchs Dorf und zum Alten Weg hinaus bis zur Höhe des Wacholderbergs, wo es eine erste Rast gab. Von dort stiegen die Wanderer durch den Wald ab ins Erfurter Tal, wo eine Schutzhütte stand. Auf der Wiese davor hatte man einen langen Tisch aus starken Holzbohlen errichtet, umgeben von ähnlich derben Sitzbänken. Während die einen den Tisch mit frischem Tannengrün schmückten, schafften andere die am Vorabend im Dickicht versteckten Bierkästen heran. Dann ging es ans Auspacken der Rucksäcke. Würste und Gläser vom Hausgeschlachteten erschienen auf dem Tisch, dazu Brote, Butter, Schinken, Käse, Jägermeister und Klosterbruder, Gurkentöpfe, Zwiebeln, Knoblauch und Senf – alles, was zu einer zünftigen Mahlzeit im Freien gehört, die halbe Speisekammer. Das Tafeln konnte beginnen. Nein, erst war ein gemeinsamer Gesang fällig, der von der alten Burschenherrlichkeit, aber dann wurde zugelangt. Theo war beschämt – er hatte nicht das Geringste eingepackt. Die Verlegenheit währte nur kurz, denn jeder bediente sich an den allgemeinen Vorräten, die zur freien Verfügung auf dem Tisch standen. Er wurde von seinen Nachbarn sogar mehrfach ermuntert, ordentlich zuzulangen. Leider setzte bald darauf Regen ein. Wie sich zeigte, ließ es sich aber auch unter Schirmen und Planen trefflich schmausen und bechern. Als es begann, ernsthaft zu schütten, floh man unter das Dach der Hütte, aber da war der Tisch schon so gut wie leer. Das Wetter tat der guten Laune keinen Abbruch, im Gegenteil, der Gesang kam in der Enge erst zur vollen Entfaltung. Die Erfurter Hütte hielt jedoch stand. Bei nachlassendem Regen ging es dann weiter talaufwärts, immer mit Musik, und so erreichte man langsam die Höhe des Kellerbergs und „den Stein“. Nun war eine kleine Pause zur äußeren und inneren Sammlung unbedingt nötig. Ganz wie es sich gehörte, verhüllte eine Thüringenfahne das Objekt der Feierlichkeit. Die Wanderfreunde ordneten sich zu beiden Seiten, eine Rede wurde gehalten, ein Lied angestimmt, zwei Böllerschüsse krachten, die Fahne sank vom Stein und gab eine Tafel frei. Beifall vermischte sich mit Freudenrufen, ein neues Lied erklang, und dann konnte die Inschrift begutachtet werden. In Edelstahl eingraviert stand da zu lesen:
„Kein schön’res Land zu dieser Zeit
als hier das unsre weit und breit.
In alter Burschenherrlichkeit
sei uns der Vatertag geweiht!“
Darunter folgten die Namen der 20 „Burschen“, die den Platz, den Stein und die Anlage verwirklicht hatten. Hiermit waren alle zufrieden. Tische und Bänke luden zur Rast und Geselligkeit ein, und Frieder mit dem Akkordeon konnte sein umfangreiches Repertoire weiterhin unter Beweis stellen. So groß es auch war – einige Gesänge wiederholten sich doch allmählich. „Von mei – ner Looo – la!“ wurde an diesem Tag mindestens viermal gesungen.
Als die Teilnehmer im Laufe des Nachmittags wieder im Dorf einrückten, konnten sie nur staunen, was sich dort inzwischen ereignet hatte: Andere